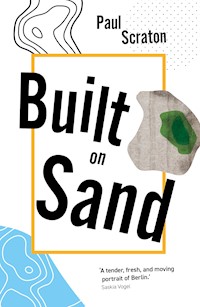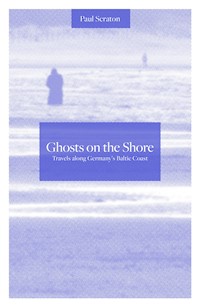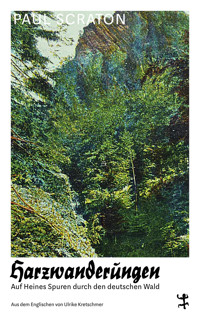
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Paul Scraton an einem klaren Herbsttag von Göttingen aus zu einer Wanderung aufbrach, wusste er nicht, was ihn erwarten würde. Mit Heinrich Heine im Gepäck wollte er den eigenen Deutschlanderfahrungen nachsinnen, die Leine entlang nach Northeim, über niedrige Hügel und lichte Wälder nach Osterode wandern. Im Harz den alten Handelsstraßen und Hexenpfaden folgen, in den Bergwerken bei Goslar unter die Erde gehen und die alte innerdeutsche Grenze mitten auf einem Damm überqueren. Er erklomm den Brocken, nicht nur auf den Spuren Heines, sondern auch Goethes und Coleridges, Lou Andreas-Salomés, Anselm Kiefers und all der Träumer und Intriganten, die von diesen Hängen angezogen wurden, wo die Hexen tanzten, die Studenten sangen und die Spione des Kalten Krieges lauschten. Gefunden hat Paul Scraton Zeichen der Vergangenheit, aber auch Wanderer, Trinker, Fußballfans, Arbeiter und Ex-Bergleute in einem von der Klimakrise bedrohten Wald, dessen Rettung neben Naturaktivisten neuerdings auch rechtsgerichtete Bewegungen für sich vereinnahmen, und somit von Neuem die Frage nach dem Platz des Waldes in der deutschen kulturellen Identität damals und heute (und zu allen Zeiten dazwischen) laut werden lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Scraton
Harzwanderungen
Auf Heines Spuren durch den deutschen Wald
Aus dem Englischen von Ulrike Kretschmer
Inhalt
Prolog
1 Die Geister von Göttingen
2 Hinunter zum Fluss
3 Narben in der Landschaft
4 Die Geschichten, die wir gehört haben
5 Über den Pass und in den Berg
6 Stimmungsmusik
7 Der deutsche Berg
8 Auf dem Brocken
9 Sirenengesang
Epilog: In Weimar
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
Sonstige Quellen
Prolog
In einer der Hallen des alten Berliner Flughafens Tempelhof war vor Kurzem eine Ausstellung zu sehen, die Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa umfasste und Aspekte der Vielfalt und Einheit im zweiten Jahrzehnt des einundzwanzigsten Jahrhunderts beleuchtete. In der Mitte der Halle befand sich eine Installation, eine Art dreidimensionale Kombination aus Gemälde und Skulptur von Anselm Kiefer. Sie trug den Titel »Winterreise« und bot Einblick in einen gefrorenen Wald mit schneeverwehten Bäumen und morschen Eichenstümpfen, mit riesigen Pilzen und einem ausrangierten, verrosteten Bett, auf dem eine herrenlose Maschinenpistole lag. Mit seinem Kunstwerk wollte Kiefer die französisch-deutsche Historie erkunden: Die Geschichten in Kiefers Winterwald erzählen davon, wie Gefühl, Empfindung und Romantik zu Militarismus und Gewalt führen können. In Kiefers Wald gehen die Geister derjenigen um, die unter seinem Blätterdach leben und deren Namen hier und dort eingeritzt sind. Tieck und von Eichendorff. Novalis und Ulrike Meinhof. Und ganz hinten, zwischen Fichte und Lord Byron: Heinrich Heine.
Im Laufe seiner Karriere kehrte Anselm Kiefer immer wieder zum deutschen Wald zurück, wobei ihm Heinrich Heine oft Gesellschaft leistete. Und in diesem Geiste machte auch ich mich auf meinen ganz eigenen Weg durch die Bäume, reiste mit Heine in den Harz und hielt mich dabei so dicht wie möglich an die Route, die er in seiner Harzreise unsterblich gemacht hat. Heine war in den rund zehn Tagen, in denen ich ihm in seinen Fußstapfen folgte, mein beständiger Begleiter, doch gab es sowohl vor als auch nach uns viele, die den deutschen Wald bereisten. Und so ist meine Harzwanderung wie jeder Waldspaziergang, der etwas auf sich hält, voller Umwege und Abschweifungen – manche zufällig, manche erzwungen, manche ganz und gar absichtlich. Dieses Buch erzählt von einer Wanderung, von Bewegung, und davon, was unterwegs zu finden ist, was dieser unser Wald unter seinem Kronendach birgt und welche Geschichten er bereithält.
Paul Scraton, Weimar und Berlin, Juli 2021
1
Die Geister von Göttingen
An einem strahlenden Herbsttag raste der Zug nach Süden in Richtung Göttingen. Eine Zeit lang verliefen die Gleise parallel zum flachen Wasser der Leine, wo sich das Licht auf den winzigen Wellen fing, die sich in der leichten Brise über die Oberfläche des Flusses kräuselten. Am Ufer ließen Weiden ihre Äste hängen, als reichten sie dem Wasser die Hand. Beim Blick zurück aus dem Zugfenster, das Tal hinunter, zeichnete das schmale Band der Bäume, die den Fluss säumten, seinen Lauf nach; wie Wächter standen sie zu beiden Seiten zwischen den Schienen und den Feldern, die sich in sanftem Anstieg zu den niedrigen Hügeln hinaufzogen. Auf der anderen Seite des Waggons waren die Hügel steiler und bewaldet. Ein erster Hinweis darauf, was unsichtbar – noch zumindest – in der Ferne lag. Der Zug raste nach Süden in Richtung Göttingen, neben dem Fluss und einem Weg her, der für Radfahrer asphaltiert worden war und auf dem ich am nächsten Morgen meine Reise beginnen wollte.
Am Stadtrand von Göttingen wurde der Zug langsamer. Reisende standen von ihren Sitzen auf, um ihr Gepäck zusammenzusuchen, die Felder und bewaldeten Hänge vor dem Zugfenster waren Outlet- und Shoppingcentern, einem Schrottplatz und Supermärkten gewichen. Auf einer verstopften Hauptstraße staute sich an einer Ampel der Verkehr, über der Szene türmte sich ein Wohnhochhaus auf und verdeckte die Sonne. Auch im Zug staute es sich; wir reihten uns im Gang vor der Tür auf, während die Waggons am Bahnsteig allmählich zum Stillstand kamen. Die meisten meiner Mitreisenden waren jung und mit Gepäck beladen: Rucksäcke auf der Ablage über den Köpfen der Passagiere, riesige Rollkoffer auf den Gepäckregalen im Einstiegsbereich. Überwiegend Studenten, dachte ich, die das erste Mal in die Stadt kamen oder rechtzeitig zum neuen Semester zurückkehrten.
Im Gedränge vor dem Bahnhofseingang genossen die Leute in ihrer Mittagspause die Sonne. Sie aßen Sandwiches, checkten ihre Smartphones und suchten Schatten unter Bäumen, die so ausladend und alt waren, dass sie aus einer Zeit zu stammen schienen, lange bevor es einen Bahnhof oder die Gleise gegeben hatte, die ihn mit dem Rest der Welt verbanden. Unter einem der Bäume, neben einem Trio aus Fahrrädern, die in aller Eile von zu einem Zug hastenden Menschen dort abgestellt worden waren, saß eine Frau mit im Schoß verschränkten Händen, die Augen geschlossen, als sei sie in Gedanken versunken.
Sie war nicht real. Nicht mehr. Ihr Name war Frau Charlotte Müller, so stand es eingraviert auf dem Steinsockel, auf dem sie saß. Sie war die älteste Marktfrau der Welt1 – wortwörtlich in Stein gemeißelt. Sie hatte den Reisenden Süßigkeiten und Obst verkauft, als es noch keinen Kiosk am Bahnhof gegeben hatte. Einen Platz im Buch der Rekorde und eine Statue unter einem alten, knorrigen Baum hatte sie bekommen, weil sie mit fünfundneunzig Jahren noch immer ihre Waren feilgeboten hatte. Manchmal werden wir eines einzigen Augenblicks der Inspiration, eines einzigen Erfolgs wegen berühmt. Manchmal, wenn wir lange genug ausharren, wird unsere Hartnäckigkeit belohnt. Die Statue war zwei Jahre nach Charlottes Tod aufgestellt worden. Nach der langen Zeit, die Frau Müller vor dem Bahnhof auf und ab gegangen war, hatte die Stadt ohne sie wohl nicht auskommen können. Sie ist einer der Geister von Göttingen und heißt den Reisenden bei seinen ersten Schritten in die Stadt auf ewig willkommen.
Ich schrieb Charlottes Namen in mein Notizbuch. Als Gedächtnisstütze. Hin und wieder, insbesondere an neuen und unvertrauten Orten, ist es leichter, die Geister, nicht die derzeitigen Einwohner zu erreichen. Die Geister haben nur ihre Geschichten zu erzählen, die Einwohner haben ein Leben zu führen. Der Spaziergänger streift durch eine Stadt oder ein Dorf bis zum Rand der Stadt oder zu einem kleinen Weiler in den Hügeln, wobei Begegnungen mit realen Menschen dem Zufall überlassen sind. Im Gegensatz dazu sind Charlotte und ihresgleichen stets zugegen und warten auf alle, die da kommen mögen, zu welcher Tages- oder Nachtzeit auch immer.
Und so sagen wir uns, sie seien der Schlüssel zur Geschichte, eine Abkürzung zum Verständnis des Ortes, an dem wir uns befinden. Sie warten vielleicht als Statue oder als Gedenktafel an einer Mauer. Als Grabstein auf dem Friedhof oder als Worte, vor langer Zeit geschrieben und doch neu zu lesen in frisch gedruckten Büchern. Sie warten auf uns in den Geschichten, die wir hören und die von Generation zu Generation weitergegeben, wiederholt und stets aufs Neue erzählt werden. In den Steinsockel, auf dem Charlotte kniend sitzt, können nicht allzu viele Worte eingraviert werden, aber das spielt keine Rolle. Wir haben trotzdem sofort Zugang zu ihrer Geschichte. Wir können sie abrufen und in Händen halten.
Auf der nächstgelegenen Bank hatte eine Frau ihr Sandwich aufgegessen und stand auf, um zu gehen. Ein älterer Mann blickte immer noch hochkonzentriert auf sein Smartphone. Ich hätte sie nach ihrer Geschichte fragen können, doch warum hätten sie sie mir erzählen sollen? Selbst wenn ich ihnen gesagt hätte, was ich vorhatte?
Vor allem wenn ich ihnen gesagt hätte, was ich vorhatte.
An der Rezeption des Hotels probierte ich es zum ersten Mal aus. Der Frau, die mich eincheckte, waren schon mein Rucksack, die an seiner Seite festgemachten Wanderstöcke und die schweren Stiefel an meinen Füßen aufgefallen. Sie hatte all das bemerkt und fragte trotzdem.
»Sind Sie mit dem Auto angereist?«
Es war schlicht eine Frage, die sie auf der Liste in ihrem Kopf abhaken musste. Es war Teil des Protokolls.
Ich schüttelte den Kopf und erzählte ihr stattdessen, was ich vorhatte. Dass ich mich am nächsten Morgen auf eine Wanderung in den Fußstapfen Heinrich Heines begeben wollte. Dass ich der Leine bis nach Northeim folgen und mich dann in die Hügel aufmachen wollte, durch Ortschaften hindurch und in Bergwerke hinunter, bevor es schließlich ganz nach oben auf den Brocken hinauf ging. Und dass ich danach, wenn ich es geschafft hatte, nach Hause, nach Berlin zurückkehren, mich hinsetzen und darüber schreiben wollte.
Die Frau sah kurz vom Bildschirm ihres Computers auf. Klickte mit der Maus. Nein, keine Anreise mit dem Auto.
»Ein Frühstücksbüfett gibt es derzeit aufgrund der aktuellen Maßnahmen leider nicht«, fuhr sie fort. »Sie können sich morgen früh an der Rezeption aber ein Frühstückspaket abholen und es auf Ihrem Zimmer essen. Sie müssen mir nur sagen, ob Sie Tee oder Kaffee dazu haben möchten …«
Auf der Weender Straße rangen Vergangenheit und Gegenwart um Aufmerksamkeit. Auf der zur Fußgängerzone umgewandelten Straße ließ es sich insbesondere im warmen Herbstsonnenschein angenehm schlendern. Letzterer fühlte sich wie eine Zugabe an, ein Verweilen des Sommers, das zu genießen alle an diesem Tag in Göttingen anscheinend entschlossen waren. An der gesamten Straße entlang, die hauptsächlich aus Fachwerkhäusern mit Geschäften im Erdgeschoss bestand, drängten sich die Menschen im Außenbereich der Cafés, solange auch nur ein Sonnenstrahl auf ihm landete. Eisdielen und Bäckereien, Restaurants und Bars.
Die meisten der Läden trugen Namen, die man auf den Hauptgeschäftsstraßen in ganz Deutschland finden kann, doch gab es auch Hinweise, die das Interesse des Besuchers weckten. Die Menschen, die hier umherbummelten, waren jung, wie meine Mitreisenden im Zug. Schließlich ist Göttingen eine Universitätsstadt. Und an der Straße, auf den öffentlichen Plätzen der Stadt und über unseren Köpfen, wo die Geschäfte aus dem einundzwanzigsten Jahrhundert den Fachwerkkonstruktionen aus dem Mittelalter Platz machten, warteten noch einige weitere Geister von Göttingen darauf, entdeckt zu werden.
Vor dem Rathaus stand das Gänseliesel mit dem namengebenden Vogel auf seinem Brunnen und wartete auf die Blumen der Studenten oder den Kuss derjenigen, die ihre Doktorprüfung geschafft hatten. Ich hatte die Geschichte vom Gänseliesel und seinem Brunnen gelesen, bevor ich nach Göttingen gekommen war. Es war eine jener zeitlosen Geschichten, die Geschichte einer Tradition, die es bestimmt schon vor zweihundert Jahren, zu Heines Zeit als Student in der Stadt gegeben hatte. Aber wie so viele Traditionen wurde auch diese in deutlich jüngerer Zeit erfunden, als wir vielleicht denken. Die Statue wurde 1901 errichtet. Ein Wettbewerb war zur Gestaltung des Brunnens ausgeschrieben worden, und während die Stadtältesten einen prachtvolleren Entwurf vorgezogen hätten, bestanden die Einwohner von Göttingen auf dem Mädchen mit dem Draht zum einfachen Volk. Nicht lange danach begannen die Studenten mit dem Blumenbringen und Küssen. Wie man sieht, braucht es nicht viel, um eine Tradition zu begründen, sie zeitlos wirken zu lassen.
Als ich dem Gänseliesel begegnete, war es nicht geschmückt – weder Blumen noch Küsse gab es, als ich mich auf dem Platz aufhielt. Vielleicht war es noch zu früh im Semester. Dennoch repräsentierte das Mädchen Göttingen jetzt. Die geliebte Tochter der Stadt zierte die Cover unzähliger mehrsprachiger Reiseführer, die in einem Buchladen in der Nähe zum Verkauf standen. Sie war das Motiv auf den Postkarten, Aschenbechern und Bierkrügen am Souvenirstand und an dem Tag, an dem ich in Göttingen ankam, ein Dutzend Jahrzehnte, nachdem man sie auf dem Platz vor dem Rathaus aufgestellt hatte, Göttingens Hauptattraktion auf Trip-Advisor.
Ich ging weiter. An der Kreuzung Weender Straße, Prinzenstraße und Theaterstraße stieß ich auf den »Nabel« der Stadt, eine Bronzeskulptur, die sich ebenfalls unter den Top Ten auf Trip-Advisor befand, und ein Ort, an dem sich der müde und ermattete Einkäufer zu Füßen eines tanzenden Paars und dessen Kind eine Weile ausruhen kann. Die Skulptur soll für das menschliche Miteinander stehen, warf für mich auf den ersten Blick aber mehr Fragen auf, als sie Antworten gab, vor allem an einem Nachmittag, an dem niemand in der Nähe war, um Musik zum Tanz zu machen. Was ging hier vor sich? Wer waren die Figuren? Ging es hier um eine Demaskierung oder einen Verschleierungsversuch? Tanzten oder rangen die Figuren miteinander?
Ein paar Schritte weiter weg stand ein Mann und fotografierte die Skulptur. Er kämpfte sichtlich mit dem Licht, da die Sonne mittlerweile tief am Himmel stand. Ich fragte ihn, was die Skulptur seiner Meinung nach bedeutete. Was sie uns sagen wollte.
Er zuckte mit den Schultern.
»Ich finde sie einfach schön«, antwortete er.
Ich fragte weiter, ob er aus Göttingen komme, aber natürlich tat er das nicht. Kein Einheimischer würde eine Skulptur fotografieren, an der er jeden Tag vorbeimüsste. Höchstens dann, wenn etwas passiert wäre, wenn jemand etwas mit Göttingens Nabel getan hätte, das ihn auffälliger gemacht, aus der Unsichtbarkeit der Vertrautheit hätte ausbrechen lassen. Doch das war an diesem Tag nicht geschehen. Ich hatte das Gefühl, der Mann und ich waren die einzigen Menschen, die der Skulptur mehr als nur einen flüchtigen Blick schenkten.
In einer Universitätsstadt wie Göttingen – und das trifft auf Universitätsstädte vielleicht mehr als auf die meisten anderen Städte zu – kommen viele der Menschen, die mit der langen Geschichte des Ortes verbunden sind, ursprünglich nicht von dort. Ihre Namen sind an der Weender Straße und anderen Stellen festgehalten, in der Regel auf schlichten Tafeln im Erdgeschoss oder ersten Stock des Gebäudes, in dem sie einmal gewohnt haben. Es sind die Namen der zahlreichen Studenten und Professoren, die sich vorübergehend in der Stadt aufgehalten haben, die Namen von Ägyptologen, Ärzten, Astronomen, Musikern, Dichtern und Schriftstellern. Auf der Weender Straße mit ihrem Defilee an ebenerdigen Ladenfronten muss man sich schon gehörig den Kopf verdrehen, um sie zu erspähen.
Während ich weiterschlenderte, fragte ich mich, auf wen diese Reihe berühmter und weniger berühmter Namen wohl abzielte. Waren sie ein interessantes Detail für jemanden wie mich, der seinen Reisegefährten, hätte er denn einen, am Ärmel zupfen und sagen könnte, »Oh, sieh mal … Alexander von Humboldt«? Vielleicht sollte sie aber auch die Erstsemester inspirieren, die mit einem Blumenstrauß in der Hand auf dem Weg zum Gänseliesel waren – als Erinnerung an die Geisteskraft und Talente derjenigen, die vor ihnen in Göttingen gelebt und gearbeitet hatten.
Vor meiner Abreise aus Berlin hatte ich eine Adresse in mein Notizbuch gekritzelt. Als ich in Göttingen dann vor der Weender Straße 50 stand, sah ich mich einer Filiale des Fast-Food-Fischrestaurants Nordsee gegenüber, die sich mittlerweile unter der Wohnung befand, die Heinrich Heine 1825 nach seiner Harzreise im Herbst des Vorjahres bezogen hatte. Von dieser dreimonatigen Wanderung hielt Heine nur einen kleinen Teil in seiner Harzreise fest. Er arbeitete an dem Text, als er in der Weender Straße wohnte, erschienen ist der Reisebericht in mehreren Fortsetzungen erstmals im Januar und Februar des Jahres 1826 in der Zeitschrift Der Gesellschafter. Zu dieser Zeit hatte Heine sein Studium beendet und sowohl der Weender Straße als auch Göttingen für immer den Rücken gekehrt.
Ich fotografierte das Haus und widerstand der Versuchung, mir ein Fischbrötchen zu kaufen. Stattdessen ging ich weiter. In den kommenden Tagen würde Heine mein Begleiter sein, in Göttingen aber buhlten noch andere um meine Aufmerksamkeit. Ein kurzes Stück die Straße hinunter, und erneut erreichte mich ein Ruf von den oberen Stockwerken eines schmucken Gebäudes aus, das dieses Mal mit einem Kleidergeschäft im Erdgeschoss aufwartete. Ich hatte Samuel Taylor Coleridge in Göttingen zwar nicht erwartet, hätte aber andererseits auch nicht allzu überrascht sein dürfen. Denn auch die englischen Romantiker waren langen Spaziergängen in den Wäldern Mitteldeutschlands durchaus nicht abgeneigt gewesen.
Coleridge lebte 1799 in der Weender Straße, ins Land gekommen war er gemeinsam mit William und Dorothy Wordsworth mit dem Dampfschiff vom englischen Yarmouth aus. Bevor es nach Göttingen ging, verbrachte Coleridge vier Monate in Ratzeburg, um so gut Deutsch zu lernen, dass er sich an der Universität für Seminare einschreiben konnte; indes zogen die Wordsworths weiter nach Goslar, eine Stadt am Rande des Harzes und für die gesamte Zeit, die sie aus England fort waren, ihr Stützpunkt. Es war der kälteste Winter des achtzehnten Jahrhunderts, worüber sich sowohl Coleridge als auch die Wordsworths in ihren Briefen in die Heimat beschwerten.
Die einzigen Bemerkungen, die sich mir aufdrängten, schrieb Coleridge später, waren die, dass es kalt war, sehr kalt. Entsetzlich kalt.2
Vielleicht hatte Coleridge deswegen die Zeit, die Sprache so schnell zu lernen, dass er kaum ein Jahr später imstande war, Schiller zu übersetzen.
In Göttingen hauste Coleridge zunächst in einer Unterkunft, die er als »verdammtes Dreckloch« beschrieb, bevor er in die Weender Straße zog. Er besuchte Vorlesungen, verbrachte aber den Großteil seiner Zeit – acht bis zehn Stunden am Stück – in der Bibliothek, wo er sich intensiv auf alle möglichen Studienthemen konzentrierte. Am meisten jedoch interessierte sich Coleridge für das Werk Lessings, über ihn wollte er ein Buch schreiben.
Für Coleridge bedeutete Göttingen etwas, das er in England anscheinend nicht hatte finden können. Aufklärung. Toleranz. Freie Meinungsäußerung. Religionsfreiheit. Er kehrte mit einer neuen Sprache nach Hause zurück und mit einigen neuen Ideen, wie er in der eigenen Sprache schreiben könnte – dazu angeregt teilweise durch Wanderungen, die er im Mai und Juni 1799 in den Harz unternommen hatte. In seinen Briefen nach England prägte er Ausdrücke, die ihren Weg nicht nur in Coleridges Gedichte, sondern in die englische Sprache allgemein fanden. Vor Heine, aber nach Goethe, erklomm Coleridge den Gipfel des Brocken sogar zwei Mal.
Ich stand auf des gewalt’gen Brocken Gipfel,
Sah Wald auf Wald und Berg auf Berg gehäuft,
Ein wogend Bild, nur durch die blaue Ferne
Begrenzt.
I stood on Brocken’s sovran height, and saw
Woods crowding upon woods, hills over hills,
A surging scene, and only limited
By the blue distance.
Später im Gedicht – »Zeilen, geschrieben in Elbingerode nach einer langen Wanderung in den Wäldern und über die Hügel«3 – führten Coleridges Feder und Vorstellungskraft ihn hinter den Horizont an Englands »Gestade und türmend weiße Klippen«; sie verbanden die beiden Landschaften im Vers miteinander und lassen ahnen, welchen Einfluss die Monate in Deutschland nicht nur auf Coleridges Werk, sondern auch auf das des in Goslar tätigen Wordsworth haben sollten. Und so spielten Wald auf Wald und Berg auf Berg eine kleine, aber entscheidende Rolle bei der Entwicklung der englischen Romantik.
Ich folgte dem Weg, den Coleridge von seiner Unterkunft in der Weender Straße zu den Befestigungsanlagen genommen hätte, wo bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die Stadtmauern gestanden hatten. Zu Coleridges Zeit in Göttingen war der Wall wie heute ein beliebter Ort für Spaziergänge gewesen, da er sich über die Straßen der Stadt erhob und den Blick über die Dächer im Zentrum freigab.
Coleridge spazierte gern abends gemeinsam mit Freunden auf dem Wall, einer Mischung aus englischen und deutschen Studenten, die meist jünger waren als er. Sie setzten sich unter die Bäume und sprachen über das, was sie an diesem Tag in den Vorlesungssälen und in der Bibliothek gelernt hatten. Als ich dort spazieren ging, konnte ich ebenfalls einige Paare und kleine Gruppen sehen, die sich mit ihren Büchern und Bierflaschen auf Bänken oder im Gras zwischen den Bäumen niedergelassen hatten, während mir in der herbstlichen Nachmittagsluft der Rauch von Zigaretten und Marihuana penetrant in die Nase stieg.
Einen solchen Abend habe ich nie zuvor erlebt, schrieb Coleridge über seine Erfahrungen auf einer Studentenparty. Gebrüll, Küsse, Umarmungen, Raufereien, an die Wand geworfene Flaschen und Gläser. Eine solche Szene des Aufruhrs habe ich noch nie gesehen, noch nicht einmal an der Universität in Cambridge …4
Unweit des Bahnhofs verließ ich den Wall und folgte der Hauptstraße, die aus dem Stadtzentrum führte, über die Gleise und den Fluss hinweg in Richtung Autobahn. Der Verkehr strömte einige Zeit vor der Rushhour aus Göttingen hinaus, zwischen einer Aufreihung von Supermärkten, Tankstellen und Autohäusern auf der einen und einer Backsteinmauer mit hohen Bäumen dahinter auf der anderen Seite.
Kurz nachdem ich den Stadtfriedhof mit seinen breiten, beschatteten Wegen zwischen gepflegten Rasenanlagen betreten hatte, drang der Straßenlärm durch die Abschirmung der Bäume und der Friedhofsmauer nur noch gedämpft zu mir. Mit jedem Schritt, der mich tiefer in den Friedhof hinein und von der Straße wegführte, konnte ich den Gesang der Vögel und die leisen Stimmen eines Paars, das mit Gießkannen in der Hand an einem Grab stand, besser hören. Der Friedhof erstreckte sich großflächig zwischen Straße und Bahngleisen, jenseits der alten Stadtmauern und der Leine, eröffnet worden war er im Jahr 1881. Seit damals war er für über vierzigtausend Seelen zur letzten Ruhestätte unter den Blätterdächern der Bäume geworden, die sich mir in herbstlicher Farbenpracht zeigten.
Ich war auf der Suche nach einem ganz bestimmten Grab, das ich nach etwa zwei Dritteln des Wegs durch den Friedhof auch fand, in Hörweite jetzt der Züge, die auf der anderen Seite der Friedhofsmauer in den Bahnhof ein- und wieder aus ihm hinausfuhren. Ein schlichter Stein markierte das Grab.
FRIEDRICH CARL
ANDREAS
GEB. 14. APRIL 1846
GEST. 4. OKT. 1930
Friedrich Carl Andreas war 1903 nach Göttingen gezogen und hatte den Lehrstuhl für Westasiatische Sprachen an der Universität inne. Doch es war nicht Friedrich, dessentwegen ich gekommen war; auf dem Grabstein steht ein weiterer Name, eine weitere Gravur, die dem vorüberstreifenden Besucher sogar noch weniger Informationen liefert. Weder Nachname noch Geburtsdatum. Auch kein Sterbedatum. Lediglich drei Buchstaben, wie von Hand geschrieben oder nachträglich eingraviert.
Lou
Sieben Jahre nach dem Tod ihres Mannes, mit dem sie von 1887 bis 1930 verheiratet war, aber zölibatär zusammengelebt hatte, schloss sich Lou Andreas-Salomé ihm auf dem Stadtfriedhof Göttingen an, wovon nur ihr Vorname auf dem Grabstein zeugt. Die Psychoanalytikerin und ausgesprochen produktive Schriftstellerin war lange Zeit für ihre Freundschaften mit Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Paul Rée und Rainer Maria Rilke bekannt. Tatsächlich war es Lou Andreas-Salomé, die Rilke dazu überredete, seinen Vornamen René in das maskulinere Rainer zu ändern, und Freud war so beeindruckt von ihrer Arbeit, dass er sie die »Dichterin der Psychoanalyse«5 nannte.
Allerdings ist Lou Andreas-Salomé weit mehr als nur die Summe ihrer Beziehungen zu berühmten Männern. Sie wurde 1861 in St. Petersburg geboren, studierte in Zürich an einer der zu dieser Zeit wenigen europäischen Universitäten, die auch Frauen zuließen, und wurde eine der ersten Psychoanalytikerinnen überhaupt. Als bedeutende Schriftstellerin widmete sie sich Themen wie der weiblichen Psychologie und Sexualität, dem Erotischen, der Geschlechterdifferenz und dem Glaubensverlust. Mit ihrer Arbeit nahm sie großen Einfluss auf feministische Bewegungen zu ihren Lebzeiten und darüber hinaus. Daneben schrieb sie Memoiren, Romane und Gedichte, beispielsweise das »Lebensgebet«, das später zur Grundlage von Friedrich Nietzsches »Hymnus an das Leben« werden sollte.
Gewiß, so liebt ein Freund den Freund,
Wie ich dich liebe, Rätselleben –
Ob ich in dir gejauchzt, geweint,
Ob du mir Glück, ob Schmerz gegeben.6
Viel von Lou Andreas-Salomés Geschichte kann über die Freundschaften erzählt werden, die sie pflegte. Den Großteil der Menschen, mit denen sie befreundet war, überlebte sie. Am Ende ihres Lebens wohnte sie in ihrem Haus am Rand von Göttingen und züchtete Nutrias in ihrem Garten, während die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland ergriffen. 1933 hängten ihre Nachbarn die Hakenkreuzfahne im Fenster auf, woraufhin Lou Andreas-Salomé schrieb: »Richtig vernünftig sprechen kann man jetzt hier eigentlich nur mit den 11 Nutrias.«7
Von Nietzsches Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche wurde sie als die »finnische Jüdin«8 denunziert. Sie hatte Lou Andreas-Salomé schon lange vorgeworfen, Friedrich zu »verderben« und einen Keil zwischen Bruder und Schwester zu treiben, auch wenn Andreas-Salomé immer sehr ruhig darauf bestand, lediglich an Freundschaft interessiert zu sein und dass es schließlich Friedrich gewesen sei, der das unmoralische Angebot gemacht habe. Dies hatte auf Elisabeth allerdings nur die Wirkung, so hysterisch zu werden, dass sie sich übergeben musste.9
Wenige Tage nach Andreas-Salomés Tod drang die Gestapo in ihr Haus ein und konfiszierte die Bibliothek unter dem Vorwand, sie sei voller Bücher jüdischer Autoren und müsse »gesäubert« werden; außerdem war Lou Andreas-Salomé eine Studentin und Kollegin von Freud gewesen. Doch wie die Journalistin Katja Iken später schrieb: »Hitlers Schergen beschlagnahmten ihre Bibliothek. Ihr geistiges Erbe vermochten sie nicht zu zerstören.«10
Mehr als für alles andere sollte Lou Andreas-Salomé für das, was sie in ihrem Leben und mit ihrer Arbeit geleistet hat, in Erinnerung bleiben. In Göttingen ist eine Straße nach ihr benannt, zudem gibt es dort das Lou Andreas-Salomé Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie. Und an der Herzberger Landstraße, wo einst ihr Haus stand und die Hakenkreuzflagge im Fenster der Nachbarn hing, trägt ein Denkmal ihre Worte, die zu allen sprechen, die die Pilgerreise dorthin unternehmen.
Du heller Himmel über mir
Dir will ich mich vertrauen
Lass nicht von Lust und Leiden hier
Den Aufblick mir verbauen
Ich verließ den Friedhof, überquerte erneut Fluss und Eisenbahngleise und begab mich auf den Wall zurück, um meine Umrundung des Stadtzentrums abzuschließen. Auch hier hingen Transparente aus den Fenstern der Wohnblocks an der Ringstraße, die dem Verlauf des ehemaligen Stadtgrabens folgt. Diese Flaggen riefen zur Solidarität ohne Grenzen auf, dazu, niemanden zurückzulassen; sie forderten Solidarität mit der Black-Lives-Matter-Bewegung und den Kurden. Daneben fanden sich Anti-Gentrifizierungs-Slogans, auf einem riesigen Stück Stoff stand »Wohnraum statt Leerstand« und darunter flatterte eine Werder-Bremen-Fahne stolz im Wind.
Es gab aber auch andere Unterbringungsmöglichkeiten für Studenten, prächtigere Gebäude mit Türmen und Türmchen und Wappen an den Mauern, die in manchen Fällen mit Farbbeuteln bombardiert worden waren. Dies waren die Häuser des Studentencorps und der Burschenschaften, Studentenverbindungen, die mitunter mehr als zweihundert Jahre alt waren. Einige von ihnen standen in dem Ruf, mit eher zweifelhaften politischen Ansichten aufzuwarten, was möglicherweise die Farbbomben erklärte.
Obwohl sich die Geschichte der Studentenverbindungen über Jahrhunderte bis zu den ältesten Universitäten im Heiligen Römischen Reich zurück erstreckt, wurden sie erst mit der Gründung der Burschenschaften im neunzehnten Jahrhundert politisch aktiver. Die Burschenschaften unterschieden sich von den Studentencorps, deren Traditionen auf den alten landsmannschaftlichen Zusammenschlüssen fußten und die an den Universitäten die Studenten verschiedener Regionen wie beispielsweise Preußen oder Westfalen vereinen wollten.
Im Gegensatz dazu entstanden die Burschenschaften aus dem nationalistischen Geist heraus, der sich während der Napoleonischen Kriege und danach entwickelt hatte – tatsächlich wurde die erste Burschenschaft 1815 gegründet –, kurz bevor Heinrich Heine an die Universität kam. Als er 1819 sein Studium in Bonn aufnahm, schloss er sich einer der neuen Burschenschaften an – wenngleich er sich später einen Ruf als dezidiert anti-nationalistischer Schriftsteller schaffen sollte.
Als er ein Jahr später erstmals nach Göttingen kam, hatte sich der Gegensatz zwischen Studentencorps und Burschenschaften bereits zu einem handfesten Streit ausgewachsen. Eine schwierige Zeit für Heine, nicht nur deshalb, weil er anscheinend vom allerersten Augenblick an eine Abneigung gegen Göttingen entwickelt hatte. Er hatte im Zusammenhang mit den Rivalitäten zwischen Burschenschaften und Corps einen Mitstudenten zu einem Duell herausgefordert und sich dabei auf die Seite der Burschenschaften gestellt – was ihm einen sechsmonatigen Ausschluss von der Universität einbrachte. Und trotz seiner Bereitschaft, die Kameraden und ihre Burschenschaft zu verteidigen, wurde ihm dann auch noch die Mitgliedschaft in der Studentenverbindung entzogen.
Aus der Verbindung geworfen hatte man ihn angeblich wegen seiner »Unkeuschheit« – der wirkliche Grund war wahrscheinlich jedoch ein viel dunklerer. Auf einer geheimen Versammlung in Dresden im September 1820 beschlossen die Burschenschaften unter sich, dass ihre Einheit einem gemeinsamen deutsch-christlichen Ursprung geschuldet war und dass die Juden »keine Heimat« hatten, schon gar nicht in einer solchen Verbindung. In der Göttinger Burschenschaft traten die antisemitischen Tendenzen nur allzu deutlich zutage – der plausibelste Grund, warum man Heine ausgeschlossen hatte. Dies sollte sich wie ein roter Faden durch Heines Leben ziehen. »Zu jüdisch und nicht deutsch genug« wurde zum leidvoll vertrauten und bedrückenden Refrain, auch in seinem Werk, sowohl zu seinen Lebzeiten als auch noch lange nach seinem Tod.
Im Sonnenschein des späten Nachmittags saß ich auf den Überresten der alten Stadtmauer in Sichtweite eines scheinmittelalterlichen Schlosses, in dem eines der Studentencorps untergebracht war, und sah den Spaziergängern zu, die an mir vorbeischlenderten. Universitätsstädte haben irgendetwas an sich, das ich schon immer anziehend fand. Vielleicht ist es schlicht das Gefühl der Jugend. Dass man sich an einem Ort wie Göttingen – so alt und voller Geschichten, die Fachwerkhäuser zugepflastert mit den Namen einiger der größten Geister, die ein Land, ja sogar ein Kontinent je hervorgebracht hat – trotzdem nicht wie in einem Museum fühlt. Der Zustrom neuer Seelen, Jahr für Jahr, Herbst für Herbst, haucht den alten Straßen neues Leben ein. Die Jungen halten die Stadt jung, und das hört nie auf.
Ich saß also auf dem Wall und dachte an Coleridge und Humboldt, an Lou Andreas-Salomé und Heine sowie an all die anderen, die in diese Universitätsstadt gekommen und aus ihr gegangen und sicherlich auch hier heraufgekommen waren, um frische Luft zu schnappen und eine Aussicht zu genießen, die sie, wenn auch nur vorübergehend, über die kleine Welt, in der sie unten lebten, hinausgeführt hatte.
Ganz anders als Coleridge war Heine kein Fan von Göttingen gewesen. Angesichts dessen, was er über die Stadt schrieb, vor allem in den Anfangspassagen der Harzreise, hätte es mich nicht im Geringsten überrascht, hätte die Stadt nach Kräften versucht, Heines Spuren in ihr zu tilgen.
Die Stadt selbst ist schön, schrieb er, und gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rücken ansieht …
Sein Studium der Rechtswissenschaft hatte Heine in Bonn begonnen, bevor er nach Göttingen weitergezogen war, doch legen eigene Äußerungen nahe, dass ihn alles interessierte – nur nicht die Rechtswissenschaft. Das Ausleihverzeichnis der Universitätsbibliothek Bonn weist Buchleihen aus allen möglichen Bereichen aus, sei es Mythologie, Geschichte, Literatur, Volkslieder, mittelalterliche Chroniken und vieles mehr.
Die Bibliothek und der Ratskeller ruinieren mich,11 schrieb er aus Bonn. Gleichzeitig aber befand er sich schon ein gutes Stück weit auf seinem richtigen Weg: der Vorbereitung darauf, der große Dichter und Schriftsteller zu werden, der er werden sollte. Ebenfalls in Bonn schloss er sich der Burschenschaft an, die ihn später hinauswarf. Er trat ihr aus einem eigenen Gefühl von Patriotismus heraus bei, obwohl ihm bald darauf klar wurde, dass sich der deutsche Patriotismus in eine ganz andere Richtung bewegte als in die, wie er ihn verstand. Dieser Patriotismus, schrieb er später, ließ das Herz des deutschen Patrioten kleiner und kälter werden, daß er das Fremdländische haßt, daß er nicht mehr Weltbürger, nicht mehr Europäer, sondern nur ein enger Deutscher sein will …12
In Göttingen verfolgte er seine Interessen weiter und arbeitete in seinem ersten Winter in der Stadt an seiner Tragödie Almansor, während er Seminare in Geschichte und Philologie besuchte und an seinen Kommilitonen verzweifelte, von denen anscheinend keiner Altdeutsch studieren wollte.
O Deutschland! Land der Eichen und des Stumpfsinnes!13
Ich hatte Heine dabei. Natürlich hatte ich das. Er sollte mich auf meiner Wanderung begleiten, auf der ich, so gut ich nur konnte, seiner in der Harzreise beschriebenen Strecke folgen wollte. Als sich Heine 1824 von Göttingen aus auf den Weg machte, konnte seine Reise kaum als originell gelten. Aber genau das war ja auch Sinn und Zweck der Sache. Neben Goethe und Coleridge hatte es viele andere gegeben, die die Wanderung in die Wälder des Harzes hinauf und auf den Gipfel des Brocken unternommen hatten und im Fieber der Romantik sowie mit zahlreichen Zeilen nicht immer brillanter Dichtkunst zurückgekehrt waren. Heine selbst eröffnete seine Reise mit einem Gedicht voller Seitenhiebe auf seine Mitstudenten, in dem er absolut klarstellte, dass seine Wanderung in die Berge nichts anderes als eine Flucht war.
Auf die Berge will ich steigen,
Wo die frommen Hütten stehen,
Wo die Brust sich frei erschließet
Und die freien Lüfte wehen.
Auf dem Wall lag Göttingen im Sonnenschein des Spätnachmittags weich und warm vor mir. Die Blätter an den Bäumen, die den Weg säumten, hatten begonnen, sich zu verfärben. Grillgeruch breitete sich vom Garten eines Hauses hinter einer hohen Mauer aus, aus einem offenen Fenster wehte der Klang von Musik zu mir herüber.
Auf die Berge will ich steigen,
Wo die dunkeln Tannen ragen,
Bäche rauschen, Vögel singen
Und die stolzen Wolken jagen.
Auf dem Wall öffnete ich die Harzreise, um Heines Eingangsverse noch einmal zu lesen. In fünf kurzen Strophen erzählt er von seiner Motivation, sich auf diese Wanderung zu begeben. Darauf folgt eine vernichtende Kritik Göttingens und all seiner Einwohner. Man spürt, dass er schon bevor er überhaupt aufgebrochen ist, das Gefühl hat, mit der Gesellschaft, die er in den Wäldern und Bergen des Harzes finden wird, glücklicher zu sein als mit der, die ihn in der Stadt umgibt.
Lebet wohl, ihr glatten Säle,
Glatte Herren! Glatte Frauen!
Auf die Berge will ich steigen,
Lachend auf Euch niederschauen.
Es gab nur noch zwei weitere Gäste in dem Restaurant, als ich mich an einem großen Holztisch in der Ecke niederließ. Im Kamin am anderen Ende des Raums brannte kein Feuer, die Bedienungen standen in einem gelangweilt wirkenden Grüppchen an der Bar und hofften, dass das Abendgeschäft allmählich Fahrt aufnahm. Eine junge Frau löste sich aus dem Haufen, steuerte federleicht durch den Raum auf mich zu, gab mir die Speisekarte und nahm meine Bierbestellung auf. Während ich auf mein Getränk wartete, holte ich eine Karte heraus und breitete sie auf dem Tisch vor mir aus.
Ich wusste, wo Heine auf seiner Wanderung übernachtet hatte, und teilweise ist es auch möglich, anhand des Textes herauszufinden, durch welche Dörfer und Städte er unterwegs gekommen war, doch die exakte Route konnte ich nur erahnen. Was ich wusste, war, dass er am allerersten Tag eine marathonähnliche Strecke zurückgelegt hatte, epische zweiundvierzig Kilometer, die ihn von Göttingen aus nach Northeim brachten, wo er zu Mittag aß, und schließlich nach Osterode, wo er lange nach Einbruch der Dunkelheit ankam. Ich hatte nicht die Absicht, es Heine in diesem Punkt gleichzutun und meine mehr als einwöchige Wanderung mit einem so tollkühnen Einstieg zu beginnen, und deshalb bereits beschlossen, die Strecke auf zwei Tage aufzuteilen. Mein Ziel am nächsten Tag war Northeim, und obwohl Heine wahrscheinlich die Hauptstraße dorthin genommen hatte, war ich von dem Gedanken, vier bis fünf Stunden in der Gesellschaft eines konstanten Stroms an Fahrzeugen zu verbringen, weniger angetan. Auf meiner alternativen Route wollte ich Göttingen über die Universitäts- und Vorstadtseitenstraßen verlassen und dann einem Fußweg über die Felder bis zu dem Radweg folgen, den ich vom Zugfenster aus gesehen hatte und der parallel zur Leine bis zu meinem morgigen Etappenziel verlief.
Als die Kellnerin mir mein Bier brachte, hielt sie inne und warf einen Blick auf die Karte. Ich nutzte die Gelegenheit, sie zu fragen, ob die Route aus ihrer Sicht sinnvoll war oder ob es vielleicht eine bessere gab. Vielleicht hatte ich ja irgendetwas übersehen. Sie aber wusste es nicht wirklich. Sie war Studentin und neu in der Stadt, die sie erst seit einigen Wochen kannte. Mit dem Job als Kellnerin wollte sie sich etwas für ihr Studium dazuverdienen. Sie sprach über die inoffizielle Hierarchie in der Studentenschaft, über diejenigen, die arbeiten mussten, um sich das Studium zu finanzieren, und diejenigen, die das nicht mussten. Eine Hierarchie, die auf familiärem Hintergrund und verfügbarer Zeit basierte. Darauf, wer schließlich wem die Getränke servierte.
»Ich muss arbeiten, sonst kann ich mir das Studium nicht leisten«, erzählte sie. Darüber, wie ihr Leben in Göttingen aussehen würde, wenn sie nicht arbeiten müsste, sprachen wir nicht.
Sie kam aus dem Norden, aus der Nähe von Kiel. Von einem Ort des offenen Himmels und der Radtouren auf dem Deich hinter den Dünen. Sie konnte mir bezüglich Göttingen keinen Rat geben und auch keinen Einblick in die Stadt gewähren, weil sie sie selbst noch nicht kannte. Sie erinnerte mich erneut daran, dass Universitätsstädte auch etwas Flüchtiges an sich haben, an das Hin und Her, bei dem die einen kommen und dem Gänseliesel Blumen in den Arm legen, während die anderen bereits auf den Brunnen klettern, um dem Mädchen einen Abschiedskuss zu geben.
Trotzdem war sie zufrieden. Immerhin hatte sie einen Job und eine hübsche Studentenunterkunft. Freundliche Mitbewohner. Sie hatte bislang noch keine Zeit gehabt, die Stadt oder ihre Umgebung eingehender zu erkunden, freute sich aber darauf. Während sie mir das alles erzählte, waren ihre Augen auf die Karte gerichtet, als sähe sie sich die Möglichkeiten an. Dann machte sie sich bereit, meine Bestellung aufzunehmen und sie in den Computer hinter dem Tresen einzugeben. Zuvor aber tippte sie mit dem Finger auf die Karte, an die Stelle, an der mich der Weg durchs Universitätsgelände und über die Felder zum Fluss führen sollte.
»Vielleicht wäre es mit dem Rad besser«, sagte sie.
Eine Gruppe jüngerer Leute betrat das Restaurant und setzte sich an einen Tisch am Fenster. Die Kellnerin ging nach hinten, um meine Bestellung weiterzugeben, und nahm dabei gleich ein paar Speisekarten für die Neuankömmlinge mit.
Als alle betrunken und alle Flaschen zerbrochen waren, so Coleridge weiter in seinem Bericht über die Göttinger Studentenparty, brachten sie ein riesiges Schwert herein, versammelten sich um das Schwert und sangen ein Lied, bevor ein jeder seinen Hut auf das Schwert spießte, Hut über Hut, noch immer singend, und man sich gegenseitig küsste und umarmte. Noch immer singend …14
Ich fand eine kleine Bar unweit der Stelle, an der einst das Weender Tor gestanden und den Zugang zur Stadt von Norden aus überwacht hatte. Wenn in Göttingen Studentenpartys stattfanden, dann nicht dort, wo ich gerade war. Vielleicht wurden sie im Verborgenen abgehalten, in den Wohnungen hinter den gewaltigen, selbst gemalten Transparenten, die zur Unterstützung von Geflüchteten aufriefen, oder in den widerhallenden Sälen scheinmittelalterlicher Villen mit einem Wappen an der Mauer und Farbspritzern am Ziegelwerk.
Ich ging hinein, bestellte mir ein Bier und nahm mein Buch heraus. Die Bar war zwar nicht gerade Heines Ratskeller in Bonn, erfüllte aber ihren Zweck. An der Wand hingen Fanschals und alte Fotografien der Stadt. Ein auf stumm geschalteter Fernseher zeigte ein Fußballspiel aus der vergangenen Woche. Abgesehen von einem weiteren Mann, der am anderen Ende des Tresens saß und mit unscharfem Blick auf das polierte Holz knapp hinter seinem Glas starrte, war ich locker die älteste Person in diesem Raum. Alle anderen waren kaum zwanzig oder zwischen zwanzig und dreißig. An einem Tisch neben der Tür saßen zwei Paare. Woanders spielten einige Jungs Karten. Noch ein Paar auf Barhockern in meiner Nähe. Eine junge Frau mit Smartphone, einen halben Schritt aus der Tür, in der Hand eine Zigarette, die sie nach draußen hielt.
Der Name des Barkeepers war Mike, vielleicht auch Maik. Die Leute riefen ihm ihre Bestellungen vom Platz aus zu, er ließ sich Zeit beim Zapfen des Biers, lächelte. Mit denen, die am Tresen saßen, sprach er über das Fußballspiel, mit denen, die zu ihm kamen, um etwas zu bestellen, machte er Smalltalk. In einem ruhigen Augenblick fragte er mich, was ich da las. Ich drehte das Buch um, damit er den Einband sehen konnte. An Heine war er nicht wirklich interessiert, doch ist meine Ausgabe der Harzreise mit Illustrationen aufgelockert. Mit einer Abbildung vom Göttinger Marktplatz, wie er 1829 ausgesehen hat. Mit einem Gemälde vom Ilsestein. Dem Holzschnitt einer Burschenschaftsfeier um 1820, auf dem ein Student auf einem Stuhl auf dem Tisch sitzt und seine Mittrinker die Gläser erhoben haben, um auf ihn anzustoßen – außer demjenigen, der bewusstlos am Boden liegt, und dem, der den Kopf zum Fenster hinausgestreckt hat, vermutlich um sich ein wenig des Drucks auf den Magen zu entledigen.
»Coole Party«, kommentierte Mike grinsend und zapfte weiter.
Ich erzählte ihm, dass Heine nicht viel von Göttingen gehalten hatte, und las ihm ein Stück aus dem Buch vor.
Die Zahl der Göttinger Philister muß sehr groß sein, wie Sand, oder besser gesagt, wie Kot am Meer; wahrlich, wenn ich sie des Morgens, mit ihren schmutzigen Gesichtern und weißen Rechnungen, vor den Pforten des akademischen Gerichtes aufgepflanzt sah, so mochte ich kaum begreifen, wie Gott nur so viel Lumpenpack erschaffen konnte.
Mike hörte mir aufmerksam zu, während er weiter zapfte, und lachte am Ende des Zitats. Er lächelte immer noch, als er mit dem Bier in der Hand den Tresen entlangging, und nickte, als wollte er Heine zustimmen.
Die Geister von Göttingen waren verstummt. Die aus der Vergangenheit ebenso wie die aus der Zukunft. Ich ging das kurze Stück zum Hotel zu Fuß, neben den Gleisen her durch ruhige Straßen. Ein Bus fuhr an mir vorbei, das Innere erhellt für den einzigen Fahrgast auf einem der hinteren Sitze. Vor mir überquerte ein Mann mit Plastiktüten in jeder Hand eilig die Straße und verschwand dann im Eingang eines riesigen Wohnblocks. Als ich an der Fassade hinaufsah, flackerte mir das Licht von anscheinend hundert Fernsehern entgegen.
Im allgemeinen werden die Bewohner Göttingens eingeteilt in Studenten, Professoren, Philister und Vieh; welche vier Stände doch nichts weniger als streng geschieden sind. Der Viehstand ist der bedeutendste.