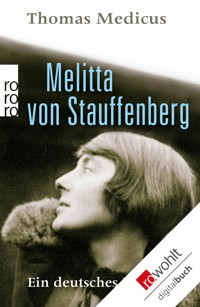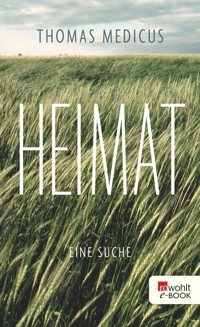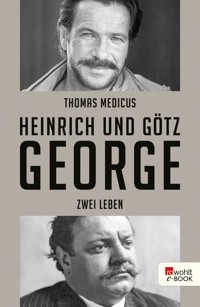
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Selten war ein Verhältnis von Vater und Sohn so innig und so komplex – obwohl sich die Lebenszeit beider kaum überschnitt: Heinrich George herrschte seit den 1920ern als Berliner Theaterkönig, spielte unter Brecht und in «Metropolis». Im Dritten Reich führte er seine Karriere zu neuen Höhen, ließ sich für Propaganda einspannen; er starb 1946 im sowjetischen Speziallager Sachsenhausen. Der Sohn Götz war da acht Jahre alt, doch mit dem Vater beschäftigte er sich zeitlebens – dem widersprüchlichen Künstler, dem er auf eigene Weise nachfolgte. Götz George spielte in Karl-May-Streifen, dann in «Schtonk» oder «Rossini», in denen sich die Republik spiegelte, glänzte in Charakterrollen wie in «Der Totmacher». Als «Schimanski» wurde er zum beliebtesten deutschen Fernsehkommissar und zum Prototyp des neuen Manns, der auch verletzlich sein durfte. Bei aller Verschiedenheit eint Vater und Sohn: Beide waren ungemein populär, echte Volksschauspieler. Ihr Leben erzählt ein Jahrhundert deutscher Geschichte. Thomas Medicus versteht es wie wenige, seine Figuren lebhaft auszuleuchten und zugleich das große Panorama zu zeichnen. Eine außergewöhnliche, bewegende Vater-Sohn-Geschichte – und die Doppelbiographie zweier prägender Künstler des 20. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Thomas Medicus
Heinrich und Götz George
Zwei Leben
Roman
Über dieses Buch
Selten war ein Verhältnis von Vater und Sohn so innig und so komplex – obwohl sich die Lebenszeit beider kaum überschnitt: Heinrich George herrschte seit den 1920ern als Berliner Theaterkönig, spielte unter Bertolt Brecht und in der Filmlegende «Metropolis». Im Dritten Reich führte er seine Karriere zu neuen Höhen, ließ sich für Propaganda einspannen; er starb 1946 im sowjetischen Speziallager Sachsenhausen. Der Sohn Götz war da acht Jahre alt, doch mit dem Vater beschäftigte er sich zeitlebens – dem widersprüchlichen Künstler, dem er auf eigene Weise nachfolgte. Götz George spielte in Karl-May-Streifen, dann in «Schtonk» oder «Rossini», in denen sich die Republik spiegelte, glänzte in Charakterrollen wie in «Der Totmacher». Als «Schimanski» wurde er zum beliebtesten deutschen Fernsehkommissar und zum Prototyp des neuen Manns, der auch verletzlich sein durfte. Bei aller Verschiedenheit eint Vater und Sohn: Beide Georges waren ungemein populär, echte Volksschauspieler. Ihr Leben erzählt ein Jahrhundert deutscher Geschichte.
Thomas Medicus versteht es wie wenige, seine Figuren lebhaft auszuleuchten und zugleich das große Panorama zu zeichnen. Eine außergewöhnliche, bewegende Vater-Sohn-Geschichte – und die große Doppelbiographie zweier prägender Schauspielkünstler des 20. Jahrhunderts.
Vita
Thomas Medicus, geboren 1953, schrieb u. a. für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und war stellvertretender Feuilletonchef der «Frankfurter Rundschau», auch arbeitete er viele Jahre für das Hamburger Institut für Sozialforschung. Heute lebt Thomas Medicus als freier Publizist in Berlin. 2012 veröffentlichte er die hochgelobte Biographie «Melitta von Stauffenberg», 2014 erschien sein Buch «Heimat», über das die «Neue Zürcher Zeitung» meinte: «Eigenwillig und fesselnd ... eine vielschichtige zeithistorische Erzählung.»
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Stefan Falke/laif; Getty Images/Ullstein Bild
ISBN 978-3-644-00503-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Erster TeilHeinrich George
Erstes KapitelZwerge, Riesen, Feen. Ein Beamtensohn will zum Theater
Ein derbes wettergebräuntes Gesicht, leuchtende Augen, Schnauzbart unter der Nase, eine Joppe aus wetterfestem Stoff samt gestreifter, fleckiger Weste über dem mächtigen Brustkorb, ein Tuch um den Hals, das vor dem Wind schützt und den Arbeitsschweiß auffängt, Schiffermütze auf dem Kopf. Mannhaft steht Henner Classen, Kapitän des Schleppkahns «Maria», bei prächtigem Sommerwetter breitbeinig auf dem Deck seines Schiffes. Während es auf einem von Gärten, Viehweiden und Dörfern gesäumten Fluss gemächlich dahinzieht, mehrere Lastkähne im Schlepptau, singt Henner, die qualmende Pfeife abwechselnd in Mund und Pranke, lauthals ein Lied darüber, wie schön das Schifferleben sei und wie viel man dabei von der Welt zu sehen bekomme. Zur Besatzung gehören Henners Frau Marie und ihr kleiner Sohn Franz. An Bord ist auch der halbwüchsige Jakob, der auf der Flucht vor seinem rohen Vater hier ein neues Zuhause gefunden hat. Bald verändert sich die Szenerie, das idyllische Bauernland geht in eine Industrielandschaft über, die «Maria» gleitet unter Eisenbrücken hindurch, Fabrikanlagen, Kräne, hohe Schornsteine werden sichtbar. Endlich erreicht das Schiff das Zentrum von Berlin und macht an der Spreeinsel in der Nähe von Dom und Lustgarten fest. Kaum hat er Land unter den Füßen, nimmt für Henner in der Reichshauptstadt das Unglück seinen Lauf. Der klobige, bodenständige Mann verfällt dem Laster der Metropole–Berlin hatte damals über vier Millionen Einwohner–in Gestalt der attraktiven Gescha. Sie ist der Lockvogel eines Ganoven-Trios. Besinnungslos lässt Henner Frau und Kind im Stich, bereit, alles zu opfern für ein neues Leben mit der Großstädterin. Zuletzt wird er doch noch eines Besseren belehrt, und er kehrt zu seiner Familie an Bord seines Kahns zurück.
Heinrich George als bodenständiger Kraftklotz und Muskelprotz, der, geht im Leben auch mal was daneben, das Herz immer am rechten Fleck hat und wieder auf die Beine kommt–so kannte, so liebte ihn sein Publikum, diesen Typ machte ihm keiner nach, das war seine Rolle. «Schleppzug M17» gehört nicht zu Georges bekanntesten Filmen, zu Unrecht, denn er ist einer seiner interessantesten. Das melodramatische Sittenbild ist unter den ungefähr achtzig Spielfilmen, die George im Lauf seines Lebens gedreht hat, seine einzige Regiearbeit. Die Rolle des gefühlvollen Kraftmeiers ist ihm entsprechend passgenau auf den Leib geschrieben. In ihrer ersten Filmrolle überhaupt sieht man auch Georges Frau Berta Drews als Marie. Noch nie gesehen waren auch Milieu und Drehorte. Berlin aus der Perspektive seiner Gewässer gesehen, von einem Spreekahn aus, das hatte es auf der Kinoleinwand noch nicht gegeben. Geschickt verband George als Regisseur dabei auch die Volkstümlichkeit verschiedener Couplets, an erster Stelle der von ihm selbst gesungene Ohrwurm des «Schifferliedes», mit eindrucksvollen semidokumentarischen Großstadtszenen. Wenn Henner mit seiner Familie über den Potsdamer Platz hastet und dann, als er Gescha erspäht, Frau und Sohn inmitten der Menschenmenge orientierungslos zurücklässt, ist das für die Zuschauer sowohl ein emotionaler Schock als auch ein cineastisches Seherlebnis.
Bemerkenswert an «Schleppzug M17» sind nicht zuletzt die Umstände der Produktion wie der Erstaufführung. Der Film war bereits im Herbst 1932 fertiggestellt worden, also noch in der Weimarer Republik. In die Kinos kam er aber erst im April 1933, im noch jungen «Dritten Reich». Die Uraufführung fand zweieinhalb Monate nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler statt, als die Terror- und Gleichschaltungsmaßnahmen der Nationalsozialisten bereits begonnen hatten. In gewisser Hinsicht war der Film ein ideologisches Spiegelbild der Zeitenwende, die viel mehr krisenhafter Übergang war als plötzlicher Bruch. Das dramaturgische Prinzip des Films beruhte auf der Konstruktion von Gegensätzen, von Wasser und Land, Tag und Nacht, Licht und Schatten, Ehrlichkeit und Verdorbenheit, Massenmensch und Familienmensch. Die Unversöhnlichkeit dieser Gegensätze zeigte sich am deutlichsten im Kontrast von Land und Stadt, der gleichbedeutend ist mit dem von Frau und Mann. In Gestalt Geschas und des Halbweltmilieus, dem sie entstammt, erscheint Berlin als zwielichtiges, oberflächliches, sittenloses, vergnügungssüchtiges und kriminelles Sündenbabel. Beinahe gelingt es dem Großstadtvamp, die kernige Männlichkeit der ländlichen Hauptfigur wie sein einfaches, ehrliches Schifferleben zur Strecke zu bringen. Am Ende kommt jedoch alles wieder in ruhiges Fahrwasser. Der Schleppkahn lässt die Verderbnis Berlins hinter sich, und die wiedervereinte Schifferfamilie gleitet in der idyllischen Flusslandschaft dem offenen Horizont entgegen. Eine Geschichte von Sünde, Läuterung und Erlösung.
Die Einfachheit des Lebens in der Provinz gegen die Dämonie der Großstadt in Stellung zu bringen war keine Erfindung des Regisseurs George oder seines Drehbuchautors Willy Döll. Die Abkehr von der im Bild der Großstadt konzentrierten kulturellen wie industriellen Moderne zugunsten eines naturgemäßen Lebens war seit der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert ein gängiger Topos deutscher Kulturkritik. Diese Kritik an der entzauberten modernen Welt besaß viele Gesichter, sie konnte politisch konservativ und reaktionär sein, grundsätzliche antimoderne Ressentiments mobilisieren und Weltuntergangsstimmungen beschwören; sie konnte aber auch fortschrittlich, ja sozialistisch-utopisch ausfallen und optimistische Vorschläge für eine bessere Zukunft machen. Die reaktionäre Sichtweise hingegen verdammte den rasenden Wandel aller Lebensverhältnisse durch die industrielle Moderne vor allem in Gestalt ihrer großstädtischen Phänomene. Mode, Jazz, Zwölftonmusik, Film, Leuchtreklame, Kaufhäuser, Kino- und Tanzpaläste, Boxkämpfe, Autorennen und andere Massenvergnügungen galten einer konservativen, vor allem einer völkisch sich radikalisierenden Kulturkritik als bloßer Schein, den es durch ein unveränderliches Wahres und Echtes zu ersetzen gelte. Volk, Nation, Heimat, Blut, Boden, Rasse, Stamm, Sippe, Gefühl, Instinkt lauteten 1933 die ideologischen Kampfparolen, die mythisch-mystisch diese Kultur mitsamt der Weimarer Republik abzuschaffen gedachten. Sollte, konnte man die Fesseln einer sowohl bedrohlichen als auch unberechenbaren und vielen abgelebt erscheinenden Zivilisation abwerfen und eine Umkehr wagen, eine Rückkehr gar in ein naturhaftes, elementares Dasein? Das war eine der grundsätzlichen weltanschaulichen Fragen, die die Zeitgenossen am Ende der Weimarer Republik in Atem hielt. Das Kinopublikum von «Schleppzug M17» wird sie sehr gut verstanden haben.
Welche Position in dieser Auseinandersetzung nahm Regisseur Heinrich George ein? In der kinematographischen Überblendung von Großstadtfeindschaft und Heimatliebe seines Films blieb das weitgehend Ansichtssache. Als Zuschauer konnte man sich über den tölpelhaften Provinzler ebenso schadenfroh amüsieren wie mit ihm Mitleid empfinden, man konnte das Erotisch-Großstädtische genießen wie verdammen, das Schifferleben als beengt wie auch als frei verstehen. Auf der Schwelle einer Zeitenwende war Georges Film ästhetisches Symptom einer Krisenzeit, die sich teils dramatisch, teils komödiantisch widerspiegelte. Dass die Großstadt dämonisch ausfiel, war allerdings unverkennbar.
Wollte Heinrich George dem Berlin der 1920er Jahre, der größten Mietskasernenstadt der Welt, der großen Hure Zeitvertreib den Rücken kehren? Friedrichstraße und Kurfürstendamm, Scala und Sportpalast, Jazz und Charleston, Revuegirls und Nachtlokalen, dem Riesensteinmeer voller Schnaps, Kokain, Opium, Straßendirnen und Lasterhöhlen? Die Stadt, in der er 1933 schon seit mehr als zehn Jahren Fuß gefasst hatte und berühmt geworden war? Die Uraufführung von «Schleppzug M17» fand am 19. April 1933 im Ufa-Palast am Zoologischen Garten statt. Die Temperatur an diesem Sonntag betrug, wie die «Vossische Zeitung» meldete, nicht mehr als sieben Grad, Nord-, Ost- und Mitteldeutschland verzeichneten Schneeschauer. Heinrich George stand im Begriff, sich zu entscheiden, wohin ihn seine Reise als Schauspielkünstler ideologisch wie politisch führen sollte. In seinem zentralen Element, dem Wasser, gab «Schleppzug M17» einen Fingerzeig. Kapitän Henner war in bestimmter Hinsicht Georges Alter Ego. Er stammte aus Pommern, von der Ostsee, dem baltisch-skandinavischen Raum galt seine ganze Zuneigung. Dort war er geboren worden, dort fühlte er sich zu Hause, dort war seine Heimat. An ihr hielt er fest, dorthin kehrte er immer wieder zurück.
Heinrich George erlebte das, was man eine glückliche Kindheit nennt. Geboren wurde er am 9. Oktober 1893 in Stettin. Die Hauptstadt der preußischen Provinz Pommern besaß einen Seehafen, der, wie die ganze Stadt, nach der Reichsgründung 1872 zunehmend an Bedeutung gewonnen hatte. Die Festungsanlagen wurden geschleift, und Stettin weitete sich aus, zählte bald an die einhundertfünfzigtausend Einwohner. Neue Stadtviertel entstanden jenseits der Wälle, die während der Gründerzeit in Boulevards umgewandelt wurden. Die Planung übernahm Georges-Eugène Haussmann, der berühmte Stadtplaner aus Paris. Stettin erblühte zu einer geschäftigen Hafen-, Handels- und Industriestadt. Die Hafenanlagen wurden verbessert und erweitert, Brücken, Eisenbahnlinien und Bahnhöfe gebaut. Um die Verbindung mit dem Hinterland und besonders mit Berlin abzusichern, wurden Kanäle gegraben. Stettin hatte internationales Gepräge durch den Hafen, an den Kais lagen Frachtschiffe aus dem gesamten skandinavischen Raum, Passagierschiffe bedienten Ziele an der Ost- und Nordsee, aber auch in Übersee. An alte Zeiten erinnerte ein mittelalterlicher Kern, ein trutziges Schloss im Renaissancestil, das Stadt und Hafen überragte. Das war die Welt, in der Heinrich George aufwuchs, eine geschäftige Stadt am Haff, erfüllt von Fern- und Heimweh und der Ahnung salziger Meeresluft.
Heinrich George wurde in der Burscherstraße 50 geboren, in einem erst nach der Reichsgründung entstandenen Viertel, nicht weit vom sogenannten Berliner Tor. Die schnurgerade Straße wurde von Mietskasernen gesäumt, die denen in Berlin ähnelten. Von einem Heinrich George konnte damals aber noch nicht die Rede sein: Er kam als Georg August Friedrich Hermann Schulz zur Welt, als erstes von sechs Geschwistern, drei Brüder und zwei Schwestern sollten folgen. Die Mutter Anna Auguste Wilhelmine, geborene Glander, stammte aus der bäuerlichen Kleinstadt Altdamm südlich von Stettin, der Vater August Friedrich Schulz, in Ostpreußen geboren, war ursprünglich Deckoffizier der Handelsmarine, eine Funktion, die eher einem Maat als einem Offizier glich. Seiner Frau zuliebe hatte August Friedrich abgemustert und war Steuerbeamter geworden. Georg Schulz’ Spitzname als Kind lautete Orcher, eine Verballhornung von Georg. Das war eine kehlige, raue, urtümliche Lautfolge, in der Land und Meer zusammenzufließen schienen, und die auch später noch gut zu seiner massigen Gestalt passte.
An seine glückliche Kindheit erinnerte sich Heinrich George Jahrzehnte später, als er 1941 in einem Sammelband mit Schauspielerbiographien selbst von seinem Werdegang berichtete. Einen Großteil ihrer Zeit hätten die Kinder der Familie Schulz im Sommer nicht in der Stadt verbracht, sondern in Altdamm, wo die Mutter herstammte, im Unteren Odertal, ein Delta aus Inseln und Flussarmen. «Der Vater hatte dort zusammen mit einem älteren Kameraden von der Marine, einem Onkel von mir, einen bäuerlichen Hof gepachtet, und während wir uns rauften, jagten und spielten, saßen die beiden Freunde am Flußufer und angelten.»[1]
Als Georg weiter heranwuchs, ging es weniger romantisch-idyllisch zu. Schon früh entdeckte der Junge, der gerne im Mittelpunkt stand, seine Theaterleidenschaft. Vater August war mit dieser Neigung aber nicht einverstanden, die Mutter hingegen förderte sie. «Daheim veranstalteten wir häufig Kindervorstellungen, die von der Mutter, die selbst eine Vorliebe für das Theater hatte, lebhaft gefördert wurden, indem sie beispielsweise Kostüme nähte. Das Publikum bildeten Verwandte, Freunde und Bekannte, von denen wir zwei oder drei Pfennig Eintrittsgeld erhoben.»[2] Begeisterung für Verkleidung und Verwandlung finden sich auch bei anderen Kindern, der zukünftige Schauspielstar Heinrich George wusste aber eine beeindruckende Urszene zu berichten. Eines Tages besuchte der kleine Orcher gemeinsam mit der Mutter eine Kindervorstellung des Stettiner Bellevue-Theaters, sein erster Bühneneindruck überhaupt. Auf dem Programm stand Grimms Märchen vom «Rumpelstilzchen». Fast wäre er eingeschlafen, berichtet George, aber beim Tanz des Kobolds –«Ach, wie gut, dass niemand weiß …»–sei er, der etwa Vierjährige, plötzlich auf die Bühne gesprungen. «Da tauchte eine Hexe auf», so die Erinnerung, «furchterregend aufgemacht, mit Vollbart und wirren Kopfhaaren, die auf dem Besen umherfuhr … Im selben Augenblick war ich auch schon von meinem Platz verschwunden, kletterte auf die Bühne, klammerte mich an den Hexenbesen und machte diese und auch die folgenden Szenen mit.»[3] Fast noch dramatischer klingt die Begebenheit bei Berta Drews in ihrem am Ende der 1950er Jahre erschienenen Erinnerungsbuch über Heinrich George. Dieser sei hinter dem Darsteller des Rumpelstilzchens schreiend und wild gestikulierend hergerannt, bis ihn der im Theater wachhabende Feuerwehrmann zu seiner Mutter zurückbrachte.[4] Das sei wohl, räsoniert Heinrich George 1941, der Beginn seiner Theaterleidenschaft gewesen. Den irrlichternden Irrwisch, den er bei seinem ersten Bühnenauftritt als Kind gab, hat Heinrich George später noch oft dargestellt.
Völlig erregt und erschöpft sei der kleine Junge nach diesem Erlebnis gewesen, berichtet Berta Drews. Aber er hatte Feuer gefangen. «Nun will er immer spielen», fährt sie fort, «Zwerge, Riesen, Feen. Als er größer wird und vier Geschwister die Wohnung füllen, schreibt er Stücke. Er treibt die Kleinen mit strengem Ernst an, diese mit ihm vor den Eltern und Bekannten aufzuführen.»[5] Der strenge Vater stand den schauspielerischen Ambitionen seines Sohnes, der als älterer Schüler jede Gelegenheit für Deklamationen bei Feiern und Veranstaltungen nutzte und irgendwann auch die Geige gut spielte, ablehnend gegenüber. Georgs schulische Leistungen waren offenbar wenig beeindruckend. Um seinem Ältesten zum Abitur zu verhelfen, schickte der Vater ihn nach Berlin-Spandau zu Verwandten. Keine gute Idee, denn hier, quasi in der Hauptstadt, entwickelte sich die Theaterbegeisterung des halbwüchsigen Georg zur wahren Bühnensucht. Der Theaterteufel nahm ihn gänzlich in Besitz. Er wurde Claqueur der Königlichen Theater, lachte und applaudierte gegen Bezahlung an verabredeten Stellen und verdingte sich auch als Statist. Gerne besuchte er das Metropol-Theater, den heutigen Admiralspalast, Heimstätte der leichten Muse, direkt am Bahnhof Friedrichstraße mitten im brodelnden Berlin der Vorkriegszeit, das damals bereits über zwei Millionen Einwohner zählte. Dem aufregenden Großstadtleben mit seinen Verführungen nicht abgeneigt, vernachlässigte Georg Schulz die Schule und gab sich nicht nur dem Theater, sondern offenbar auch den Frauen hin.
Als Orcher eines Morgens vom überreichen Genuss der Berliner Theaterluft erschöpft in sein Zimmer zurückkehrte, erwartete ihn dort mit bedrohlichem Schweigen sein Vater. Weil er vergessen hatte, das Schulgeld zu bezahlen und der Vater eine Mahnung erhielt, war sein Lotterleben aufgeflogen. Damit endeten vorerst die hauptstädtischen Eskapaden des jungen Mannes. Vater August brachte ihn auf der Stelle zurück nach Stettin und verfrachtete ihn als Hilfsschreiber in die Stadtverwaltung.
Von seinem Wunsch, zur Bühne zu gehen, ließ George dennoch nicht ab. Heimlich nahm der nunmehrige Hilfsschreiber nach der Büroarbeit Schauspielunterricht. Sein Lehrer war Bernhard Majewski, der bekannteste Schauspieler Stettins. Wegen der ausgedehnten Abende mit Majewski schlief Georg am Schreibpult seines Büros häufig ein, und nach zwei Monaten war er seine Stelle wieder los. Irgendwann legten sein Schauspiellehrer und sogar der Pfarrer, der viel von dem darstellerisch begabten Sechzehnjährigen hielt, bei dem strengen Vater ein Wort für ihn ein. Und siehe da, August Schulz willigte ein, und Georg ergriff seinen Traumberuf und wurde Schauspieler. Er muss ein sehr von sich überzeugter und durchsetzungsfähiger junger Mann gewesen sein.
Von den Auseinandersetzungen, die der junge Georg mit seinem Vater wegen seines Berufswunsches führte, ist nur wenig bekannt. Berta Drews’ heitere Anekdoten lassen allerdings auf einen tiefen Konflikt schließen. Der Vater schreckte auch vor körperlichen Züchtigungen nicht zurück. Als er einmal nach einer Rezitation vergessen hatte, sich abzuschminken, berichtet der spätere Heinrich George, «verabfolgte er mir ein paar Backpfeifen und meinte: ‹So, nun brauchst du dich nicht mehr zu schminken, nun hast du rote Backen!›»[6] Offenbar entwickelte der ehemalige Deckoffizier eine tiefe Abneigung gegen die theatralischen, seiner Meinung nach offenbar wenig männlichen Verwandlungsbedürfnisse seines Sohnes.
Die Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn Schulz waren kein bloß individueller Streit innerhalb einer Familie. Vielmehr handelt es sich um einen für das wilhelminische Fin de Siècle typischen Generationenkonflikt. Vom Schreckbild der Verweiblichung verfolgt, verabscheute das männliche Leitbild dieser Epoche sentimentale Gefühle und andere Schwächlichkeiten und verlangte stattdessen Härte und Willensstärke. Einem ehemaligen Seemann wie August Schulz erschien der Beruf des Schauspielers wohl als unmännlich.[7] Von dieser Welt der wilhelminischen Väter und ihrer Männlichkeitsrituale begann sich eine Generation junger Männer im Zeichen der «Jugend», ein Schlagwort der Zeit, abzuwenden. Die Vorkriegsjahre waren eine Zeit kultureller Gärung, und der junge Georg Schulz war ein Repräsentant dieser Gärung. Die deutschsprachige Literatur der Epoche ist voll von aufbegehrenden Söhnen, die an väterlichen Autoritäten und patriarchalischen Institutionen verzweifeln. An erster Stelle der Autoritätskritik stand dabei häufig der herrschende Schulbetrieb. Schule galt von Hermann Hesse über Frank Wedekind, Thomas und Heinrich Mann bis hin zu Robert Musil und vielen anderen Schriftstellern als Unterdrückungsinstrument ersten Ranges. Im 1914 entstandenen Drama «Der Sohn» von Walter Hasenclever, am sinnfälligsten in «Vatermord» von Arnolt Bronnen, geschrieben 1915, aber erst nach dem Weltkrieg uraufgeführt, gipfelte die Seelennot der Söhne als expressionistischer Aufschrei. Die Zwangsinstitution der Schule, die Herrschaft der Väter, so die Auffassung der rebellischen Jugendgeneration, produziere Anpasser und Duckmäuser, besitze aber für individuelle, gar musische Neigungen und Vorlieben nicht das geringste Verständnis.
Mit seiner reizsamen Empfänglichkeit für äußere Eindrücke, seiner Nervosität und Sensibilität war Georg Schulz der moderne, der künstlerische Mensch, der aufbegehrende Sohn, der Wege einschlug, die in seiner Familie noch keiner eingeschlagen hatte. Ein radikaler Neuanfang, der zeigt, dass er in diesem Generationenkonflikt den Mut besaß, ästhetisches Gespür und literarische Neigung über den Selbstzwang zu einer berechenbaren bürgerlichen Karriere stellte. Wobei eine gewisse bürgerliche Sicherheit wohl auch beim Einverständnis von August Schulz mit dem Berufswunsch seines Sohnes im Spiel war, nämlich in Form eines von Bernhard Majewski ausgehandelten Vertrags, der den achtzehnjährigen Georg für den Sommer 1912 an das Stadttheater Kolberg verpflichtete.
Kolberg in Pommern, keine hundertfünfzig Kilometer nordöstlich von Stettin, gehörte neben Binz auf Rügen und Heringsdorf auf der Insel Usedom und einigen anderen Kurorten zu den beliebtesten deutschen Ostseebädern. Wen es von der Reichshauptstadt aus in den Sommerferien nicht in die Alpen oder das Riesengebirge zog, der reiste an die nur wenige Bahnstunden von Berlin entfernte Ostseeküste. Dort versammelte sich ein erholungsbedürftiges Publikum, das auf gebildete Unterhaltung nicht verzichten wollte, sich aber während des Kururlaubs auch gerne an der leichten Muse erfreute. Für einen Anfänger auf den Brettern, die die Welt bedeuten, war das genau die richtige Mischung. Hier konnte er sein Talent gelegentlich tragisch, meist aber komödiantisch erproben. Das Gehalt war mäßig, deshalb war Einfallsreichtum gefragt, zum einen, um den kargen Lohn aufzubessern, zum anderen ganz grundsätzlich. Denn sich einen Namen zu machen war für einen ehrgeizigen Schauspieler auch wortwörtlich wichtig: Als Georg Schulz aufzutreten machte nicht viel her, solch einen Namen behielt niemand im Gedächtnis. Darauf aber kam es an, wenn die Provinz die Vorschule für die höheren Weihen der Schauspielkunst sein sollte. Also wurde aus Georg Schulz–nein, noch nicht Heinrich, sondern zunächst Heinz George. Das klang fast unverwechselbar und außerdem ziemlich modern. Heinz George spielte nicht nur alles, was ihm angeboten wurde, er half auch als Geiger an Operettenabenden aus und hatte inzwischen gelernt, die Laute zu spielen. Mit ihr verdiente er sich als Bänkelsänger hin und wieder ein paar Mark dazu.
In Kolberg gelang es dem jungen George, sich vom Einfluss seines Vaters zu emanzipieren. Als er am Morgen nach seiner Ankunft in seiner billigen Schlafstatt aufwachte, las er auf der Tapete den Namen Adalbert Matkowsky, königlich-preußischer Hofschauspieler am Berliner Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Matkowsky hatte sich hier mit seiner Unterschrift verewigt. Dass der berühmte Mime seine Laufbahn ebenfalls in Kolberg begonnen hatte, sah George als Omen. Er lief zum Strand, dort brüllte er Wind, Meer und dem Geschrei der Möwen all die Monologe entgegen, die ihm sein Stettiner Schauspiellehrer beigebracht hatte. Später habe er, berichtet George, eine Regieanweisung Schillers für die Figur des Roller in den «Räubern» allzu penibel befolgt. Vor seinem Auftritt sei er zur Ostsee gelaufen, dort ins Wasser getaucht und dann flugs zur Bühne zurückgeeilt, um dort, wie von Schiller gefordert, triefend nass zu erscheinen. Allerdings habe er dann vor Aufregung seinen Text vergessen gehabt. Zur Gewohnheit wurde es ihm jedoch, auf der Mole, gegen das Meer gewendet, im Wettkampf mit der Brandung sein Organ zu stärken und seine Stimme zu üben. Das Kurbad an der Ostseeküste war für den jungen Mann ein Ort der Befreiung.
Dass der junge Schauspieler sein erstes Engagement am Kolberger Stadttheater erhielt, erwies sich als schicksalsträchtiger Zufall. Wenn der Ostseeraum eine Grundströmung in Georges Leben war, so wurde Kolberg ein Leitmotiv. Mit Kolberg begann seine Karriere, mit «Kolberg», dem Film, endete sie mehr als dreißig Jahre später. Dazwischen lag ein bewegtes, hochdramatisches Leben. Kommt noch hinzu, dass der Bühnenneuling in seinem ersten Engagement in Kolberg auch noch in dem Drama «Colberg» auftrat. Dessen Schöpfer, der Schriftsteller Paul Heyse, in Berlin geboren, in München zum Dichterfürsten avanciert, war einer der großen Erfolgsautoren der Kaiserzeit, 1910 erhielt er den Literatur-Nobelpreis. Sein Schauspiel «Colberg» war bereits 1863 erschienen. Darin hatte Heyse die erfolgreiche Verteidigung der Festung Kolberg durch die Preußen gegen französische Truppen während der Befreiungskriege im Jahr 1807 dramatisiert. Das Stück entwickelte sich zu einem der am meisten gespielten deutschen Dramen seiner Zeit. Trotz ursprünglicher Ablehnung wegen angeblich allzu demokratischer Tendenzen wurde «Colberg» allmählich systematisch für politisch-nationale Zwecke instrumentalisiert. Zwischen 1868 und 1914 erlebte das Stück hundertachtzig Druckauflagen, und zwar mit tausend Stück pro Auflage.[8] 1901 war es in den preußischen Schullehrplan aufgenommen worden. Vaterlandsliebe, Pflicht- und Ehrgefühl, Gottvertrauen, Opfer- und Hilfsbereitschaft standen im Mittelpunkt der volkspädagogischen Betrachtung, schon vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und noch mehr währenddessen.[9] Kolberg mochte ein persönlicher Schicksalsort Georges sein. Die Stadt an der pommerschen Ostseeküste war aber auch ein geschichtsmythologisches Gebilde, das tief hineinführte in einen nationalen Gefühlskomplex der Deutschen.
Von Kolberg wechselte George an das Stadttheater in Bromberg–eine hübsche, preußisch-wilhelminische Stadt mit einer polnischen Minderheit in der Provinz Posen. Der Sommer 1913 führte ihn nach Kudowa im äußersten südöstlichen Zipfel des Deutschen Reiches im Glatzer Dreieck, nicht weit von der böhmischen Grenze. Ein kleiner Ort, zugleich ein aufstrebendes Kurbad mit drei Heilquellen und einer höchst modernen Kuranlage. Hier blieb George nur zwei Monate, es war ein Gastspiel, mit dem er auch in den Theaterferien Geld verdiente. Im Oktober wechselte er, ein erster Karrieresprung, an das Großherzogliche Theater in Neustrelitz. Die barocke Residenzstadt nördlich von Berlin und etwa gleich weit entfernt von Stettin mit Schloss, Palais, Schlosskirche, Park und Orangerie bot auch das Mecklenburgisch-Strelitzsche Hoftheater, das war eine Adresse. «Vor zwei Stunden bekam ich die Bestätigung vom Hofmarschallamt», verkündete George stolz in einem Brief noch aus Bromberg an seine Familie, «unterzeichnet vom Freiherrn v.Maltzahn, dass der Herzog mein Engagement billigt.»[10]
Die Spielpläne der Bühnen, an denen George in den knapp drei Vorkriegsjahren auftrat, unterschieden sich nicht wesentlich voneinander. Man gab Lustspiele, historische, oft stark patriotische Dramen sowie Volksstücke, verfasst von damals viel gespielten Schriftstellern, deren Namen heute längst vergessen sind. Heinrich George spielte in Operetten von Franz Lehár und Johann Strauß und trat in den großen Erfolgsstücken der Zeit auf, an erster Stelle in «Alt-Heidelberg», einem der meistgespielten Stücke in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, gefolgt von «Im weißen Rössl», damals noch kein Sing-, sondern ein Lustspiel, das nach seiner Uraufführung 1896 seinen Siegeszug antrat. Gelegentlich gab es Klassiker, Lessing, Schiller oder Goethe, seltener, aber erstaunlich genug, sogar Gerhart Hauptmanns «Fuhrmann Henschel» oder Maxim Gorkis «Nachtasyl». George hat diese Zeit des Tingelns in der Provinz nie bereut, sondern als unersetzliche und für jeden Schauspieler notwendige Erfahrung gerühmt. Etwa 1936, längst ein Star, trat er in einem Zeitungsartikel mit dem Titel «Ein Wort an die jungen Schauspieler» mahnend an den Nachwuchs heran: «Es fehlen die Jahre des Zweifels, es fehlen die Jahre, in denen das Leben streng ist. Kurz und gut, die alten Schmierenbühnen gehen ab.»[11] Er selbst hat die Schmiere bis zur Neige ausgekostet, er wollte nichts weiter als auf der Bühne stehen und spielen, Abend für Abend, egal, unter welchen Bedingungen, egal, was, Hauptsache spielen.
In Neustrelitz blieb Heinz George bis 1914, seine letzte Premiere hatte er dort Ende April. Anschließend sollte er, wie im Jahr zuvor, wieder in Bad Kudowa auftreten. Daraus aber wurde nichts. Der lange Sommer des Friedens neigte sich dem Ende zu, alles wurde anders. In Europa, in Deutschland, auch im Leben des Schauspielers Heinz George wurde durch den Großen Krieg alles von Grund auf umgestürzt.
Zweites KapitelAls Freiwilliger im großen Nervenkrieg
Am 17. Februar 1918, der Erste Weltkrieg war in sein letztes Stadium eingetreten, schreibt Dr. Max Alberty, Direktor des Albert-Theaters in Dresden, einen Brief an seinen Kollegen Karl Zeiss, Generalintendant des Schauspielhauses in Frankfurt am Main. Handschriftlich sei sein Schreiben deshalb verfasst, teilt Alberty mit, weil er den Inhalt keiner Schreibkraft von «zweifelhafter Diskretion» anvertrauen wolle. Alleiniger Gegenstand ist «Heinz George», zu diesem Zeitpunkt seit etwa einem dreiviertel Jahr in Dresden engagiert. Es geht um Georges Wechsel von der Dresdner Bühne an das Frankfurter Schauspiel. Alberty gibt den Schauspieler frei, empfiehlt ihn, betont mehrfach, es handele sich um ein «ganz exzeptionelles, seltenes Talent, das eine große Zukunft vor sich hat, wenn–darauf komme ich noch». Der Rest der in kleiner Schrift dicht beschriebenen drei Seiten ist genau genommen eine Warnung. Die will der Absender allerdings nicht so nennen, handele es sich doch bei dem Schauspieler George um ein ganz «warmes Theaterblut». Er sei aber auch, und nun kommt es, «ein so überaus disziplinloser Mensch», «ein zuchtloses Mitglied» des Ensembles, unter dessen «Tyrannis» alle Mitarbeiter zu leiden hätten. Voraussetzung für den zukünftigen Erfolg des brillant Begabten, fährt Alberty fort, sei dessen Wille, «sich einem Organismus einzugliedern» und «seine schlimmen menschlichen Fehler» abzustreifen.[1] Der Absender vermittelt den Eindruck, als sei er nicht unglücklich darüber, diesen künstlerischen Rohdiamanten loszuwerden, auf dass er anderswo zu einem funkelnden Schmuckstück geschliffen werde.
In Frankfurt bezog George unweit der Kaiserstraße zwischen Hauptbahnhof und Main eine Wohnung, die bald ein legendärer Ort war. Elbestraße 9, liest man bei Berta Drews, war «ein Zauberwort für jeden, der hier Premieren mitfeiern, Proben miterleben, mitreden, streiten, lieben, hassen und trinken konnte! Schlüsselwort für stummes Entzücken oder Entsetzen. Spärlich, dafür mit verwegener Phantasie möbliert, wird dies eins der gastfreiesten Häuser der Stadt. Es ist Werdezeit, welche die guten Bürger erschreckt und die künstlerisch gebannte Jugend begeistert. Diese wilden Nächte formen den großen Schauspieler Heinrich George. Er wird breit, er wird stark. Das von der Natur großflächig geplante Gesicht erhält seine Fülle und Prägung. Der breite Schädel, mit der mächtig gebuckelten Stirn, die weit auseinanderliegenden Augen, die fleischige breite Nase, der volllippige, genießerische Mund. Jetzt stimmt alles.»[2]
Eine fulminante Schilderung. Dass alles bereits stimmte, traf allerdings nicht zu. Häufig stimmte überhaupt nichts. Nimmt man die Erinnerungen von Zeitgenossen, die mit George befreundet oder ihm wohlgesinnt waren, für bare Münze, dann scheint der Mittzwanziger in Frankfurt vor allem das Leben eines Bohemiens par excellence geführt zu haben. Ein seltsamer Kauz, dieser damals noch weitgehend unbekannte, aufstrebende Schauspieler, Marotten ohne Ende, dennoch liebenswert, ein künstlerisch begabter Antibürger, wie ihn sich der Bürger vorstellt.
Ende 1919 kam es jedoch zur ersten ernsthaften Frankfurter Krise, die sich bis 1921 hinziehen und im Zwist enden sollte. Georges Disziplinlosigkeit, vor der Max Alberty gewarnt hatte, wurde in dieser Zeit offensichtlich. Obwohl finanziell notorisch klamm, gab er sein Geld mit vollen Händen für Feste und Getränke aus, Rechnungen dagegen wurden, auch dies war bald notorisch, erst nach zahllosen Mahnungen am Ende durch Pfändung des Gehaltes beglichen. So musste Hugo Erfurth in Dresden, einer der bedeutendsten Theater- und Porträtfotografen, für ein Lichtbild von George mehrfach den Betrag von 112,50 Reichsmark anmahnen. Um den leidigen Vorgang abzuschließen, erklärte das Frankfurter Schauspiel brieflich an Erfurth, der Schuldner habe sich bereit erklärt, die Summe in zwei monatlichen Raten «durch Abzug an seiner Gage» zu tilgen.[3] Den Ansprüchen seiner Gläubiger schien sich George auch durch häufigen Wohnungswechsel zu entziehen, weshalb sich die Anwälte jeweils an die Intendanz des Frankfurter Schauspiels wandten. Dieser schuldete George noch lange nach seinem dortigen Engagement Tausende von Reichsmark, Vorschüsse, die er nie abgearbeitet oder zurückgezahlt hatte.[4] Mindestens so gravierend wie diese, vorsichtig gesagt, finanzielle Unzuverlässigkeit waren andere Verhaltensweisen Georges, die den Spielplan des Theaters und seine Karriere zu gefährden drohten.
Mitte Dezember 1919, zwei Wochen vor der Premiere von Shakespeares «Maß für Maß», in der George die tragende Rolle des Angelo übernommen hatte, blieb er der Probe ohne Angabe von Gründen fern. Die Intendanz äußerte in einem Schreiben an George ihr Missfallen, forderte eine schriftliche Erklärung und fürchtete, dass die Premiere vor Weihnachten nicht mehr stattfinden könne.[5] In den Wochen nach dieser Entgleisung kam es zu einer ganzen Kette von Vorfällen. Unter anderem blieb George Anfang Februar 1920 der Vorstellung von Oskar Kokoschkas «Orpheus und Eurydike» im Neuen Theater fern, die Theaterleitung wurde erst eineinhalb Stunden vor Aufführungsbeginn in Kenntnis gesetzt. Als Ersatzvorstellung musste Walter Hasenclevers «Antigone» ins Programm genommen werden. Beim kurzfristig informierten Publikum, größtenteils Abonnenten, war der Unmut darüber groß, dass man innerhalb kurzer Zeit dieselbe Inszenierung noch einmal vorgesetzt bekam. Die Gäste wollten Ersatzansprüche geltend machen, wurden aber mit der Begründung zurückgewiesen, das Theater habe «doch den meisten Schaden an der Änderung». Über Georges Fernbleiben in der Kokoschka-Inszenierung urteilte das Publikum laut Schauspieldirektion: «Der Herr ist jedenfalls wieder betrunken.»[6]
Der Schaden war groß, und er wurde noch größer. Denn nun forderte der «Angestellten Ausschuss des Solopersonals Schauspielhaus» in einer «Resolution» die sofortige Suspendierung Georges «wegen seiner fortgesetzten Verstösse gegen die Disciplin und Würde unseres Standes». Eine probeweise Wiederaufnahme in das Ensemble sei möglich, falls er sich zu einer ärztlichen Behandlung «in eine entsprechende Anstalt» begebe. Diese Chance gewährte der Ausschuss, da er der Ansicht war, bei George handele es sich um einen Kriegsbeschädigten, dessen Verstöße die Folge «seines krankhaften Nervenzustandes» seien.[7] Um Georges Erkrankung belegen zu können, forderte der Angestellten-Ausschuss in einem Schreiben an den Generalintendanten Karl Zeiss, sich an die zuständige amtliche Stelle zu wenden und «einen Stammrollen-Auszug zu erbitten». Man wollte Einblick in das amtliche Verzeichnis aller Einsätze sowie Truppenteile erhalten. Stammrollen wurden über jeden Kriegsteilnehmer angelegt, also auch über George.
Weil die Stammrolle die Vermutungen hinreichend bestätigte, wurde George für die nächsten acht Wochen in die «Frankfurter Kuranstalt Hohemark bei Oberursel» eingewiesen. Dabei handelte es sich um eine von dem Nervenarzt Prof. Dr. Friedländer gegründete «Privatanstalt für Nerven- und Gemüthskranke», eröffnet 1904 in landschaftlich schöner Lage im Taunus. Die hochmoderne Klinik war vor allem für betuchte adlige Gäste aus dem In- wie Ausland geplant worden. Sie war ein luxuriöses Resort für die Reichen der Vorkriegsepoche, die an «Neurasthenie» litten, an Nervenschwäche, der häufig diagnostizierten psychischen Krankheit dieser Zeit. Die Therapie der Klinik Hohemark war nicht streng schulmedizinisch, sondern lebensreformerisch orientiert. Man gab «den natürlichen Heilfaktoren» den Vorzug, «wie sie in erster Linie die seelische Behandlung, dann aber die Heilkräfte von Luft, Sonne, Licht, Wasser, endlich die richtige Ernährung darstellen». Hydro- und Elektrotherapien, medikamentöse Bäder, Massage, Luft- und Sonnenbäder, «Diät-, Terrain-, Mast und Entfettungskuren» gehörten zur Palette der Kurmittel, ergänzt durch Arbeitstherapie und Sportangebote.[8] Als in Folge des Ersten Weltkriegs der zahlungskräftige Hochadel ausblieb, übernahm 1918 die Stadt Frankfurt die Klinik, die nun einem mittelständischen Bürgertum offenstand.
Mochten die Gäste 1920 nicht mehr von edlem Geblüt sein, der von Dr. Friedländer gepriesene «elegante Landhausstil» war unverändert, die Annehmlichkeiten eines Billardraumes, einer Lufthütte, eines Bassinbades sowie eines Speisesaals im Jugendstil dürften weiter vorhanden gewesen sein. George wird also einen von Zwängen freien, angenehmen Kuraufenthalt verbracht haben. In welchem der einzelnen Gebäude er untergebracht war, ob in der Villa Mathilde, Wahnfried oder Helene, ist nicht bekannt. Bekannt sind aber sowohl Diagnose als auch Ursache seines Leidens. Am 19. Januar 1920 erhielt die Frankfurter General-Intendanz von Georges behandelndem Arzt Dr. Dreyfus die Nachricht, Heinrich George leide «an einer nervösen Erkrankung, welche durch die Strapazen und Erlebnisse des Krieges (Verschüttung) eine Verschlimmerung erfahren hat».[9] In den folgenden Wochen wurde von ärztlicher Seite wie von George selbst aufgrund merklicher Besserung seiner Gesundheit mehrmals eine Rückkehr auf die Bühne angekündigt, dann allerdings wieder zurückgenommen.
Anfang März kehrte George an das Frankfurter Schauspiel zurück. Und bald gab er sich lieber wieder dem Trunk hin, anstatt in den Proben zu erscheinen. Im Oktober des Jahres empfahl Dr. Fritz Kalberlah, ein Spezialarzt für Nervenkranke, der George bereits in Hohemark behandelt hatte, einen abermaligen Urlaub wegen «nervösen Überreizungs- und Erschöpfungszustandes».[10] George hatte allerdings auch die Nerven der Intendanz wie der Mitarbeiter des Schauspiels aufs Äußerste durch seine Eskapaden strapaziert. Wie sich jetzt herausstellte, besaß er darüber hinaus die Chuzpe, mit dem Direktor des Deutschen Theaters in Berlin einen von September 1920 an gültigen Fünfjahresvertrag abzuschließen. Das war bereits im März des Jahres geschehen, als er noch Patient in Hohemark war, obwohl sein Vertrag in Frankfurt ihn noch für weitere zweieinhalb Jahre verpflichtete. George lenkte nach langem Streit zwischen den beiden Theaterleitungen ein, nicht ohne den Frankfurtern vorzuwerfen, sie hätten ihm mit ihrem Beharren schwer geschadet. Tatsächlich hatte man auf seine Nervenkrankheit Rücksicht genommen und sich ihm gegenüber äußerst kulant gezeigt. Obwohl er weiterhin in Frankfurt spielte, trat er auch in Berlin auf, unter anderem an Max Reinhardts Großem Schauspielhaus im «Jedermann». Die Rolle des Mammon hatte er bereits in Salzburg gespielt. Sein Frankfurter Arbeitgeber hatte sich als konziliant erwiesen und ihn für Gastrollen freigegeben.
Gedankt hat George dem Frankfurter Schauspiel diese Großzügigkeit allerdings nicht. Als er im März des folgenden Jahres abermals vertragsbrüchig wurde und in Darmstadt bei Gustav Hartung auftrat, einem der aufstrebenden, modernen Regisseure der Zeit, war nicht nur in Frankfurt, sondern in ganz Deutschland Schluss für ihn. Die Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger untersagte ihm weitere Auftritte. Die Folge: Heinrich George ging nach Wien und spielte in zwei Inszenierungen am Burgtheater. Ein Abgang mit Aplomb, den er noch kurz vor dem Vertragsbruch mit einem Tobsuchtsanfall samt anschließender Ohnmacht mitten im Schauspielhaus würzte.
Jahrgang 1893, war Heinrich George ein Vertreter der jungen Frontgeneration, der jungen Männer, die zwischen 1890 und 1900 geboren worden waren. Als er sich Ende August 1914 in Stettin als Kriegsfreiwilliger meldete, war er noch keine einundzwanzig Jahre alt. Eine gewisse Kriegsbegeisterung kann man also bei ihm annehmen. Dem jungen Schauspieler, der in seiner Stammrolle noch als Georg Schulz geführt wurde, dürfte es nicht anders ergangen sein als vielen seiner Generationsgenossen, die sich vom Waffengang «Reinigung, Befreiung» erhofften. So hatte es im November 1914 der fast zwanzig Jahre ältere Thomas Mann formuliert. Damit hatte er den Nerv all derjenigen getroffen, die ihrer Epoche überdrüssig waren, der Wollust des Untergangs frönten, ein heilsgeschichtliches Ende ersehnten oder in nationalistische Kriegsbegeisterung ausbrachen. Die Realität sah anders aus. Hunderttausende von Männern starben in Trommelfeuer, Sturmangriff und Grabenkrieg, Blutbad statt Reinigung.
Bei keiner Generation hinterließen die Materialschlachten des Ersten Weltkriegs so tiefe, nie wieder verschwindende Spuren psychischer Verletzungen wie bei derjenigen des jungen George. Diese jungen Männer mit ihren achtzehn, neunzehn oder zwanzig Jahren hatten nur wenig Lebenserfahrung. Ihre jugendliche Eindrucksfähigkeit, ihr Erlebniswille war groß und aufnahmebereit, aber sie waren unfertig und ungeschützt. Noch bevor die Theaterbühne für den jungen George zur prägenden Erfahrung werden konnte, waren es die Furcht und der Schrecken des Krieges, war es sein Fronterlebnis. In der Unschuld ihrer Jugend war diese Generation gleich ins Allerschlimmste hineingeworfen «und ohne jeden Übergang durch grausamstes, größtes, brutalstes Erleben hindurch gepeitscht worden».[11] Daran zerbrachen viele.
Anhand der «Militär-Dienstbescheinigung» für Georg Schulz lassen sich Dauer und Orte seiner Frontaufenthalte ziemlich genau rekonstruieren.[12] Es sind Auszüge aus jener Stammrolle, nach der beim Frankfurter Schauspiel gefragt wurde, um sich ein Bild über die Kriegsbeschädigung des Schauspielers Heinz George zu machen.
Als er Ende August 1914 in die Armee eintrat, stand Georg Schulz kurz vor seinem einundzwanzigsten Geburtstag. Nach einer kurzen militärischen Ausbildungsphase wurde er Ende Oktober «ins Feld» geschickt, wie der damalige Sprachgebrauch lautete. Zuständig war die in Stettin stationierte 2. Feld-Pionier-Kompanie des Königlich Preußischen I. Pionier-Bataillons Nr. 2. Damals Pionier zu sein bedeutete harte Arbeit und gefährliche Einsätze. Das Schlagen von Brücken über Gewässer etwa war Aufgabe der Pioniere: Das konnten Pontonbrücken sein, die Reparatur zerstörter Brücken oder Neubauten aus Holz über unwegsame Abbrüche und Böschungen. Hinzu kam die Errichtung von Unterständen und Bunkern, das Verdrahten der Frontverläufe mit Stacheldraht, der das Vordringen des Gegners erschwerte. Von größter Bedeutung waren dabei die Sappen. Darunter verstand man oberirdische Laufwege, die mühsam gegraben wurden, um sich möglichst unbemerkt der feindlichen Front zu nähern, eine im Stellungskrieg unerlässliche Maßnahme. Hinzu kam das Verlegen von Telefonkabeln zwischen den Frontabschnitten sowie der Bau von Eisenbahndämmen, die den Nachschub sicherten. Pioniere beseitigten auch bauliche Hindernisse, die das freie Schussfeld beeinträchtigten oder der gegnerischen Artillerie Zielorientierungen gaben. Weil sie im ungeschützten Raum agierten, gerieten sie leicht unter feindliches Feuer. Pioniere galten als kaltblütig, mutig und unerschrocken–das war zumindest der Ruf, der ihnen vorauseilte.
Entsprechende Nerven schien Georg Schulz anfangs zu besitzen. Erstaunlich schnell wurde er befördert. Schon zehn Tage vor seinem ersten Einsatz war er zum Gefreiten ernannt worden, vier Wochen später zum Unteroffizier. Gleich am 20. Oktober 1914, seinem ersten Tag an der Front, erlebte er die sogenannte Feuertaufe.[13] Laut Militär-Dienstzeitbescheinigung geschah das an der Westfront in der Nähe von Noyon, einer Kleinstadt hundert Kilometer nordöstlich von Paris. Dorthin, an die Aisne, hatten sich die 1. und 2. Armee zurückgezogen, nachdem die Marneschlacht für die Deutschen verloren war und der Vormarsch im Stellungskrieg erstarrte. Wie an anderen Frontabschnitten kam es auch bei Noyon zu feindlichem Infanterie- und Artilleriefeuer und dadurch zu täglichen Verlusten an Gerät und Soldaten, aber auch an Pferden, die im Ersten Weltkrieg an allen Fronten mit dabei waren. Hindernisse in Form von Stolperdrähten, aber auch befestigte Stellungen zu errichten und sich durch Sappen näher an den oft nur hundert oder zweihundert Meter entfernten Feind heranzuschieben gehörten zum Alltag eines Pioniers wie Georg Schulz. Solche Arbeiten erledigte man oft nach Einbruch der Dunkelheit, möglichst unsichtbar für den Feind.
Die Bedingungen waren miserabel. Im November war es, wie eine zeitgenössische Quelle festhielt, «rauh, stürmisch und regnerisch. Der Boden ist vom Regen aufgeweicht. Wasser sickert und läuft in die Unterstände und Deckungsgräben des Rgts. Die flandrische Landschaft präsentiert sich mit der ganzen ihr inne wohnenden Melancholie.»[14] Es folgten Frostwetter und Schneefall, das Ausharren in den voller Wasser stehenden Gräben war eine Tortur. Trommelfeuer, egal, ob von Freund oder Feind, sorgte für nie gehörten, stundenlangen höllischen Lärm. Dieser Krieg war nicht nur ein Angriff auf Leib und Leben, sondern auch eine Attacke auf die fünf Sinne eines jedes Einzelnen. Der Tod war allgegenwärtig. Einen Schützengraben oder einen Frontabschnitt vom Feind zurückerobert zu haben bedeutete zwar militärischen Erfolg, ein kurzes Siegesgefühl, aber auch schwer erträgliche Anblicke. Sprangen die Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett in eine umkämpfte Stellung hinein, trafen sie auf zertrümmertes Gerät, zerfetzte, zerschossene, blutige Leichen, Körperteile sowie Pferdekadaver, über den Köpfen das Hämmern des Trommelfeuers. In der ersten Flandernschlacht bei Ypern im November 1914, an deren letzter Phase Georg Schulz beteiligt war, gelang es ihm, sich den englischen Scharfschützen zu entziehen. Er hätte leichte Beute sein können, Stahlhelme waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebräuchlich, die ledernen Pickelhauben boten nur wenig Schutz. Überleben war reine Glückssache. In den Kämpfen um Ypern, so der britische Historiker John Keegan, waren «im Oktober und November 24000 Briten und 50000 Deutsche gefallen».[15]
Und dann war der Spuk vorbei. Der Gefreite Schulz war nur vier Wochen an der Westfront, und er sollte dorthin nie mehr zurückkehren. Von Lille ging es für den jungen Kriegsfreiwilligen innerhalb von fünf Tagen mit der Eisenbahn über Cambrai, Saint-Quentin, Sedan, Luxemburg, Frankfurt am Main, Leipzig, Cottbus Richtung Osten bis in die Gegend um die polnische Stadt Łódź, wo mittlerweile die russische Armee lag. Der deutsche Generalstab hoffte, den Zweifrontenkrieg, in den die Mittelmächte durch den ausbleibenden schnellen Sieg im Westen geraten waren, nun durch einen alsbaldigen Sieg im Osten beenden zu können. Die Hoffnung auf solch eine schnelle Lösung war Ende 1914 noch lange nicht erschöpft. Als der Truppenteil von Georg Schulz an seinem Ziel anlangte, hieß es im Regiment: «Was wird uns dieses unwegsame und unwirtliche Land bringen; werden wir den Krieg noch vor Weihnachten beenden, das ist die allgemeine Frage!?»[16]
Langes Verharren gab es auch nach der Ankunft an der östlichen Front nicht. «Kämpfe an der Rawka» hält Georg Schulz’ Dienstzeitbescheinigung für die ersten Wochen des Jahres 1915 fest.[17] Nachdem die russischen Truppen zurückgewichen waren, Łódź kampflos geräumt und den Deutschen überlassen hatten, setzten diese ihre Truppen mit dem Fernziel, Warschau zu erobern, in Bewegung. Anfang Dezember kam es an den Flüssen Bzura und Rawka zu Kämpfen. Wenige Tage vor Weihnachten wurde das Flüsschen Rawka mittels einer provisorischen Kriegsbrücke überschritten, der für den 24. Dezember geplante Angriff gelang mit mäßigem Erfolg, am Heiligen Abend wurde Tee mit Rum ausgegeben, die Truppen gruben sich ein und arbeiteten sich in den nächsten Tagen durch Sappen an den Feind heran. Die Gräben waren voller Wasser, viele Männer wurden krank. Zwei Tage vor Silvester kam der Befehl zum Angriff auf das Dorf Humin, bis Warschau waren es von hier aus etwa sechzig Kilometer.
Eine gute Woche zuvor, einen Tag vor seinem ersten Kriegsweihnachten an der Front, hatte Georg Schulz das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhalten, am nächsten Tag war er zum Unteroffizier ernannt worden. Nicht bekannt ist, ob er sich beim Schlagen der Kriegsbrücke über die Rawka hervorgetan oder ob er taktisch wertvolle Laufgänge angelegt hatte. Was wir wissen, ist, dass die Kämpfe an der Rawka, noch bevor die eigentliche Schlacht um Humin Ende Januar 1915 begann, heftig, hart und verlustreich waren. Die deutschen Truppen standen mehrere Tage bei schlechtestem Wetter im Kampf, wichen dann aber in die alten Stellungen zurück. In der Nacht vor dem nächsten Angriff wurden Stolperdrähte und andere Hindernisse des Gegners beseitigt, die Artillerie fing zu bellen an, und unter Infanterie- und Maschinengewehrfeuer begann der Sturm auf die feindlichen Gräben. «Überall Verwundete, überall brach Deutschlands Jugend zusammen», liest man in einer der zahlreichen nach dem Krieg erschienenen Geschichten eines beteiligten Infanterie-Regiments.[18] Nach tagelangem Angreifen und Verteidigen und schweren Verlusten auf beiden Seiten wurde das Dorf Humin von den Deutschen genommen. Inzwischen war Schnee gefallen, und es herrschte «trockenes, klares Frostwetter».[19]
Dann erfolgte die nächste Verlegung mit der Eisenbahn. Wohin die Reise gehen sollte, wussten die Feldgrauen nicht. Nach mehr als sechshundert Kilometer in südlicher Richtung, bei guter Verpflegung in überfüllten und unbeheizten Abteilen, war das Ziel erreicht. Der Anblick der Karpaten konnte nur eines bedeuten: «Es galt, sich für einen Gebirgskrieg vorzubereiten.»[20] Den durchgefrorenen und übermüdeten Männern wurden «Bergstöcke, Schneebrillen, Schneereifen, Ueberhosen und zum Teil Schneeschuhe» ausgehändigt, hinzu kamen sogenannte Hindenburg-Pelzjacken, erworben durch Spendensammlungen in deutschen Großstädten. Maultiere und kräftige, kleinwüchsige Pferde trugen Munition und Verpflegung hinauf ins Gebirge. Auf jeden Soldaten vom Offizier bis zum Gemeinen warteten härteste Strapazen.
Die Winterschlacht in den Karpaten hatten die österreichisch-ungarischen Truppen im Kampf gegen russische Verbände im März 1915 verloren. Nun musste ein Durchbruch der Russen in das ungarische Tiefland verhindert werden. Ihnen sollten sich die von Süden an die Karpaten herangeführten deutschen Truppen des II. Armeekorps, die sogenannte Südarmee, entgegenstellen. Anfang März begannen die deutschen Truppen mit dem Aufstieg in ein schroffes Mittelgebirge mit zum Teil mehr als fünfzehnhundert Meter hohen Gipfeln. Auf den Höhen lagen bis zu zwei Meter Schnee, die Temperaturen erreichten stellenweise bis zu fünfundzwanzig Grad unter null. An eine durchgehende Frontlinie war unter diesen Bedingungen nicht zu denken, die Soldaten gruben sich in Schneelöcher ein und warteten auf den Angriffsbefehl. Krankheitsfälle durch Erfrierungen mehrten sich, Kranke konnten nur auf Zeltbahnen, befestigt an zwei Tragestangen, in entfernte Täler transportiert werden. Umgekehrt war es mit den größten Mühen verbunden, die gebirgigen Höhenstellungen mit Proviant zu versorgen. Oft ging die Hälfte der Lebensmittel unterwegs verloren, der Rest gefror und musste mühsam aufgetaut werden.
Kurz nach dem Anstieg auf die Passhöhe der Beskiden meldete sich Georg Schulz krank und wurde zum ersten Mal in ein Lazarett verlegt.[21] In dem Plauderbuch «Schauspieler erzählen», in dem er 1941 seinen Werdegang berichtete, beließ es der nunmehr Berühmte bei der Anmerkung, er sei «in den Beskiden verwundet» worden.[22] Anfang März 1915 war es in den Beskiden allerdings noch gar nicht zu Kampfhandlungen gekommen. Ob es sich bei dem Satz möglicherweise um einen versteckten Hinweis auf eine andere, psychische Art der Verwundung handelt, kann nur Spekulation bleiben. Um nach Galizien vorzudringen, mussten die deutschen Truppen allerdings einen von den Russen gesprengten Eisenbahntunnel durchqueren, den Beskid-Tunnel. Diesen für den Vormarsch von Fahrzeugen, Feldküchen, Lasttieren und die Truppe in voller Ausrüstung frei zu räumen, war Aufgabe der Pioniere. Erst nach einem extrem mühevollen Aufstieg bei Kälte, Eis und Schnee konnte der fast zwei Kilometer lange, nur von einigen Fackelträgern erleuchtete Tunnel passiert werden. Das war am 3. März 1915. Am nächsten Tag befand sich George im Lazarett. Gab es hier einen Zwischenfall?
Eine Verwundung beim Wegräumen von Trümmern ist denkbar, eine Schussverletzung im Kampf unwahrscheinlich. Vorstellbar wäre auch jene Verschüttung, die der Arzt Dr. Dreyfus als Ursache für Georges Nervenschwäche ein paar Jahre später in Frankfurt diagnostizieren wird. Verschüttungen waren ein nicht ungewöhnliches, böses Phänomen infolge von Granateinschlägen zumeist in Unterständen. Die Überlebenden erlitten schwere Quetschungen und diverse Verletzungen durch Granatsplitter, entwickelten aber auch ebenso schwere wie lang anhaltende psychosomatische Symptome, sie halluzinierten, lebendig begraben zu sein und zu ersticken. Gravierend scheint der Anlass für den Lazarettaufenthalt Georges nicht gewesen zu sein, oder er wurde lediglich als nicht allzu schwerwiegend eingeschätzt. Schon zwei Monate später jedenfalls fand sich der wiederhergestellte Kriegsfreiwillige Schulz in Spandau zum Ausbildungskurs für Offiziersaspiranten ein. Alles also halb so schlimm? Vielleicht, aber psychische Traumata machen sich häufig nicht unmittelbar bemerkbar, sondern erst mit zeitlicher Verzögerung.
Auf den Frontsoldaten Georg Schulz stoßen wir wieder im Juli 1915. Er ist zum Vizefeldwebel ernannt worden, das Heer braucht tüchtige Unteroffiziere, viele haben bereits für Kaiser, Volk und Vaterland auf dem angeblichen Feld der Ehre ihr Leben gelassen. Anscheinend haben seine Vorgesetzten Vertrauen in ihn, aber in seine Seele hineinschauen, das können sie nicht. Vielleicht nicht einmal der Vizefeldwebel Schulz aus Stettin selbst. Vielleicht will er tapfer, unerschrocken und mutig sein, aber dieser Wille nützt ihm nichts. Er hat schon zu viel Blut, zu viele Kameraden fallen, zu viele Tote gesehen. Abgestellt zum Pionier-Ersatz-Bataillon 2, befand er sich im Herbst 1915 wieder an der Front.
Inzwischen hatte sich für die Mittelmächte die militärische Lage an der Ostfront dramatisch verbessert. Nach der Schlacht von Gorlice-Tarnow im Südosten Polens war der Weg frei, um nach Osten vorzustoßen und Galizien zurückzuerobern. Auch dem Beskidenkorps war nach einer Verstärkung der österreichisch-ungarischen Truppen der Durchbruch gelungen. Die Karpatenfront, an der alle Seiten furchtbar gelitten hatten, existierte nicht mehr. Die Russen hatten Polen, Litauen sowie einige westliche weißrussische Gebiete aufgegeben, die Deutschen waren nachgerückt und weiter nach Osten vorgestoßen. Von Mitte Oktober 1915 bis Ende Februar 1916 war der frischgebackene Vizefeldwebel Georg Schulz wieder im Kampfeinsatz. Danach kehrte er nicht mehr an die Front zurück. In diesen gut drei Monaten muss es–für ihn persönlich–zu einer entscheidenden Wende im Kriegsgeschehen gekommen sein.
Im Herbst lag er östlich von Białystok bei Slonim an der Schtschara. Was hier zu tun war, kannte er. Ein Gefecht, eine Flussüberquerung, feindlicher Artilleriebeschuss, Pontons verlegen. Bald beginnen sich die deutschen Truppen auch hier einzugraben und ihre Stellungen zu befestigen. Und dann wieder Alarm. Angriff der Russen östlich von Baranowitschi, eine sumpfige Gegend. Der Feind wird abgewehrt, am Frontverlauf ändert sich nichts, die Stellungskämpfe gehen weiter.
Baranowitschi, ein Städtchen mit fast dreißigtausend Einwohnern, davon vierzig Prozent jüdisch, war bei Kriegsbeginn Hauptquartier der Obersten Russischen Heeresleitung, geriet nach dem Großen Rückzug der Russen im Sommer 1915 aber in deutsche Hände. Im Lauf der Zeit wurde der Ort völlig den militärischen Zwecken der in der Nähe verlaufenden Front untergeordnet, die Bevölkerung transportierte man ab. Es gab eine Kommandantur, ein Soldatenheim, ein Kasino, Brausebäder, Entlausungsanstalten, es war eine richtige deutsche Garnisonsstadt. Am 11. November stattete der oberste Kriegsherr, Kaiser Wilhelm II., dem Truppenabschnitt einen Besuch ab. Zu Ehren des Kaisers traten Abordnungen aller Divisionen in Baranowitschi zur Parade an. Ein dreifaches Hurra erscholl, Wilhelm schritt die Truppen ab, verlieh Eiserne Kreuze und sprach mahnende Worte. Die Frontlinie wurde in den folgenden Wochen systematisch befestigt, es kam zu erbitterten Gefechten. Die Arbeit der Pioniere ging meist nachts vonstatten. «Die Stellung ist mit allen Schikanen ausgebaut. Elektrische Hindernisse. Erdwerke. Stollen. Viel Wald. Kuppen und Nasen. Alles schwer verdrahtet.»[23]
Das russische Artilleriefeuer während der Schanzarbeiten war heftig, wegen der gegnerischen Scharfschützen konnten sich die deutschen Soldaten nur in den Gräben aufhalten. Einsetzender Frost machte die Sumpfniederungen der Schtschara leicht passierbar. Russische Jagdkommandos–bei Nacht operierende Spezialeinheiten von etwa vierzig Mann–nutzten die Gelegenheit immer wieder zu plötzlichen Überfällen. Trotz solcher Kommandoaktionen gelang es den Russen nicht, sich am anderen Flussufer festzusetzen und Brückenköpfe zu bilden. Die Abwehrkämpfe, oft Nahkämpfe Mann gegen Mann, waren brutal und blutig. Die nächtlichen Attacken gefährdeten vor allem die Posten- und Patrouillendienste, die bei Dunkelheit, Frost und Schneefall in ständiger Alarmbereitschaft sein mussten. Erfrierungen waren an der Tagesordnung, nur Tauwetter vereitelte den Jagdkommandos den Weg durch die Sümpfe, dann beruhigte sich die Lage.
So ging es auch im neuen Jahr 1916 fort, Frost und Schneefall wechselten mit Tauwetter und anhaltendem Regen. Mitte Februar griffen die Deutschen wieder an. Die Truppen stürmten auf die gegnerischen Vorwerke zu, die Pioniere zerstörten die russischen Stellungen. Sie hatten einen Toten und viele Verwundete zu beklagen. Und dann schrieb man März 1916, und plötzlich war für den Vizefeldwebel Georg Schulz alles vorbei. Aus seiner Militär-Dienstzeitbescheinigung geht hervor, dass er fortan zwischen der Revierstube seines Ersatztruppenteils und dem Lazarett pendelte.[24] Im März 1915 war er zum ersten Mal in ein Lazarett überstellt worden, in den beiden folgenden Jahren häuften sich diese Aufenthalte. Zwischen März 1916 und Januar 1917 findet man ihn dreimal im Krankenstand, insgesamt belaufen sich seine unterschiedlich langen Lazarettaufenthalte auf mehr als sieben Monate. Mitte März 1917 wurde Georg Schulz aus dem Kriegsdienst endgültig lassen, bis dahin galt er noch als Armeeangehöriger.
Er kehrte nach Stettin zurück, wo sein Ersatztruppenteil, das Pionier-Ersatzbataillon 2, stationiert war. Das Lazarett, in das er laut «Militär-Dienstzeitbescheinigung» dreimal verlegt worden war, hieß, «Kückenmühler Anstalten», eine evangelisch-lutherische Gründung. Ursprünglich als «Anstalt für Schwachsinnige» gegründet, nahm die im Volksmund so genannte Kückenmühle am nördlichen Stettiner Stadtrand während des Krieges auch Patienten auf, die psychisch versehrt von der Front kamen.
Georg Schulz wurde nachweislich seit dem 1. März 1916 an der Front nicht mehr eingesetzt. Seine Stettiner Lazarettaufenthalte zeigen, dass er psychisch ernsthaft erkrankt war. Dass er überdies einen Vorgesetzten zu Boden geschlagen haben soll und auch deshalb in ein Lazarett verlegt wurde, ist nicht unwahrscheinlich.[25] Wutausbrüche gehören zum Krankheitsbild einer Kriegsneurose, die wir heute posttraumatische Belastungsstörung nennen. Der mutmaßliche Zwischenfall legt eine kriegstraumatische Erkrankung nahe, zumal der junge Schauspieler Heinz George bereits vor dem Krieg durch nervöse Reizbarkeit aufgefallen war.[26]
Kranken- beziehungsweise Personalakten aus den Jahren des Ersten Weltkrieges sind heute nicht mehr verfügbar.[27] Aufschlüsse geben jedoch die Jahresberichte der Kückenmühler Anstalten. Darin heißt es für die ersten beiden Kriegsjahre, dass «sofort nach der Mobilmachung der Heeresverwaltung 30 Plätze für geisteskranke Offiziere und Soldaten zur Verfügung gestellt» worden seien. «Diese Plätze waren sehr schnell belegt. Ihre Anzahl wurde alsbald vermehrt. Gegenwärtig haben wir eins unserer Häuser als Lazarettabteilung eingerichtet, welches fast dauernd mit mehr als 70 Soldaten belegt ist.»[28] Als George dort eintraf, begann sich die Ernährungslage auch wegen der alliierten Seeblockade im Lauf des Jahres 1916 dramatisch zu verschlechtern. Die Anzahl der Todesfälle stieg gegenüber den Vorkriegsjahren erheblich. Zudem nahm die Zahl der Lazarettkranken bis Kriegsende zu, zeitweise befanden sich «bis 400 lungenkranke, nervenkranke, geisteskranke usw. Soldaten in den hiesigen Anstalten».[29] Nicht allein die Ernährungslage war katastrophal, auch die Therapiemöglichkeiten waren erheblich eingeschränkt. Ein Großteil des ärztlichen wie pflegerischen Personals befand sich an der Front. Keiner der drei Aufenthalte in Kückenmühle konnte demnach für George in irgendeiner Weise komfortabel verlaufen, die Versorgung der Kranken fand unter miserablen Bedingungen statt.
Nervenkranke Soldaten waren an allen Fronten des Ersten Weltkriegs ein auffälliges Phänomen. «Shell shock» nannte es die britische Seite, und ähnlich wie der «Kriegszitterer», «Kriegshysteriker» oder «Kriegsneurotiker» bei den Mittelmächten entwickelte sich der «Granatschock» im Nachhinein zum Symbol für die Grausamkeit eines Krieges, der nicht allein etwa zehn Millionen Soldaten das Leben kostete und fast ebenso viele körperlich Versehrte hinterließ, sondern auch immense psychische Zerstörungen bewirkte. In der «Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie» sammelte etwa der deutsche Psychiater Karl Birnbaum zwischen 1915 und 1921 eine Fülle an Fallbeispielen–ein wahres Schreckensszenario kriegsbedingter psychischer Krankheiten. Im September 1918 beschäftigte sich der fünfte Internationale Psychoanalytische Kongress in Budapest mit dem Phänomen der Kriegsneurose, an der Spitze Sigmund Freud. In seinem Vortrag stellte der Begründer der Psychoanalyse eine Bewusstseinsspaltung des Kriegsneurotikers zur Debatte. Einem am friedlichen Leben festhaltenden alten Ich stehe, so Freud, ein neues kriegerisches Ich gegenüber, das den militärischen Anforderungen genügen wolle, aber dadurch das alte Ich zwangsläufig in Lebensgefahr bringe. Solch ein Konflikt zwischen verinnerlichter militärischer Disziplin und abwehrendem Überlebenswillen sei nur durch Flucht in die traumatische Neurose als letzter Selbstschutz zu lösen.
War das der Konflikt, der auch im Vizefeldwebel Georg Schulz tobte? Gut vorstellbar ist, dass sich eine eventuelle Verschüttung oder Verletzung in den Beskiden erst nach einer Verzögerung und in den anschließenden Stellungskämpfen bei Baranowitschi traumatisierend ausgewirkt hat. Dort war er noch der gute Kamerad und «Komiker», wie ihn seine Kameraden seines Berufes wegen bezeichneten, der gerne trank und für Unterhaltung sorgte. Der Pontonbau unter Artilleriefeuer, womöglich erst recht die Mann-zu-Mann-Kämpfe dort waren jedoch wahrscheinliche Auslöser für eine fundamentale Nervenkrise. Berta Drews sprach in ihren Erinnerungen davon, dass «der erste bewußte Schuß auf den Gegner» bei «Baranovice», Anfang 1916 also, Georges Nervenkrise ausgelöst habe.[30] Damit war er als Frontsoldat gescheitert. Georg Schulz alias Heinz George war aber weder Feigling noch Held, weder Simulant noch Irrsinniger. Er war ein empfindsamer junger Mann, der den Schrecken des Krieges wie so viele andere nicht gewachsen war. Traumatisiert, innerlich verletzt, kehrte er in seinen Beruf zurück.
Drittes KapitelBoheme und Expressionismus–endlich wieder auf der Bühne
Der Weg vom Militär zum Theater, vom Lazarett auf die Bühne verlief für Heinz George erstaunlich direkt. «Ich selbst habe George», schreibt Max Alberty, Direktor des Albert-Theaters in Dresden in dem erwähnten Brief an seinen Frankfurter Kollegen Karl Zeiss, «den ich zufällig in Stettin im Caféhaus in Uniform kennenlernte, hierher gebracht, weil ich ein starkes Talent, bloß aus unserem Gespräch heraus, hinter ihm vermutete.»[1] Diesem ersten Eindruck sollte George in seiner gesamten Dresdner Zeit entsprechen. Es blieb nur ein knappes Jahr in Dresden, vom Mai 1917 bis zum April 1918. Den vorherigen Hungerwinter hatte er noch in Stettin überstanden. Mitten im Krieg tat er diesen wichtigen Karriereschritt. Nach seinen zermürbenden Front- wie Lazarettaufenthalten suchte er Orientierung, bedurfte er vor allem der Selbstfindung, als Mensch wie auch als Schauspieler. Allerdings zeigte er in Dresden bizarre Verhaltensauffälligkeiten. George soll im Wipfel eines Baumes mit Käuzchenrufen und röhrendem Brunftgeschrei einer angebeteten Kollegin nachgestellt haben, diverse Liebeleien angefangen, Hausfassaden emporgeklettert und in fremden Betten geschlafen, dabei junge Frauen zu Tode erschreckt und sich beim Hinauswurf Siegestrophäen unter den Nagel gerissen haben.[2] Dresden amüsierte sich über den komischen Vogel, der auf der Bühne zu beeindrucken wusste. «Aufbruch, Überschwang, aber auch gefährliche Exaltiertheit!», konstatiert Berta Drews, denn: «Er hat eine schlimme Gewohnheit aus dem Krieg behalten: Er trinkt.»[3] Der Irrwisch aus den Kinderjahren kehrte in Dresden in weitaus drastischerer Gestalt wieder, als Bürger- und Jungmädchenschreck.
In Wahrheit hatte der jetzt dreiundzwanzigjährige Heinz George das Lazarett nicht gänzlich hinter sich gelassen. Er ließ sich im Stadtteil Weißer Hirsch jenseits der Elbe nieder. Das schöne Gebiet am Elbhang war wegen der Vielzahl seiner lebensreformerischen Naturheilsanatorien berühmt, sie hatten bereits seit Jahrzehnten gekrönte Häupter, aber auch Scharen von Künstlern angezogen. Franz Kafka hatte hier zu Beginn des Jahrhunderts gekurt, ebenso Thomas Mann, aber auch der junge Ernst Barlach weilte in einer «Klinik für reformierte Medizin». George logierte in der Pension «Felsenburg», eine der vielen hübschen Villen, die zu «Teuschners Sanatorium» gehörte, 1895 gegründet.[4] Wer dort Unterkunft bezog, war in der Regel zur Rehabilitation überwiesen worden. Das war bei George zwar nicht der Fall. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass Alberty das Talent, das er in seinem Gegenüber bei dem Treffen im Stettiner Caféhaus vermutet hatte, auch mit der Aussicht auf eine ärztlich begleiteten Rückkehr zur Bühne nach Dresden gelockt hatte.
So war es Oskar Kokoschka ergangen. Durch den expressionistischen Lyriker und Kriegsgegner Albert Ehrenstein war Kokoschka Ende 1916 an Teuschners Sanatorium, zu dieser Zeit ein Militärlazarett, vermittelt worden. Der dreißig Jahre alte Maler und Dramatiker war selbst schwer kriegsverletzt und kriegstraumatisiert. Anfangs noch Kavallerist mit guter Nervenkraft, war ihm Ende August 1916 in Galizien in die Schläfe geschossen worden, zudem hatte ihm ein Kosake eine Lanze durch die Brust gebohrt. Die Kopfverletzung, die er in einem Wiener Spital auskurierte, hatte ihm den Gleichgewichtssinn geraubt, der gesamte Vorfall eine Angstneurose hervorgerufen.[5] Wider jede Vernunft, auch das kam nicht selten vor, zog es ihn, offenbar in selbstmörderischer Absicht, wieder an die Front. Einer der Sanatoriumsärzte, Fritz Neuberger, dem Kokoschka weniger später sein Drama «Hiob» widmete, fing ihn unterwegs ab und lotste ihn in die «Felsenburg». Hier traf er auf den Dramatiker Walter Hasenclever, den Dichter Ivar von Lücken sowie die Schauspielerin Käthe Richter. Ein Jahr später entstand Kokoschkas Gemälde «Die Freunde», das die drei Logiergäste aus der «Felsenburg» in düster-kräftigen Farben um einen Tisch versammelt zeigt, den Maler selbst als Rückenfigur im Vordergrund mit eingeschlossen.
Mit Avantgardisten der künstlerischen Moderne war Dresden vertraut. 1905 war hier die «Künstlergruppe Brücke» von Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff gegründet worden. Wenige Jahre später versammelte die lebensreformerisch orientierte Gartenstadt Hellerau die besten Architekten und Kunsthandwerker der Zeit. Während des Krieges radikalisierte sich die Stimmung in der bis dahin behaglich-bürgerlichen Residenzstadt. Neben dem malerischen warf jetzt auch der literarische Expressionismus seine Wort- und Bildsplitter in die Abenddämmerung einer Welt, die sich anschickte, zur Welt von gestern zu werden. Die anfängliche Kriegsbegeisterung der jungen Generation der Expressionisten war unter dem Eindruck der Fronterfahrung zusammengebrochen. Viele Schriftsteller, deren Werke Kurt Pinthus 1919 in der Anthologie «Menschheitsdämmerung», der bedeutendsten Gedichtsammlung des Expressionismus, veröffentlichte, waren im Krieg gefallen. Für eine kurze Weile war Dresden eine Probebühne für das ersehnte Ende des Krieges wie der wilhelminischen Ständegesellschaft, aber auch für die Morgendämmerung einer neuen, besseren Welt.
Hasenclevers Drama «Der Sohn», ein zentrales dramatisches Zeugnis der Zeit, erlebte im Herbst des Jahres 1916 seine deutsche Premiere am Albert-Theater in Dresden. Ein halbes Jahr später folgten Kokoschkas Dramen «Mörder Hoffnung der Frauen» sowie «Hiob» mit Käthe Richter. Im selben Zeitraum trat Heinz George in Kokoschkas Schauspiel «Der brennende Dornbusch» auf. All das war kein Zufall. Die «Felsenburg» war ein Tempel des Dresdner Expressionismus und der Mediziner Fritz Neuberger ihr oberster Priester. Neuberger war nicht nur Arzt, sondern auch pazifistischer Schöngeist. Zur medizinischen Therapie des Balzac-Übersetzers