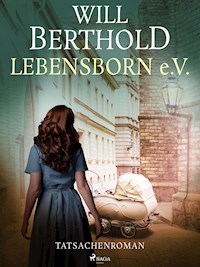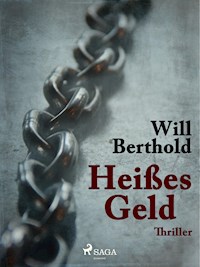
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Werner Nareikes, eigentlich Horst Linsenbusch, hat sich die Hände schmutzig gemacht. Mit Menschenhandel und Erpressung hat er Millionen verdient, und das Geld liegt sicher auf einem Schweizer Nummernkonto. Nach siebzehn Jahren im Untergrund will er sein Doppelleben nun endlich beenden. Die Einzige, die seine wahre Identität und seine schmutzige Vergangenheit kennt, ist seine Frau Hannelore, die er tatsächlich dazu gebracht hat, ihn bei den Behörden als verstorben zu melden. Dies soll Hannelores letzte Aktion werden, denn Linsebusch will sie beseitigen und sich an der Seite seiner knapp dreißig Jahre jüngeren Geliebten ein schönes Leben machen. Doch der Millionär hat die Rechnung ohne seine Frau gemacht, und ehe er sich versieht, geraten seine Pläne durcheinander …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Heißes Geld
Roman
SAGA Egmont
Heißes Geld
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass,
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de).(www.ava-international.de).
Originally published 1980 by Blanvalet Verlag, Germany.
All rights reserved
ISBN: 9788711726921
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
Natürlich war sie Gift für ihn, schieres Gift, er spürte es auf den ersten Blick, doch er blieb auf der Hut, und dafür gab es zwingende Gründe. Er verglich die verführerische Blondine mit Hannelore, seiner alternden Frau, und wußte, daß er es von nun an immer wieder tun würde. So mag es während der Bürostunden manchem Chef ergehen, aber bei Werner Nareike gab es noch eine zusätzliche Komplikation: Seine Frau war in gewisser Hinsicht auch seine Witwe und hatte ihn deshalb in der Hand.
Sie lebte getrennt von ihm, getrennt durch 800 Kilometer Raum und jeweils elf Monate Zeit pro Jahr. Er nahm nicht an, daß ihn Hannelore hier im Ruhrgebiet überwachen ließe – aber er kannte und fürchtete ihre grenzenlose Eifersucht. Werner Nareike war bisher äußerst zurückhaltend gewesen, aber ein Mann, der sich eine Mönchskutte überstreift, ist noch kein Asket. Seine Situation war gefährlich, lächerlich und paradox – der Preis für eine Dollarmillion, die er umsichtig und rechtzeitig außerhalb Deutschlands angelegt hatte, an einem Platz, wo sie weder Rost, Motten, Zusammenbrüche, Besatzungsmächte noch Währungsreformen hatten auffressen können. Dieser ungehobene Schatz, das heiße Geld, war Fluch und Wahn seines Lebens. An ihm hingen seine Vergangenheit und, wie er hoffte, auch seine Zukunft. Seine Gegenwart freilich sah anders aus:
»Bitte nehmen Sie Platz, Fräulein Littmann«, sagte Nareike und bot dem Mädchen mit der reizend-aufreizenden Figur, dem hübschen Gesicht mit den langen, sorgfältig gepflegten Haaren jenes fatalen Blonds, das mitunter nicht nur Männern über fünfzig nasse Augen und heiße Hände macht, einen Stuhl an. »Sie wissen ja, daß Sie in die engste Wahl gekommen sind. Für die Stelle meiner persönlichen Mitarbeiterin habe ich mir die Entscheidung selbst vorbehalten. Sie verstehen sicher, daß ich Ihnen einige, auch persönliche, Fragen stellen …«
»Deswegen bin ich ja hier«, erwiderte die Bewerberin in dem knappsitzenden, eleganten Kostüm. Sie lehnte sich bequem in den Stuhl zurück, schlug die Beine übereinander, Beine, die sich sehen lassen konnten und auch im Büro noch ein Blickfang blieben. Nareike überflog die Bewerbungsunterlagen auf seinem Schreibtisch lediglich zum Schein noch einmal: Was er einmal gelesen hatte, konnte er sich merken. In diesen Dingen hatte er ein gutes Gedächtnis, und so wiederholte er: Sabine Littmann, 29, ledig, geboren in Breslau, seit der Ausweisung aus Schlesien nacheinander wohnhaft in Nürnberg, Herne und Düsseldorf, sechs Jahre Handelsschule, mittlere Reife mit hervorragendem Notendurchschnitt, 350 Anschläge auf der Schreibmaschine, 250 Stenosilben pro Minute, gediegene Englisch-Kenntnisse, ordentlicher Leumund, zuletzt als selbständige Sekretärin bei einer renommierten Werbefirma tätig.
»Wir haben gelegentlich mit Radke & Reuß zu tun«, sagte er, »und offengestanden dort Erkundigungen über Sie eingeholt.« Er lächelte knapp. »Sie hätten kaum besser ausfallen können.« Er betrachtete sie eingehend. In ihren grünen Augen lichterten braune Tüpfchen, und in ihrem flächigen Gesicht spielten zierliche Grübchen.
Die Zeit seiner Kissenschlachten mit den Nackten und den Schönen lag hinter Nareike, und im Büro hatte er sich ohnedies seine Abenteuer nie gesucht – wer würde schon in einem Zoo wildern –, aber als Mann, der sich mit Frauen auskannte, nahm er bei dieser Provokation in Blond an, daß sie – fast dreißig und noch immer frei, nicht einmal geschieden – eine herbe Enttäuschung erlebt oder sich eine langwierige Liaison mit einem verheirateten Mann geleistet haben mußte. Ihre kühle Ausstrahlung erregte ihn und verstärkte zugleich sein Gespür für die Gefahr. Vorsicht tat not, aber es könnte nicht schaden, wenn ihn künftig eine langbeinige Blondine mit schmalen Hüften und festen Rundungen, einer rauchzarten Stimme und einem Gesicht von abgefeimter Unschuld fortgesetzt daran erinnerte, daß sein Leben auslief wie Wein aus einem lecken Faß.
Er wußte, daß er handeln müßte; er wußte es seit langem. Er hatte es nur nicht gewagt, noch nicht. Die Zeit arbeitete für ihn, das Alter gegen ihn, und wenn er nichts unternähme, würde ihm nicht mehr genügend Zeit bleiben, den Lohn der Angst in Saus und Braus zu verleben. Er war bereits über 58 und damit alt genug für sein drittes – und voraussichtlich sonnigstes – Leben.
»So weit, so gut«, sagte Nareike. »Eigentlich verkörpern Sie genau die Dame, die wir uns für diese Position vorgestellt haben.« Er hob den Blick von den Unterlagen: »Gewandt, tüchtig und repräsentativ.« Sein Lob klang abschätzend: »Sie haben nur ein Manko.«
»Bitte?« fragte sie.
»Sie sind mir fast zu hübsch.«
»Zu hübsch?« fragte Sabine, betroffen wie geschmeichelt.
»Ich bin zwar ein alter Hagestolz«, erwiderte Nareike mit gespieltem Selbstmitleid, »aber durchaus aufgeschlossen für feminine Reize. Sehen Sie, Ihre Vorgängerin war weit weniger attraktiv als Sie, und so hätte ich mir alles eher vorstellen können, als daß sie plötzlich einen Mann findet, mit ihm auf und davon geht und mich im Stich …« Er lächelte anzüglich: »Wenn mir das schon mit einer grauen Maus passiert, frage ich mich natürlich, was mir mit Ihnen alles bevorstünde, Fräulein Littmann.«
»Ich glaube nicht, daß Sie sich darüber Gedanken machen sollten, Herr Direktor.«
Er empfand ihre dunkle Stimme als einen hübschen Kontrast zu ihren hellen Haaren, und die Kandidatin war sich auf einmal sicher, daß sie ihre Konkurrentinnen verdrängen würde. Sie betrachtete den neuen Chef, auf den sie sich einließ, eingehend: Er war mehr hager als schlank, was sein langer, faltiger Hals noch unterstrich. Er wirkte groß und selbstsicher, und sein vom Leben gezeichnetes Gesicht ließ erkennen, wie gut der Mann in den besten Jahren in seinen besseren einmal ausgesehen haben mußte. Er trug den üblichen grauen Flanell, offensichtlich von einem ersten Schneider, nicht wie eine Bürouniform. Seiner Wirkung und Erscheinung nach war er kein Emporkömmling des Wirtschaftswunders, und Sabine nahm an, daß er auch schon in der Vergangenheit keine Anzüge von der Stange getragen hatte: »Unabhängigkeit hat für mich einen enormen Stellenwert«, erklärte sie.
»Für mich auch«, erwiderte Nareike. »Allerdings war ich in Ihrem Alter noch nicht so weise.«
»Ich weiß nicht, ob es ein Ausdruck von Weisheit ist«, erwiderte sie mit sanfter Ironie.
»Was dann?«
»Vielleicht Mißtrauen, Unsicherheit, Vorsicht …«
Nareike lächelte: »Sie haben ja braune Sprenkel in Ihren grünen Augen, hübsch«, erwiderte er und bot ihr eine Zigarette an. Sabine griff nach kurzem Zögern zu. Sie war auf die Begegnung mit ihrem potentiellen neuen Arbeitgeber sorgfältig vorbereitet, entschlossen, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Mit Männern hatte sie leichtes Spiel, aber sie erschwerte es sich oft selbst, weil sie sich wenig aus Männern machte. Aber das versteckte man besser, wenn man sich um eine Spitzenstellung bewarb und längst wußte, daß es sich in der Direktionsetage weicher sitzt als im Großraumbüro.
»Die ›Kö‹ gegen Kettwig – das ist natürlich kein so toller Tausch«, sagte Nareike.
»Das Revier ist weit besser als sein Ruf«, erwiderte sie. »Ich wäre nicht abgeneigt, hierherzuziehen.«
»Warum?« schoß er die Frage ab.
»Solide Gründe: Vielleicht schätzen Sie mich jetzt als sehr materiell ein, aber ich bringe sie einmal auf einen Nenner: Geld.«
Nareike nickte und lächelte.
»Ich könnte mich in Ihrer geschätzten Firma ganz hübsch verbessern«, erklärte die Kandidatin: »Fast 200 Mark brutto mehr im Monat, plus eine Woche zusätzlicher Urlaub und dann auch noch eine günstige Betriebswohnung.«
»Ein Apartment in Kettwig«, versetzte er. »Vermutlich klein, aber fein.«
»Ich bin bescheiden«, erwiderte sie. »Ich habe es lernen müssen. Wir sind Flüchtlinge und haben alles verloren.«
»Schlimm«, entgegnete er mit wenig Teilnahme, obwohl er selbst aus Breslau stammte. »Persönliche Gründe ziehen Sie also nicht in den Kohlenpott?« fragte er wie beiläufig.
»Doch«, antwortete Sabine und überlegte, ob er sich von dem Typ unterschied, den sie nur zu gut kannte: Dem Alter nach ein Vater, der Güte nach ein Onkel, und bei Gelegenheit ein seniler Sittenstrolch: »Meine Mutter wohnt in Castrop-Rauxel. Sie ist ganz allein, und ich könnte mich von hier aus natürlich viel besser um sie kümmern.«
»Wie schön für Ihre Frau Mutter«, erwiderte der Geschäftsführer der Firma Müller & Sohn, Produktion von Autobedarfsartikeln. Die Motorisierungswelle, einige Erfindungen des Firmengründers und der Geschäftssinn Nareikes hatten in eineinhalb Jahrzehnten aus einem größeren Handwerksbetrieb ein Unternehmen mit rund tausend Arbeitnehmern und drei Zweigwerken gemacht. Die stürmische Expansion ging weiter, und Nareike war – wenn auch bescheiden – am Gewinn beteiligt. Er verdiente mehr, als er ausgeben konnte. Vermutlich wäre er mit seinem Einkommen zufrieden gewesen, würde ihn nicht die erraffte Dollarmillion zur Habgier verleitet haben.
Der Dollarschatz war sein Traum wie sein Trauma, seine Fluchtburg wie das Wolkenkuckucksheim seiner Zukunft; er brachte den Erfolgsmenschen um Schlaf, Ruhe, Selbstbescheidung und Besonnenheit und dadurch in Gefahr.
Solange er nicht an das heiße Geld heranging, würde ihn auch niemand mehr verfolgen – aber verfolgte man ihn überhaupt noch oder schlug er sich nur mit Schatten herum?
Es gab Tage, da glaubte er beim Erwachen, als Werner Nareike zur Welt gekommen zu sein. Dann tauchte plötzlich aus dem Dunkel des Vergessens der Name eines Verschollenen im Radio oder in den Schlagzeilen auf und löste in der Öffentlichkeit eine Explosion von Anschuldigungen, Verdächtigungen und Enthüllungen aus. Dann überlegte Nareike jeweils zwecklos, ob man ihn in einem solchen Fall an die Franzosen oder an die Amerikaner ausliefern würde. Freilich: Guillotine, Strick oder Peloton brauchte er nicht mehr zu fürchten, davor schützte ihn die Bonner Verfassung, das Grundgesetz. Normalerweise durfte er keinem Land übergeben werden, in dem es noch die Todesstrafe gab, oder allenfalls gegen die verbindliche Zusicherung, daß man sie an dem Ausgelieferten nicht vollstrecken würde.
Aber in Deutschland drohte ihm der Tod, wenn auch in Raten. Lebenslänglich. Das Wort fraß sich in seinem Bewußtsein fest, bis er merkte, daß er wieder an Hannelore dachte. Niemand außer seiner Frau wußte, daß er noch lebte, untergetaucht war und unter falschem Namen eine zweite Karriere geschafft hatte. Er konnte sich auf seine einzige Mitwisserin verlassen, solange sie seiner sicher war, und mitunter wurde ihm bewußt, daß seine Ehe nicht im Himmel geschlossen, sondern auf Erpressung gegründet war. Immerhin hatte der seltsame Balanceakt seit fast 17 Jahren ohne Panne funktioniert. Aber ständig hatte Nareike das Gefühl, mit einer Zeitbombe zu leben.
Womöglich war seine Rücksicht auf Hannelore übertrieben, aber er wußte um ihre Witterung für seine Seitensprünge, obwohl er sie vermutlich überschätzte, denn in seinen Glanzzeiten – als er Massen von Menschen und Unsummen von Geld beherrscht hatte – waren Amouren Salz, Pfeffer und Paprika seines Lebens gewesen. Liebschaften im Dutzend, wenn nicht im Hundert, kleine und große, überschäumende und überflüssige, nur notdürftig verheimlicht vor seiner Frau. Damals, als er mehr Mühe darauf zu verwenden hatte, seine Gespielinnen wieder loszuwerden als sie zu erobern. – Nareikes Gedanken kehrten in die Gegenwart zurück: »Ich denke, wir sollten es miteinander versuchen«, sagte er. »Sie wissen natürlich, daß wir manchmal Überstunden …«
»Daran bin ich gewöhnt«, antwortete Sabine.
»Und es macht Ihnen nichts aus, wenn ich Ihnen vielleicht einmal – ich wohne hier im Penthouse über dem Verwaltungsgebäude – unrasiert und unter Umständen im Pyjama ein dringendes Telegramm diktiere?«
»Ich würde mir nichts dabei denken«, erwiderte Sabine, sie wollte die Bemerkung unterdrücken, setzte aber doch etwas spitz hinzu: »Im übrigen habe ich auch gelernt, mich meiner Haut zu wehren.«
»Bravo«, spottete Nareike. »Schlagen Sie mich nur nieder, wenn ich zudringlich werde.«
»Mein Gott, entschuldigen Sie, Herr Direktor«, erwiderte Sabine erschrocken.
»Schon gut.« Er nickte und beglückwünschte sich zu dem Zufall, der ihm ihre Bewerbung zugespielt hatte. In seiner Lage hatte er wenig Möglichkeit, Zufällen nachzuhelfen, oder besser gesagt: überhaupt keine. Abstinenz war ihm aufgezwungen, und mitunter kam sich Nareike vor wie ein Gefangener, der in Einzelhaft laute Selbstgespräche führt, um sich seiner Stimme zu vergewissern. So besuchte er nach geschäftlichen Besprechungen in Düsseldorf dann und wann das anrüchige Haus an der Rethelstraße, weniger vom Trieb geplagt, als von der Frage getrieben, ob er noch bei Stimme sei.
Sabine wußte noch nicht, wie sie Nareike einschätzen sollte: Er wirkte großzügig, und sie hatte absolut nichts gegen Geld, aber sie mochte spendable Gönner nicht, die auf Dankbarkeit spekulierten. Er war anderen offensichtlich überlegen, er wußte und er nutzte es und ließ keine Zweifel aufkommen, daß er in diesem Haus der Mann war, auf den es ankam.
»Damit wir weiterkommen«, entschied er sich ohne Übergang: »Wann könnten Sie eigentlich bei uns anfangen, Fräulein Littmann?«
»In fünf Wochen, wenn ich auf meinen Urlaub verzichte.«
»Und das würden Sie tun?« fragte Nareike und spürte, wie sich die Haut auf seinem Rücken spannte. So war es immer gewesen, wenn das unterschwellige Spiel eingesetzt hatte, aus dem er eigentlich seit vielen Jahren heraus war. Aber Radfahren würde man nicht verlernen, sagte er sich, solange man in der Lage wäre, stramm in die Pedale zu treten. Er nahm an, daß dieses Mädchen als Sekretärin perfekt und als Frau schwierig wäre. Vielleicht naturherb bis bitterzart, vermutlich geschockt durch unsachgemäße Behandlung. Einen Moment lang zürnte er Männern, die nicht wußten, wie man geeiste Blondinen flambiert, dann war er froh, daß wenigstens er das Rezept noch kannte.
»Gut«, erwiderte Sabine. »Ich wäre bereit, falls Sie sich für mich …«
Nareike ließ den Personalchef kommen, einen untersetzten, servil wirkenden Mann mit Stirnglatze und zackiger Aussprache: »Herrn Brill kennen Sie ja schon«, sagte der Geschäftsführer und nickte seinem Mitarbeiter zu. »Ich habe mich für Fräulein Littmann entschieden.« Er lächelte süffisant: »Hoffentlich verdächtigen Sie mich nicht, Herr Brill, daß ich hier eine schlesische Mafia gründen …«
»Ich werde mich hüten, Herr Nareike«, erwiderte er beflissen. »Wenn ich bemerken darf«, setzte er mit einem ranzigen Lächeln hinzu: »Auch ich hätte mich für Fräulein Littmann entschieden.«
»Wie schön«, entgegnete der Manager, als interessiere es ihn tatsächlich, ob seine Mitarbeiter seine Meinung teilten. »Wann ist das Apartment frei?«
»Jetzt schon beziehbar«, antwortete Brill.
»Erster Februar«, wandte sich Nareike geschäftsmäßig an Sabine. »Wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch schon früher einziehen.«
»Vielleicht ein paar Tage«, erwiderte Sabine.
»Sechs Monate Probezeit«, stellte Nareike formell fest: »Bei Ihnen sicher nur eine Formsache. Aber Ausnahmen läßt unser Personalchef nicht zu.«
»Einverstanden«, entgegnete sie.
»Bei der endgültigen Übernahme würden sich Ihre Bezüge aufbessern«, versprach Nareike. »Notieren Sie sich das bitte, Herr Brill, und erinnern Sie mich zur gegebenen Zeit.«
»Selbstverständlich, Herr Nareike.« Erwin Brill nahm die Gelegenheit wahr, dem Spitzenmann des Hauses seine Tüchtigkeit vorzuführen. »Wenn Sie in fünf Minuten bei mir vorbeikommen wollten, Fräulein Littmann, könnten Sie die Anstellungsvereinbarung gleich einsehen, gegenzeichnen und auch den Mietvertrag schon mitnehmen.«
Nareike wartete, bis Brill das Büro verlassen hatte, lächelte und schüttelte belustigt den Kopf. »Der platzt uns eines Tages noch vor Wichtigkeit«, bemerkte er und wandte sich dann wieder der Besucherin zu: »Tja, dann wäre ja wohl alles klar zwischen uns. Irgendwelche Fragen noch?«
»Könnte mich meine Vorgängerin eventuell kurz einweisen?«
»Das ist nun wirklich nicht nötig«, erwiderte Nareike großartig. »Das erledige ich selbst.« Er setzte ein wenig gewaltsam das ausgewachsene Lächeln des großen Jungen auf: »Und am Anfang bin ich immer sehr geduldig.« Er lachte trocken. »Diskretion bringen Sie mit, wie ich hoffe. Im übrigen werden Sie von niemandem hier Weisungen entgegennehmen, außer von mir.« Er trat ans Fenster: »Sieht nach weißer Weihnacht aus«, sagte er und drehte sich zu Sabine um: »Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre zweitwichtigste Aufgabe.« Vor der Bücherwand blieb er stehen und drückte auf einen Knopf. Mit leichtem Surren wich die Wand nach beiden Seiten zurück und gab eine imposante Bar frei mit Gläsern, Cocktailgarnitur, Kühlschrank und Spülbecken. Nareike fuhr einladend mit der Hand an Whisky, Wodka, Genever, Cognac, Calvados, Grappa, Aquavit, Metaxa und anderen Schnäpsen entlang, sauber aufgestellt wie in Linie zu einem Glied: »Die vereinigten Flaschen von Europa«, sagte er lachend. »Was nehmen Sie?«
»Danke, nichts«, erwiderte Sabine, sie spürte seinen Unmut und korrigierte sich: »Vielleicht einen ganz kleinen Cognac, Herr Direktor.«
Nareike schenkte zwei mittlere ein, reichte ein Glas der Besucherin: »Alsdann – auf gute Zusammenarbeit.«
»Danke bestens«, entgegnete Sabine, nippte höflich und setzte das Glas sofort wieder ab. »Ich hoffe sehr, daß ich Sie nicht enttäuschen werde.«
»Ich auch«, entgegnete Nareike ernsthaft, obwohl er einen Schuß Ironie herausgehört hatte. Er nickte ihr zu, trank aus, sah auf die Uhr: »So, jetzt wird Brill wohl mit seinem Papierkrieg fertig sein.«
Er brachte die Besucherin an die Tür und stellte dabei nebenbei fest, daß sie ihm in ihren hochhackigen Schuhen über den Kopf gewachsen war; aber darüber ließe sich reden, falls er erst an ihrer Seite ginge.
Er öffnete die Tür.
Ein Schwall weihnachtlicher Musik überfiel ihn. »Mein Gott«, sagte Nareike, obwohl auf seinen Wunsch hin von einem Arbeitspsychologen das Programm für die Adventszeit zusammengestellt worden war. Er liebte es, neue amerikanische Ideen zu kopieren, ob es sich um Großraumbüros, Getränkeautomaten oder Bowlingbahnen handelte, und so installierte er Fließbandmusik, als er gelesen hatte, daß im US-Staat Wisconsin Farmer die Milchleistung ihrer Kühe durch Dauerberieselung mit sanften Weisen gesteigert hatten.
»Ach, das müssen Sie noch wissen«, sagte Nareike, als hätte er es vergessen: »Aus betriebstechnischen Gründen müßten Sie zur gleichen Zeit wie ich Ihren Urlaub nehmen.«
»Kein Problem«, antwortete Sabine.
»Immer Ende Juli bis Ende August.«
»Wie schön«, versetzte sie: »Da ist wenigstens etwas los.« Sie lächelte und reichte Nareike eine Hand, die weich war, gepflegt, nach »Vents verts« duftete und keinen Moment länger in seiner blieb, als es die Etikette erlaubte.
Er sah Sabine nach, bis sie im Personalbüro verschwand – er genoß ihren herausfordernden Gang. Es war, als schwänge der ganze Körper mit ihren Schritten leicht mit; es wirkte melodisch, gekonnt, doch nicht gekünstelt.
Er schloß die Tür, blieb einen Moment wie unschlüssig stehen und sah ins Leere, um zur Wirklichkeit zurückzufinden. Mit abrupten Schritten ging er wieder an die Bar, griff nach der »Rémy Martin«-Flasche, hielt sie am Hals, als wollte er sie würgen, schüttete sich hastig Cognac ins Glas wie ein Wermutbruder im Stehausschank, trank dann doch mit mehr Genuß als Gier. Dabei suchte er sein Gesicht im Spiegel und stellte sachlich fest, daß er keine Zeit mehr zu verlieren hätte.
Er dachte an den alljährlichen Ferienmonat. August, der heißeste Monat des Jahres, für ihn auch – und erst recht – wenn er verregnet war, denn dann konnte er nicht in die Berge flüchten, sondern mußte mit seiner Frau in einem engen Zimmer zusammen hausen und von morgens bis abends fragliche Hoffnungen schüren und konkrete Versprechungen vermeiden.
August – das war für Nareike ein Synonym für Hannelore. Elf Monate sah er seine Frau nicht, dann hatte er jeweils vier volle Wochen mit ihr zu verbringen. Tag für Tag und Nacht für Nacht, und wenn er sich am Morgen schlafend stellte, um Rede und Antwort noch eine Zeitlang aufzuschieben, verlängerte er nur noch die Zeit, in der sie neben ihm lag, zeitgeizig und erwartungsbang, jederzeit bereit, wieder ihre Frau zu stellen. Sowie er die Augen öffnete, mußte er für Hannelores Situation pausenlos Verständnis aufbringen und seine Liebe beteuern, um seine Mitwisserin ein Jahr lang wieder mit Energie aufzuladen wie eine altersschwache Batterie.
Auf einmal hatte er einen Geschmack von Dingsbach bei Mittenwald im Mund. Er goß sich noch einen großen Schluck »Rémy« ein, um Hannelore hinunterzuspülen! Er fühlte sich jetzt wohler, weil er merkte, daß seine Zunge geschmeidig und sein Gehör pelzig wurde. Nareike lächelte, hob das Glas, prostete seinem Konterfei zu: Ein Mann Ende 50, fast fünffacher Millionär in Mark und in spe, an seinen guten Tagen dem Aussehen nach Ende 40, dem Lebenshunger nach Ende 30, voller Verlangen auf eine Blondine Ende 20.
Nareike räumte die Gläser weg und schloß die Bar. Daß er gerne trank, war das einzige schlechtgehütete Geheimnis, das es bei Müller & Sohn um den kapitalen Spitzenmann gab, aber das spielte im Kohlenpott keine Rolle. Wer an Rhein und Ruhr nicht trank, würde es ohnedies nicht weit bringen, und die Zeit, in der der alte Krupp die Kneipen auf dem Weg zu seinem Werksgelände hatte aufkaufen und abreißen lassen, um seine Kohlengräber am Trinken zu hindern, war längst vorbei. Nareike hatte sich angewöhnt, Besuchern seine Sesam-öffne-dich-Bar so stolz vorzuführen, wie früher Adolf Hitler auf dem Obersalzberg seine versenkbare Panoramascheibe.
Auf den Diktator war er schlecht zu sprechen. Mit ihm wollte er nichts mehr zu tun haben. Früher als andere hatte er sich von ihm abgekehrt und war deshalb im letzten Moment noch zwischen die Fronten geraten. Manchmal verwünschte er die kolossale Umsicht, mit der er die Geschäfte der Dewako in Paris von 42 bis 44 geleitet hatte, einschließlich der verwahrungssicheren Dollars, die dabei für ihn abgefallen waren. Das »Deutsche Warenkontor«, Verwaltungssitz Paris, Champs-Élysées, gleich hinter dem Rond Point, war der Brükkenkopf einer deutschen Scheinfirma, die wiederum zu einer so omnipotenten Staatsholding gehörte, daß sich ihre Beauftragten bei ihr Vollmacht über Leben und Tod ausleihen konnten. Aber es ließ sich nicht leugnen, daß Männer, die Nareike aus seiner Pariser Zeit nur zu gut kannte und die wirkliche Abscheulichkeiten verübt hatten, es unter ihrem richtigen Namen als ehrenwerte Bürger bereits wieder zu etwas gebracht hatten, während er unter falschem Namen im Untergrund bangen mußte, durch einen albernen Zufall oder eine eifersüchtige Ehefrau entlarvt zu werden. Bei Zusammenbrüchen heißt es eben: Wer zuerst kommt, hängt zuerst, und Nareikes Verhängnis war es gewesen, daß er – von einem früheren Mitarbeiter denunziert – auf der Flucht vor dem Galgen einen US-Captain niedergeschossen hatte.
Die Fabriksirenen verkündeten die Mittagspause. Nareike schaltete automatisch die Nachrichten ein. Er saß im Stuhl zurückgelehnt, die Beine auf die Schreibtischplatte gelegt. Im Radio machten sie bereits Inventur, obwohl das Jahr noch nicht zu Ende war, in dem durch die Berliner Mauer die Spaltung Deutschlands zementiert worden war und das ProKopf-Einkommen der Deutschen bereits die Hälfte des amerikanischen erreicht hatte und wuchs und wuchs und wuchs. Und er würde das Vermögen der Müllers mehren und, wie alljährlich, zur Kur nach Dingsbach fahren, zur Ekelkur, und sich vornehmen, es wäre das letzte Mal gewesen, wie sich ein Raucher verspricht, nach der nächsten Zigarette aufzuhören. Aber ab und zu schaffte es ein Nikotinsüchtiger doch, und Nareike nahm sich in dieser Stunde endgültig vor, das Rauchen aufzugeben.
Hannelore war anständig. Sie würde ihn nie verraten, solange er zu ihr hielte, aber der Kontakt, zu dem sie ihn zwang, brachte Gefahren mit sich: Seine Ehefrau war die einzige Verbindung zur Welt von gestern, und wenn man nach ihm fahndete, würde man ihn über Hannelore suchen und sich fragen, wohin sie jeweils im August reiste und wen sie dort träfe.
Er hatte sie immer wieder darauf hingewiesen, aber seine Witwe klammerte sich gleich einer Schiffbrüchigen an die befristete Gemeinsamkeit, bestand hartnäckig auf der Exekution jeder Stunde. Mitunter hatte er versucht, das Datum zu manipulieren oder den Urlaub zu beschneiden. Als er feststellte, daß sie bösartig wurde, ja fast tückisch, hatte er es aufgegeben.
Es war nicht die einzige Schwachstelle seiner neuen Identität, denn seine stillgelegte Ehefrau bestand darauf, daß er sich abwechselnd – einmal in der Woche brieflich oder telefonisch bei ihr meldete. Er tippte eigenhändig magere Briefe auf einer privaten Schreibmaschine, postlagernd München, im Turnus jeweils ein anderes Postamt. Noch riskanter waren die Telefonanrufe, die er alle 14 Tage – morgen wieder – führen mußte. In Sicherheitsfragen war Nareike ein Fanatiker des Details. Er fuhr nach Düsseldorf, um seine Mitwisserin jeweils von einem anderen Restaurant aus im Telegrammstil zu beschwichtigen, wobei Hannelore jedesmal in einem anderen Hotel der Isarstadt seinen Anruf erwartete. Das Schema wurde nach einem abgesprochenen Prinzip durchgespielt, so daß sie höchstens zweimal jährlich im gleichen Haus auftauchte.
Das Verfahren war aufwendig und umständlich, aber sie blieben dabei, auch als sie sich längst daran gewöhnt hatten, daß sich niemand, und schon gar kein Staatsanwalt, Richter, Kriminalist oder Geheimdienst-Agent, für sie interessierte.
Nareike wußte wohl, daß seine Frau ihre Qualitäten hatte – mitunter aber haßte er sie so, daß er sie hätte töten können. Diese Vorstellung war für einen Mann wie ihn weder spontan noch theoretisch, noch abwegig. Schließlich hatte er in seinem Leben schon weit härtere Dinge hinter sich gebracht als die Beseitigung einer einsamen Frau. Hannelores Ende war für ihn Teil eines Planspiels, vor allem, wenn es auf den Hochsommer, auf das vierarmige Verlies der Intimität, zuging.
Nareike gab die lässige Haltung am Schreibtisch auf. Sein Entschluß war gefaßt. Einem Spieler gleich, setzte er alles auf eine Karte, und da er bei Frauen immer ein Falschspieler war, würde es eine gezinkte sein. Es war ihm nicht wohl dabei, aber er mußte Hannelore loswerden.
Er öffnete noch einmal seine Knopfdruckbar, goß sich einen letzten »Rémy« ein; es war ein Abschiedstrunk, denn sein exakter Plan über den Verlauf der »Operation Heißes Geld« sah als erste Maßnahme den sofortigen Verzicht auf Alkohol vor, aber die ungewohnte Nüchternheit war nur eine unangenehme Seite des Einstiegs in die Zukunft.
Sie war der einzige Gast in der kleinen Tagesbar; sie saß still in der Ecke, als horche sie in sich hinein. Sie kam in Abständen von fünf, sechs Monaten ins »Carlton«, seit Jahren schon, manchmal nur auf eine kurze Einkaufsrast, mitunter blieb sie in dem zentral gelegenen Haus auch über Nacht. Da sie ein, wenn auch seltener, Stammgast war, brauchte sie dann keinen polizeilichen Anmeldeschein mehr auszufüllen, und der aufmerksame Keeper wußte, daß die stille Frau Linsenbusch hieß – Hannelore Linsenbusch –, irgendwo im oberbayerischen Alpenvorland wohnte, aber ihrer Sprechweise nach aus Berlin oder jedenfalls aus Norddeutschland stammte.
Sie wirkte stets schlicht angezogen, wenn auch nicht billig. Es schien ihr mehr am Geschmack zu fehlen als an Geld. Sie bestellte nie mehr als eine Tasse Kaffee und hinterher vielleicht noch einen kleinen Cointreau, aber wenn sie zahlte, ließ sie sich kein Wechselgeld herausgeben, das bedeutete wenig Mühe und ein schönes Trinkgeld, und so war sie, aus der Kellnerperspektive betrachtet, doch ein guter Gast.
Sooft an der Rezeption das Telefon klingelte, schreckte die Besucherin – müde Augen in einem knochigen Gesicht, halblange, phantasielos geschnittene Haare – aus ihrer Versunkenheit hoch, um dann, wenn sie nicht gerufen wurde, wieder ins Grübeln zurückzufallen. Sie saß die Zeit ab wie eine Freiheitsstrafe, erschöpft vom Warten. Sie hinterließ den Eindruck, als wartete sie immer und meistens vergeblich.
»Telefon in diesen Tagen, das ist furchtbar, gnä’ Frau«, sagte der Ober. »Das Netz ist ständig überlastet.«
Die Besucherin nickte, ohne etwas zu erwidern. Alle Jahre wieder wurde der Adventsmonat zu ihrer schlimmsten Zeit. Hannelore war dann schon vier Monate von Horst – der jedesmal zornig wurde, wenn sie ihn nicht Werner nannte – getrennt und mußte sich sieben weitere bis zum nächsten Zusammensein gedulden. Während die Menschen kaufwütig durch die City drängten, spürte sie ihre Verlassenheit schlimmer denn je. »Süßer die Glocken nie klingen«, spielte eine Melodie halblaut in den Raum und verstärkte den bitteren Zug um Hannelores Mund. Der Stern von Bethlehem war allenfalls für die Registrierkassen der Warenhäuser aufgegangen, jedenfalls nicht für sie.
»Frau Linsenbusch«, rief der Mann an der Rezeption.
Sie erhob sich rasch und eilte behende in die Telefonzelle zwischen Tagesbar und Empfang und nahm den Hörer ab: »Ja, bitte«, sagte sie mit belegter Stimme, wartete und horchte, sie hörte nur ein Rauschen und legte langsam auf, wie in Zeitlupe. Die Verbindung war wieder einmal zusammengebrochen – sie wußte, daß die Kommunikation mit einem Verschollenen problematisch war.
Hannelore ging mit fahrigen Schritten zurück. Der Keeper, der sich vielleicht nur langweilte, sagte sich, daß sie mit hohen Absätzen, einem kräftigeren Lippenstift und etwas Rouge mehr aus sich hätte machen können und vor allem machen sollen. »Wieder nicht geklappt?« drückte er sein Bedauern aus.
Im Grunde war es gleichgültig, ob Horst sie um 16 Uhr oder um 17 Uhr erreichte. Seine Gespräche liefen wie vom Tonband, und das lag nur zum kleinen Teil an ihrem Mann und zum größeren an den Umständen.
Mit seinen Briefen ging es ihr ähnlich. Sie glichen einander, als wären sie hektographiert. Es ging nicht anders. Horst – Pardon, Werner – mußte übervorsichtig sein, und obwohl Hannelore diese Verschwörertricks nicht lagen, hielt sie sich gewissenhaft an seine Anweisungen, um sich wenigstens ein minimales Arrangement zu bewahren.
Sie waren Gestrandete der Stunde Null, und Hannelore hatte sich in der ersten Zeit damit getröstet, daß andere Frauen, deren Männer gefallen waren, weder einen vorprogrammierten Brief noch einen standardisierten Telefonanruf und schon gar keine vier Wochen Zusammenleben einmal im Jahr haben würden.
Aber dann waren Männer wieder aufgetaucht, von denen man es nie erwartet hatte, ganz große des Dritten Reiches, nur leicht angeschlagen, sonst ziemlich ungeschoren. Hannelore war nicht neidisch, aber das hielt sie nun doch für ungerecht, zumal Horst viel früher als alle anderen erkannt hatte, daß der deutsche Schicksalskampf mit einem Debakel enden würde. Seine Intelligenz war für sie, und vor allem für ihren Vater, immer weniger in Frage gestanden als seine Treue zum Führer. Schon bei Kriegsausbruch hatte Horst wenig Begeisterung gezeigt, und als der deutsche Vormarsch vor Moskau liegengeblieben und die USA in den Krieg eingetreten waren, hatte er – freilich etwas angetrunken – festgestellt: »Du wirst lachen – auch diesmal werden wir verlieren.«
Sie war entsetzt gewesen, zumal sie später feststellte, daß er nüchtern genauso dachte. Sie wenigstens wollte keine Defätistin sein, und Horst hätte als Schwiegersohn eines Reichsleiters wohl auch jeden Grund gehabt, den Helm fester zu binden und sich entschlossener in die Bewegung einzureihen. Eine Zeitlang hatte sie Horst wegen seiner laxen Auffassung sogar verachtet. Später begann sie zu fürchten, daß er recht behalten könne, denn der Feind rückte immer näher. Die deutschen Städte lagen zunehmend im Bombenhagel, und alle gewöhnten sich an, die Zeitungen von hinten nach vorne zu lesen, wegen der vielen kleinen Todesanzeigen.
Horsts Dienststelle hatte Paris räumen müssen, er war jetzt wieder in Berlin, sie noch immer in Breslau, und Horst jr., ein aufgeweckter Junge, an dem sie beide gleichermaßen hingen, wurde mit noch nicht einmal 14 Jahren als Flakhelfer eingezogen. Kurz nach der letzten Kriegsweihnacht erschien sein Vater in Breslau und forderte Hannelore auf, das Wichtigste zusammenzupacken und sich abmarschbereit zu machen. Er sei für sie verantwortlich und wolle sie nach Oberbayern evakuieren. Sie war zuerst so verblüfft, daß sie sich wehrte; sie nahm an, es hinge wieder mit einer seiner dummen Weibergeschichten zusammen, aber Horst erklärte ihr, daß der Reichsführer SS bereits falsche Ausweise an seine engsten Mitarbeiter ausgeben lasse, er verzog den Mund: »Und Zyankali-Kapseln, die in ein paar Sekunden tödlich wirken – aber wenn du noch immer an Wunderwaffen glaubst, brauchst du kein Gift, dann werden schon die Russen für dein Ableben sorgen.«
Hannelore glaubte ihm noch immer kein Wort, aber sie gab schließlich nach und versprach ihm auch, besonders auf den braunen Koffer, Horsts spezielles Fluchtgepäck, zu achten, bis auf weiteres niemanden ihren künftigen Aufenthaltsort mitzuteilen und – was auch geschähe – in jedem Fall abzuwarten, bis ihr Mann wieder bei ihr auftauchen würde. In der Zeit des Zusammenbruchs war Hannelore wie betäubt, nicht mehr sie selbst; nur allmählich fing sie sich wieder. Als sie am 20. Mai 1945 im Radio hörte, daß ein gewisser Heinrich Hitzinger, der nach seiner Festnahme durch britische Militärpolizei eine im Mund verborgene Giftkapsel zerbissen und dadurch Selbstmord verübt hatte, im Vernehmungslager 031 bei Lüneburg einwandfrei als Heinrich Himmler identifiziert worden sei, lebte Hannelore längst unerkannt und unbekannt in Sicherheit. Erst später erfuhr sie, daß ihre Eltern den gleichen Weg gewählt hatten, sich der Zukunft zu stellen, wie der Reichsführer SS, dessen Namensgeber Hitzinger übrigens als Volksschädling zum Tode verurteilt worden war.
Zuvor hatte Hannelore schon unerträgliche Hiobsnachrichten hinnehmen müssen: Horst, ihr prächtiger Junge, war in einem den letzten Kriegstagen in einem Berliner U-Bahn-Schacht gefallen und Horst senior, ihr Mann mit ungewissem Schicksal, auf der Flucht. Er hatte bei der Dewako in Paris eine ganz entscheidende Aufgabe zugunsten der Kriegswirtschaft gelöst und – trotz seiner Zweifel – seine Pflicht getan, woraus ihm die Alliierten einen Strick drehen wollten. Die Familie Linsenbusch hatte einen hohen Preis für die Bewegung zu bezahlen, über die man jetzt auch noch die übelsten Dinge hören mußte, aber Hannelore war noch immer davon überzeugt, daß diese Untaten – soweit sie wirklich geschehen waren – von unverantwortlichen Gefolgsleuten hinter dem Rücken des Führers verübt worden seien.
Sie hob den Kopf.
Der Keeper sah sie fragend an.
»Nein, danke«, sagte Hannelore. Ob sie wollte oder nicht, so oft sie aufsah, mußte sie in den großen Wandspiegel unter dem Flaschenregal blicken, und das war kein sehr erfreulicher Anblick. Sie war neun Jahre jünger als ihr Mann, aber sie wirkte viel älter als er. Sie hatte ihre Haare frisch gewaschen, aber sie sahen strähnig und farblos aus. Nie hatte sie sich zu einer modischeren Frisur durchringen können und nie auch dazu bereitgefunden, ihr fahles Haar aufzublonden, obwohl sie wußte, daß ihre Rivalinnen bei Horst – so verschieden wie auch immer – in jedem Fall blond waren, von heller, strahlender Farbe.
In dieser Hinsicht hatte ihr Horst nun wirklich einiges angetan. Bis zu seinem Sturz war er fast ständig hinter überzüchteten Blondinen hergehechelt, wie ein Windhund hinter dem falschen Hasen. Hannelore hatte immer der Versuchung widerstanden, ihn zu bespitzeln, aber doch instinktiv gefühlt, wann es wieder einmal soweit war. Sie gewöhnte sich daran, seine Seitensprünge zu erdulden, da sie während eines langen Martyriums die Scheidung mehr fürchtete als seine Affären mit anderen Frauen, die den großen Vorzug aufwiesen, rasch zu enden.
Der Zusammenbruch hatte alles mit einem Schlag beendet, und inzwischen war Horst ohnedies aus den wilden Jahren heraus. Es war ein Treppenwitz, daß sie sich am besten verstanden, seit sie nur noch selten zusammen waren. Nunmehr gab es nur noch sie in seinem Leben, und so warf ihm Hannelore die alten Geschichten auch nicht mehr vor. Sie blieb auf der Hut, aber sie sah die Dinge jetzt doch mit anderen Augen. Früher hatte sie Horst meistens gehaßt und manchmal geliebt, heute liebte sie ihn meistens und zürnte ihm nur noch selten. Bei seiner Frau war ihm gelungen, was ihm das Leben versagt hatte: die Rehabilitierung – aber sie würde sich wohl nie damit abfinden, daß Horst – ihrer Überzeugung nach zu Unrecht – sich verbergen mußte, während weit bekanntere Wehrwirtschaftsführer längst wieder auf den Kommandobrücken der deutschen Industrie standen, sogar und selbstverständlich auch in der Rüstung – die Sowjets machten es nötig und die Amerikaner möglich.
Wieder klingelte das Telefon; diesmal hatte sie es überhört.
»Für Sie, gnä’ Frau«, schreckte sie der Keeper hoch. Hannelore betrat erneut die Zelle.
»Ich«, sagte eine Stimme, die – wie auf die Adventszeit abgestellt – heute eher weich als metallisch klang: »Wie geht’s dir, Liebes?«
»Wie immer«, entgegnete sie spröde.
»Schlimm, diese Zeit«, stellte er fest. Seine Stimme war so nah, als stünde er neben ihr: groß, schlank, überlegen, selbstbewußt.
Wo er auch immer war, in diesem Moment bereute sie nicht, Horst als 19jährige geheiratet zu haben, den ersten Mann ihres Lebens, der zugleich ihr letzter sein würde, und wenn er sie nur wegen ihres mütterlichen Geldes und ihres väterlichen Einflusses gefreit hätte: »Für dich auch?« fragte sie leise.
»Wie kannst du daran zweifeln?« erwiderte er etwas heftig: »Ich habe nur mehr Ablenkung als du, und du weißt ja, Männer sind nun mal härter als Frauen, Hannelore.« Sie erschrak, weil er sie erstmals am Telefon mit ihrem Vornamen angeredet hatte. Im Gegensatz zu ihr unterlief ihm nie so eine Fahrlässigkeit; sie schloß daraus, daß er sehr erregt sein mußte: »Ist etwas passiert?« fragte sie hastig.
»Nein, nein, schon alles in Ordnung«, antwortete er. »In allerbester Ordnung sogar«, setzte er hinzu, und Hannelore wartete auf die vorfabrizierten Worte. Auf einmal merkte sie, daß das Gespräch diesmal keiner Aufzeichnung glich, die von der Spule kam.
»Ich habe dieses Leben satt«, sagte er, »und bin entschlossen, es zu beenden.«
»Beenden?« wiederholte sie, mit einer Stimme, die Angst befrachtete.
»Ja. Zu unseren Gunsten. Ich möchte, daß es wird, wie es einmal war. Weißt du noch, damals in unserer ersten Zeit?«
»Mein Gott, Horst …« Sie hustete und verbesserte sich: »Werner, davon träume ich doch schon seit …«
»… seit langem«, fiel er ihr ins Wort, um unverschlüsselte Mitteilungen für eventuelle Zuhörer zu vermeiden: »Die Umstände haben uns in ein Labyrinth gehetzt, aber ich bin jetzt dabei, mit allen Mitteln, aber auch mit allen, uns ein für allemal einen Ausweg zu bahnen.«
Hannelore lehnte sich gegen die Wand. Sie hörte Worte, die sie seit langem erwartet hatte, und die ihm nie über die Lippen gekommen waren. »Und du weißt schon …«
»Ja«, antwortete er. »Ich weiß, wie wir den gordischen Knoten zerschlagen. »Sie hörte seinen Atem: »Möchtest du wieder mit mir zusammenleben – ich meine, immer?«
»Wie kannst du nur fragen«, entgegnete sie.
»Richtig verheiratet, mit Ehering?«
»Horst …«, erwiderte sie atemlos und merkte gar nicht, daß er sie nicht zurechtwies: »Wann und wo und wie?«
»Das werde ich dir alles sagen«, versetzte er, »aber nicht jetzt, nicht am Telefon. Nun hör mir gut zu. Ich weiß, daß du sehr aufgeregt bist, konzentriere dich bitte und sei kein kopfloses Huhn.«
»Ja, aber …«
»Ich bin unterwegs.«
»Hierher?«
»Zu dir«, antwortete er.
»Aber wieso ist es auf einmal möglich?« fragte sie.
»Ich sagte dir doch«, erwiderte er leicht gereizt: »Unsere Zukunft hat schon begonnen. Du mußt mir nur ein bißchen dabei helfen …«
»Und ob ich dir dabei helfe«, entgegnete Hannelore. »Wann kommst du?«
»Morgen.«
»Werner, sag das noch einmal, bitte, ich bin unfähig …«
»Gut«, antwortete er. »Ich werde dir noch eine ganze Menge sagen, altes Mädchen.« Er wurde ganz deutlich, sprach wie ein 18jähriger, nicht wie einer mit 58, und einen Moment fragte sich Hannelore erschrocken, ob er nicht etwa nur zuviel getrunken hätte. Aber es war überflüssig, denn ob Horst getrunken hatte oder nicht, das witterte sie über Raum und Zeit hinweg genauso, wie wenn er sie mit einer anderen Frau hinterging. Freilich hatte sich Horst, solange sie ihn kannte, früher an scharfe Sachen gehalten – im Glas wie im Bett.
Als Hannelore nach wenigen Minuten die Kabine verließ, hatte sie rote Flecken im Gesicht. Sie ging mit taumeligen Schritten, als tastete sie sich über ein Hochseil, und schwindelfrei war sie noch nie gewesen. Sie setzte sich an ihren Platz und starrte mit vollem Gesicht ins Leere.
»Dieses Mal hat’s wohl geklappt, gnä’ Frau«, sagte der Barkeeper.
»Ja«, antwortete Hannelore und lächelte, und der Mann mit der weißen Jacke staunte, um wieviel ein Lächeln auch noch eine ältere Frau verjüngen konnte: »Ja«, wiederholte die Besucherin, die sonst keine Silbe zuviel sprach. »Es hat geklappt. Es hat wirklich geklappt.«
Hannelore griff nach ihrer Tasche, als wollte sie bezahlen. Und dann glaubte sie, daß ihr so viel Glück nicht allein zustünde, daß sie es mit einem anderen teilen müsse. Ein seltsamer Gedanke fraß sich fest: »Sagen Sie«, überrannte sie ihren Widerstand. »Was würden Sie trinken, wenn Sie eine außergewöhnlich gute Nachricht …«
»Sekt, Madame«, entgegnete der Ober lachend. »Ich will wirklich nicht auf Umsatz machen«, versicherte er, »aber wenn ich mir Ihr Gesicht so ansehe, vielleicht sogar Champagner.«
»Champagner«, entschied Hannelore. »Und zwei Gläser, bitte.«
Sie, deren Arroganz und Unnahbarkeit in Hartmannsberg im Chiemgau sprichwörtlich waren, weil sie fast nie ein privates Gespräch mit den Einheimischen führte, stieß mit einem Unbeteiligten an und verstand auf einmal, warum Horst so gerne trank. Sie kam sich leicht vor, schwerelos, und hatte auf einmal Schwierigkeiten mit dem Denken.
»Vielleicht bin ich in Wirklichkeit Hans Huckebein, der Unglücksrabe«, sagte sie lachend, als sie bezahlte, »aber ich muß es Ihnen sagen, auch wenn Sie mich für eine törichte, alte Gans halten …«
Aber, gnä’ Frau …«
»Ich werde wieder heiraten«, sagte Hannelore und ließ das letzte Glas stehen, hielt sich einen Moment lang an der Bar fest, merkte, daß sie aufrecht gehen konnte, und sagte sich, daß sie jetzt gehen müsse, bevor sie den Keeper als Trauzeugen zu ihrer Hochzeit einladen würde.
Der alte Mann hatte seit vielen Jahren einsam und zurückgezogen gelebt, aber er war in Wirtschaftskreisen viel zu bekannt, um unbemerkt sterben zu können. Zwar fehlte in den Inseraten-Plantagen der New Yorker Zeitungen seine Todesanzeige, aber die Blätter berichteten dafür ausführlich im redaktionellen Teil über das Lebenswerk des »Eremiten von Wallstreet«, und so mußten sich die Großen des Geschäftslebens bei launischem Aprilwetter auf Brooklyns Armenfriedhof bemühen, um Aaron S. Greenstone die letzte Ehre zu erweisen. Obwohl der Verstorbene weder Angehörige noch Freunde hinterlassen hatte, gerieten die Trauergäste an seinem offenen Grabe in dichtes Gedränge.
Für Henry W. Feller war es ein Pflichtbesuch, den er mit Anstand hinter sich bringen wollte. Er wußte noch nicht, daß ihn der stille Tod dieses Klienten über Monate hinweg beschäftigen und durch die halbe Welt hetzen würde.
Er hielt sich im Hintergrund, stand neben dem Senior der bekannten Anwaltsfirma Brown, Spencer & Roskoe, einen Kopf größer, der designierte Nachfolger, 39, neben dem 70jährigen Firmenchef. Er betrachtete die illustre Versammlung gewichtiger Herren in dunklen Anzügen. Ihre Gesichter wirkten feierlich, auch wenn die Zeremonie für viele von ihnen nur lästig war. Die Manager der City ließen sich ungern daran erinnern, daß etwas mächtiger war als ihre Aktivitäten an der Börse. Aber womöglich brauchte man gar kein Geschäftsmann zu sein, um Beerdigungen zu meiden – die meisten Menschen würden sicherlich ihrer eigenen fernbleiben, wenn sie es könnten.
Feller, breitschultrig, schlank und sportlich, war auf den ersten Blick ein Mann, dessen Vitalität durch Intelligenz beherrscht wurde; er hatte eine hohe Stirn, klare Augen und vereinigte, nach einem Wort seines Gönners, Brillanz mit Bizeps. Der Anwalt hatte den Verstorbenen kaum gekannt, und so war er weniger aus Pietät als auf persönlichen Wunsch Roskoes nach Brooklyn gefahren. Der Senior, durchaus nicht zimperlich, brauchte bei der düsteren Zeremonie keinen Begleiter, sicherlich verband er mit seiner Einladung einen Zweck. Wünsche, die aus der Reihe fielen, hatten bei seinem Firmenchef meist einen besonderen Grund.
Sie saßen in Roskoes Mercedes-Limousine und fuhren nach Manhattan zurück: »Wir haben nicht nur einen Mann begraben, sondern eine Institution«, sagte der Senior. »Karrieren, wie sie Greenstone machte, wird es wohl künftig auch in Amerika nicht mehr geben.«
Feller nickte, er wußte, daß der Verstorbene Mitte der zwanziger aus Rußland und Mitte der dreißiger Jahre aus Deutschland zur Emigration gezwungen worden war, und dann in New York, Englisch nur radebrechend, einen ungewöhnlichen Aufstieg geschafft hatte. Die Zeit dieser legendären Himmelsflüge – vom Tellerwäscher bis zum Multimillionär – war wohl endgültig vorbei.
»Soviel ich weiß, gibt es keine Erben?« fragte Feller.
»Keine persönlichen«, erwiderte Roskoe: »Wir haben den Auftrag, seine Firma zu liquidieren, den Erlös in eine Stiftung zugunsten von Kriegsopfern einzubringen. Bis zur Bestellung eines Kuratoriums – das kann noch Jahre dauern – handeln wir als Treuhänder. So betrachtet, ist Mr. Greenstone unser Klient geblieben. Wir haben freie Hand und viele, sehr viele Mittel.« Feller lächelte, er wußte, daß der Senior in der gleichen Reihenfolge an Gott, Geld und Golf glaubte, ein Mann, der mühelos puritanischen Lebenswandel mit erheblichem Erwerbssinn und mildem Alterssport verbinden konnte.
»Falsch, Henry«, sagte der Alte: »Ich werde dieses Geld nicht anrühren. Keinen Cent, außer Vertrauensspesen. Ich will Ihnen damit nur etwas umständlich sagen, daß – falls wir den Fall gleich beurteilen – Geld keine Rolle spielen würde.« Sein Gesicht wurde hart: »Ich habe heute morgen einen Brief von einem Toten erhalten, der gewissermaßen 18 Jahre an mich unterwegs war«, sagte er. Das Schreiben war bei einer Anwaltsfirma in Fort Worth, Texas, als testamentarischer Wunsch hinterlegt und an die Auflage gebunden, es uns nach dem Tod von Miriam und Aaron Greenstone auszuhändigen.«
»Warum?«
»Das werden Sie sofort begreifen, wenn Sie den Brief gelesen haben«, erläuterte Roskoe: »Nathan Greenstone, der Verfasser, wollte, daß der Tatvorgang bei der Ermordung seines älteren Bruders Joseph festgehalten wird, nicht jedoch, daß ihn seine Eltern erfahren. Diese Geschichte ist so grausam, daß er sie ihnen ersparen wollte. Nathan war damals in Texas als Bomberpilot ausgebildet worden und hat diese Verfügung unmittelbar vor seiner Versetzuhg nach Europa getroffen. Ein paar Monate später ist er gefallen. Kommen sie mit, Henry?«
»So ungefähr.«
Der alte Roskoe sah einen Moment zum Autofenster hinaus. »Miriam Greenstone war schwer herzkrank gewesen. – Ihr Mann hat die Zusammenhänge geahnt, aber nicht gewagt, sie ganz aufzuklären.«
»Die Geschehnisse liegen doch an die 20 Jahre zurück?«
»Ja.«
»Und es ist bisher nichts in der Sache unternommen worden?«
»Doch, es ist viel unternommen worden.« Der Senior Jächelte bitter. »Es ist bloß – soviel ich weiß – wenig geschehen.«
Feller sagte nichts; es war eine Antwort.
»Für mein Rechtsgefühl ist es einfach unerträglich, daß hier Mörder gewissermaßen über den Gräbern ihrer Opfer die erpreßte Millionenbeute genießen, das Blutgeld für ein Verbrechen, an dem eine ganze Familie zugrunde gegangen ist.«
»Aber der alte Greenstone wollte doch an diese Dinge nicht mehr rühren«, erwiderte Feller behutsam.
»Nicht er hat Nathans Brief bekommen, sondern wir«, entgegnete der Alte mit leichter Schärfe.
Feller nickte, er war weder störrisch noch begriffsstutzig, ein blendender Jurist, ein Pragmatiker, kein Theoretiker. Als Gegenanwalt Roskoes hatte er in einem Zivilverfahren dem Alten schwer zugesetzt, und es war bezeichnend für den Senior gewesen, daß er Feller später als Kronprinzen in seine Firma berief, da – wie er grinsend festgestellt hatte – »die Spitzenstellung von Brown, Spencer & Roskoe darauf basiere, daß sich die Kanzlei seit 90 Jahren durch Adoption fortpflanze«.
Henry W. Feller stammte aus dem Mittelwesten. Er war der Sohn deutscher Einwanderer, die aus Dortmund in die Staaten gekommen waren und sich in Milwaukee niedergelassen hatten, wo bekanntlich Milch und Bier fließen. Bereits vier Monate nach ihrer Einbürgerung war ihr einziger Sohn Henry zur Welt gekommen, und als im Land geborener Amerikaner hätte er nunmehr sogar US-Präsident werden können. Fellers Ziele waren jedoch bescheidener.
»Und was können wir unternehmen?« fragte er.
»Zunächst einmal die Zusammenhänge aufklären.«
»My god – nach 20 Jahren?«
»19«, erwiderte der alte Roskoe.
»Sehr ehrenwert«, entgegnete Feller und lächelte ein wenig resignant. »Und sehr romantisch.« Er betrachtete einen Moment seine Schuhspitzen. »Ich fürchte, wir Juristen werden das Unrecht so wenig aus der Welt schaffen wie die Mediziner den Tod.«
»Keine Philosophie, Henry«, sagte der Senior. »Sie werden jetzt gleich auf dem Schreibtisch in Ihrem Büro Nathans Brief finden. Zunächst verlange ich von Ihnen nicht mehr, als daß Sie ihn lesen.«
Sie hatten die Fifth Avenue erreicht und stiegen, bevor der Fahrer die schwere Mercedes-Limousine in die Tiefgarage zur 53. Straße brachte, aus. Sie fuhren im Lift hoch, erreichten die noble Kanzlei, in der es keine unechten Orientteppiche, keine falschen Antiquitäten und keine leeren Worte gab. Nach einem geflügelten Wort, das der Senior durchaus ernst nahm, suchten sich Brown, Spencer & Roskoe ihre Klienten aus und nicht diese ihre Anwaltsfirma.
»See you later«, verabschiedete Roskoe seinen Mitarbeiter.
Gleich bei Betreten seines Büros sah Feller in einem verschlossenen Umschlag auf seinem Schreibtisch die Unterlagen, die ihm sein Förderer angekündigt hatte. Er wußte, daß ihm der Tag nichts schenken würde, und griff nach dem Begleitbrief der texanischen Anwälte, die darum baten, ihnen die Übergabe des Schreibens ihres im März 45 gefallenen Klienten Nathan Greenstone zu bestätigen und »alles Nötige und Mögliche veranlassen zu wollen«. Der Anwalt griff nach dem Hauptschreiben.
Bevor er sein Jurastudium an der Harvard University als Zweitbester seiner Crew absolviert hatte, war er als Leutnant in einem der Eliteregimenter des Panzergenerals Patton von der Normandie bis zur deutschen Grenze gestürmt. Während die Kämpfe im Reichswald bei Aachen tobten, versetzte man den Offizier – der zweisprachig aufgewachsen war – zu einer Spezialeinheit für psychologische Kriegführung. Automatisch landete Feller dann in der Besatzungszeit für zweieinhalb Jahre beim US-Geheimdienst. Aus der Zeit beim »Counter Intelligence Corps« in Frankfurt waren ihm Beziehungen und Erfahrungen geblieben, die sich ihm eingebrannt hatten, und so könnte ihn – wie er annahm – ein über Deutschland abgeschossener Bomberpilot kaum mit etwas Neuem überraschen.
Er nahm den Brief zur Hand und erfaßte als erstes, daß der alte Greenstone doch erheblich länger gelebt haben mußte, als sein jüngster Sohn bei der Niederschrift des Briefes, der zu einem Vermächtnis werden sollte, Ende 44 angenommen hatte.
»Ich werde morgen mit meinem Geschwader nach Italien verlegt, um von dort aus Einsätze über Deutschland zu fliegen. Für den Fall, daß mir dabei etwas zustoßen sollte, möchte ich meine Aussage über einige Vorgänge in Paris festhalten, die in direktem Zusammenhang mit dem Tod meines Bruders Joseph stehen. Ich bin bereit zu beschwören, daß es sich bei meinem Bericht um die reine Wahrheit handelt.
Ich hatte mich 1940 in Frankreich aufgehalten, um mich in Vertretung meines Vaters um unsere französische Zweigniederlassung zu kümmern. Als sich die deutschen Truppen Paris näherten, flüchtete ich aus der französischen Hauptstadt nach Süden und gelangte mit vielen anderen in den zunächst unbesetzten Teil Frankreichs. Ich war 24 Jahre alt, hatte bereits die amerikanische Staatsbürgerschaft und sprach – da ich in Berlin aufgewachsen war – fließend deutsch, weshalb ich den Maquisards der Résistance gelegentlich behilflich sein konnte. Gleichzeitig versuchte ich, unsere Besitzungen in Südfrankreich zu verkaufen, bevor sie die Nazis enteignen konnten. Im Norden war die Registrierung der jüdischen Bevölkerung und Firmen bereits angeordnet; es schien nur eine Frage der Zeit, bis sich die Vichy-Regierung den Verfolgungen im besetzten Frankreich anschließen würde.
Freunde, bei denen ich mich versteckt hielt, warnten mich davor, daß Hitlers Truppen bald den Doubs überschreiten und auch den unbesetzten Teil Frankreichs okkupieren würden. Ich wollte mich nach Portugal durchschlagen und wartete auf eine Gelegenheit, doch meine Abreise verzögerte sich immer wieder. Ich wurde denunziert und fiel in die Hände der Leute, die mich aus Deutschland vertrieben hatten. Ich wurde mißhandelt und mit anderen Leidensgefährten zusammen in das berüchtigte Lager Drancy geschafft, um von hier aus mit einem Sammeltransport per Viehwagen in den Osten › verschubt‹ zu werden. Ich machte mir keine Illusionen über unser weiteres Schicksal und tröstete mich, daß wenigstens Joseph das Furchtbare erspart bliebe. Ich hatte vor meiner Abreise gehört, daß er sich als Soldat freiwillig zur Army gemeldet hatte. Das gleiche hatte ich vorgehabt, aber nun war es zu spät.
Es blieb uns nur die Hoffnung, darauf zu setzen, daß sich der Transport so lange verzögerte, bis wir eine Fluchtmöglichkeit gefunden hätten. Ein-oder zweimal gelang es mir, der wahllosen Verladung in die Waggons zu entkommen, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis ich das Schicksal der anderen teilte.
Ende 43 erschienen einige Offiziere der SIPO im Stab des Höheren SS- und Polizeiführers von Paris, um uns zu vernehmen. Ich berief mich darauf, daß ich Amerikaner sei, und stellte fest, daß sich der Obersturmführer Dumbsky – wie sich bald herausstellte, unter den Vernehmern für die subtileren Verhörmethoden zuständig – mehr für unsere Firma in New York interessierte als für meine Tätigkeit in Frankreich.
Ich wurde von meinen Schicksalsgefährten getrennt und in eine Art Privatgefängnis in der Nähe des Boulevard Lannes gebracht, wo die Gestapo während der Besatzungszeit ihre feudalen Quartiere bezogen hatte. Ich kam mit anderen Gefangenen zusammen und erfuhr, daß wir uns nunmehr in den Händen einer zivilen Firma, der Dewako, befänden, die im neutralen Ausland dringend benötigte Rohstoffe für die deutsche Rüstung besorgte. Dafür brauchte sie Devisen, und zwar in erster Linie Dollars, und so war die tatsächliche Handelsware dieses ›Deutschen Warenkontors‹ die Erpressung in ihrer übelsten Form:
Aus der zunächst grob aussortierten Menge der Gefangenen wurden die ›Devisenbringer‹ herausgefischt. Während die anderen wieder nach Drancy geschafft oder ›auf der Flucht‹ erschossen wurden, verblieb in dem zum Gefängnis umgebauten Hotel eine äußerst gemischte Gesellschaft: Neben einigen jüdischen Insassen auch Sozialisten, Freimaurer, Nationalisten, Katholiken und tatsächliche oder angebliche Mitglieder der Résistance. Es waren Alte und Junge, Kranke und Gesunde, Franzosen und Ausländer, Juden und Christen. Es waren zähe, tapfere Burschen unter ihnen wie auch Feiglinge und Opportunisten. Sosehr wir uns auch voneinander unterschieden, es gab eine Gemeinsamkeit: Alle hatten wir Verwandte in den USA, in der Schweiz oder Schweden, reiche Verwandte, die uns mit Dollars freikaufen sollten, womit die Dewako wiederum ihre Einkäufe finanzierte. Die Summen wurden willkürlich festgesetzt und laufend erhöht. Es ergab sich der zwingende Verdacht, daß einige Dewako-Bedienstete auch und zunehmend in die eigene Tasche arbeiteten.
Das Unternehmen, in dessen Vorstand aus Tarnungsgründen auch zwei französische Kollaborateure saßen, war eine Tochterfirma der ›Deutschen Ausrüstungswerke GmbH‹, die über blendende Beziehungen zur Pariser Außenstelle des Reichssicherheitshauptamts in Berlin verfügte und dadurch den Menschenhandel ankurbeln konnte. Sipo und Gestapo trieben bei Razzien brutal Tausende von Menschen zusammen, und Vertreter der Dewako oder in ihrem Auftrag handelnde Offiziere tasteten oft nur flüchtig und willkürlich ihren ›Marktwert‹ ab, er wurde von Verhör zu Verhör, je nach Solvenz unfreiwilliger Finanziers aus Übersee, erhöht und über das neutrale Ausland in US-Währung eingetrieben. Erst nach Eingang des Lösegeldes wurden dann die Freigekauften auf Schleichwegen aus Frankreich hinausgeschafft, wobei die Dewako – um ins Geschäft zu kommen – auch einige Vorleistungen erbracht hatte.
Nunmehr aber hieß es: Geld oder Leben. Der Handel wurde über eine Genfer Anwaltsfirma, deren Namen ich nicht kenne, abgewickelt. Beauftragte der Dewako fuhren in regelmäßigen Abständen in die. Schweiz, um die Dollars persönlich in Empfang zu nehmen. Selbstverständlich gab es bei dieser Art Geschäfte keine Belege, keine Buchung und keinen Schriftverkehr. Da die Dewako auch noch Diskretion für die ›Vereinbarung‹ verlangte, war der Zahlungsmodus kompliziert. Meistens schaffte ein Kurier aus den USA in seinem Handgepäck die abgepreßte Summe als Bargeld in die Schweiz. Die genauen Zusammenhänge erfuhr ich von Joseph.
Er war nicht bei der US-Army, sondern tauchte zu meinem Entsetzen mit einem Schub Gefangener auf, der hier eingeliefert wurde. Er war – wie ich erst später erfuhr – mit einer ganz speziellen Aufgabe aus England mit dem Fallschirm über Frankreich abgesprungen und später aufgeflogen – nicht als Agent, sondern als Ausländer. Als seine Häscher erfuhren, daß er Jude war, interessierten sie sich nur noch dafür. Mein Bruder und ich sprachen niemals deutsch miteinander; wenn die Vernehmenden nicht Französisch oder Englisch konnten, wurde ein Dolmetscher zugezogen.
Die Gefangenen wurden nur noch von ihrem Selbsterhaltungstrieb beherrscht; es kam zu fürchterlichen Szenen. Um ihr Leben zu retten, hatten sich einige Häftlinge reiche US-Verwandte zugelegt, die es gar nicht gab. Andere wiederum, die ihre Freikaufchance nicht erkannten, spielten das elterliche Vermögen herunter, um es unangetastet zu lassen. Auch Joseph und ich machten in der ersten Haftzeit die Firma Greenstone viel kleiner, als sie war, weniger um Geld zu sparen Vater hätte zähneknirschend den Nazis für unsere Rettung sicher den letzten Cent gegeben –, sondern weil wir uns schämten, dem Schicksal der anderen nur durch das Geld unseres Vaters zu entgehen.
Joseph dachte von Anfang an klarer, härter und logischer als ich. Er überzeugte mich, daß mit einer heldenhaften Geste niemandem gedient wäre, am wenigsten unseren Eltern, und so einigten wir uns mit Obersturmführer Dumbsky auf eine Kopfprämie von je 100000 Dollar. Wir schwebten Wochen, die uns wie Monate vorkamen, zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Schließlich wurden wir erneut zum Verhör abgeholt. Dumbsky erklärte uns, daß wir das Vermögen unserer New Yorker Firma falsch angegeben hätten und sich die Dewako deshalb nicht mehr an die Vereinbarung gebunden fühle. Er erhöhte die Freikaufsumme auf je 200000 Dollar und verlangte, daß wir unverzüglich in handschriftlichen Briefen unsere Eltern beschworen, das Geld auf schnellstem Weg aufzubringen und nach Genf zu transferieren. ›Andernfalls‹, sagte Dumbsky, müßte ich Sie zu meinem Bedauern nach Polen verschuben lassen. ‹ Er deutete es nicht an, aber sein Gesicht ließ erkennen, daß Polen für uns das Ende wäre: ›Und zwar heute noch‹, sagte er. › Welche Garantie hätten wir‹, fragte Joseph, ›daß Sie nicht noch einmal mehr Geld verlangen?‹
›Mein Wort‹, erwiderte Dumbsky.
Joseph schwieg, und auch ich wußte keine Antwort.
›Ich weiß‹, setzte der Obersturmführer hinzu: ›Bei der Art Ihrer Geschäfte ist es wohl nicht üblich. ‹ Mit einem zynischen Lächeln stellte er fest: ›Aber bei uns gilt noch der Handschlag. ‹
Wir zögerten, um nicht zu einer weiteren Neufestsetzung einzuladen. Da trat Hauptsturmführer Eckel in Aktion, ein grobschlächtiger Kerl mit niedriger Stirn, tückischen Augen, unter unseren Peinigern zuständig für unsagbar sadistische Quälereien, an denen er offensichtlich auch noch Freude hatte.
Joseph und ich mußten zusehen, wie Eckel – Dumbsky im Hintergrund rührte keine Hand dabei – den Neffen eines internationalen Bankiers mit den Stiefeln buchstäblich tottrat. Wir erlebten, daß er Ehepaare auseinanderriß – nur um die Zahlungsfrist zu verkürzen oder das Lösegeld zu verdoppeln, ließ er den Mann in die Zelle zurückführen und die Frau nach Drancy zurückschaffen oder auch umgekehrt.
Einmal zeigte uns Eckel am Morgen Häftlinge, die sich über Nacht an der Heizung erhängt hatten – dann gab er uns das Briefpapier.
Nach drei Tagen schrieben wir, jeder für sich, den Text, der uns abverlangt wurde. Von da ab wurden wir in Ruhe gelassen, bis die äußerst knapp gesetzte Frist für das Eintreffen des Geldes abgelaufen war. Dann sagte Dumbsky, daß es sehr peinlich für uns werden könnte, wenn die Dollars jetzt nicht binnen dreier Tage da wären, und Eckel übersetzte in Klartext, daß wir in diesem Fall ›durch den Kamin gejagt‹ würden. Mitten in der Vernehmung begann er auf mich einzuschlagen, aber ein Zivilist namens Saumweber, ein wuchtiger Mann mit weizenblonden Haaren und blauen Augen, trat dazwischen. Ich fiel nicht darauf herein; offensichtlich waren es abgesprochene Rollen, echt waren wohl nur die sadistischen Einlagen Eckels und der unterkühlte Haß Dumbskys.
Nach drei Tagen tat sich gar nichts. Weder war das Lösegeld eingetroffen, noch ließen sich unsere Peiniger sehen. Den Betrag hätte unser Vater jederzeit flüssig machen können, aber Postverbindung und Reiseverkehr waren im Krieg umständlich, und der Zwangsumweg über Genf kostete zusätzliche Zeit. Wir hofften, Dumbsky hätte sein Ultimatum vergessen – aber dann wurden wir plötzlich aus den Zellen gezerrt und in das Vernehmungszimmer gebracht, wo Eckel wieder seinen Part übernahm. Er war gerade dabei loszuschlagen, als ein hochgewachsener, sehr gut aussehender Mann erschien, der mit Sturmbannführer angesprochen wurde, obwohl er Zivil trug; er hieß Lindenbach, Lindsberg oder so ähnlich. Der Mann ließ sich fast nie sehen, aber seinem ganzen Auftreten nach erkannten wir auf den ersten Blick, daß es sich um den Chef der Dewako handeln mußte, die ihren der Repräsentation dienenden Hauptsitz auf den Champs-Élysées hatte.
Alle drei sprangen auf, und Eckel machte als Dienstältester Meldung.
Der Zivilist nickte lässig: ›Warum denn am frühen Morgen schon so aufgeregt, Hauptsturmführer?‹ fragte er und streifte uns mit einem Blick ohne jedes Interesse: ›Wer sind diese Leute?‹ fragte er.
›Abraham und Esau‹, erwiderte Eckel. ›Der Stolz des gelobten Landes.‹
›Und?‹
›Brüder‹, sagte Eckel giftig. ›Als ob nicht einer von denen schon genug wäre.‹
›Zahlungsverzug‹, schaltete sich Dumbsky ein. ›Im Interesse eines reibungslosen Geschäftsablaufs sollten wir natürlich diese Terminüberschreitungen nicht ins Uferlose …‹
›Dann erhebt einen Säumniszuschlag‹, erwiderte der Mann.
›Längst geschehen. ‹ Dumbsky lächelte schief: ›Und in durchaus angemessener Höhe.‹
›Na also‹, entgegnete der Besucher. ›Mit den Herren geht es wie mit dem Wein: der wird auch jeden Tag wertvoller.‹
›Wenn er nicht verdirbt‹, maulte Eckel. ›Ich muß mit Ihnen reden, Sturmbannführer. So geht’s nicht weiter …‹
›Apropos Wein‹, erwiderte der Chef. ›Ihr seid vielleicht schlechte Gastgeber geworden. ‹ Er ging voraus, öffnete die Tür zum nebenan liegenden Konferenzzimmer, auf dem Weg zum Getränkeschrank.
Keiner kümmerte sich um uns. Wir blieben wie vergessen zurück. Wir konnten hören, daß sie tranken, alten Cognac am frühen Morgen, und wir verfolgten jedes Wort des Gesprächs durch die offene Tür, denn keiner der Teilnehmer wußte, daß wir deutsch wie Deutsche sprechen konnten.
›Santé!‹ sagte der Chef der Menschenhandelsgesellschaft zu seinen Lieferanten: ›Also, dann schießen Sie mal los mit Ihren Beschwerden, Eckel. ‹