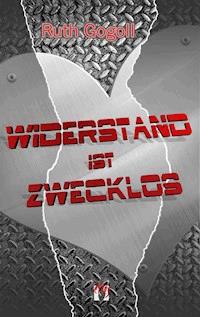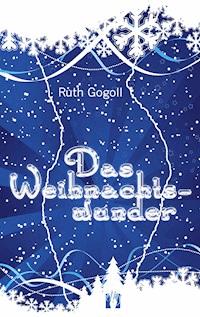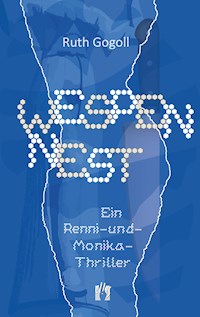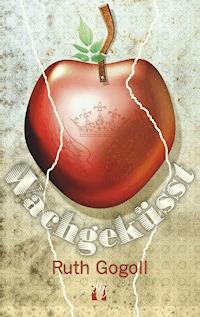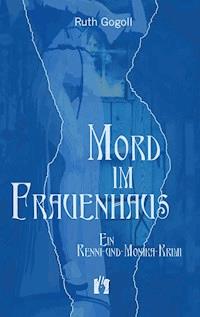Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: édition el!es
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
"Eine Tote in der Bibliothek!", ruft die Bibliothekarin des beschaulichen Dorfes Oberwahrdingen am Bodensee aufgeregt. Henrietta Murbel eilt mit wehendem Cape herbei, doch zwischen den Bücherregalen liegt keine Tote, sondern eine Schaufensterpuppe. Sofort ist Henriettas Neugier geweckt. Wer deponiert eine Schaufensterpuppe in einer Bücherei? Henriettas kriminalistisches Gespür wird erst recht gefragt, als eine tatsächliche Tote aus dem Bodensee gezogen wird und die Spur zum Mörder nach Oberwahrdingen führt – sehr zum Missfallen ihres Neffen Tassilo, der als Kriminalkommissar offiziell die Ermittlungen leitet und mit seiner schnüffelnden "Tante Henry" so gar nichts anfangen kann ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ruth Gogoll
HENRIETTA MURBEL UND DIE SCHAUFENSTERPUPPE
Ein Cosy-Krimi
© 2018édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-95609-261-9
Coverfoto:
1
»Frau Murbel! Frau Murbel!«
Aufgeregte Rufe hallten durch die Dorfstraßen von Oberwahrdingen.
»Was ist denn, Frau Strenger?« Henrietta Murbel, die gerade energischen Schrittes und mit wehendem Cape die kleine Hauptstraße überquert hatte, drehte sich um und runzelte die Augenbrauen.
Dora Strenger kam keuchend bei ihr an und bewahrte mit einer Hand ihr pochendes Herz davor, aus der Brust zu springen und ihren wallenden Busen zu überholen. »Eine Tote in der Bibliothek!«
»Verwechseln Sie das nicht vielleicht mit dem Buch von Agatha Christie?« Henrietta runzelte die Stirn noch mehr, nun eindeutig missbilligend.
»Nein, nein.« Frau Strenger keuchte erneut heftig, diesmal aus Protest. »Kein Buch. Ich habe sie gesehen!«
»Tatsächlich?« Henrietta konnte es kaum glauben. So etwas Unwahrscheinliches passierte einfach nicht in ihrem kleinen Dorf. »Sind Sie auch ganz sicher? Was genau haben Sie gesehen?«
»Ich war –« Frau Strenger keuchte erneut und brach ab. »Ich war«, fuhr sie dann unter heftigem Atemholen fort, »gerade eben noch in der Stadtbücherei – Sie wissen ja, ich habe Ihnen extra Gullivers Grabmal zurückgelegt –, und nachdem Sie es abgeholt hatten, wollte ich schließen. Da plötzlich –«, sie wurde noch bleicher, als sie es schon war, »sah ich einen weißen Fleck hinter einem Regal. Ich dachte, ein Buch wäre heruntergefallen, aber . . . aber –«
»Ja, was denn nun?« Henrietta tippte ungeduldig mit dem Fuß auf.
»Es war kein Buch!«, stieß Frau Strenger hervor, als ob es das Letzte wäre, was sie je sagen würde.
»Das hätte ich jetzt aber überhaupt nicht erwartet«, bemerkte Henrietta ironisch. »Ich will nicht wissen, was es nicht war, sondern was es war!«
»Ein Fuß.« Frau Strenger schauderte. »Ein Fuß in einem weißen Damenschuh.«
»Nur . . . ein Fuß?«, fragte Henrietta zögernd.
»Ich . . .« Dora Strenger blickte zu Boden. »Ich bin Ihnen dann sofort nachgelaufen. Mehr habe ich nicht gesehen.«
»Frau Strenger!« Henriettas Stimme zitterte vor Empörung. »Statt der armen Frau zu helfen, die vielleicht nur in Ohnmacht gefallen ist, laufen Sie mir hinterher und erzählen mir etwas von einer Leiche?«
Dora Strenger wagte kaum aufzublicken. »Ich . . . ich dachte . . . es könnte doch ihr . . .«
»Also wirklich, Frau Strenger!« Henrietta machte ein missbilligendes Geräusch. »Dann lassen Sie uns einmal nachschauen, was da wirklich los ist. Wahrscheinlich ist die arme Frau längst wieder zu sich gekommen und verschwunden. Sie sollten sich schämen.«
»Das tue ich.« Frau Strenger schaute sie verlegen von der Seite an.
»Dann los!« Henriettas Cape wehte über die halbe Hauptstraße, als sie sich umdrehte. »Zurück zur Bücherei!«
Nachdem sie am Haupteingang angekommen waren, zog Frau Strenger ihr Schlüsselbund heraus, das eher dem einer Schlossherrin glich. Sie hatte eine Unmenge riesiger altertümlicher Schlüssel an einem Ring vereint.
»Sie haben abgeschlossen?«, fragte Henrietta. Ihre Stimme klang ziemlich tadelnd. »Ich dachte, Sie wären mir quasi in Panik gefolgt.«
»Ja, ich . . .« Die arme Dora fand den Schlüssel nicht und wurde immer nervöser.
»Geben Sie her!« Henrietta nahm ihr die Schlüssel ab, fand sofort den richtigen und steckte ihn ins Schloss.
»Es war ein Reflex«, verteidigte Dora sich. »Ich mache das doch jeden Abend.« Es knarzte, als sie den Schlüssel herumdrehte. Sowohl Schloss als auch Schlüssel waren reichlich rostig.
Henrietta stieß die Tür auf, als Dora es nicht tat. »Es ist dunkel«, sagte sie.
Frau Strenger stolperte an ihr vorbei in den Raum und suchte nach dem Lichtschalter. Nachdem sie ihn gefunden hatte, wurde es auch nicht viel heller, aber zumindest konnte man den Fußboden erkennen.
»Und wo ist sie nun?«, herrschte Henrietta sie an.
»D-d-d-da!«, stotterte Dora, die im Vorraum stehengeblieben war und nach hinten in die Regale der Bücherei wies.
Henrietta rauschte an ihr vorbei. Ihr Cape streifte Doras leicht wirres Haar und ließ es wie Vogelfedern auffliegen. Die Bibliothekarin machte entschieden den Eindruck eines zerrupften Huhns.
»Wo genau?« Henriettas Stimme kam von hinten aus den dunklen Gängen. Sie selbst war nicht mehr zu sehen.
Frau Strenger tastete sich vorsichtig in den Gang hinein, der am Ausleihpult abzweigte. »Gleich hinter den historischen Romanen«, flüsterte sie mit unterdrückter Stimme, als ob sie darauf achten müssten, dass niemand sie hörte.
»Aha.« Ein leichtes Scharren, sonst nichts.
Dora tastete sich weiter in den Gang hinein. »Haben Sie sie gefunden?«, fragte sie leicht zitternd.
»Ja.« Henriettas Stimme klang fest. »Habe ich.«
Im nächsten Moment blitzte etwas hinten im Gang auf, und Henrietta kam mit bestimmtem Schritt auf Dora zu. »Meinen Sie das hier?«
Frau Strenger kniff die Augen zusammen. Sie wollte gar nicht sehen, was Henrietta ihr da zeigte.
»Machen Sie die Augen auf«, befahl Henrietta, und zu ihrem üblichen bellenden Ton gesellte sich eine leichte Amüsiertheit. »Es ist nur eine Schaufensterpuppe.«
»Eine Schaufensterpuppe?« Doras Augen öffneten sich weit.
»Ja, eine Schaufensterpuppe.« Henrietta schmunzelte. »Die hat Sie so erschreckt. Das war Ihre Leiche.«
»Gottseidank!« Dora atmete erleichtert aus. »Und ich dachte schon –«
»Das haben Sie mir erzählt, was Sie dachten«, seufzte Henrietta und stellte die Puppe an der Wand ab.
Es war eine elegant gekleidete Schaufensterpuppe, ganz in gedecktem Weiß, vom Sommerhut über das damenhafte Kostüm bis zu den Schuhen.
»Aber . . .« Dora kämpfte noch um ihre Fassung. »Was macht sie hier? Ich meine . . . es . . . also . . . die Puppe.«
»Sie sind die Leiterin der Bücherei«, sagte Henrietta. »Sie müssen es doch wissen.«
Dora Strenger hob die Hände. »Ich weiß gar nichts. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich meine, nicht hier . . .«, sie geriet ins Stottern, »in der . . . zwischen den Büchern.«
»Da gehört sie ja auch nicht hin«, blaffte Henrietta. »Irgendjemand muss sie mitgebracht haben.«
»Ja.« Dora starrte in das bewegungslose Gesicht der Plastikfigur. »Irgendjemand muss sie mitgebracht haben.«
»Und Sie haben nichts gesehen?«
»Nichts.« Dora zuckte die Schultern. »Eigentlich sehe ich jeden, der hereinkommt oder hinausgeht. Die Glocke läutet ja auch. Ich hätte ihn sehen müssen.«
»Ihn?« Henrietta schaute sie an. »Sie denken, es war ein Mann?«
»Ich . . . nein . . .« Dora legte die Stirn in angestrengte Falten. »Ich meine, na ja, es könnte natürlich auch eine Frau gewesen sein. Aber ich habe beide nicht gesehen.«
»Beide?« Henrietta schmunzelte. »Jetzt sind es schon zwei?«
»Sie bringen mich ganz durcheinander, Frau Murbel!« Dora Strenger ließ sich auf einen Besucherstuhl fallen. »Eins, zwei – ich weiß es nicht!«
»Gut.« Henrietta betrachtete noch einmal eingehend die Figur. »Vorerst ist die Sache also ein Rätsel.« Sie strich über das elegante Kostüm. »Sie erinnert mich an jemanden«, sagte sie nachdenklich. »Ich weiß nur nicht –« Sie brach ab und schaute die Figur an, als ob sie erwartete, dass sie mit ihr sprechen würde.
»Ach.« Frau Strenger stand durchatmend auf. »Es tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe, Frau Murbel. Ich dachte wirklich –« Sie verzog verlegen das Gesicht. »Aber da es nun ja nur eine Puppe ist, kann ich wieder abschließen. Wir können gehen. Morgen holt sie bestimmt jemand ab. So etwas vergisst man doch nicht so einfach irgendwo.«
»Das würde ich auch sagen«, nickte Henrietta. »Sicher holt sie jemand ab.«
Aber dennoch betrachtete sie die Figur misstrauisch, als sie die Bücherei verließen.
2
Die ganze Nacht über ließ ihr diese Angelegenheit keine Ruhe. Es war so harmlos. Eine Puppe. Aber irgendwie spürte sie etwas dahinter, das nicht harmlos war. Es war nur ein Gefühl, doch sie wusste, dass ihre Gefühle sie selten getrogen hatten, weil sie auf Erfahrung beruhten.
Vor allem Männer nannten diese Gefühle weibliche Intuition und lachten darüber, aber Intuitionen speisten sich immer aus Tatsachen. Es gab keinen Rauch ohne Feuer.
Normalerweise konnte sie einordnen, was in ihrem Dorf geschah. Sie kannte alles und jeden – bis auf die Touristen, die im Sommer die Ufer des Bodensees überfluteten, aber die zählten nicht – und konnte sich immer einen Reim darauf machen.
So etwas wie mit dieser Puppe war noch nie vorgekommen, aber es erinnerte sie an etwas. An jemanden. Ein rothaariger Junge, der anderen immer gern Streiche gespielt hatte, erschien vor ihrem inneren Auge. Der Sohn des Metzgers, der stets mit seinem Bernhardiner herumlief, einem riesigen, aber äußerst gutmütigen Tier. Schon allein deshalb, weil er diesen Hund so liebte, konnte dem Uli Engel – einen unpassenderen Namen hätte sich niemand einfallen lassen können – keiner böse sein. Und Uli war auch nicht böse. Dennoch machten seine Lehrerinnen drei Kreuze, als er auf die höhere Schule in der Kreisstadt wechselte.
War dies wirklich nur ein Dummer-Jungen-Streich?
Irgendwie hatte sie nicht das Gefühl.
Sie musste sich Gewissheit verschaffen.
»Sie hatten letztens so ein hübsches Kostüm im Fenster.« Henrietta schaute sich zwanglos in dem kleinen, gepflegten Laden um. Hier wurden hauptsächlich hochpreisige Kleidungsstücke verkauft, vor allem an Touristinnen, aber auch Henrietta selbst hatte hier schon das eine oder andere erstanden. »Ich sehe es nicht mehr. Haben Sie es verkauft?«
»Leider nicht.« Eine Angestellte, die sich bisher diskret im Hintergrund gehalten hatte, trat gemessen – es sollte sicherlich auf keinen Fall so aussehen, als wollte sie die Kundin zu etwas drängen, schon gar nicht zu einem Kauf. So ein Verhalten hatte dieses Geschäft nicht nötig, sie waren ja schließlich kein Ramschladen – auf sie zu. »Es ist verschwunden.«
Henrietta hob die Augenbrauen. »Verschwunden?«
»Wir vermuten, es wurde gestohlen.« Die Angestellte runzelte die Stirn, wurde sich dessen aber sofort bewusst und glättete sie wieder. Sie war bereits über vierzig, und in ihrem Beruf konnte sie sich keine Falten leisten. Sie schüttelte verständnislos den Kopf. »Inklusive der Schaufensterpuppe, die es trug. Niemand kann sich das erklären. Ein teures Accessoire verschwindet vielleicht schnell einmal in einer Handtasche – nicht bei uns natürlich«, schränkte sie sofort ein. »Solche Kundinnen haben wir nicht. Aber wer stiehlt denn eine Schaufensterpuppe mit allem Drum und Dran?«
Mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck schaute Henrietta sie an. »Ja, das ist die Frage.« Sie lächelte leicht. »Sie würden sich sicher freuen, das Kostüm wiederzubekommen, nicht wahr?«
Die Angestellte wirkte erstaunt. »Meine Chefin wäre begeistert. Aber es ist wohl kaum zu erwarten, dass der Dieb die Ware noch hat.«
»Der Dieb vielleicht nicht . . .« Henrietta schmunzelte in sich hinein und nickte der Angestellten dann zu. »Ich komme später wieder.«
Kurze Zeit darauf betrat sie die Stadtbücherei. »Frau Strenger!« Sie blickte hinter die Theke, wo Dora Strenger normalerweise saß. Ihr Platz war leer. »Wo sind Sie denn?« Sie reckte den Kopf wie ein neugieriger Papagei, um eventuell hinter die Regale schauen zu können.
»Ich komme . . . Komme ja schon«, keuchte die atemlose Stimme der Bibliothekarin, die wie eine taumelnde Blüte im Wind aus den Tiefen der dicht zugestellten Gänge auftauchte. »Bin schon da, Frau Murbel. Ich war ganz hinten –«
Mit einer Handbewegung schnitt Henrietta ihr das Wort ab. »Wo ist die Puppe?«
»Puppe?« Dora Strenger sah aus, als hätte sie das Wort noch nie gehört.
»Die Schaufensterpuppe«, drängte Henrietta ungeduldig. »Die Sie mir gestern gezeigt haben. Die mit dem weißen Kostüm.«
»Ach so, die. Ja . . .« Dora blickte sich argwöhnisch um, als müsste sie sich vor ungewollten Lauschern hüten. Dann senkte sie ihre Stimme zu einem Flüstern. »Es hat sie noch niemand abgeholt.«
»Das dachte ich mir.« Henriettas Ungeduld wuchs. »Ich glaube, ich weiß, wo sie hingehört.« Sie blickte Dora auffordernd an, die aber nicht verstand. »Könnten Sie sie vielleicht holen?«, fügte sie seufzend hinzu.
»Holen? Ja. Holen.« Dora Strenger drehte sich um und taumelte gehorsam in den Gang zurück, aus dem sie gekommen war.
Henrietta atmete tief durch. Manchmal war es schon mühsam.
»Da ist sie ja!« Es war fast, als würde Regine Ducker-Hemringhausen eine alte Freundin begrüßen. Mit ausgebreiteten Armen kam die Boutiquebesitzerin auf Henrietta und Dora zu.
Letztere trug die Puppe und stolperte fast über deren Füße ebenso wie über ihre eigenen.
»Passen Sie doch auf, Frau Strenger!«, blaffte Henrietta. »Ich dachte, ich bringe sie Ihnen zurück«, wandte sie sich etwas freundlicher an die Herrin des Ladens, den sie gerade betreten hatten. »Ich hörte, Sie haben sie bereits vermisst.«
Regine Ducker-Hemringhausen blieb stehen und betrachtete das Kostüm, das die Puppe trug, entsetzt. »Mein Gott, das ist ja völlig ruiniert!« Sie warf einen vernichtenden Blick auf Dora.
Die sank sofort in sich zusammen, aber Henrietta erklärte entschieden: »Dafür sind wohl diejenigen verantwortlich, die die Puppe gestohlen und dann einfach in der Stadtbücherei auf den Boden geworfen haben. Wir . . . das heißt, Frau Strenger . . . haben sie nur gefunden. Und zurückgebracht.«
»Na ja . . .« Die äußerst elegant zurechtgemachte Boutiquenbetreiberin in mittleren Jahren blickte fast etwas mit Widerwillen erneut auf das Kostüm, nahm den Stoff am Ärmel in die Hand, prüfte ihn und bemerkte: »Da fehlt ein Finger.«
»Er ist abgebrochen«, nickte Henrietta. »Das habe ich auch festgestellt. Er befand sich jedoch nicht neben der Lei- . . . ich meine: neben der Puppe. Er muss auf dem Transport verloren gegangen sein. Oder vielleicht schon hier im Laden.« Sie blickte sich suchend um.
»Sicher nicht! Der Laden wird jeden Tag peinlichst gesäubert!«, protestierte Frau Ducker-Hemringhausen empört. Unwillig schweifte ihr Blick zu den Füßen der Puppe, die Dora immer noch festhielt, damit sie nicht umkippte. »Wo ist der Ständer?«
»Der Ständer?« Es kam selten vor, aber Henrietta wirkte tatsächlich verblüfft.
»Die Puppe kann allein nicht stehen, das sehen Sie doch. Sie braucht dafür eine Stütze. Die ist auch verschwunden«, klärte Regine Ducker-Hemringhausen auf.
»Sie ist nicht hier im Laden?« Henriettas Blick schweifte über verschiedene Puppen, aber sie hatten alle nur einen Ständer, nicht zwei. Und allein stand auch keiner herum.
»Hätte ich Sie sonst danach gefragt?«, fauchte die diätgestählte Dame in den hochhackigen Schuhen ungnädig.
»Nun, mit dem Ständer können wir leider nicht dienen«, teilte Henrietta ihr mit blitzenden Augen mit. Ihre Geduld hatte definitiv Grenzen. »Wir haben nur das hier gefunden.« Sie wies auf die Puppe. »Sie können sich nicht erklären, wie sie in die Bücherei geraten ist?«
»Na, ich habe sie dort bestimmt nicht hingebracht!«, schnappte die Dame und schnappte sich gleichzeitig die Puppe, mit der sie hinter einem dunklen Vorhang verschwand.
Dora stand wie vom Blitz getroffen da, die Hände immer noch ausgestreckt, als würde sie die Puppe halten, und stumm, aber Henrietta ließ ihren Gefühlen freien Lauf. »So was nennt man wohl Dankbarkeit!« Sie schüttelte heftig den Kopf. »Vielleicht hätten wir die Puppe einfach behalten sollen. Oder sie gleich zur Polizei bringen.«
»Zur Polizei?«, hauchte Dora. »Aber warum denn zur Polizei?«
»Irgendetwas an der Sache ist absolut nicht koscher«, stellte Henrietta stirnrunzelnd fest. »Ich kann noch nicht den Finger drauflegen, aber irgendetwas ist faul.«
»Faul?«, echote Dora erneut.
Henrietta warf ihr einen tadelnden Blick zu. »Müssen Sie immer wiederholen, was ich sage?«
Dora sank noch mehr in sich zusammen.
»Ach, kommen Sie schon. Ich kann gar nicht sehen, wie Sie da herumstehen wie ein Häufchen Elend«, grummelte Henrietta gutmütig. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie wusste, wie verschüchtert Dora ohnehin schon war, und sie trotzdem immer noch anraunzte. Das war eben ihre Natur. »Wir gehen einen Kaffee trinken. Im Marktcafé gibt es heute frischen Käsekuchen.« Ohne auf ihre Antwort zu warten, fasste sie Dora entschlossen am Arm und zog sie mit sich zur Tür.
Es waren nur ein paar Schritte bis zum Marktcafé, und nachdem sie sich gesetzt und Kaffee und Kuchen bestellt hatten, fuhr Henrietta mit ihren Gedanken fort, als wäre sie nie unterbrochen worden. »Überlegen Sie doch mal«, sagte sie. »Eine Schaufensterpuppe inklusive einer sehr kostspieligen Ausstattung wird gestohlen. Doch statt das teure Kostüm zu verkaufen oder an seine Freundin zu verschenken oder sonstwie Kapital daraus zu schlagen, entsorgt der Dieb Puppe samt Fünfhundert-Euro-Pumps und allem anderen in einer Bücherei. Bis auf einen abgebrochenen Finger und den Ständer. Ist das nicht merkwürdig?«
»Na ja . . .« Dora Strenger schien nicht so sicher.
»Es ist merkwürdig!«, entschied Henrietta. »Wenn er schon alles mitgenommen hat, warum hat er dann nicht auch alles in der Bibliothek gelassen? Der Finger . . . der ist bestimmt abgebrochen, ohne dass er es bemerkt hat. Aber der Ständer . . . So klein sind die Dinger nicht. Den hat er nicht einfach so verloren. Das glaube ich nicht.«
»Vielleicht hat er ihn gebraucht?«, vermutete Dora.
Henrietta schüttelte den Kopf. »Die sind ziemlich speziell, diese Dinger. Für was anderes kaum zu gebrauchen. Außer er wäre ein Bastler oder so etwas. Aber wer bricht schon in ein Modegeschäft ein, um sich Basteldraht zu besorgen?«
Über diese Frage schien Dora ernsthaft nachzudenken.
Der Kuchen kam mit zwei dampfenden Tassen Kaffee, und sie begannen zu essen.
Doch schon nach dem ersten Bissen stach Henrietta mit der Kuchengabel in die Luft. »Ich hab’s!«
Doras Gabel verharrte mit dem Kuchenstück, das sie sich gerade hatte zuführen wollen, direkt vor ihrem Mund. Ihre Augäpfel drehten sich nach oben, um Henrietta anschauen zu können. Es sah ein bisschen so aus, als wäre sie ein Chamäleon.
»An dem Ständer klebt Blut!«, fuhr Henrietta triumphierend fort.
»Blut?« Das Echo war zurück.
»Nun ja, bildlich gesprochen«, schränkte Henrietta ein. »Er ist ein Beweis für irgendetwas. Blut oder nicht Blut, das ist belanglos. Aber hätten wir den Ständer, wüssten wir wahrscheinlich, was passiert ist.«
»Aber was soll denn passiert sein? Die Puppe ist wieder dort, wo sie hergekommen ist. Den Finger kann man reparieren und den Ständer ersetzen. Dann ist alles wieder so wie vorher.« Doras Gedankenwelt unterschied sich offensichtlich sehr von Henriettas.
Was man schon am nächsten Satz merkte. »Das wäre aber kaum interessant«, entgegnete sie. »Und ich glaube auch nicht, dass es so harmlos ist.«
»Ihr Neffe hat gesagt –«
»Mein Neffe!«, unterbrach Henrietta Doras schüchternen Versuch, und ihr Gesicht erhellte sich plötzlich, als wäre es mit einem Scheinwerfer erleuchtet worden. »Sie sind ein Schatz, Dora! Ein Schatz!« Wie ein aus einer Schachtel springender Clown schnellte sie hoch. »Essen Sie mein Stück auch. Ich muss weg!«
Und mit wehendem Cape jagte sie wie ein mittelalterlicher Herold über den Marktplatz davon.
Dora Strenger blieb verdattert sitzen, aber dann fuhr sie sich mit einem erwartungsvollen Lächeln verzückt über die Lippen.
Sie liebte Käsekuchen.
3
»Nein, Tante Henry! Nein, nein und nochmals nein!«
»Aber mein Junge . . .«
»Es hat sich ausgejungt.« Kommissar Tassilo Bluhm blitzte seine Lieblingstante – nun ja, es war seine einzige – an und beugte sich über seinen Schreibtisch, um sie Auge in Auge anzustarren. »Ich habe dir schon das letzte Mal gesagt, du sollst die Finger von solchen Sachen lassen. Entweder es ist eine Sache für die Polizei oder es geht niemanden etwas an, weder dich noch uns.« Er ließ sich schwer zurückfallen. »Ich habe wirklich genug zu tun! Auch ohne dass du noch Verbrechen erfindest.«
»Ich erfinde nichts.« Henrietta blitzte mit derselben blauen Augenfarbe zurück, die auch ihrem Neffen eigen war. »Da ist etwas. Ich kann es riechen!«
»Dann bring mir einen Beweis, der riecht. Oder besser noch: Fingerabdrücke. Und wie wäre es mit einem Motiv? Oder einem Verdächtigen? Einem Opfer?« Er blickte sie streng an. »Eine Schaufensterpuppe in der Bibliothek. Das kann’s ja wohl nicht sein.«
»Das ist es auch nicht«, erwiderte Henrietta überzeugt. »Das ist nur die Spitze des Eisbergs.«
»Schau mal, Tante Henry . . .« Schon als Kind hatte der kleine Tassilo – das bedeutete glänzend wie der Tag, und seine Mutter hatte diesen Namen mit Bedacht gewählt, denn Tassilos blondes Haar glänzte schon bei seiner Geburt wie die goldene Sonne – seine Tante mit dieser Abkürzung ihres Vornamens angesprochen, weil ihm der Rest einfach zu lang war. »Du musst doch einsehen, dass die Polizei nicht dazu da ist, Fälle zu verfolgen, die gar keine sind. Gib mir ein Verbrechen, und ich fange an zu ermitteln, aber ohne das . . .«, er hob die Arme, »sind mir die Hände gebunden.«
»Das weiß ich schon«, pflichtete Henrietta ihm für sie ganz untypisch bei. »Aber ich bin überzeugt, dass es hier ein Verbrechen gibt. Deshalb wollte ich ja bei dir nachfragen. Ihr habt keinerlei Anhaltspunkte?«
»Wofür?«, fragte Kommissar Bluhm zurück. »Anhaltspunkte wofür, Tante Henry? Einbruch, Diebstahl, Rauschgifthandel . . . oder vielleicht sogar Mord? Eventuell die Mafia?« Er lachte. »Nicht hier bei uns!«
»Nur weil wir an einem beschaulichen See leben, der im Winter ohne die Touristen fast wie ein Leichentuch wirkt – Apropos Leichentuch . . .« Henrietta blinzelte ihn unschuldig an.
Tassilo Bluhm stöhnte auf. »Bitte nicht, Tante Henry! Ich verspreche dir, Augen und Ohren offenzuhalten. Ich werde sogar bei der Polizeidirektion nachfragen – auch wenn die mich garantiert für verrückt erklären –, aber mehr kann ich wirklich nicht tun.« Er schaute sie flehend an. »Bitte, bitte, lass mich arbeiten! Schau dir meinen Schreibtisch an!« Er machte eine allumfassende Geste über die Papiere und Ordner, die die Tischplatte zum Verschwinden gebracht hatten.
»Na gut, mein Junge . . .« Henrietta stand auf und warf sich ihren Schal über die Schulter. »Ich will dich nicht länger stören. Aber wenn du etwas hörst . . . Du hältst mich doch auf dem Laufenden?«
Er hob die Augenbrauen. »Es gibt nichts, worüber ich dich auf dem Laufenden halten könnte. Abgesehen davon . . . bist du nicht bei der Polizei, und Polizeiermittlungen werden nicht an Zivilpersonen weitergegeben.«
»Das sagst du jedes Mal.« Henrietta lächelte verschmitzt, so dass die Fältchen in ihren Augenwinkeln sich belustigt runzelten. »Und dann . . .«
»Und dann . . . halte ich mich auch daran«, behauptete Tassilo Bluhm fest. »Wenn ich das nämlich nicht täte, wäre ich schon längst aus dem Dienst entlassen worden.«
»Was die Polizeidirektion nicht weiß, macht sie nicht heiß«, zwinkerte Henrietta und verschwand, bevor ihr Neffe einen Aktenordner nach ihr werfen konnte.
»Wir müssen die Zeit genauer eingrenzen«, verkündete Henrietta, als sie die Stadtbücherei betrat, in die auch Dora Strenger mittlerweile zurückgekehrt war. »Wann waren Sie zum letzten Mal an der Stelle, an der Sie später die Schaufensterpuppe gefunden haben, und die Puppe war noch nicht da?«
Dora zwinkerte mehrmals schnell hintereinander, weil Henrietta sie mit ihrem Eintritt völlig überrumpelt hatte. »Wie? Noch nicht da?«
»Drei kleine Wörter«, wiederholte Henrietta ungeduldig. »Noch . . . nicht . . . da.« Sie holte tief Luft. »Es ist hinter den historischen Romanen. Sie haben es gesehen, als Sie einen historischen Roman zurückgestellt haben, nicht wahr?«
Langsam erholte Dora sich. »Ja.« Sie nickte. »Der Page des Königs. Immer wieder schön.« Sie seufzte hingerissen.
»Was war der letzte historische Roman davor?«, fragte Henrietta. »Hat jemand im Laufe des Tages einen ausgeliehen oder zurückgebracht? Ich meine, außer Der Page des Königs.«
»Warten Sie . . .« Dora überlegte. »Ich müsste nachschauen. Ich bin nicht ganz sicher.« Sie blätterte in dem großen Ausleihbuch, das auf der Theke lag. »Nicht an dem Tag«, sagte sie. »Aber am Tag davor. Frau Haflinger. Sie hat mehrere Bücher ausgeliehen, zwei davon waren historische Romane.« Zerstreut schaute sie Henrietta an. »Als ich ihr die geholt habe, war noch alles normal. Kein weißer Schuh.«
»Und wann war das?«, fragte Henrietta. »Uhrzeit?«
Wieder konsultierte Dora das Buch. »Kurz vor Schluss.«
Henrietta schürzte nachdenklich die Lippen. »Das heißt, sie könnte in der Nacht hierher gebracht worden sein.«
»In der Nacht?« Dora wirkte verwirrt – was allerdings ja nichts Besonderes bei ihr war. »Aber da ist doch geschlossen.«
»Was Sie nicht sagen.« Henrietta runzelte die Stirn. »Wen interessiert das? Wenn jemand etwas entsorgen will, findet er Wege. Und ich habe das Gefühl, diese Puppe sollte entsorgt werden. Gibt es dahinten Fenster? Ich meine, Fenster, die groß genug sind, um so etwas hindurchzupraktizieren?«
»Fenster?« Echo war Dora Strengers zweiter Vorname.
Statt auf eine weitere Wiederholung zu warten, begab Henrietta sich nach hinten. »Aha!«, stellte sie zufrieden fest. »Na, das ist doch groß genug. Und mir scheint –« Sie trat auf das Fenster zu und stieß dagegen. »Genau. Es ist nicht richtig geschlossen.«
»Es ist nicht . . . aber . . . aber . . .« Dora, die ihr hinterhergekeucht war, schnappte nach Luft. »Das heißt, jeder könnte die Bücher –«
Henrietta lachte trocken auf. »Ich glaube, das ist im Moment unser geringstes Problem!«
»Aber . . . aber . . .« Dora war so erschüttert, dass sie nur noch stammeln konnte. »Es sind so schöne Bücher.«
»Natürlich.« Henriettas Gesicht nahm auf einmal einen gutmütigen Ausdruck an. »Das sind sie. Und ich bin auch froh, dass ihnen nichts passiert ist. Ich hätte nur ungern auf Gullivers Grabmal verzichtet.« Sie tätschelte Dora freundlich die Schulter. »Und Sie haben ganz recht. Wir wissen schließlich immer noch nicht, was das Ganze hier soll. Warum ausgerechnet die Bücherei als Ablageplatz – wenn man es so nennen will – ausgesucht wurde. Vielleicht hat derjenige, der die Puppe hier deponiert hat, tatsächlich eine Beziehung zu Büchern.«
»Sie meinen –« Dora starrte sie mit aufgerissenen Augen an. »Sie meinen, es ist vielleicht jemand, der hier Bücher ausgeliehen hat? Bei mir?« Es war, als ließe das ihre ganze Gestalt erbeben.
Henrietta zuckte die Schultern. »Möglich ist alles. Bis jetzt wissen wir gar nichts. Und wenn mich etwas ärgert«, sie presste ihre Lippen zu einem weißen Strich zusammen, »dann das. Diese Ungewissheit macht mich rasend. Hier ist etwas im Busch, das fühle ich. Wenn mein Neffe auch nichts auf Gefühle gibt, ich tue es. Sie haben mich noch nie getrogen. Im Gegensatz zu offensichtlichen Beweisen, die immer mit Absicht hinterlassen worden sein können.«
»Die Puppe ist ein Beweis, der absichtlich hinterlassen wurde?« Das schien Dora noch mehr zu verwirren.
»Niemand kann so etwas Großes lange übersehen«, überlegte Henrietta mit gerunzelter Stirn. »Ich glaube, sie sollte hier gar nicht versteckt werden. Sie sollte gefunden werden.« Die Falten auf ihrer Stirn wurden noch tiefer. »Die Frage ist jedoch, warum.«
»Der Herr Kommissar hatte dazu keine Idee?«, fragte Dora hoffnungsvoll.
»Der Herr Kommissar . . .«, Henrietta atmete tief durch, »hält mich für seine durchgeknallte Tante, die überall Gespenster sieht. Der wird uns keine große Hilfe sein.«
»Uns?« Dora begann wieder ihr Echo-Dasein aufzunehmen.
»Nun ja . . .«, erklärte Henrietta gedehnt, »immerhin haben Sie die Puppe gefunden. Und außerdem . . . sind wir doch ein gutes Team. Wenn wir gemeinsam überlegt haben, wer in einem Buch der Mörder sein könnte, hatten Sie immer wieder gute Ideen.«
»Wirklich?« Offenbar konnte Dora es kaum glauben, so gelobt zu werden. »Sie hatten zum Schluss immer recht, soweit ich mich erinnere.«
»Aber nur, weil Sie mir geholfen haben.« Henrietta lächelte wohlwollend auf sie hinunter. »Sie haben so ein Talent, immer die falsche Person sympathisch zu finden . . .«, ihr Lächeln wurde zu einem Schmunzeln, »dass man dann schon fast davon ausgehen kann, dass das der Mörder ist.«
4
»Wenn ich etwas ungern zugebe, dann . . .« Tassilo Bluhm warf seiner unbequemen Verwandten über seinen Schreibtisch hinweg einen grimmigen Blick zu, »dass du recht hast, Tante Henry.«
Henrietta hob überrascht die Augenbrauen. »Es ist also wirklich etwas passiert?«
»Ja.« Tassilo nickte grimmig. »Aber selbst du hättest es nicht verhindern können. Sie war schon tot, bevor du das erste Mal bei mir warst.«
»Sie? Wer?« Neugierig beugte Henrietta sich vor.
»Eine Touristin, wie es aussieht. In ihrem Personalausweis steht eine Adresse in Hamburg. Anscheinend war sie gerade erst angekommen, denn wir haben keine Zimmerreservierung gefunden. War wohl eine von denen, die mehr ins Blaue in Urlaub fahren und sich dann vor Ort ein Zimmer suchen.«
»Vom Nordmeer zum Schwäbischen Meer«, sinnierte Henrietta. »Man sollte meinen, dass Leute, die ohnehin am Meer wohnen, eher in die Berge fahren und umgekehrt.«
Tassilo zuckte die Schultern. »Manche Leute lieben Wasser eben immer und überall. Außerdem ist der See ja nun etwas anderes als der raue Atlantik da oben. Und Berge gibt es drumherum zur Genüge. Schließlich haben wir die Schweizer Alpen vor der Tür.«
»Zeitweise ist der See auch ganz schön rau«, erwiderte Henrietta. »So rau, dass Menschen sterben, die gerade mit ihrem Boot draußen sind.«
»Oder auch ohne Boot«, ergänzte Tassilo trocken. »Wie Annette Paulsen hier.«
»Da sie keine Zimmerreservierung hat . . .«, überlegte Henrietta weiter, »wollte sie vielleicht jemanden besuchen. Verwandte, Bekannte . . .«
»Könnte sein.« Tassilo nickte. »Aber darüber wissen wir bisher noch nichts. Auf den ersten Blick haben wir hier in der Gegend keine Verwandten gefunden. Aber Bekannte sind nicht so leicht zu ermitteln. Das könnte im Prinzip jeder sein.«
»Hat sie niemand gesehen?« Henrietta schaute ihren Neffen fragend an. »Sie hat sich nicht nach irgendeiner Adresse erkundigt, kein Taxi genommen?«
»So schnell geht das mit den Ermittlungen nicht«, wies er sie ärgerlich zurecht. »Wenn du nicht gerade mal wieder hier reingeschneit wärst«, seine blauen Augen blitzten, »wüsstest du ja auch noch gar nichts davon. Du hattest das Gefühl, es ist etwas passiert, und es ist tatsächlich etwas passiert. Dass ich dir das überhaupt sage, ist eigentlich schon zu viel.« Er setzte sich sehr aufrecht in seinen Stuhl. »Und dass es etwas mit deinem Gefühl zu tun hat, das glaube ich auch nicht. Solche Dinge passieren eben. Wenn auch bei uns nicht gerade oft.«
»Wie . . .«, Henrietta räusperte sich, »ist sie denn gestorben?«
»Erstochen«, gab Kommissar Bluhm widerwillig Auskunft. »Sie wissen noch nicht, womit. Sieht nicht nach einer der üblichen Stichwunden aus, Messer oder so. Die Gerichtsmedizin wird uns ihren Bericht schicken. Bis dahin wissen wir nicht, was die Tatwaffe war.« Er seufzte. »Und auch nicht, was für eine Tat es war. Es könnte auch ein Unfall gewesen sein.«
»Selbstmord auf jeden Fall nicht«, stellte Henrietta fest. »Wer ersticht sich schon, wenn er sich umbringen will?«
»Vor allem nicht von hinten«, fügte Tassilo nachdenklich hinzu, bereute es aber sofort, wie man seinem Gesichtsausdruck anmerkte.
»Von hinten?« Henrietta legte unverzüglich den Finger auf die Wunde. »Und das soll ein Unfall gewesen sein?«
»Es muss nicht immer Mord sein!«, entgegnete er abwehrend. »Nur weil du dauernd Kriminalromane liest, in denen das so ist.«
»Kannst du dir einen Unfall vorstellen, bei dem man von hinten erstochen wird?«, fragte Henrietta nüchtern, aber mit verräterisch glänzenden Augen.
»Natürlich«, schleuderte er ihr selbstbewusst entgegen. »Sie kann gestolpert und rückwärtsgefallen sein – auf einen spitzen Gegenstand, der sie dabei getötet hat.«
»Ist möglich«, gab Henrietta zu. »Aber warum ist dieser Gegenstand dann nicht da? Warum wurde er entfernt? Und von wem? Bei einem Unfall wäre das nicht nötig. Da ruft man die Polizei oder meinetwegen die Feuerwehr und versteckt sich nicht. Weder sich noch das unglückliche Werkzeug, das zum Tode dieser armen Frau geführt hat.«
Dagegen konnte Tassilo allerdings tatsächlich nicht direkt etwas einwenden.
»Wo ist es denn passiert?«, fragte Henrietta. »Wo wurde sie gefunden?«
»Gefunden . . .«, Tassilo zögerte, »wurde sie am See. Beim Wilden Mann. Am Anlegesteg.«
Die Gastwirtschaft Zum wilden Mann hatte eine Terrasse, die unmittelbar am Wasser lag, und wenn man wollte, konnte man darunter sogar mit einem Boot anlegen, um sich zum Abendessen zu begeben.
»Das ist aber nicht gerade ein versteckter Ort«, stellte Henrietta überrascht fest. »Von der Terrasse aus kann man da doch jeden sehen, der kommt oder geht. So einen Platz würde sich ein Mörder doch nie aussuchen.«
Man konnte regelrecht zuschauen, wie Tassilo Bluhm dagegen ankämpfte, etwas zu sagen, aber dann brach es doch aus ihm heraus. »Hat er auch nicht.«
»Aha.« Ein wissendes Lächeln überzog Henriettas Gesicht. »Sie wurde woanders ermordet und dann dort hingebracht. Bei Dunkelheit? Deshalb wurde ihre Leiche auch erst jetzt gefunden.«
»Erstens«, Kommissar Bluhm hob warnend einen Finger, »ist überhaupt noch nicht klar, ob sie ermordet wurde. Und zweitens . . .«, er seufzte, »hast du recht. Der Fundort war nicht der Tatort.«
»Und den Tatort kennt ihr nicht«, schloss Henrietta messerscharf aus seinem Zögern.
»Noch nicht«, betonte er. »Wobei von Tatort auch keine Rede sein kann. Wann begreifst du das endlich? Es könnte genauso gut ein Unfallort sein.«
»Könnte.« Henrietta wiegte zweifelnd den Kopf hin und her. Dann unterbrach sie die Bewegung abrupt und fragte: »Kann ich die Leiche sehen?«
Tassilo schnappte nach Luft.
»Also wirklich . . .«, bemerkte Henrietta tadelnd, als ob er noch ein kleines Kind wäre und sie eine Erwachsene, die ihm etwas erklären müsste, was er auch genauso gut selbst wissen könnte. »Sie ist tot, oder? Was kann sie schon daran stören?«
»Es geht doch nicht darum, ob es die . . . die Leiche stört.« Er kam geradezu ins Stottern vor lauter Empörung. »Du bist eine Zivilperson! Du hast hier im Präsidium überhaupt nichts zu suchen. Und im Leichenschauhaus schon mal gar nichts!«
»Und wenn ich sie identifizieren müsste?«, fragte Henrietta. »Ich könnte doch eine Verwandte sein oder so etwas.«
»Bist du aber nicht!«
Henriettas eines Auge blinzelte leicht, während das andere sich nur amüsiert verzog. »Das weiß doch aber niemand. Außer dir.«
»Nein, Tante Henry. Also nein. Nein, wirklich nicht.« Er schüttelte heftig den Kopf. »Du kannst ja eine Menge von mir haben, aber das nicht.«
»Warum nicht?«, fragte Henrietta. Sie seufzte. »Kannst du mir dann wenigstens den Autopsiebericht geben?«
Langsam verwandelte sich seine Empörung in ein ungläubiges Schmunzeln. »Sonst noch was? Du spinnst, Tante Henry. Das sind polizeiliche Dokumente. Die sind nicht für die Öffentlichkeit freigegeben.«
Erneut seufzte sie und atmete dann tief durch. »Du machst es mir aber wirklich nicht leicht.«
»Was? Was mache ich dir nicht leicht?« Er lachte. »Deine Ermittlungen, Frau Kommissarin? Wann bist du in den Polizeidienst eingetreten?«
»Meine Güte . . .« Als würde sie es nun aufgeben, ein widerspenstiges Kind zu erziehen, breitete Henrietta die Arme aus. »Was ist denn schon dabei? Ermittelt ihr denn überhaupt weiter, wenn ihr denkt, dass es ein Unfall war?«
Er legte leicht den Kopf schief. »Warum willst du unbedingt, dass wir weiterermitteln? Was ist dir so wichtig daran? Ich glaube nicht, dass du Annette Paulsen gekannt hast.«
»Ich habe einfach«, Henrietta verzog leicht das Gesicht, weil sie genau wusste, wie ihr Neffe darauf reagieren würde, was sie gleich sagen musste, »ein ungutes Gefühl dabei.«
»Ein Gefühl. Richtig.« Er nickte und schüttelte dann erneut den Kopf. »Hier geht es aber nicht um Gefühle, Tante Henry. Hier geht es um harte Tatsachen. Eine Frau ist tot. Es liegt keinerlei Hinweis darauf vor, dass sie ermordet wurde. Dennoch beschäftigen wir uns natürlich auch mit dieser Möglichkeit. Insbesondere, da die Leiche offensichtlich bewegt wurde. Das kann sie ja nicht allein getan haben. Aber«, er holte tief Luft, »das ist alles Polizeiarbeit. Und selbsternannte Detektivinnen mit Miss-Marple-Komplex können wir dabei nicht gebrauchen.«
Henrietta erstarrte. So respektlos hatte Tassilo eigentlich noch nie mit ihr gesprochen. »Miss-Marple-Komplex?«, fragte sie entgeistert.
»Das ist es doch, oder etwa nicht?« Er stöhnte auf. »Tante Henry . . . Ich will dir doch nichts Böses. Ich will dich nur davor bewahren, deine Nase zu tief in Angelegenheiten zu stecken, die dich nichts angehen. Und die eventuell gefährlich sein könnten.«
»Ha!« Henrietta sprang auf und stach mit ihrem Finger wie mit einem Degen in die Luft. »Du gibst es also zu! Es ist etwas Gefährliches daran. Es war kein Unfall.«
Schicksalsergeben seufzte er, diesmal, als wäre er der Erwachsene und Henrietta das Kind. »Ich gebe gar nichts zu. Ich bin hier nämlich kein Verdächtiger und schon gar nicht der Angeklagte. Ich mache meine Arbeit, sonst nichts. Und die kann immer gefährlich sein. Aber«, er beugte sich vor und blickte ihr tief in die Augen, »dafür werde ich bezahlt. Du nicht.«
Henrietta lächelte leicht. »Das brauche ich auch nicht. Ich bin Rentnerin.«
»Eben.« Erneut seufzend lehnte er sich zurück. »Auch das noch. Du bist nicht mehr so jung, wie du mal warst, Tante Henry.« Beschwörend beugte er sich wieder vor. »Ich weiß, du hast ein wildes Leben geführt«, er lachte, »hat meine Mutter jedenfalls immer gesagt, aber du musst doch einsehen, dass Verbrecherjagd sich nicht gut mit dem Ruhestand verträgt. Mal angenommen, du ständest dann wirklich mal irgendwann so einem Kerl gegenüber. Was würdest du dann machen? Was könntest du überhaupt machen?«
»Muss ja nicht immer ein Kerl sein«, entgegnete Henrietta. »Es gibt auch Mörderinnen.«
»Natürlich gibt es die.« Er schüttelte schmunzelnd den Kopf. »Ich wollte hier niemand diskriminieren. Aber«, er hob einen Finger, »die sind die Ausnahme. Was auch immer irgendwelche Feministinnen erzählen, Frauen sind nicht so aggressiv wie Männer, nicht so gewalttätig.«
»Nicht auf dieselbe Art«, korrigierte Henrietta. »Nicht unbedingt körperlich.«
»Mag sein.« Er zuckte die Schultern. »Aber wenn es eine Leiche gibt, hat das etwas Körperliches. Oder würdest du das bestreiten?« Er hob fragend und auch etwas ironisch neckend die Augenbrauen.
Unzufrieden schürzte Henrietta die Lippen. »Diese Leiche ist . . . anders«, behauptete sie. »Irgendetwas stimmt mit ihr nicht.«
»Liegt vielleicht daran, dass sie tot ist.« Er rollte die Augen. »Du hast die Leiche noch nicht einmal gesehen – und das wirst du auch nicht«, setzte er sofort warnend hinzu, als Henrietta den Mund öffnete, um zu sprechen, »aber du machst Aussagen über sie, als hättest du die Frau schon ewig gekannt.«
»Weißt du«, Henrietta lächelte zuckersüß, »Menschen sind nicht so einmalige Individuen, wie sie immer denken. Die meisten passen in irgendein Muster, ein psychologisches. Diese Geschichte hier hat mich zum Beispiel an Uli Engel erinnert –«
»Uli Engel?«, unterbrach er sie mit weit aufgerissenen Augen.
»Ja, ich weiß, du bist mit ihm zur Schule gegangen –«, setzte Henrietta an, wurde aber erneut von Tassilo unterbrochen.
»Er hat mir die Schule vermiest«, knurrte er. »Der immer mit seinen . . . Scherzen. Fand keiner lustig außer ihm.«
»Och, ich glaube, das fanden schon einige lustig«, widersprach Henrietta. »Nämlich die, die genau der Person, der er gerade einen Streich gespielt hatte, auch gern etwas hätten auswischen wollen, sich nur nicht getraut haben.«
»Blöder Kerl.« Tassilo beharrte auf seiner Meinung. »War gut, dass er dann weg war.«
»Ich habe gehört, er hat sich ziemlich gemacht dann in der Großstadt«, schmunzelte Henrietta. »Hatte eben Phantasie, der Knabe. So ein Dorf am Bodensee hier war einfach zu klein für ihn.« Sie beugte sich auf eindeutig tantenhafte Art zu ihrem Neffen vor und sprach leise. »Ich weiß, dass er dir dein Lieblingskuscheltier kaputtgemacht hat. Das war nicht nett von ihm.«
Tassilo verzog das Gesicht. »Du hast mir dann ein viel schöneres mitgebracht. Von einer deiner Reisen.«
»Trotzdem hast du deinem Dino nachgetrauert. Manche Dinge kann man einfach nicht ersetzen.« Henrietta streifte ihn kurz mit einem mütterlichen Blick, der aber auch noch eine andere Qualität hatte. »Ich meine . . . damals hast du gesagt, das würdest du mir nie vergessen . . .«
»Nein.« Auf einmal bekam Tassilos Gesicht einen strengen Ausdruck. Er verwandelte sich in Kommissar Bluhm zurück. »Du kannst die Leiche nicht sehen, Tante Henry, und damit basta!«
»Schon gut.« Henrietta stand auf. »War ja nur eine Frage. Was regst du dich so auf? Du solltest wirklich besser auf deinen Blutdruck achten. Deine Frau ist schon ganz besorgt.«
Mit beiden Händen fuhr Tassilo Bluhm sich durch die Haare, als wollte er sie sich ausraufen. »Tante Henry . . . Du gehst jetzt. Oder ich lasse dich abführen.«
»Ich glaube . . .«, Henrietta schmunzelte heftig, »ich muss dir wieder mal ein Kuscheltier besorgen. Zur Beruhigung.«
Und bevor Tassilo etwas darauf erwidern konnte, war sie wie eine seidenweiche Fee zur Tür hinausgehuscht.