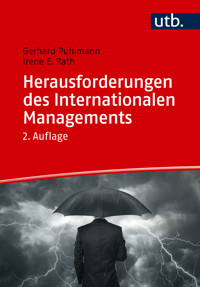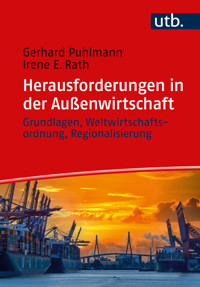
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Reibungslos funktionierende Lieferketten für Rohstoffe, Bauteile und fertige Produkte sind für Unternehmen überlebensnotwendig, denn Produktionsengpässe bis hin zu Produktionsausfällen und Reputationsverlusten kann sich kein Unternehmen erlauben. Neben den Grundlagen der Außenwirtschaft in Teil 1 dieses Buches stehen in Teil 2 die Weltwirtschaftsordnung (bestehend aus Welthandels-, Weltfinanz- und Weltumweltordnung) und in Teil 3 die Regionalisierung des Außenhandels (auch überregionale Wirtschaftsabkommen) im Vordergrund. Den theoretischen Grundlagen werden aktuelle Entwicklungen und Tendenzen sowie die unterschiedlichsten Herausforderungen in der Praxis gegenübergestellt. Viele Beispiele veranschaulichen die Thematik. Das Gelesene kann durch Aufgaben vertieft und überprüft werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
utb 6351
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Gerhard Puhlmann (MBA) ist langjähriger Tutor und Dozent an der Euro-FH Hamburg sowie Geschäftsführer der S-Servicepartner Berlin GmbH, mit rund 750 Mitarbeitenden das größte Unternehmen für Marktfolgedienstleistungen in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Prof. Dr. Irene Rath ist Studiengangs-Dekanin für die Studiengänge International Business Administration (B.A), BWL und Customer Experience (B.A.), Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) und International Management (M.A.) sowie Professorin für Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management an der EURO-FH Hamburg.
Gerhard Puhlmann / Irene E. Rath
Herausforderungen in der Außenwirtschaft
Grundlagen, Weltwirtschaftsordnung, Regionalisierung
Umschlagabbildung: © iStockphoto · Fotogreenhorn
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
https://doi.org/10.36198/9783838563510
© UVK Verlag 2024
– Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption l gestaltung
utb-Nr. 6351
ISBN 978-3-8252-6351-5 (Print)
ISBN 978-3-8385-6351-0 (ePDF)
ISBN 978-3-8463-6351-5 (ePub)
Vorwort
Willkommen zu diesem Buch über die spannende Welt der Außenwirtschaft, das aus drei Teilen besteht:
Teil 1: Hier wird es um die allgemeinen und theoretischen Grundlagen gehen, die für die Außenwirtschaft von Bedeutung sind. Ein Blick auf die aktuelle Situation in Deutschland rundet den Blick ab.
Teil 2: Die Weltwirtschaftsordnung – mit der Weltordnung im Allgemeinen sowie der Weltwirtschaftsordnung, der Weltfinanzordnung und der Weltumweltordnung im Speziellen – wird hier im Mittelpunkt stehen.
In einem kurzen Exkurs werden wir dort auch einen Blick auf die militärische und religiöse Weltordnung werfen.
Teil 3: Die Regionalisierung inklusive regionaler Wirtschaftsabkommen – in der Theorie und anhand von vielfältigen tatsächlichen Abkommen schließt dann dieses Buch ab.
Im Verlauf werden wir uns mit zahlreichen Facetten von internationalen Handelsbeziehungen und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft befassen und dabei unterschiedliche Sichten einnehmen.
Es geht dabei in allen drei Teilen nicht nur um einen theoretischen Hintergrund, vielmehr stehen auch die Praxis sowie aktuelle Entwicklungen im Vordergrund.
Denn die Welt und damit auch der Handel über Ländergrenzen hinweg befindet sich im Wandel, und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Die Gründe dafür sind vielfältig und einige werden Ihnen bekannt vorkommen – von der Corona-Pandemie, über die zunehmenden Versuche, geopolitische Interessen auch mit Gewalt durchzusetzen, über die Klimakrise, Migrationsprozesse, schnelle oder aber zu langsame Fortschritte in der Digitalisierung im internationalen Vergleich bis hin zu einem zunehmenden Mangel an qualifizierten Fachkräften in einigen Staaten wie beispielsweise auch in Deutschland.
Es gibt weitere Gründe, die nicht für alle Staaten gelten, wie beispielsweise ein Deutschland zugeschriebener, stark ausgeprägter Bürokratismus, in Verbindung mit im internationalen Vergleich hohen Arbeitskosten und einer hohen Steuerlast für Privatpersonen und für Unternehmen.
Aber schon vor der Corona-Pandemie war die lückenlose Versorgung der Bevölkerung mit bestimmten Gütern wie beispielsweise Arzneimitteln keine Selbstverständlichkeit mehr.
Reibungslos funktionierende Lieferketten für Rohstoffe, Bauteile und fertige Produkte sind für Unternehmen überlebensnotwendig, denn Produktionsengpässe bis hin zu Produktionsausfällen und Reputationsverlusten kann sich kein Unternehmen erlauben.
Eine vergleichbar hohe Bedeutung für einen funktionierenden Außenhandel und damit einen steigenden, mindestens gleichbleibenden Wohlstand haben auf der Ebene von Staaten und der Europäischen Union Handelsabkommen mit anderen Staaten und Regionen weltweit.
Diese kurzen Ausführungen zeigen bereits, dass Außenhandel vielfältig und vielschichtig ist und sich in einem stetigen Wandel befindet.
Sie werden die Möglichkeit haben, das Kennengelernte anhand von praxisorientierten Aufgaben anzuwenden – selbstverständlich finden Sie die zu den Aufgaben passenden Antworten jeweils am Ende der oben vorgestellten drei Teile dieses Buches.
Die Bedeutung von Außenhandel auch und insbesondere für das exportorientierte Deutschland fasst das folgende Zitat des ehemaligen Präsidenten und aktuellen Ehrenpräsidenten des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Martin Kannegießer, gut zusammen:
„Wenn mein Unternehmen nur für Deutschland produzieren würde, könnten wir den Betrieb jeden Dienstag um elf Uhr schließen.“
(Kannegießer, n. d.)
Die Auswirkungen einer „Schließung um elf Uhr“ wären eine deutlich geringere Anzahl von benötigten Arbeitskräften, verbunden mit einer steigenden Arbeitslosigkeit, weniger Kaufkraft der deutschen Bevölkerung und damit einem nachlassenden inländischer Konsum und Vielem mehr.
Kurz gesagt bedeutet Außenhandel ein erhebliches Maß an zusätzlichem Wohlstand insbesondere für Deutschland. Andersherum ausgedrückt geht ein nachlassender Außenhandel einher mit einem deutlichen Wohlstandsverlust.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses Buchs.
Ihre
Gerhard Puhlmann und Irene Rath
Hinweis
Die Inhalte dieses Buchs basieren auf von den Autoren unter gleichem Titel erstellten Studienheften der Europäischen Fernhochschule Hamburg GmbH, University of Applied Sciences.
Inhaltsübersicht
Teil 1Grundlagen der Außenwirtschaft
Einleitung
1Definition und Kategorisierung von Außenhandel
2Aktuelle Entwicklungen im Außenhandel
3Ursachen für Außenhandel und ausgewählte Theorien
4Zahlungsbilanz
5Einflussfaktoren auf Zahlungsbilanz und Wechselkurs
Schlussbetrachtung
Lösungen der Aufgaben zur Selbstüberprüfung
Teil 2Weltwirtschaftsordnung
Einleitung
1Von einer Weltordnung hin zu einer Weltwirtschafts- und Weltumweltordnung
2Weltwirtschaftsordnung Teil 1 – Welthandelsordnung
3Weltwirtschaftsordnung Teil 2 – Weltfinanzordnung
4Weltumweltordnung
5Exkurs: Militärische Weltordnung und religiöse Weltordnung
Schlussbetrachtung
Lösungen der Aufgaben zur Selbstüberprüfung
Teil 3Regionalisierung und regionale Wirtschaftsabkommen
Einleitung
1Regionalisierung – eine Einordnung
2Die Rolle der Welthandelsorganisation (WTO) bei regionalen Handelsabkommen
3Regionale Handelsabkommen im Überblick
4Ausgewählte regionale Handelsabkommen
5Ausgewählte regionale Handelsabkommen in Europa
6Aktuelle Entwicklungen mit Auswirkungen auf Handelsabkommen – vier Beispiele
Schlussbetrachtung
Lösungen der Aufgaben zur Selbstüberprüfung
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Teil 1Grundlagen der Außenwirtschaft
Inhaltsverzeichnis Teil 1
Einleitung
1Definition und Kategorisierung von Außenhandel
1.1Außenhandel, was ist das?
1.2Kategorisierung von Außenhandel durch die UNO
1.3Vorteile von Außenhandel
1.4Nachteile von Außenhandel
1.5Risiken im Außenhandel
1.6Zusammenfassung
2Aktuelle Entwicklungen im Außenhandel
2.1Entwicklungen im produzierenden Gewerbe
2.2Entwicklungen im Dienstleistungssektor
2.3Entwicklungen in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
2.4Ausländische Direktinvestitionen (ADI)
2.5Bedeutung von Protektionismus für den Außenhandel
2.6Bedeutung des Außenhandels für Deutschland
2.7Wirtschaftlicher Ausblick und Herausforderungen für den exportorientierten Wirtschaftsstandort Deutschland
2.8Zusammenfassung
3Ursachen für Außenhandel und ausgewählte Theorien
3.1Ursachen für Außenhandel
3.1.1Nicht-Verfügbarkeit von Gütern
3.1.2Theorie der technologischen Lücke
3.1.3Kostendifferenzen zwischen Staaten
3.1.4Intra-Industrieller Handel
3.1.5Grenzüberschreitender Intra-Firmenhandel
3.2Ursachen für Kostendifferenzen
3.2.1Kostendifferenzen aufgrund unterschiedlicher Arbeitskosten
3.2.2Kostendifferenzen aufgrund unterschiedlicher Produktivität
3.2.3Kostendifferenzen aufgrund unterschiedlicher Ausstattung mit Produktionsfaktoren
3.2.4Sonstige Ursachen für Kostendifferenzen
3.2.5Auswirkungen der Nachfrage auf Außenhandel
3.3Sonstige Außenhandelstheorien
3.4Zusammenfassung
4Zahlungsbilanz
4.1Begriff und Zusammensetzung der Zahlungsbilanz
4.1.1Leistungsbilanz
4.1.2Vermögensänderungsbilanz
4.1.3Kapitalbilanz und Devisenbilanz
4.1.4Saldo der statistisch nicht aufgliederbaren Transaktionen
4.2Die Zahlungsbilanz im Wirtschaftskreislauf
4.2.1Volkseinkommensgleichung
4.2.2Geldmenge und Zahlungsbilanz
4.3Die Zahlungsbilanz Deutschlands im Zeitverlauf
4.4Zusammenfassung
5Einflussfaktoren auf Zahlungsbilanz und Wechselkurs
5.1Wechselkursänderungen und Zahlungsbilanz
5.1.1Devisenmarkt
5.1.2Wesentliche Währungen der Welt
5.1.3Aktuelle Entwicklungen mit Auswirkungen auf Währungen
5.1.4Wechselkurssysteme
5.1.5Einflussfaktoren auf flexible Wechselkurse
5.1.6Vor- und Nachteile von flexiblen Wechselkursen
5.1.7Realer Wechselkurs
5.1.8Wechselkurstheorien
5.1.9Wirkung von Wechselkursänderungen auf die Leistungsbilanz
5.2Preisänderungen und Leistungsbilanz
5.3Einkommensänderungen und Leistungsbilanz
5.4Zusammenfassung
Schlussbetrachtung
Lösungen der Aufgaben zur Selbstüberprüfung
Einleitung
Naturgemäß beinhaltet ein Schwerpunkt zu Grundlagen, hier den außenwirtschaftlichen Grundlagen, einiges an Theorie. Diese Theorie ist jedoch zwingend für das weitere Verständnis notwendig, warum es Außenhandel überhaupt gibt und welche Mechanismen ihn begünstigen oder aber behindern. Letztendlich ist es daher das Ziel dieses ersten Teils des Buches, das Rüstzeug zu schaffen, um die Auswirkungen von weltweiten Ereignissen auf die Außenwirtschaft besser verstehen, einordnen und beurteilen zu können.
Beispielsweise erfahren die Überwachung und die regelmäßige Neubewertung von Risiken in länderübergreifend agierenden Unternehmen seit Jahren einen deutlich höheren Stellenwert. Dazu gehört die Überprüfung von „Make-or-Buy“-Entscheidungen genauso wie eine höhere Lagerhaltung in (teilweiser) Abkehr von „Just-in-Time“-Produktionen. Teurere Zulieferer können sich lohnen, wenn diese ihren Sitz im eigenen Staat oder in Nachbarstaaten haben – anstelle von Zulieferern am anderen Ende unserer Welt mit entsprechend höheren Risiken. Ein Bauteil (etwas) teurer zu erhalten ist am Ende sinnvoller als ein Bauteil gar nicht oder mit erheblichen Verzögerungen zu erhalten.
Auch wenn Grundlagen und insbesondere Außenwirtschaftstheorien losgelöst sind von einzelnen Staaten, wird in diesem Teil des Buchs in einem Kapitel die Situation in Deutschland eine Rolle spielen – auch um ein Gefühl für die Entwicklungen im Außenhandel aus einer deutschen Perspektive heraus zu erhalten.
In diesem Teil des Buchs geht es nicht um einen umfassenden Blick auf alle Entwicklungen seit dem zweiten Weltkrieg, vielmehr geht es um aktuelle Ereignisse mit wesentlichen Auswirkungen auch auf den Außenhandel.
Welche Bedeutung und Macht ein freier Handel und damit auch ein freier Außenhandel haben, verdeutlicht das folgende Zitat von Adam Smith:
„Die Macht des freien Handels liegt darin, dass er den Wohlstand einer Nation mehrt und das Angebot an Gütern und Dienstleistungen erweitert.“
(Smith, n. d.)
1Definition und Kategorisierung von Außenhandel
Nach Abschluss dieses Kapitel
-können Sie erklären, was unter „Außenhandel“ verstanden wird, welche Formen von Außenhandel es gibt und welche wesentlichen Akteure
-wissen Sie, welche Wirtschaftszweige nach der International Standard Industrial Classification (ISIC) der UN für den Außenhandel wesentlich sind
-kennen Sie die Vor- und Nachteile von Außenhandel sowie die Risiken, die aus Außenhandel entstehen können
1.1Außenhandel, was ist das?
Will man sich dem Begriff „Außenhandel“ nähern, bietet sich zuerst ein Blick auf die Definition von Außenhandel an, hier auf die des Deutschen Statistischen Bundesamtes (Destatis).
„Unter Außenhandel versteht man den Austausch von Gütern über Staatsgrenzen hinweg.“
(Statistisches Bundesamt Deutschland, Destatis, 2024a)
Für den weiteren Verlauf ist wichtig, was unter „Gütern“ zu verstehen ist und wie diese unter anderem von „Waren“ abgegrenzt werden:
Güter können dabei sowohl materielle Güter sein (Waren, wie beispielsweise Fahrzeuge, Maschinen, Lebensmittel, Spielzeug), als auch immaterielle Güter (Dienstleistungen wie beispielsweise Finanzdienstleistungen oder Transporte).
Güter sind also der Oberbegriff für Waren und Dienstleistungen.
Während es für Außenwirtschaft ausreicht, wenn grenzüberschreitende Handelsbeziehungen zwischen den Beteiligten aus zwei Staaten existieren, geht es bei der Weltwirtschaft und einem globalen Handel um weltweite Handelsbeziehungen und Verflechtungen.
Wesentliche Formen des Außenhandels sind
der Import, das heißt der grenzüberschreitende Bezug von Wirtschaftsleistungen aus dem Ausland.
der Export, das heißt die grenzüberschreitende Bereitstellung von Wirtschaftsleistungen an Abnehmende aus dem Ausland.
der Transithandel, das heißt der Import von Wirtschaftsleistungen aus dem Ursprungsland durch einen Transithändler kombiniert mit dem Export der unveränderten Wirtschaftsleistung an Kundinnen und Kunden in einem weiteren Bestimmungsland.
Darüber hinaus gibt es Sonderformen, vor allem ausländische Direktinvestitionen (ADI), auf die im Unterkapitel 2.4 weiter eingegangen wird.
Wenn von „grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen“ gesprochen wird, sind die eigentlichen Akteure im Wesentlichen Unternehmen und Institutionen aus einem Staat, mit Absatzmärkten beziehungsweise Kundinnen und Kunden in anderen Staaten. Auch grenzüberschreitende Handelsbeziehungen zwischen einer Muttergesellschaft und deren in anderen Staaten ansässigen Tochtergesellschaften werden dem Außenhandel zugerechnet (Büter, 2020, S. 1f). Dazu kommen viele weitere in Außenhandel involvierte Akteure, unter anderem
internationale Organisationen wie beispielsweise die Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO), die mit ihren Abkommen
–GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen für Waren),
–GATS (General Agreement on Trade in Services, Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen), und
–TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums)
einen Rahmen für den weltweiten Handel mit Waren und Dienstleistungen vorgibt, oder
die beteiligten Staaten, die den jeweiligen nationalen Rahmen für Exporte und Importe vorgeben.
Beispielsweise seien hier das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) oder die Außenwirtschaftsverordnung (AWV) in Deutschland genannt.
Eine komplette Darstellung aller (relevanten und weniger relevanten) Akteure soll hier kein Schwerpunkt sein.
1.2Kategorisierung von Außenhandel durch die UNO
Außenhandel kann alle und damit die unterschiedlichsten wirtschaftlichen Tätigkeiten umfassen.
Um ein Gefühl für die Vielfältigkeit der Wirtschaftszeige zu erhalten, bietet sich die in Tabelle 1.1 dargestellte „Internationale Standardklassifikation der Wirtschaftszweige“ der UNO (International Standard Industrial Classification, ISIC) an, die für weltweite Statistiken Anwendung findet. Aus der Klassifizierung selbst ist erst einmal nicht erkennbar, ob es sich um Handel im Inland oder um Außenhandel handelt.
Tab. 1.1: Internationale Standardklassifikation der UNO von Wirtschaftszweigen, ISIC (eigene Darstellung in Anlehnung an International Labour-Organisation, 2023)
Aggregierte Wirtschaftstätigkeit
1.Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
Pflanzen- und Tierproduktion, Jagd und damit verbundene Dienstleistungstätigkeiten
Forstwirtschaft und Holzeinschlag
Fischerei und Aquakultur
Industrie
Herstellung
Konstruktion
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Strom-, Gas- und Wasserversorgung
2.Nicht-Landwirtschaft
Dienste
Marktdienstleistungen (Handel; Transport; Unterkunft und Verpflegung; Unternehmens- und Verwaltungsdienstleistungen)
Nicht-marktwirtschaftliche Dienstleistungen (Öffentliche Verwaltung; kommunale, soziale und andere Dienste und Aktivitäten)
Es handelt sich in der Tabelle 1.1 nur um die obersten Stufen der von der UNO verwendeten Klassifizierung.
Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird kurz auf aktuelle und wesentliche Entwicklungen in den Clustern
Industrie (hier: Herstellung und Konstruktion als produzierendes Gewerbe),
Dienstleistungssektor (hier: die Marktdienstleistungen aus Tabelle 1.1), sowie
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
insbesondere mit Bezug auf den Außenhandel eingegangen. Dabei werden unterschiedliche Blickwinkel eingenommen – nicht zuletzt, um die Vielfalt von Außenwirtschaft zu verdeutlichen.
1.3Vorteile von Außenhandel
Für Außenhandel sprechen vielfältige Gründe wie
eine Nicht-Verfügbarkeit beziehungsweise nicht ausreichende Verfügbarkeit von Gütern in einzelnen Staaten. Durch Importe wird die Versorgungssicherheit beispielsweise für Rohstoffe, die für die Herstellung von Gütern unabdingbar sind, verbessert.
die Ausnutzung von Kostendifferenzen zwischen Staaten.
(zusätzliches) Wirtschaftswachstum und Wohlstandsmehrung, auch resultierend aus der Nutzung der beiden vorgenannten Aspekte.
Auf alle drei Aspekte wird in Unterkapitel 3.1 weiter eingegangen. Zusätzlich zu nennen sind beispielsweise:
die Ausweitung und Sicherung von Beschäftigung, durch eine höhere Produktion als nur für das Inland und durch eine Risikostreuung über mehrere Absatzmärkte. Dadurch steigen die Einkommen und der Wohlstand von Arbeitnehmenden, diese Einkommen stehen für zusätzlichen Konsum zur Verfügung,
die Auslastung von Produktionskapazitäten, gerade bei saisonalen Schwankungen im Inland durch den Export von überschüssiger Produktion,
die Steigerung von Umsatz und Gewinn von Unternehmen und eine Risikooptimierung über die bereits oben erwähnten zusätzlichen Absatzmärkte,
eine höhere Produktion, die den Unternehmen Kosteneinsparungen durch die Nutzung von Skaleneffekten ermöglicht,
Wettbewerbsvorteile durch Spezialisierungen,
zusätzliche Steuereinnahmen für Staaten, insbesondere durch die vorgenannten Umsatz- und Gewinnsteigerungen,
Deviseneinnahmen für exportorientierte Staaten (Koch, 2023, S. 109ff).
Zusammengefasst bildet folgende Tabelle 1.2 die Vorteile von Außenhandel ab, unterteilt in Vorteile für das Inland und in internationale Vorteile.
Tab. 1.2: Vorteile von Außenhandel (Koch, 2023, S. 112)
inländische Vorteile
internationale Vorteile
Exporte
Importe
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Einkommen, Gewinnen und Steuereinnahmen
Bessere Versorgung im Inland durch Vergrößerung der Gütervielfalt (Qualität, Innovation, Preis) und Intensivierung des Wettbewerbs
Steigerung des allgemeinen Wohlstands durch Nutzung internationaler Arbeitsteilung
Erzielung von Wettbewerbsvorteilen durch Skalen-, Skill- und Scope-Effekte:
Kostensenkungen, Innovationseffekte, Spezialisierungen, Effizienzsteigerungen
Schaffung von Produktionsvoraussetzungen (beispielsweise Rohstoffe, Energieträger)
Ausgleich von Mangel und Überfluss
Exporterlöse sichern die Finanzierung von Importen durch Deviseneinnahmen
Verbesserung der Produktionsmöglichkeiten (beispielsweise Patente, preisgünstige Vorprodukte)
3.Tendenz zur Krisenvermeidung aufgrund wechselseitiger Abhängigkeit
(Möglicher) Abbau von Produktionsüberschüssen
Vermeidung von Produktionsnachteilen im Inland (beispielsweise Umweltbelastung, schwankende Kapazitätsauslastung)
Handelsbilanzüberschuss
Handelsbilanzdefizit
Tendenzielle Verstärkung der Wirkungen
Finanzierung von Defiziten in anderen Teilbilanzen der Leistungsbilanz
./.
Zusätzlich können über eine strategische Handelspolitik in unterschiedlicher Ausprägung und Intensität auch geopolitische Ziele von Staaten erreicht werden, beispielsweise in Form der Schaffung von Abhängigkeiten.
Ein Beispiel für geopolitische Ziele findet sich im folgenden Unterkapitel 1.4.
1.4Nachteile von Außenhandel
Der wesentliche Nachteil aus Außenhandel sind unterschiedliche Arten und unterschiedliche Ausprägungen von Abhängigkeiten.
Ein Beispiel für die Abhängigkeit von Staaten ist die Neue Chinesische Seidenstraße (OBOR, „One Belt, One Road“ oder auch BRI, „Belt and Road Initiative“), die seit 2013 nicht nur den chinesischen Außenhandel stärken soll, sondern auch den Einfluss der VR China in der Welt. Während dieses Vorgehen für die VR China vorteilhaft erscheint, sind über die Jahre Abhängigkeiten von Schwellen- und Entwicklungsländern entstanden:
„Mehr Kredite, mehr Abhängigkeiten
Die ‚Neue Seidenstraße‘ Chinas wird teurer: 60 Prozent der Auslandskredite drohen auszufallen. Um dies zu vermeiden, vergibt Peking Rettungsdarlehen und schafft so neue Abhängigkeiten.
Gemäß einer Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hat das ambitionierte Handelsprojekt ‚Neue Seidenstraße‘ für China hohe Kosten zur Folge. Immer mehr Schwellen- und Entwicklungsländer, die von der Volksrepublik Kredite für den Bau von Infrastruktur aufgenommen haben, können diese nicht mehr planmäßig bedienen. Als Folge dessen habe die chinesische Regierung in den letzten Jahren die Vergabe von Rettungskrediten erheblich erhöht. […]
Fest steht: Durch die Vergabe immer neuer Kredite verstrickt Peking die Schuldnerländer in immer stärkere Abhängigkeiten – und stärkt so seine geopolitische Position.“
(Tagesschau, 2023a)
Ebenso können Rohstoffabhängigkeiten genannt werden, wie die vieler europäischer Staaten von Russland bei Öl-, Gas- und Kohleimporten vor deren Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022.
Es gibt weitere Nachteile, beispielsweise
kann es zu einer Ungleichverteilung der Vorteile von Außenhandel zwischen den beteiligten Staaten kommen;
kann es bei neuen protektionistischen Maßnahmen, wie beispielsweise Exportquoten oder -verboten, Unternehmen und Staaten schwerfallen, kurzfristig zu reagieren;
müssen exportorientierte Staaten wie Deutschland (in angemessenem Umfang) die Interessen und die Situation in den Partnerstaaten in ihrer eigenen Außenpolitik berücksichtigen;
stehen Exporte für das Inland nicht mehr oder nur eingeschränkt zur Verfügung – es kann zu einem Preisanstieg im Inland kommen, gerade bei einer steigenden Nachfrage aus dem Ausland;
kann eine für den Außenhandel höhere Produktion zusätzlich die Umwelt im Exportstaat belasten;
können zu hohe Importe zu einer sinkenden Produktion im Inland und damit zu einer Gefährdung von Arbeitsplätzen und des Wohlstands führen;
kann Knowhow verloren gehen, wenn Güter nicht mehr im Inland produziert werden;
werden illegaler Handel, Wirtschaftskriminalität (unter anderem Produktpiraterie) und Cyberkriminalität für Täterinnen und Täter einfacher (Koch, 2023, S. 114ff).
Zusätzlich gibt es Risiken, die aus dem grenzüberschreitenden Handel entstehen. Auf diese wird im Unterkapitel 1.5 eingegangen.
Zusammengefasst bildet folgende Tabelle 1.3 die Risiken ab, die aus Außenhandel entstehen können – unterteilt in Risiken für das Inland und in internationale Risiken.
Tab. 1.3: Nachteile von Außenhandel (Koch, 2023, S. 121)
inländische Nachteile
internationale Nachteile
Exporte
Importe
Abhängigkeit als Kernproblem auf nationaler und internationaler Ebene
Übernahme von Absatz- und Beschäftigungsrisiken für das Ausland
Möglicher Verzicht auf Arbeitsplätze und Einkommen
Ungleiche Verteilung von Außenhandelsvorteilen, vor allem von Massenproduktionsund Spezialisierungsvorteilen
Übernahme von Produktionsrisiken (beispielsweise Umweltrisiken)
Verzicht auf entwicklungs- und produktionsbedingte Vorteile (Zukunftstechnologien, Erfahrungen, Synergieeffekte)
Klima- und Umweltprobleme durch zunehmenden Handel (Transporte, Schadstoffemissionen, Öko-Dumping)
Eventuelle Beeinträchtigung der inländischen Versorgung (Ausbeutung von Ressourcen, Verwendung knapper Faktoren)
Erfordert Deviseneinnahmen durch Exporterlöse zur Finanzierung
Krisenverschärfung durch Handel mit Rüstungsgütern
Inflationsrisiken durch Kapazitätsüberlastung
Gesundheitsgefahren durch Importe durch Nichtbeachtung von Verbraucherschutzgesetzen
Illegaler Handel (Produktpiraterie, Drogen, geschützte Produkte, Waffen, gestohlene Güter)
Inflationsrisiken durch „importierte Inflation“
Handelsbilanzüberschuss
Handelsbilanzdefizit
Tendenzielle Verstärkung der Wirkungen
Forderungsrisiko: Bei Abwertungen sinkt der Gegenwert von Devisenforderungen
Mögliche Tendenz zur Auslandsverschuldung
Evtl. protektionistische Gegentendenzen
./.
Aus Sicht der Autoren überwiegen die im Unterkapitel 1.3 vorgestellten, aus Außenhandel resultierenden Vorteile deutlich gegenüber den hier vorgestellten Nachteilen.
1.5Risiken im Außenhandel
Vor allem resultierend aus den unterschiedlichen (Rechts-)Systemen der an Außenhandel beteiligten Staaten und den teilweise deutlich längeren Transportwegen gibt es im Außenhandel Risiken.
Politische Risiken
Beispielsweise können Kriege, Revolutionen, Bürgerunruhen, Embargos, Verstaatlichungen usw. dazu führen, dass der Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis nicht erhält, da eine Bezahlung für den Käufer nicht möglich ist oder die Ware verloren geht, beschlagnahmt wird oder beschädigt beim Empfänger ankommt.
Auch können Änderungen von Export- und Importbestimmungen durch einen Staat zu Problemen für Verkäufer und / oder Käufer führen.
Transferrisiken
sind devisenrechtliche Maßnahmen eines Staates oder einer Zentralbank, durch die einem Käufer der Erwerb der für die Bezahlung notwendigen Devisen unmöglich gemacht wird.
Delkredere-Risiko
Das Delkredere- oder auch Ausfallrisiko tritt auch im inländischen Handel auf und umfasst vor allem die Zahlungsunfähigkeit oder -unwilligkeit des Käufers. Die ausfallende Bezahlung kann zu Liquiditätsproblemen bei dem Verkäufer führen.
Risiken aus höherer Gewalt,
beispielsweise aus Naturkatastrophen oder Pandemien wie der Corona-Pandemie, die dem Verkäufer den Versand der Ware oder dem Käufer den Empfang der Ware unmöglich oder unzumutbar machen.
Wechselkursrisiken,
das heißt Kursschwankungen der Heimatwährung des Verkäufers und / oder des Käufers und der vertraglich vereinbarten Währung, in der die Ware bezahlt werden muss. Das Risiko kann beim Käufer, Verkäufer oder Beiden liegen, je nachdem welche Währung als Vertragswährung vereinbart wird – die des Käufers, die des Verkäufers oder eine dritte (vermeintlich sicherere) Währung.
Bei Außenhandel im Euro-Raum entfällt dieses Risiko, da Käufer und Verkäufer den Euro als gemeinsame Inlandswährung haben. Auf die auf Wechselkurse wirkenden Einflussfaktoren wird in Unterkapitel 5.1 vertieft eingegangen.
Sonstige Exportrisiken, beispielsweise Risiken während des Transports der Ware wie beispielsweise die Blockade des Suez-Kanals durch das Containerschiff „Ever Given“ im Jahr 2021.
Der überwiegende Teil dieser Risiken kann über unterschiedliche Versicherungen abgesichert werden. Am Ende sind Versicherungsprämien ein Bestandteil der Gesamtkalkulation beziehungsweise Grundlage für die Bewertung der Vorteilhaftigkeit von Außenhandel.
1.6Zusammenfassung
Außenhandel als grenzüberschreitender Handel ist eine wesentliche Grundlage für den Wohlstand in der Welt, auch für den Deutschlands als exportorientierte Industrienation.
Es gibt viele Vorteile, die aus Außenhandel entstehen. Diese Vorteile überwiegen aus Sicht der Autoren deutlich gegenüber den aus Außenhandel möglichen Nachteilen und Risiken. Dabei treten die Nachteile nicht durchgängig auf und Risiken können durch geeignete Absicherungen reduziert werden.
Formen des Außenhandels sind Exporte, Importe, der Transithandel sowie Sonderformen, vor allem ausländische Direktinvestitionen (ADI).
Um weltweite Entwicklungen statistisch einheitlich zu erfassen, unterteilt die Internationale Standardklassifikation der UNO Außenhandel in die bekannten Hauptwirtschaftszweige „industrielle Herstellung und Konstruktion“ (produzierendes Gewerbe), „Dienstleistungssektor“ und „Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft“.
Eine wesentliche Rolle im Außenhandel spielen – neben den direkt beteiligten Vertragspartnern – die Welthandelsorganisation (WTO) mit ihren Abkommen GATT, GATS und TRIPS sowie die beteiligten Staaten mit ihren jeweiligen, den Außenhandel regulierenden Gesetzen und Verordnungen.
Aufgabe 1.1
Finden Sie am Beispiel von „Farben und Lacken“ heraus, wie die Internationale Standardklassifikation der UNO von Wirtschaftszweigen (ISIC) einzelne Segmente tiefergehend klassifiziert und wie weit diese Klassifizierungen tatsächlich gehen.
Aufgabe 1.2
Finden Sie neben der Neuen Chinesischen Seidenstraße ein weiteres Beispiel, in dem die VR China durch ihr Handeln Außenhandel negativ beeinflusst hat.
Aufgabe 1.3
Recherchieren Sie den Unterschied zwischen „ungebrochenem“ und „gebrochenem Transithandel“ sowie zwischen „aktivem“ und „passivem Transithandel“.
2Aktuelle Entwicklungen im Außenhandel
Nach Abschluss dieses Kapitel
-können Sie die wesentlichen Entwicklungen im Außenhandel erläutern
-können Sie die Bedeutung und Entwicklungen von ausländischen Direktinvestitionen (ADI) einschätzen und bewerten
-wissen Sie um die Bedeutung von Außenhandel für den Wohlstand in Deutschland und können die aktuellen Herausforderungen erklären
Für alle drei im ersten Kapitel vorgestellten Teilwirtschaftszweige (Industrie, Dienstleistungssektor sowie Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft) gilt, dass die aktuellen Herausforderungen gravierend sind. Dabei sind hier nicht alle Facetten und Ereignisse seit dem zweiten Weltkrieg relevant, die in ihrer Summe zu dem heutigen Stand des weltweiten Außenhandels geführt haben.
Aus der jüngeren Vergangenheit seien aber beispielhaft genannt:
die wirtschaftlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie.
Kriege und Konflikte wie beispielsweise
–der Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022,
–der Konflikt im Südchinesischen Meer und um Taiwan,
–der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo, der sich im Jahr 2023 erneut zugespitzt hat, oder
–der mit dem Angriff durch die palästinensische Terrororganisation Hamas auf Israel im Oktober 2023 wieder eskalierte Nahostkonflikt.
der Versuch insbesondere der VR China und Russlands, ein Gegengewicht zu den westlichen Industrienationen unter Führung der USA und zum US-Dollar als weltweite Leitwährung zu schaffen.
neue regionale Handelsabkommen, wie beispielsweise das weltweit größte Abkommen „Regional Comprehensive Economic Partnership“ (RCEP) ohne direkte Beteiligung der EU oder den USA.
der Klimawandel und die Umweltverschmutzung (mit katastrophalen Wetterereignissen wie beispielsweise Überflutungen, Dürren oder der Verlust an Biodiversität), die eigentlich zu weltweit harmonisierten Anstrengungen zu deren Eindämmung führen müssten.
der Bedarf an nur regional und begrenzt vorhandenen Rohstoffen für die Energiewende.
Alle diese Beispiele haben Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und damit auch auf den Außenhandel.
Abb. 2.1: Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenhandels 1960 bis 2022 (Bundeszentrale für politische Bildung, 2023)
2.1Entwicklungen im produzierenden Gewerbe
Der weltweite Warenhandel von Rohstoffen über halbfertige Waren bis hin zu fertigen Waren verzeichnete von 1960 bis 2022 ein deutliches Wachstum, wie die vorangegangene Abbildung 2.1 zeigt.
Der Außenhandel an sich ist stark gestiegen, aber auch das Verhältnis zwischen Warenexporten und Warenproduktion hat sich grundlegend verändert. Die zunehmende Optimierung der Produktionskosten, die weltweite Aufteilung von Lieferketten sowie stark gesunkene Kommunikations- und Transportkosten waren wesentliche Gründe dafür.
Die Weiterleitung unfertiger Erzeugnisse in andere Staaten nach einem abgeschlossenen Produktionsschritt erhöht hierbei die Warenexporte, nicht jedoch die Warenproduktion (Bundeszentrale für politische Bildung, 2023).
Deutlich erkennbar sind die Rückgänge bei den Warenexporten 2008 / 2009 aufgrund der weltweiten Finanzmarktkrise sowie 2020 aufgrund der Corona-Pandemie. Diese Rückgänge sind bei der Warenproduktion deutlich weniger erkennbar.
Ordnungspolitischer Rahmen für den weltweiten Handel mit (fertigen und unfertigen) Waren ist das General Agreement on Tariffs and Trade (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen, GATT) unter dem Dach der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO).
2.2Entwicklungen im Dienstleistungssektor
Außenhandel im produzierenden Gewerbe ist gut zu greifen, da es um gegenständliche Waren geht, die zwischen Verkäufer und Käufer und dabei auch über Landesgrenzen hinweg gehandelt werden.
Demgegenüber geht es bei Dienstleistungen in der Regel um immaterielle Güter, bei denen die Leistungserbringung, also der Service und nicht ein Produkt im Vordergrund steht. Dienstleistungen werden beispielsweise erbracht durch Transportunternehmen, Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Call Center, Unternehmensberatungen, Radio-/Fernsehsender, Reiseveranstalter und -büros, Architekten, Ingenieure, IT-Dienstleister und viele mehr.
Diese Vielfältigkeit im Dienstleistungssektor findet sich auch im Außenhandel wieder und ist deutlich komplexer zu kategorisieren. Eine von mehreren Kategorisierungen nimmt das General Agreement on Trade in Services (Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen, GATS) vor, das den ordnungspolitischen Rahmen für den Handel mit Dienstleistungen unter dem Dach der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) vorgibt.
Abb. 2.2: Entwicklung der weltweiten Exporte von Dienstleistungen im Zeitraum 2005 bis 2022 in Millionen US-Dollar (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, 2023)
Das GATS unterscheidet dabei in vier sogenannte „Modes“:
Im Mode 1 („Cross border supply“) überschreitet nur die Dienstleistung die Grenze, Produzent und Konsument verbleiben in ihrem jeweiligen Land.
Ein Beispiel ist die telefonische Beratung eines im Ausland ansässigen Kunden.
Bei Mode 2-Transaktionen („Consumption abroad“) erfolgt der Konsum im Ausland, der Konsument begibt sich dafür in das Land des Produzenten.
Ein Beispiel sind Reisen von Touristinnen und Touristen ins Ausland und die Inanspruchnahme von Hotelleistungen vor Ort.
Im Mode 3 („Commercial presence oder presence of natural persons“) werden alle Dienstleistungen erfasst, die durch im Ausland ansässige juristische Personen (ausländische Tochtergesellschaften von Unternehmen, Repräsentanzen) oder durch natürliche Personen (dauerhaft) vor Ort erbracht werden.
Ein Beispiel sind Unternehmensberatungen, die eine Tochtergesellschaft im Ausland unterhalten.
Bei Mode 4-Transaktionen begibt sich der Produzierende abweichend zum Mode 3 nur vorübergehend ins Ausland, um die Dienstleistung zu erbringen, beispielsweise Unternehmensberaterinnen und -berater, die sich für einen einzelnen Beratungsauftrag zeitlich befristet ins Ausland begeben. (Koch, 2023, S.13)
Dies nachgereicht, zeigt Abbildung 2.2 ein ähnlich exorbitantes Wachstum wie Abbildung 2.1 für den grenzüberschreitenden Warenhandel, hier für Dienstleistungen seit dem Jahr 2005. Auch hier sind die Auswirkungen der Finanzmarktkrise 2008 / 2009 sowie der Corona-Pandemie 2020 deutlich zu erkennen.
2.3Entwicklungen in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
Die am Anfang dieses Kapitels beispielhaft für den Außenhandel im allgemeinen beschriebenen aktuellen Herausforderungen gelten auch für die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft im Speziellen.
So …
bedroht der Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 auch die Welternährung,
umfasst der Konflikt im Südchinesischen Meer und um Taiwan auch die dortigen bedeutenden Speisefischvorkommen, und
gefährden Umweltverschmutzung und Klimawandel insbesondere die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft.
Dazu kommen hier beispielsweise noch …
Landnahmen („Land-Grabbing“), das heißt die friedliche oder kriegerische Übernahme von land- oder forstwirtschaftlichen Großflächen durch ausländische Staaten oder ausländische Unternehmen.
der zerstörerische Umgang einiger Staaten mit ihren natürlichen Ressourcen, beispielsweise die jahrzehntelange Abholzung und Brandrodung des brasilianischen Regenwalds oder die Überfischung von ganzen Meeresregionen.
Am Beispiel der Landwirtschaft soll die Bedeutung der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft für die Sicherstellung der Welternährung auch anhand der aktuellen Entwicklungen verdeutlicht werden.
Landwirtschaft ist die Grundlage für die Ernährung der Weltbevölkerung und spielt daher eine wesentliche Rolle im Außenhandel. Bei der Welternährung ist neben der weltweiten und regionalen Bevölkerungsentwicklung auch das Nahrungsangebot beispielsweise von Getreide relevant. Angebot und Nachfrage müssen zwischen Produzent und Kunde in Entwicklungs-, Schwellen- und Industriestaaten in Einklang gebracht werden.
Ein erster Blick auf die Entwicklung der Weltbevölkerung zeigt in der Abbildung 2.3 für die Vergangenheit und prognostiziert bis etwa zum Jahr 2075 einen deutlichen Anstieg.
Abb. 2.3: Weltbevölkerung erreicht die 8-Milliarden-Marke (UN Population Division, 2022)
Wesentliche Gründe für das Wachstum sind laut UN-Experten:
der sukzessive Anstieg der Lebenserwartung aufgrund von Fortschritten im Gesundheitswesen, der Ernährung, der Hygiene und der Medizin sowie
hohe Geburtenraten in einigen Staaten (Janson, 2022).
Schaut man auf die Regionen dieser Welt in Abbildung 2.4. wird deutlich, dass bereits heute Asien mit der VR China und Indien die höchsten Bevölkerungszahlen aufweist, im Jahr 2023 hat Indien die VR China als bevölkerungsreichstes Land unserer Erde abgelöst. Für das Jahr 2025 werden nur noch die USA als Staat außerhalb Asiens und Afrikas unter den bevölkerungsreichsten Staaten weltweit erwartet.
Abb. 2.3 und 2.4 verdeutlichen, dass nicht nur die Nachfrage nach Lebensmitteln aufgrund der steigenden Weltbevölkerung weiter steigen wird. Es wird auch deutlich, dass sich die Nachfrage regional weiter in Richtung Asien und Afrika verschieben wird.
Abb. 2.4: Die bevölkerungsreichsten Staaten der Welt – Entwicklung 1950 bis prognostiziert für 2100 (Vereinte Nationen via Pew Research Center, 2019)
Abb. 2.5: Landwirtschaftliche Anbaufläche pro Kopf weltweit (Industrieverband Agrar e. V., n. d.)
Der steigenden Weltbevölkerung steht allerdings immer weniger fruchtbarer Boden zur Verfügung, wie Abbildung 2.5 zeigt.
Dem Außenhandel, hier der Sicherstellung der Welternährung in Regionen ohne ausreichende Eigenversorgung durch Unternehmen aus Staaten mit einem Überangebot, kommt daher eine wesentliche Bedeutung zu.
Wie fragil der Außenhandel im Bereich der Landwirtschaft ist, zeigt nicht zuletzt der Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022. Denn neben dem unsäglichen Leid für die ukrainische Bevölkerung gefährdet Russland die Ernährung in einigen Staaten, vor allem die in afrikanischen und asiatischen Entwicklungsländern.
Sowohl Russland als auch die Ukraine gehören bei wesentlichen Grundnahrungsmitteln zu den größten Exportstaaten der Welt. Beispielsweise entfielen vor dem von Russland begonnenen Krieg rund zwei Drittel der weltweiten Exporte von Sonnenblumenöl auf Russland und die Ukraine.
Seit dem Einmarsch Russlands gibt es in der Ukraine gravierende Ernteausfälle in Kombination mit deutlich erschwerten Exporten. Russland wiederum hat zeitweise einen Exportstopp für eigenen Weizen und andere Produkte verhängt.
Abb. 2.6: Wo Weizen besonders knapp wird (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD; Statista, 2022a)
Die Auswirkungen sind insbesondere für afrikanische und asiatische Entwicklungsländer verheerend, da beispielsweise Weizen vor dem Krieg bis zu einhundert Prozent aus Russland und der Ukraine importiert wurde (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, Statista, 2022).
Die vorangegangene Abbildung 2.6 zeigt die Abhängigkeit afrikanischer Staaten von Russland und der Ukraine am Beispiel von Weizen; die Gefährdung der Welternährung insbesondere die in einigen afrikanischen Staaten wird deutlich. Eine wesentliche Aufgabe der weltweiten Außenpolitik ist daher die Aufrechterhaltung der Weltversorgung und die Vermeidung von Hungerkatastrophen.
2.4Ausländische Direktinvestitionen (ADI)
Ausländische Direktinvestitionen (ADI) sind eine Sonderform des Außenhandels und wesentlich für das Wachstum von international tätigen Unternehmen.
Das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) definiert ADI wie folgt:
„Ausländische Direktinvestitionen (ADI) sind in der Zahlungsbilanz ausgewiesene internationale Investitionen, die eine in einem Wirtschaftsgebiet ansässige Einheit tätigt, um eine langfristige Beteiligung an einem in einem anderen Wirtschaftsgebiet ansässige Einheit zu erwerben.
Langfristige Beteiligung bedeutet, dass zwischen dem Direktinvestor und dem Unternehmen eine dauerhafte Beziehung besteht und dass der Investor auf die Geschäftspolitik des Unternehmens maßgeblichen Einfluss ausübt.
Ein Unternehmen ist dann Gegenstand einer Direktinvestition, wenn ein Direktinvestor mindestens 10 % der Stammaktien oder Stimmrechte (im Fall von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit) beziehungsweise einen vergleichbaren Anteil (im Fall von Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) besitzt.“
(Statistisches Amt der Europäischen Union, Eurostat, 2018)
ADI haben für diese Unternehmen – aber auch für die Zielunternehmen der Investitionen – vielfältige Chancen:
Vielfach führen ADI zu einer Portfolioerweiterung bei gleichzeitiger Risikoreduzierung gegenüber wenigen Produkten.
Die Innovationsfähigkeit beider Unternehmen wird gefördert.
Die Akquisition von Talenten wird unternehmensübergreifend erleichtert.
Mitbewerber können durch ADI in das eigene Unternehmen integriert werden.
Der Kapitalzufluss kann für Zielunternehmen von ADI die einzige Möglichkeit sein, selbst an anderer Stelle zu investieren und ihrerseits zu wachsen.
Ein Technologietransfer in beide Richtungen wird ermöglicht. (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V., BDI, 2023).
Ausländische Direktinvestitionen (ADI) stehen dabei auch für die Attraktivität von Wirtschaftsstandorten. Je höher der Nettozufluss von ADI (ADI aus dem Ausland abzüglich ADI in das Ausland) aus Sicht eines Staates ist, desto attraktiver scheint dieser Standort für Investoren zu sein.
Die Deutsche Bundesbank beschreibt diese Entwicklung mit den Werten für 2021 für Deutschland eher als kritisch und reiht sich damit in den Kreis derer ein, die dem Wirtschaftsstandort Deutschland eine nachlassende Attraktivität bescheinigen:
„Zum Jahresende 2021 sind die unmittelbaren deutschen Direktinvestitionsbestände im Ausland gegenüber dem Stand zum Ende des Vorjahres um knapp 8 % auf 1.506 Mrd. € gestiegen.
Die ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland boten ein anderes Bild. Die Bestände gingen erstmals seit langem zurück, und zwar um 2 % auf 852 Mrd. €.
Die deutschen Direktinvestitionsströme ins Ausland zeigten mit 169 Mrd. € für 2022 eine robuste Entwicklung, auch wenn sie gegenüber dem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert leicht zurückgingen.
Die aus dem Ausland nach Deutschland fließenden Direktinvestitionsströme haben sich mit 44 Mrd. € hingegen fast halbiert.“
(Deutsche Bundesbank, 2023a)
Abb. 2.7: Direktinvestitionen aus Deutschland in das Ausland (Deutsche Bundesbank, 2023a)
Abb. 2.7 zeigt die Entwicklungen von Direktinvestitionen aus Deutschland heraus im Zeitverlauf. An der Spitze lagen im Jahr 2021 zum wiederholten Mal die USA als Zielstaat (Bestand Ende 2021: 409 Milliarden Euro, rund 29 Prozent aller deutschen Direktinvestitionen). Auf die VR China entfiel ein Bestand zum Ende 2021 von 103 Milliarden Euro.
In Abb. 2.8 zu den ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland ist bei optisch ähnlichen Säulen im Vergleich zu der vorherigen Abb. 2.7 vor allem die Skalierung zu beachten.
Abb. 2.8: Direktinvestitionen aus dem Ausland in Deutschland (Deutsche Bundesbank, 2023a)
Ausländische Direktinvestitionen anderer europäische Länder in Deutschland bilden dabei den Schwerpunkt (rund 78 % zum Jahresende 2021).
Saldiert bedeuten beide Abbildungen einen deutlichen Mittelabfluss aus Deutschland heraus in andere Staaten.
Abschließend zeigt folgende Abb. 2.9 die Verflechtungen zwischen inländischen und ausländischen Wirtschaftszweigen durch ADI.
Viele deutsche Unternehmen investieren im Ausland überwiegend in ihrer eigenen Branche (unter anderem die im deutschen Außenhandel wesentlichsten Branchen „Kraftwagen und Kraftwagenteilen“ oder „Herstellung von chemischen Erzeugnissen“). Beteiligungsgesellschaften sind hier naturgemäß breiter aufgestellt und investieren in die unterschiedlichsten Branchen.
Abb. 2.9: Deutsche Direktinvestitionen nach Top10-Wirtschaftszweigen (Deutsche Bundesbank, 2023a)
Bei allen Chancen stehen jedoch auch die Risiken von ADI für die Zielstaaten und -unternehmen immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Vorhandene Wettbewerbsvorteile eines Standortes könnten so verloren gehen, der Einfluss von ausländischen Unternehmen und / oder ausländischen Staaten könnte im Zielstaat von ADI zunehmen, die nationale Sicherheit sowie der Schutz strategischer Industrien könnte gefährdet sein.
Allerdings gibt es hier kein schwarz oder weiß. Darüber hinaus geben das deutsche Investitionsprüfungsverfahren im Zusammenhang mit dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG), der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) sowie die EU-„Verordnung zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der (Europäischen) Union“ hier einen Rahmen vor, der diese Risiken angemessen berücksichtigen soll.
Umgekehrt werden aktuell dringend benötigte Leuchtturmprojekte, wie die Tesla-Gigafactory Berlin-Brandenburg in Grünheide (Brandenburg) oder das chinesische Lithium-Ionen-Batteriewerk im thüringischen Arnstadt durch Subventionen und andere Erleichterungen beispielsweise beim Schutz des Grundwassers zu einem hohen Preis erkauft.
Diese Thematik wird uns erneut im Abschnitt 3.1.2 begegnen, wenn es um die „Theorie der technologischen Lücke“ gehen wird.
2.5Bedeutung von Protektionismus für den Außenhandel
Eine wesentliche Einflussgröße für Außenhandel ist das Ausmaß von Protektionismus, der wie folgt definiert wird.
„Verschiedene handelspolitische Maßnahmen (tarifäre Handelshemmnisse oder nicht tarifäre Handelshemmnisse), deren Zweck es ist, einzelne Sektoren einer Volkswirtschaft vor Importkonkurrenz zu schützen oder der eigenen Exportwirtschaft Vorteile auf dem internationalen Markt zu verschaffen.“
(Springer Fachmedien, 2022, S.176)
Tarifäre Handelshemmnisse können Zölle, die Festlegung von Mindestpreisen oder Subventionen für Exporte sein.
Nicht tarifäre Handelshemmnisse können Importquoten, Subventionen für inländische Unternehmen, (einengende und das Ausland benachteiligende) Verwaltungsvorschiften oder eigene Exportbeschränkungen sein.
Hier auf alle Entwicklungen der letzten Jahre im Detail einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Beispiele wie
die Regierungszeit des 45. US-amerikanischen Präsidenten Donald J. Trump unter seinem Motto „Make America great again“ mit umfangreichen protektionistischen Maßnahmen für Unternehmen in den USA und gegen andere, auch verbündete beziehungsweise befreundete Staaten,
der „Inflation Reduction Act“ seines Nachfolgers, des 46. US-Präsidenten Joseph Biden, mit dem gezielt Investitionen in den USA auch von ausländischen Unternehmen gefördert werden (vgl. Aufgabe 2.2 am Ende dieses Kapitels).
der jahrelange Streit zwischen Boeing und Airbus mit gegenseitigen Vorwürfen zu umfangreichen staatlichen Subventionen der USA für Boeing beziehungsweise der EU für Airbus, oder
die Exporthindernisse für Seltene Erden durch die VR China aus dem Jahr 2023 bis hin zu einem möglichen Exportverbot
decken nur einen kleinen Teil der weltweiten protektionistischen Veränderungen der letzten Jahre ab.
Sanktionen wie beispielsweise die gegen Russland wegen des Einmarschs in die Ukraine am 24. Februar 2022, aber auch die gegen den Iran wegen Verstößen gegen grundlegende Menschenrechte, deren Nuklearprogramm oder die Belieferung von Russland mit Drohnen, beeinflussen Außenhandel (zurecht) zusätzlich.
Insbesondere wenn es in Kapitel 3 um die Theorien des Außenhandels geht, sind die oben genannten Beispiele wichtig. Denn der theoretische Idealzustand unterstellt eine Welt unter gleichen Bedingungen beziehungsweise möglichst ohne Handelshemmnisse.
Von dieser idealen Welt sind wir heute weit entfernt, wie folgende Abb. 2.10 für die Anzahl schädlicher handelspolitischer Interventionen von Staaten im Zeitraum 2008 bis 2021 zeigt. Hierin enthalten sind auch durch die Mitgliedsstaaten der EU gemeinsam beschlossene Handelssanktionen, die allerdings unterschiedliche Auswirkungen sowohl auf der „Täter-“, als auch auf der „Opferseite“ für die EU-Mitgliedsstaaten haben.
Abb. 2.10: Anzahl schädlicher handelspolitischer Interventionen, 2008 bis 2021 (Stiftung Familienunternehmen, 2023, S. 11)
2.6Bedeutung des Außenhandels für Deutschland
Wie schon das Zitat in der Einleitung deutlich macht, hat Außenhandel für Deutschland eine sehr hohe Bedeutung. Dabei gehört Deutschland zu den größten Exportnationen der Welt, gleichzeitig ist Deutschland als rohstoffarmes Land auf den Import von Rohstoffen angewiesen.
Im Jahr 2023 waren die wichtigsten Exportgüter Deutschlands (Statistisches Bundesamt, Destatis, 2024b):
Kraftwagen und Kraftwagenteile
mit rund 270 Milliarden Euro
Maschinen
mit rund 225 Milliarden Euro
Chemische Erzeugnisse
mit rund 141 Milliarden Euro
Für das gleiche Jahr 2023 waren die wichtigsten Importgüter Deutschlands (Statistisches Bundesamt, Destatis, 2024c):
Kraftwagen und Kraftwagenteile
mit rund 149 Milliarden Euro
Datenverarbeitungsgeräte u. a.
mit rund 143 Milliarden Euro
Elektrische Ausrüstung
mit rund 111 Milliarden Euro
Die Außenhandelsbilanz Deutschlands weist seit Jahren einen deutlichen Überschuss aus, das heißt einen höheren Wert der Exporte gegenüber den Importen. Dieser Handelsbilanzüberschuss ist für Deutschland ein unverzichtbarer Bestandteil des eigenen Wohlstands – anders ausgedrückt führen ein rückläufiger Außenhandel und / oder ein rückläufiger Exportüberschuss zu Wohlstandsverlusten in Deutschland und für die deutsche Bevölkerung.