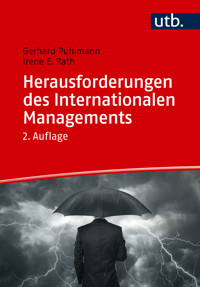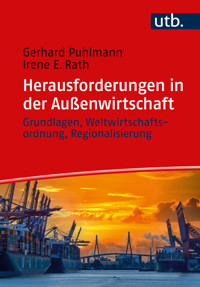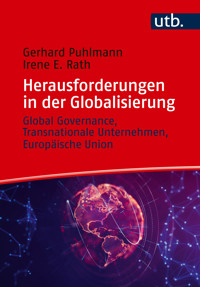
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Globalisierung ist eine Entwicklung, die über die Globalisierung der Wirtschaft deutlich hinausgeht und die alle Menschen weltweit betrifft. Lediglich der Umfang der jeweiligen Betroffenheit in den unterschiedlichen Regionen unserer Welt variiert dabei, und das in erheblichem Umfang. Zudem wird auch auf die mögliche oder teilweise eingetretene De-Globalisierung eingegangen. Im Teil 1 dieses Buches werden wesentliche Entwicklungen im Zusammenhang mit der Globalisierung und die Chancen und Risiken aus der Globalisierung dargestellt. Auch die Sicht ausgewählter Kritiker des Globalisierungsprozesses, aktuelle Entwicklungen sowie der weltweite Rechtsrahmen spielen dabei eine Rolle. Teil 2 befasst sich mit weltweit tätigen Unternehmen und hier insbesondere mit transnationalen Unternehmen, ebenso mit ausländischen Direktinvestitionen auch anhand von Beispielen sowie mit Lieferketten und deren Management. Die Europäische Union steht im Teil 3 im Mittelpunkt, von einem Überblick über die EU bis hin zu der Rolle der EU im Zusammenhang mit der Globalisierung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
utb 6392
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Psychosozial-Verlag · Gießen
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Gerhard Puhlmann (MBA) ist langjähriger Tutor und Dozent an der Euro-FH Hamburg sowie Geschäftsführer der S-Servicepartner Berlin GmbH, mit rund 750 Mitarbeitenden das größte Unternehmen für Marktfolgedienstleistungen in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Prof. Dr. Irene E. Rath ist Studiengangs-Dekanin für die Studiengänge International Business Administration (B.A), BWL und Customer Experience (B.A.), Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) und International Management (M.A.) sowie Professorin für Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management an der Euro-FH Hamburg.
Gerhard Puhlmann / Irene E. Rath
Herausforderungen in der Globalisierung
Global Governance, Transnationale Unternehmen, Europäische Union
Umschlagabbildung: © iStockphoto · blackdovfx
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
https://doi.org/10.36198/9783838563923
© UVK Verlag 2025
– Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption l gestaltung
utb-Nr. 6392
ISBN 978-3-8252-6392-8 (Print)
ISBN 978-3-8385-6392-3 (ePDF)
ISBN 978-3-8463-6392-8 (ePub)
Vorwort
Die Welt, wie wir sie kennen und in der wir leben, verändert sich rasant. „Globalisierung“ ist eines der wesentlichen Schlagworte, das diese tiefgreifenden Veränderungen der letzten Jahrzehnte erfasst und auch beschreibt.
Globalisierung ist eine Entwicklung, die über die wirtschaftlichen Veränderungen deutlich hinausgeht und die für eine zunehmende Verflechtung und Vernetzung der Welt auch in politischer, kultureller und technologischer Hinsicht steht. Sie beeinflusst unser tägliches Leben, unsere Arbeit, unsere Kultur und sogar unsere nationale, europäische, aber auch internationale Identität.
Alle Menschen weltweit sind von Globalisierung betroffen ‒ lediglich der Umfang der jeweiligen Betroffenheit in den unterschiedlichen Regionen unserer Welt variiert dabei, dies jedoch in erheblichem Umfang.
Im Zuge der zunehmenden Krisen bis hin zu Kriegen stellt sich allerdings immer wieder die Frage, wieviel Globalisierung gut und wieviel Globalisierung auch sinnvoll ist.
Drehen wir das Rad der Globalisierung vollständig zurück, produzieren wir nur noch im eigenen Land und betreiben wieder Protektionismus, oder wird unser wirtschaftliches Handeln zukünftig (oder auch schon heute) auch von ethischem und völkerrechtlichem Handeln bestimmt?
Inwieweit flechten wir klimapolitische Aspekte in unseren Handelsbeziehungen mit ein?
Kann eine Globalisierung funktionieren, wenn Teile der Welt behaupten, es gäbe keinen Klimawandel und / oder wenn Länder diesen Klimawandel in ihrem Handeln nicht beziehungsweise nicht angemessen berücksichtigen?
Inwieweit spielen der zunehmende, weltweit zu beobachtende Rechtsdruck und Populismus eine Rolle bei unseren wirtschaftlichen Entscheidungen?
Können wir uns als Deutschland oder als Teil von Europa solche Überlegungen überhaupt leisten?
Aus Globalisierung resultieren Chancen, aber auch Risiken, die mit der Globalisierung einhergehen ‒ aus unserer Sicht als Autoren überwiegen die Chancen die Risiken deutlich.
Dieses Buch verfolgt das Ziel, die komplexen Prozesse der Globalisierung anschaulich darzustellen. Dafür haben wir uns in diesem Buch auf drei Aspekte fokussiert:
Teil 1: „Globalisierung und Global Governance“ mit einem Überblick über die Globalisierung an sich, die damit verbundenen Chancen und Risiken, die aktuellen Entwicklungen sowie den weltweite Rechtsrahmen.
Teil 2: „Transnationale Unternehmen“ als wesentliche Akteure der Globalisierung.
Teil 3: „Die Europäische Union im Prozess der Globalisierung“ mit einem Überblick über die EU sowie einer kurzen Vorstellung ausgewählter Handelsabkommen mit der EU als Vertragspartner.
Unser Ziel ist, dass Sie einen Überblick erhalten und verstehen,
was den modernen Prozess von Globalisierung ausmacht,
welche Faktoren die Globalisierung unterstützt haben,
welche Akteure es im Zusammenhang mit der Globalisierung gibt,
welche positiven und negativen Aspekte mit Globalisierung verbunden werden,
welche aktuellen Entwicklungen Globalisierung beeinflussen und teilweise zu einer De-Globalisierung führen,
welche Notwendigkeiten es für eine Global Governance gibt, wie diese ausgestaltet ist und wie sie sich im Zeitverlauf entwickelt hat,
wo Global Governance an ihre Grenzen stößt und aus welchen Gründen.
Über Erklärfilme und Aufgaben haben Sie die Möglichkeit, für Sie interessante Aspekte weiter zu vertiefen.
Am Ende dieses Buchs sind Ihnen wichtige Aspekte und Zusammenhänge von Globalisierung und von Global Governance bekannt.
Es lohnt sich, die aktuellen Entwicklungen in einer äußert schnelllebigen Zeit weiter zu verfolgen und die erworbenen Kenntnisse weiter zu vertiefen.
„Die Globalisierung erzeugt Dynamik, bringt Veränderungen, aber auch viele Chancen.
Wo einander widersprechende Weltsichten, Werte oder Lebensweisen aufeinandertreffen, können Unsicherheit und Desorientierung entstehen. Viele haben Angst vor dem Unbekannten, Fremden. Gleichzeitig verschwinden Grenzen, Menschen verschiedener Kulturen kommen sich näher.
Für junge Menschen ist es heute selbstverständlich, international zu denken und zu arbeiten. Wir müssen diese vielfältigen Chancen zur Verständigung nutzen. Jeder kann etwas dazu beitragen, damit die Zukunft gelingt.“
Elisabeth Mohn, Bertelsmann-Stiftung (n. d.)
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses Buchs.
Ihre
Gerhard Puhlmann und Irene Rath
Hinweis
Die Inhalte dieses Buchs basieren auf von den Autoren unter gleichem Titel erstellten Studienheften der Europäischen Fernhochschule Hamburg GmbH, University of Applied Sciences.
Inhaltsübersicht
Teil 1 Globalisierung und Global Governance
Einleitung
1Globalisierung
2Global Governance
Schlussbetrachtung
Lösungen zu den Aufgaben
Teil 2 Transnationale Unternehmen
Einleitung
1Weltweit tätige Konzerne – so fern und doch so nah
2Unterschiedliche Ausprägungen von Unternehmen mit Auslandsbezug
3Wachstumsstrategien von Multinationalen und Transnationalen Unternehmen
4Ausländische Direktinvestitionen (ADI)
5Die Auswirkungen von ADI chinesischer Unternehmen an den Beispielen KUKA AG, Hamburger Hafen Tollerort sowie Elmos AG
6Lieferketten, Supply Chain Management und die Verantwortung von Transnationalen Unternehmen für ihre eigenen Lieferketten
7Ein Blick auf die fünf wichtigsten Unternehmen der Digitalwirtschaft („Big 5“)
Schlussbetrachtung
Lösungen zu den Aufgaben
Teil 3 Die Europäische Union im Prozess der Globalisierung
Einleitung
1Die Europäische Union – ein (kurzer) Überblick
2Die Europäische Union als ökonomischer Faktor in der Globalisierung
3Aktuelle Ereignisse und die jeweilige Rolle der Europäischen Union
4Wesentliche aktuelle Herausforderungen für die Europäische Union und deren Mitgliedsstaaten
5Global Governance ‒ die Europäische Union in der Globalisierung
6Weltweite Bedeutung von Unternehmen aus der Europäischen Union
Schlussbetrachtung
Lösungen zu den Aufgaben
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Teil 1Globalisierung und Global Governance
Inhaltsverzeichnis Teil 1
Einleitung
1Globalisierung
1.1Was bedeutet „Globalisierung“?
1.2Internationaler Handel, ein (kurzer) historischer Rückblick
1.3Moderne Globalisierung
1.4Dimensionen der modernen Globalisierung
1.5Akteure der modernen Globalisierung
1.6Weltwirtschaft im Wandel
1.6.1Entwicklung der Globalisierung in Zahlen
1.6.2Wesentliche Gründe für die Entwicklungen
1.6.3Entwicklung des Welthandels nach Regionen
1.7Positive Aspekte von Globalisierung
1.7.1Stärkung des Wohlstands und Wirtschaftswachstums ‒ auch in Entwicklungs- und Schwellenländern
1.7.2Stärkung der Innovationskraft durch länderübergreifende Zusammenarbeit
1.7.3Zunehmende Mobilität, Zusammenwachsen von Kulturen
1.7.4Internationale Kommunikation in Krisenzeiten
1.7.5Migration als Baustein zur Fachkräfte-Rekrutierung
1.8Negative Aspekte von Globalisierung
1.8.1Ungleichverteilung der positiven Globalisierungseffekte und Einhaltung von Menschenrechten
1.8.2Zunehmende Anfälligkeit der Weltwirtschaft
1.8.3Zunehmende Umweltbelastungen, Klimawandel
1.8.4Internationale (Wirtschafts-)Kriminalität
1.8.5Steuerflucht, Steuervermeidung
1.9De-Globalisierung – aktuelle Entwicklungen
1.10Kritik am Globalisierungsprozess
1.10.1Kritik von Wirtschaftswissenschaftlern
1.10.2Kritik von NGOs am Beispiel von Attac und Terre des Hommes
1.10.3Kritik von Klimaschutzorganisationen und Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten
1.10.4Kritik von nationalen Gewerkschaften und international vernetzten Gewerkschaftsverbänden am Beispiel des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB)
1.10.5Club of Rome
1.11Zusammenfassung
2Global Governance
2.1Die Bedeutung von Global Governance, deren Entstehung und Akteure
2.2Wesentliche Akteure der Global Governance
2.2.1Von Staaten getragene internationale Organisationen
2.2.2Internationale Verbände als Interessenvertretung nationaler Organisationen am Beispiel des Internationalen Gewerkschaftsbundes
2.2.3Kooperationsabkommen am Beispiel der EU
2.2.4Informelle Absprachen und Vereinbarungen
2.2.5Vereinbarungen zwischen internationalen Organisationen und Unternehmen
2.2.6Internationale Nichtregierungsorganisationen (Non-Governmental Organisations NGOs)
2.3Global Governance gegenüber nationalen Interessen an den Beispielen der USA und der VR China
2.3.1Globalisierung, Global Governance und die USA
2.3.2Globalisierung, Global Governance und die VR China
2.4Zusammenfassung
Schlussbetrachtung
Lösungen zu den Aufgaben
Einleitung
Die Globalisierung selbst, die Chancen und Risiken aus der Globalisierung, aber auch die Sicht ausgewählter Kritiker des Globalisierungsprozesses bilden einen Schwerpunkt dieses ersten Teils. Darüber hinaus werden aktuelle Entwicklungen in Bezug auf Globalisierung und De-Globalisierung kurz vorgestellt.
Risiken und Probleme aus der Globalisierung ziehen aber auch die Notwendigkeit von rechtlichen Rahmenbedingungen nach sich. Daher bildet der weltweite Rechtsrahmen oder die „Global Governance“ den zweiten Schwerpunkt dieses Teils.
Dabei ist es nicht der Anspruch, alle Theoretiker zu Wort kommen zu lassen und damit die ausschließliche Ausrichtung zu setzen. Vielmehr haben wir versucht, ein Gleichgewicht zwischen Theorie und Praxis (anhand von Beispielen, Entwicklungen und praktischen Fällen) zu wählen, um Ihr Interesse zu wecken und Ihnen Globalisierung und auch Global Governance insgesamt „schmackhaft zu machen“.
1Globalisierung
Erklärungsansätze und Definitionen von „Globalisierung“ gibt es viele, die im Kern einander ähnlich sind.
Unterschiede in den Sichten gibt es im Wesentlichen, wenn es um die Tragweite von Globalisierung geht oder um die Frage, ab welchem Zeitpunkt sinnvollerweise tatsächlich erst von (moderner) Globalisierung gesprochen werden kann.
Nach Abschluss dieses Kapitels
-kennen Sie die Erklärung der wirtschaftlichen Globalisierung,
-haben Sie ‒ nach Absolvierung der Übung ‒ einen Überblick über die historische Entwicklung des internationalen Handels,
-wissen Sie, welche zwei wesentlichen Ereignisse als Startpunkt der „modernen Globalisierung“ gesehen werden,
-haben Sie gelernt, dass die moderne Globalisierung auch andere Dimensionen als die rein wirtschaftliche Perspektive umfasst,
-kennen Sie Chancen und Risiken der Globalisierung und aktuelle Entwicklungen in der Weltwirtschaft,
-kennen Sie die unterschiedlichen Akteure der Globalisierung sowie die Sicht der Globalisierungskritikerinnen und Globalisierungskritiker.
1.1Was bedeutet „Globalisierung“?
In Bezug auf den Schwerpunkt der wirtschaftlichen Globalisierung definiert die Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Globalisierung wie folgt:
„„Der Begriff Globalisierung wird allgemein verwendet, um eine zunehmende Internationalisierung der Märkte für Waren und Dienstleistungen, die Produktionsmittel, die Finanzsysteme, den Wettbewerb, die Unternehmen, die Technologie und die Industrien zu beschreiben.
Dies führt unter anderem zu einer erhöhten Mobilität des Kapitals, einer schnelleren Verbreitung technologischer Innovationen und einer zunehmenden Interdependenz und Einheitlichkeit der nationalen Märkte.“
(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD, 2013, übersetzt durch die Autoren)
Kurzum geht es hier vorrangig um die Zunahme des weltweiten Handels unter Berücksichtigung aller dafür zu beachtenden Rahmenbedingungen sowie um die daraus resultierende stetig zunehmende Vernetzung von Ländern und Regionen. Damit handelt es sich um eine überwiegend betriebswirtschaftliche Sicht.
Tatsächlich ergeben sich aus dieser Definition unter anderem folgende Fragen:
Gab es Globalisierung in der hier beschriebenen Form schon immer?
Auf diese Frage wird in den folgenden Unterkapiteln 1.2 und 1.3 eingegangen.
Umfasst der Begriff „Globalisierung“ tatsächlich nur wirtschaftliche Aspekte oder geht Globalisierung (deutlich) darüber hinaus?
Diese Fragestellung wird in Unterkapitel 1.4 vertieft. Die folgende weitere Definition zeigt aber bereits, dass Globalisierung nicht mit der betriebswirtschaftlichen Sicht enden kann, sondern alle volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren umfasst.
„Globalisierung ist ein dynamischer Prozess, der die wirtschaftliche Vernetzung der Welt durch den zunehmenden Austausch von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräften vorantreibt, die wirtschaftliche Bedeutung nationaler Grenzen verringert und den internationalen Wettbewerb immer weiter intensiviert, sodass durch das Zusammenwachsen aller wichtigen (Teil-)Märkte die Möglichkeiten internationaler Arbeitsteilung immer intensiver genutzt werden, sich der weltweite Einsatz der Ressourcen laufend ‒ wirtschaftlich ‒ verbessert, ständig vielfältige neue Chancen aber auch Risiken entstehen und die (nationalen und internationalen) politischen Akteure gezwungen sind, laufend Entscheidungen zur Gestaltung der Globalisierung zu treffen ‒ ein Prozess, der von intensiven interkulturellen Interaktionen und einem Wissensaustausch zwischen den Kulturen begleitet wird.“(Koch, 2022, S.11)
Auch die Frage, ob alle Länder gleichermaßen Akteure in der Globalisierung sind und gleichermaßen von ihr profitieren, ist für das Verständnis wichtig:
Globalisierung konzentriert sich auf die Industrienationen Europas, Nordamerikas und Asiens (OECD-Länder), die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, die Volksrepublik China – „VR China“, Südafrika) überwiegend noch ohne die seit Anfang 2024 beigetretenen Länder als BRICS+, sowie auf wenige weitere Schwellenländer in Asien und Lateinamerika.
Rund 80 % aller Länder spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle; ihr Beitrag im Rahmen der Globalisierung, aber auch ihr eigener Nutzen aus der Globalisierung ist eher gering.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht versucht die Globalisierung den Einsatz der weltweit vorhandenen, unterschiedlichsten Produktionsfaktoren zu optimieren.
1.2Internationaler Handel, ein (kurzer) historischer Rückblick
Unstrittig ist, dass es Handel über Grenzen hinweg schon lange gibt, sei es im Altertum, im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit. Die Frage, ob dabei bereits von einem „globalisierten Handel“ gesprochen werden kann, wird allerdings sehr unterschiedlich beantwortet.
Wir wollen hier nicht die unterschiedlichen Sichten darstellen und diskutieren oder mit dem Handel mit Federn, Muschelschalen, Feuerstein oder Schneckenhäuser als Tauschobjekte für Waren und damit als Vorläufer des Geldes beginnen.
Aber beispielsweise
vom Handel der Phönizier zwischen 1200 und 900 vor Christi Geburt über weite Entfernungen hinweg (Abbildung 1.1 zeigt, dass nicht nur Schiffe von den Phöniziern genutzt wurden, sondern auch Münzen als Zahlungsmittel),
über die (alte) Chinesische Seidenstraße, die über ein Geflecht von Routen und Wegen zwischen China und dem östlichen Mittelmeer viele Länder umfasste,
von den Wikingern, die ‒ neben ihren Raubzügen ‒ einen regen Handel mit vielen Ländern praktizierten,
vom Handel der Römer zu Zeiten des Römischen Reiches,
vom Handel der Hanse oder der italienischen Städte Venedig, Florenz und Genua,
bis hin zur Entdeckung Amerikas und der Verlagerung des Handels über Seewege zum Atlantik
in den unterschiedlichen geschichtlichen Epochen haben alle Leser mal mehr, mal weniger gehört.
Abb. 1.1: Darstellung eines phönikischen Schiffes auf einer antiken Münze (Welt, 2013)
Da der Schwerpunkt dieses Buchs auf der neueren Zeitrechnung liegt, bieten wir Ihnen am Ende dieses Kapitels die Aufgabe 1 für eine historische Einordnung des Welthandels an.
1.3Moderne Globalisierung
Wenn im Unterkapitel 1.2 von der historischen Einordnung des weltweiten Handels gesprochen wird, stellt sich die Frage, ab wann von einer „modernen Globalisierung“ gesprochen werden kann.
Auch hierzu gibt es unterschiedliche Ansichten, die jeweils gut begründet werden. Zwei Ereignisse aus der jüngeren Geschichte sind jedoch als besondere Meilensteine der modernen Globalisierung besonders relevant:
Das Ende des zweiten Weltkriegs, hier gilt insbesondere das Abkommen von Bretton Woods als wesentliche Grundlage für die moderne Globalisierung.
Der ab 1985 beginnende Zerfall des Ostblocks und die Auflösung der Sowjetunion Ende 1991.
Wir nehmen hier keine Wertung vor, welches dieser beiden Ereignisse entscheidender war. Vielmehr wird auf die beiden oben genannten Meilensteine im Abschnitt 1.6.2 vertiefend eingegangen.
1.4Dimensionen der modernen Globalisierung
Tatsächlich geht Globalisierung über die rein wirtschaftliche Sicht und die Definition der OECD aus dem Unterkapitel 1.1 weit hinaus und umfasst beispielsweise auch die Globalisierung von Politik sowie kulturelle und soziale Aspekte.
Der Grad der Globalisierung einzelner Länder wird anhand von Globalisierungsindices wie beispielsweise dem sogenannte „KOF-Index“ (KOF: Konjunkturforschungsstelle) der Schweizerischen Wirtschaftshochschule gemessen. Dieser beurteilt neben einer Gesamtsicht auch den wirtschaftlichen, politischen und sozialen Grad der Globalisierung (erstmals Dreher, 2006).
Tabelle 1.1 verdeutlicht die Vielfalt dieser hier für diesen Globalisierungsindex als relevant eingestuften Komponenten sowie deren Zuordnung zu den Kategorien Politik, Wirtschaft und Soziales. An dem Beispiel der „Ikea-Filialen“ oder der „Mobiltelefone pro Kopf“ wird aber auch deutlich, dass zu der Aussagekraft unterschiedlicher Indizes auch sehr unterschiedliche Meinungen existieren.
Tab. 1.1: Indikatoren des Globalisierungsindex nach Kategorien (eigene Darstellung in Anlehnung an Dreher, erste Veröffentlichung 2006, Stand 2024)
Wirtschaftliche Globalisierung
Politische Globalisierung
Soziale Globalisierung
Handelsglobalisierung
•Als Anteil des BIP:
–Güterhandel und
–Dienstleistungshandel
•Diversifikation der Handelspartner
•Höhe der Zölle auf Importe
•Handelsregulierung
Finanzielle Globalisierung
•Höhe in Anteil am BIP:
–Ausländische Direktinvestitionen
–Auslandsüberweisungen
–Auslandsschulden
–Devisenreserven
•Ausmaß der Restriktionen für ausländisches Kapital
Interpersonelle Globalisierung
•Internationaler Telefonverkehr
•Anzahl der
–Mobiltelefone pro Kopf
–internationalen Touristen in Relation zur Bevölkerung
–internationalen Flughäfen
•Reisefreiheit
•Migrantenanteil der Bevölkerung
Globalisierung der Information
•Anzahl der
–Patentanmeldungen durch ausländische Personen
–Auslandsstudierende in Relation zur Bevölkerung
–Haushalte mit Fernsehen
–Haushalte mit Internetanschluss
•Anteil High-Tech-Exporte als Anteil an gesamten Exporten
•durchschnittliche Internetgeschwindigkeit,
•Presse- und Medienfreiheit
•Gesamtzahl der ausländischen Botschaften in einem Land
•personeller Beitrag zu UN-Friedenstruppen pro Kopf
•Anzahl der
–internationalen Nichtregierungsorganisationen (NGO)
–internationalen Organisationen, in denen ein Land Mitglied ist
–internationalen Abkommen, die ein Land unterzeichnet hat
–Partnerländer, mit denen internationale Abkommen geschlossen wurden
Kulturelle Globalisierung
•Anteil des Handels mit
–kulturellen Gütern
–Dienstleistungen
•Anzahl der
–Registered Trade Marks
–McDonald’s-Filialen und 1KEA-Läden pro Kopf
•Gleichberechtigung der Geschlechter
•staatliche Bildungsausgaben pro Kopf
•Respektierung der Bürgerrechte
Folgende Tabelle 1.2 zeigt die Top 5-Länder im Globalisierungsindex 2023 (auf Basis von Daten aus 2021) sowie deren Werte für die einzelnen Komponenten. Sofern Deutschland nicht unter den Top 5 lag, wurde Deutschland mit Rangstelle und Daten hinzugefügt.
Tab. 1.2: Globalisierungsindex 2023: Top 5-Länder und Deutschland auf Basis von Daten aus 2021 (eigene Darstellung, Daten aus Gygli et al., 2021)
Europäische Länder inklusive Deutschlands belegen nicht nur die Top 5-Ränge in der Gesamtbetrachtung („Gesamtindex“). Mit Kanada folgt erst auf Rang 18 das erste nichteuropäische Land.
Auf den letzten drei Rangstellen des Index 2023 liegen mit Somalia (196.), Eritrea (195.) und der Zentralafrikanische Republik (194.) durchgängig Staaten aus Afrika mit Indexwerten deutlich unter 40, für Somalia nur bei 30 (Gygli et al., 2021).
Damit wird die Aussage im Unterkapitel 1.1 unterlegt, dass nicht alle Länder und Regionen in vergleichbarem Umfang Akteure der Globalisierung sind – egal wie man zu einzelnen Indikatoren des hier vorgestellten Index steht.
Abschließend verdeutlicht Abbildung 1.2 den gravierenden Anstieg des Gesamtindex-Wertes und damit den zunehmenden Grad der Globalisierung von 1970 bis 2021 in dem Vergleich Welt (grün) mit Deutschland (blau). Es wird deutlich, dass der Indexwert weltweit in dem betrachteten Zeitraum stärker gestiegen ist als der Deutschlands.
Abb. 1.2: Entwicklung der Globalisierungsindices im Zeitverlauf 1970 bis 2021 ‒ Welt und Deutschland im Vergleich (Gygli et al., 2021)
Auf wesentliche Regionen und Länder mit Bezug zur Europäischen Union (EU) wird – unabhängig von der Index-Rangstelle – in dem Teil 3 dieses Buchs „Die EU im Prozess der Globalisierung“ weiter eingegangen.
1.5Akteure der modernen Globalisierung
Unternehmen, hier insbesondere transnationale Unternehmen (Transnational Corporations, TNCs) sind wesentliche Treiber der Globalisierung. TNCs ist daher auch der zweite Teil dieses Buchs gewidmet.
Abbildung 1.3 gibt einen Überblick über weitere Akteure im Globalisierungsprozess, auf die im Anschluss kurz eingegangen wird.
Unternehmen (inklusive TNCs ‒ siehe Teil 2 „Transnationale Unternehmen“)
Neben TNCs hat nahezu jedes Unternehmen mindestens internationale, häufig auch weltweite Kontakte. Wesentliche Gründe sind der Bezug von Rohstoffen oder Bauteilen für die eigene Produktion aus unterschiedlichen Ländern und / oder international ausgerichtete Absatzmärkte.
Personen
… können beispielsweise als Arbeitnehmende im Ausland, als Kundinnen und Kunden ausländischer Unternehmen oder als Reisende in einer globalisierten Welt in Erscheinung treten.
Abb. 1.3: Akteure der Globalisierung (Koch, 2022, S. 50)
Einzelne Länder / Staaten
… bestimmen im Innenverhältnis beispielsweise Steuern, nationale Gesetze und Standortbedingungen auch für Unternehmen und im Außenverhältnis ihre Außen- oder Außenwirtschaftspolitik, beispielsweise über die Höhe ihrer Zölle oder Wechselkurse. Sie beeinflussen dadurch den Erfolg (oder Misserfolg) von Unternehmen und schaffen Arbeitsplätze (oder vernichten diese).
Länderkooperationen
… wie beispielsweise Europäische Union (EU), USMCA (United States Mexico Canada Agreement) als Nachfolgeabkommen des NAFTA (North American Free Trade Agreement, Nordamerikanisches Freihandelsabkommen), RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, Verband Südostasiatischer Nationen) oder Mercosur (Mercado Común del Sur, Gemeinsamer Markt des Südens) sollen die Rahmenbedingungen über die Möglichkeiten einzelner Länder hinaus verbessern und erfolgreiche Kooperationen ermöglichen.
Auf Länderkooperationen wie die EU selbst sowie solche mit Bezug zur EU wird im dritten Teil dieses Buchs „Die EU im Prozess der Globalisierung“ weiter eingegangen.
Einzelne (Welt-)Metropolen
… wie beispielsweise New York, Tokio, Jakarta, Delhi, Shanghai, Shenzen, London, Paris oder Frankfurt am Main versuchen über attraktive Rahmenbedingungen interessante Unternehmen von einem Standort vor Ort zu überzeugen, genauso aber auch Zuzüge von interessanten Privatpersonen zu erhöhen. Darüber hinaus sind sie beispielsweise auch Ziel von international Reisenden und meist auch Standort internationaler Flughäfen. Einzelne Städte haben sich dabei auf bestimmte Themen ausgerichtet, wie beispielsweise Frankfurt am Main und London als Finanzmetropolen.
Nationale und internationale Organisationen sowie Nichtregierungsorganisationen (Non Governmental Organisations, NGOs)
… vertreten die sehr unterschiedlichen Interessen ihrer Mitglieder nicht nur im eigenen Land, sondern vielfach auch über Netzwerke international beziehungsweise weltweit. Auf ausgewählte Organisationen wie beispielsweise den Internationalen Währungsfonds (IWF), die Vereinten Nationen (United Nations, UN), die World Trade Organisation (WTO), NGOs wie Attac (Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens, Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der Bürgerinnen und Bürgern) oder den Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) wird im weiteren Verlauf eingegangen.
Netzwerke für Kriminalität und Terror
… profitieren beispielsweise von Reisefreiheiten oder – bei Internet-Kriminalität – von den Möglichkeiten des World Wide Web. Im Abschnitt 1.8.4 werden Beispiele der internationalen (Wirtschafts-)Kriminalität vorgestellt.
(Koch, 2017, S. 50f)
1.6Weltwirtschaft im Wandel
Dieses Unterkapitel soll einen Überblick über beispielhafte Parameter der Weltwirtschaft geben, dann aber vor allem auf die wesentlichen Gründe für deren Entwicklung eingehen.
Es geht nicht darum, ein lückenloses Bild aller Facetten in Zahlen aufzuzeigen. Vielmehr sollen Sie ein Gefühl für die Entwicklungen in der Weltwirtschaft erhalten und die wesentlichen Gründe dafür kennen.
1.6.1Entwicklung der Globalisierung in Zahlen
Folgende Tab. 1.3 zeigt als Einstieg anhand einiger Parameter einzelne Entwicklungen im Rahmen der modernen Globalisierung. Die verfügbaren Jahressichten sind untereinander nicht identisch. Die Aufstellung soll dennoch ein erstes Gefühl für einzelne rasante Entwicklungen in den Bereichen
Handel
(hier: Exporte)
Finanzen
(hier: Devisenreserven und -umsätze)
Transport
(hier: Kapazität von Containerschiffen)
Umwelt
(hier: CO2-Ausstoss), sowie
Internationale Verflechtungen (hier: ausländische Direktinvestitionen)
vermitteln.
Tab. 1.3: Ausgewählte Indikatoren in ihrer Entwicklung (eigene Darstellung in Anlehnung an United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD 2024 a-b; International Monetary Funds, IMF 2023a und 2024a, Bank for international Settlement, BIZ 2020, Global Carbon Project 2023a)
Wirtschaftsbereich
historische Daten
gegenwärtige Daten
Exporte weltweit (in Milliarden US-Dollar)
59 (1948)
23.783 (2023)
Devisenreserven weltweit (in Milliarden US-Dollar)
1.390 (1995)
11.902 (Q3 2023)
Täglicher Umsatz an den weltweiten Devisenmärkten (in Milliarden US-Dollar)
539 (1989)
6.590 (2019)
Kapazitäten von Containerschiffen im Weltseehandel (in Millionen dwt - deadweight tonnage)
11 (1980)
305 (2023)
CO2-Ausstoss weltweit (in Millionen Tonnen)
9.386 (1960)
37.150 (2022)
Ausländische Direktinvestitionen (ADI Outflow) weltweit (in Milliarden US-Dollar)
12 (1970)
2.013 (2022)
Bei der Bewertung dieser Zahlen sind immer aktuelle Weltereignisse zu berücksichtigen. So hatten beispielsweise die als wichtiger Indikator für Globalisierung geltenden ausländischen Direktinvestitionen im Jahr 2007 (kurz vor der Finanzmarktkrise) ihren Höchstwert mit 3.195 Milliarden US-Dollar gegenüber den hier für das Jahr 2022 gezeigten „nur“ 2.013 Milliarden US-Dollar für das erste Jahr nach der Hochphase der Corona-Pandemie.
Wichtig ist hierbei auch die Unterscheidung in
intraregionaler Handel (über Grenzen hinweg, aber in einer Region) wie beispielsweise innerhalb der EU;
interregionaler Handel (zwischen unterschiedlichen Weltregionen) wie beispielsweise zwischen Deutschland und der VR China.
Der vertiefende Blick auf die Exporte in Abbildung 1.4 zeigt, dass seit 1960 die Warenexporte deutlich stärker gewachsen sind als die eigentliche Warenproduktion.
Abb. 1.4: Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenhandels (Bundeszentrale für politische Bildung, 2023)
Aus dieser Entwicklung der letzten Jahrzehnte wird die steigende Bedeutung des Außenhandels genauso deutlich wie die Veränderung des Verhältnisses der Weltwarenexporte zu der Weltwarenproduktion. Der wesentliche Grund für die zunehmende Spreizung ist die zunehmende und weltweit ausgerichtete Fragmentierung der Lieferketten, um Produktionskosten zu optimieren. Jede einzelne Weiterleitung eines unfertigen Produktes nach einem Produktionsschritt in ein anderes Land erhöht den Warenexport, nicht jedoch die Warenproduktion. Parallel hat die Globalisierung des Kapitalverkehrs über internationale Finanzmärkte gravierend an Bedeutung gewonnen (Bundeszentrale für politische Bildung, 2023).
Auch hier sind weltweit wirkende Ereignisse aus den Rückgängen in einzelnen Jahren erkennbar – die Auswirkungen der Finanzmarktkrise (mit dem Zusammenbruch der US-amerikanischen Großbank Lehman Brothers als Höhepunkt im September 2008) im Jahr 2009 und das erste Jahr der Corona-Pandemie 2020.
Welche weltweiten Veränderungen diese Entwicklungen begünstigt haben, wird in Abschnitt 1.6.2 erläutert.
Für eine wissenschaftlich fundierte Betrachtung wäre die Bevölkerungsentwicklung in der Welt genauso zu berücksichtigen, wie die Entwicklung der Wechselkurse. An dem hier aufgezeigten Trend würden sich aber keine wesentlichen Veränderungen ergeben.
Die Erläuterung der in Abbildung 1.4 abgebildeten Entwicklung wird durch die Relation dieses Wachstums zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) in dem Zeitraum 1980 bis 2007 bestätigt:
„Seit 2012 wächst der Welthandel ungefähr im Gleichschritt mit dem globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) um nur noch 2 bis 3 Prozent pro Jahr, mit Ausnahme von 2017, als alle großen Wirtschaftsräume synchron wuchsen.
Zwischen 1980 und 2007 wuchs der weltweite Handel dagegen ungefähr doppelt so schnell wie das globale BIP.
Damit stagniert derzeit die Handelsintensität, also der Anteil des Handels am globalen BIP ‒ ein Novum in der Nachkriegszeit. Mehrere Faktoren sind hier ausschlaggebend: Die ökonomischen Folgen der Finanzkrise, wie beispielsweise geringere Investitionen der Unternehmen, erhöhte Unsicherheit, geringere Nachfrage, aber auch starker politischer Gegenwind für den Handel durch Zölle und handelserschwerende Vorschriften, spielen alle eine Rolle.“ (Börsch, 2020, basierend auf WTO)
Es wird deutlich, dass lange Zeit das prozentuale Wachstum des Welthandels über dem prozentualen Wachstum des BIP lag und erst die Folgen der Finanzmarktkrise diese Relation verringerten.
Das in dem Zitat beschriebene „Novum“ setzt sich seit 2020 mit der Corona-Pandemie und weiteren Ereignissen fort. Im Unterkapitel 1.9 wird auf aktuelle Entwicklungen in Bezug auf Globalisierung eingegangen, beispielsweise auch auf gestörte Lieferketten.
1.6.2Wesentliche Gründe für die Entwicklungen
Wie bereits in Unterkapitel 1.3 geschrieben, gibt es mit dem Abkommen von Bretton Woods und dem Auseinanderbrechen des „Ostblocks“ zwei Ereignisse, die wesentlich sind für den Start der modernen Globalisierung. Auf diese beiden Ereignisse wird im Folgenden genauso eingegangen, wie auf die Entwicklung der Transport- und Kommunikationskosten sowie auf die Liberalisierung des Welthandels inklusive der zunehmenden Freizügigkeit für Personen und Unternehmen zwischen unterschiedlichen Ländern.
1.6.2.1Ende des Zweiten Weltkriegs und Abkommen von Bretton Woods
Das Abkommen von Bretton Woods ist benannt nach dem gleichnamigen Ort im US-Bundesstaat New Hampshire, wo sich im Juli 1944 die Finanzminister und Notenbankgouverneure der späteren Siegermächte des Zweiten Weltkrieges aus 44 Staaten auf ein System fester Wechselkurse einigten. Deutschland trat dem Abkommen im Jahr der Gründung 1949 bei.
In dem Abkommen wurde der US-Dollar als Leitwährung für die Wechselkurse festgelegt, mit einem festen Wert von 35 US-Dollar für eine Unze Feingold (nach dem amerikanischen Volkswirt und Politiker Harry Dexter White benannter „White-Plan“). Zusätzlich wurde die Gründung der Weltbank und des IWF vereinbart.
Die USA waren damit völlig autonom in Bezug auf ihre Währungs- und Geldpolitik. 1971 kündigten die USA ihre Verpflichtung, Dollar in Gold einzulösen, nachdem 1969 Frankreich seine Dollarreserven in Gold umtauschen wollte und die Goldreserven nicht einmal für die Forderung dieses einen Landes ausgereicht hatten.
In der Folge brach das System zusammen und wurde durch flexible Wechselkurse abgelöst. 1973 wurde das Bretton-Woods-System außer Kraft gesetzt, die Wechselkurse wurden endgültig freigegeben.
Abb. 1.5: Wechselkurssystem nach Bretton Woods, Gold-Dollar-Bindung (Gold.de, 2022)
Aus Abbildung 1.5 wird das bis 1973 geltende Wechselkurssystem mit dem US-Dollar als (Welt-) Leitwährung sowie dessen Bindung an Gold im Verhältnis 35 US-Dollar für eine Unze Gold deutlich. Ablesbar ist auch die weitere Entwicklung des Goldpreises ab 1973 (US-Dollar pro eine Feinunze Gold).
Der IWF und die Weltbank (heute Weltbankgruppe) blieben bis heute erhalten (Deutsche Bundesbank, 2013).
Damit wurden nicht nur mit dem IWF und der Weltbank auch heute noch wesentliche Institutionen gegründet. Es war auch ein weiterer wesentlicher Meilenstein für die wachsende Bedeutung der USA in der globalen Weltordnung. Diese Bedeutung hat sich im Lauf der Zeit immer wieder verändert, die USA sind aber auch heute der wesentliche Faktor in der westlichen Welt (siehe Abschnitt 2.3.1).
Abb. 1.6: Die Bretton-Woods-Konferenz 1944 (Höfinghoff, 2008 und Deutsche Bundesbank, 2013)
1.6.2.2Zerfall der Sowjetunion und des „Ostblocks“ ab 1985
Zum (von der westlichen Welt geprägten Begriff) „Ostblock“ gehörten neben der Sowjetunion die ehemalige Tschechoslowakei und das ehemalige Jugoslawien, die Deutsche Demokratische Republik (DDR), Polen, Rumänien, Bulgarien und Ungarn sowie bis 1960 Albanien. Auf andere, unter dem Einfluss der Sowjetunion stehende Staaten in der Welt, die im weiteren Sinne auch zum „Ostblock“ gezählt wurden, wie beispielsweise Kuba und sogar das frühe China, wird hier nicht weiter eingegangen.
Diesen „Ostblock“ und dessen zugehörigen Staaten prägten drei Besonderheiten:
der Warschauer Pakt als militärisches Bündnis,
der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) für die wirtschaftliche Zusammenarbeit,
das Kommunistische Informationsbüro (Kominform) für die politische und ideologische Ausrichtung.
Abb. 1.7: Zerfall der Sowjetunion 1990/1991 (Bergmoser + Höller Verlag AG, 2014)
Nach Jahrzehnten des kalten Krieges wurde der im August 2022 verstorbene Michail Gorbatschow 1985 zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt. Sein System von „Perestroika“ (Umbau des eigenen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systems) und „Glasnost“ (Transparenz und Offenheit des Staates gegenüber der eigenen Bevölkerung) entspannte auch die Situation zwischen der Sowjetunion und den USA. Es führte nach und nach zur Beendigung der Bevormundung der Mitgliedstaaten des „Ostblocks“, bis dieser ab dem Herbst und Winter 1989 nach friedlichen Demonstrationen in einigen Mitgliedsländern auseinanderfiel und einen Höhepunkt im Fall der Berliner Mauer und der ein Jahr später folgenden Wiedervereinigung Ost- und Westdeutschlands hatte. Ende 1991 wurde die Sowjetunion offiziell aufgelöst (Kleinert, 2019, S. 519ff).
Um ein Gefühl für ihre Größe und damalige Zusammensetzung zu erhalten, zeigt Abbildung 1.7 die ehemalige Sowjetunion (ohne weitere zum „Ostblock“ gehörende Länder) und die Daten der Unabhängigkeitserklärungen der ehemals zu ihr gehörenden Staaten.
Mit dem Zerfall des Ostblocks haben sich nicht nur die Landesgrenzen für den Handel und den Tourismus geöffnet. Vielmehr haben sich auch die Machtverhältnisse sukzessive in Richtung des Westens verschoben, da nahezu jedes Land seine eigene wirtschaftliche und sicherheitspolitische Ausrichtung frei bestimmen konnte. Nur wenige Länder wie beispielsweise Weißrussland blieben bis heute unter einem deutlichen Einfluss Russlands, so dass von „freien Entscheidungen“ nicht wirklich gesprochen werden kann.
Einige Länder wurden Mitglieder der EU und auch der NATO (North Atlantic Treaty Organization, Nordatlantikpakt). Umgekehrt wurde der Warschauer Pakt aufgelöst.
Der Wirtschaftsraum Europa, der internationale Handel und damit auch die Globalisierung bekamen einen deutlichen Schub, nicht zuletzt auch durch die Ost-Erweiterungen der EU in den Jahren 2004 und 2007.
1.6.2.3Entwicklung der Transport- und Kommunikationskosten
In den letzten Jahrzehnten war ein drastischer Verfall der Transport- und Kommunikationskosten feststellbar, beide sind wesentliche Faktoren für den Import und Export (Transport) sowie für den Abschluss sowie die Abwicklung von Verträgen weltweit (Kommunikation). Die Entwicklung seit 1930 wird aus Abbildung 1.8 deutlich.
Dass keine aktuelleren Daten verfügbar sind, kann hier vernachlässigt werden, da die gravierenden Rückgänge auch so deutlich werden (Statista, 2013):
Bei der Seefracht und der Passagierluftfahrt verringerten sich die Kosten im Betrachtungszeitraum um etwa 80 beziehungsweise 90 Prozent,
bei den Kommunikationskosten (hier die Gebühren für ein dreiminütiges Telefongespräch von New York nach London) sogar um 99,9 Prozent gegenüber dem Niveau von 1930.
Diese drastischen Rückgänge spielen eine maßgebliche Rolle für die moderne Globalisierung.
Abb. 1.8: Entwicklung der weltweiten Transport- und Kommunikationskosten in den Jahren 1930 bis 2005 (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD, 2006)
Hafenanlagen wie der Hamburger Hafen verdeutlichen die enorme Rationalisierung des Transportwesens, die erst die Kostenreduktion in diesem Bereich ermöglichte. Gerade Container, Containerhäfen und die immer größer werdenden Containerschiffe symbolisieren die Entwicklungen im globalen Transportwesen in Bezug auf Standardisierung und Leistungsfähigkeit sowie insgesamt sinkende Transportkosten.
Aus Abbildung 1.9 werden die Dimensionen von modernen Containerschiffen deutlich.
Abb. 1.9: Hamburg, Hamburger Hafen (© Silver / Pixabay, 2018)
Das folgende Video der HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG gibt darüber hinaus einen Eindruck über den modernen und weitestgehend automatisierten Hamburger Hafen, hier über das Container-Terminal Altenwerder.
https://hhla.de/unternehmen/tochterunternehmen/container-terminal-altenwerder-cta/so-funktioniert-cta
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, HHLA (n. d.).
In den letzten Jahren sind Container aber umgekehrt auch zu einem Symbol für die Zerbrechlichkeit von weltweiten Lieferketten geworden. Auf die Entwicklungen, unter anderem im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (SARS-COV-2 oder COVID-19), wird in Unterkapitel 1.9 weiter eingegangen.
Darüber hinaus belastet der weltweite Transport von Waren die Umwelt (siehe Abschnitt 1.8.3).
1.6.2.4Politische Liberalisierung und Deregulierung
Mit folgenden wesentlichen Veränderungen versuchten ab den 1980er-Jahren immer mehr Staaten, Hindernisse für den weltweiten Handel zu beseitigen und die Attraktivität des eigenen Standortes zu steigern:
Liberalisierung
Weltweite Forcierung eines freien Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs, der Freizügigkeit von Personen sowie der Niederlassungsfreiheit u. a. für Unternehmen.
Deregulierung
Überprüfung aller nationalen Gesetze, Vorschriften und Regelungen zum Abbau von Bürokratie (Überregulierung) beispielsweise auf den Arbeits-, Finanz- und Gütermärkten.
Privatisierung
Beseitigung von Staatsmonopolen, Steigerung der Profitabilität bislang staatlich reglementierter Sektoren wie Telekommunikation, Energie, Infrastruktur, Transport. Schaffung von (mehr und internationalem) Wettbewerb in diesen Sektoren.
Flankiert wurde dieser Prozess durch immer mehr internationale Vereinbarungen im Bereich von Währung und Wirtschaft, um einen verbindlichen Rahmen und damit die Voraussetzungen für eine Intensivierung der Globalisierung zu schaffen (Koch, 2022, S. 15f). Auf diese internationalen Vereinbarungen wird in Kapitel 2 weiter eingegangen.
Abb. 1.10: Asiens wachsende Bedeutung im Welthandel 1950 bis 2020 (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, 2023a)
1.6.3Entwicklung des Welthandels nach Regionen
Nicht nur der weltweite Handel an sich hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt, es ist auch eine Verschiebung feststellbar, mit einer deutlichen Stärkung Asiens.
Die vorangegangene Abbildung 1.10 zeigt die wachsende Bedeutung Asiens anhand des Anstiegs des Anteils in Prozent an den weltweiten Exporten von 1950 bis 2022.
Während Asien früher durch Japan Anteile gewinnen konnte, ist der Aufstieg Asiens mittlerweile maßgeblich geprägt durch den Aufstieg der VR China. Gleichzeitig sind die Anteile Europas und Nordamerikas in dem betrachteten Zeitraum deutlich rückläufig.
Bei dem Aufstieg Asiens spielen auch Freihandelsabkommen eine zunehmende Rolle. So ist mit dem im Jahr 2020 unterzeichneten und im Jahr 2022 in Kraft getretenen Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) die größte Freihandelszone der Welt entstanden, die für rund ein Drittel des Welthandels steht. Teilnehmende Staaten sind Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam, die VR China, Japan, Südkorea, Australien sowie Neuseeland. Indien war an den Verhandlungen beteiligt, ist dem Abkommen am Ende aber nicht beigetreten.
1.7Positive Aspekte von Globalisierung
In diesem Unterkapitel zeigen ausgewählte Aspekte die positiven Seiten der Globalisierung, wobei der Schwerpunkt der positiven Aspekte auf dem Abschnitt 1.7.1 liegen wird.
Festzuhalten bleibt bereits an dieser Stelle, dass (auch aus Sicht der Autoren) die positiven Aspekte der Globalisierung deutlich gegenüber den negativen Aspekten überwiegen.
Bei allen positiven Seiten wird jedoch bei jedem der folgenden Aspekte deutlich, dass noch Potential im Interesse der Weltgemeinschaft gehoben werden könnte.
1.7.1Stärkung des Wohlstands und Wirtschaftswachstums ‒ auch in Entwicklungs- und Schwellenländern
Wie in Unterkapitel 1.6 auch anhand von Indikatoren beschrieben, entwickelt sich der weltweite Handel rasant. Sinkende Herstellungskosten durch die weltweite Verteilung und Optimierung von Lieferketten sind dabei für Unternehmen genauso positiv wie die weltweite Ausweitung der Absatzmärkte für die unterschiedlichsten Produkte.
Für Endverbrauchende beeinflusst die weltweite Konkurrenz die Preise genauso positiv wie die Transparenz zu Preisen und zu Produkteigenschaften (Qualität). Beispielhaft sei hier noch einmal auf die gravierend gesunkenen Kommunikationskosten, hier auch für Endverbrauchende, hingewiesen. Aber auch Produkt- und Preisrecherchen über Internetrecherchen sind hier maßgeblich.
Insgesamt hat die Globalisierung zu einer gravierenden Wohlstandsmehrung geführt. Dieser steigende Wohlstand umfasst jedes Land, das an der Globalisierung teilnimmt.
Dabei ist es erst einmal nicht relevant, ob es sich um Industrie-, Schwellen- oder Entwicklungsländer handelt, denn jeder durch Globalisierung zusätzlich entstandene Euro zählt hier bereits mit. Es entsteht ein Wandel, eine überwiegend positive Entwicklung durch den weltweiten Handel. Dass diese Wohlstandsmehrung ungleich verteilt ist, wird in Abschnitt 1.8.1 weiter vertieft.
1.7.2Stärkung der Innovationskraft durch länderübergreifende Zusammenarbeit
Unstrittig ist, dass eine weltweite Zusammenarbeit von Forschenden, Spezialistinnen und Spezialisten in nahezu allen Themenfeldern immer bessere Ergebnisse bringen wird als nur national eingegrenzte Bemühungen.
Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass eine länderübergreifende Zusammenarbeit – hier bei der Entwicklung von Impfstoffen – eigentlich helfen kann beziehungsweise helfen könnte, Krisen besser zu bewältigen.
Getrübt wird aber schon dieses Beispiel durch die
Diskussion, die Patente für Impfstoffe weltweit freizugeben, wobei es für und gegen die Patentfreigabe gute Argumente gibt (siehe Aufgabe 1.4);
Vermutung, dass die VR China nicht alle Informationen zu dem Ausbruch der Pandemie offengelegt hat;
Klagen des Unternehmens Moderna Inc. (USA) sowie der CureVac AG (Deutschland) gegen die BioNTech SE (Deutschland) und deren Partner Pfizer Inc. (USA) wegen Patentrechtsverletzungen.
Am Ende verfolgten jedes Unternehmen und jedes Land vorrangig seine eigenen Interessen, was auch das folgende Beispiel zeigt:
„Woran BioNTech nach Corona forscht
Das Mainzer Unternehmen BioNTech kennt seit der Pandemie jeder. Doch inzwischen ist es ruhig geworden um den Biotech-Konzern. Dabei arbeitet das Unternehmen im Hintergrund fleißig weiter.
„An der Goldgrube“ ‒ so lautet die Adresse von BioNTech an dessen Hauptsitz in Mainz. Und eine Goldgrube waren die Geschäfte des deutschen Biotechnologieunternehmens auch lange. 2022 erzielte BioNTech mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty einen Gewinn von mehr als zehn Milliarden Euro.
Doch der große Hype ist vorbei. Impfstoffe sind ohne Lockdown und Ausgangssperre weniger gefragt. Zuletzt meldete BioNTech einen Nettoverlust für das erste Halbjahr über 1,1 Milliarden Euro. Beim US-Konkurrenten Moderna sieht es ähnlich aus. Hier steht ein Minus von 1,3 Milliarden US-Dollar in den ersten sechs Monaten des Jahres.
Rückkehr zur Krebsforschung
Die Gründe liegen auf der Hand: "Weil die Pandemie zwar nicht vorbei ist, wir aber alle irgendwie immunisiert sind, bricht das Geschäft jetzt ein", sagt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Acatis.
Die Folge: Unternehmen wie BioNTech und Co. kehren zurück zu ihren eigentlichen Wurzeln, zur Krebsforschung. Die große Hoffnung: Dass irgendwann eine Impfung gegen Krebs möglich sein könnte durch die mRNA-Technologie. Außerdem will man schonendere Therapien entwickeln als etwa die heutige Chemotherapie.“
(Leimbach, 2024)
Aber müssen wir nicht umdenken? Gewinnen multinationale und transnationale Unternehmen nicht zuviel Einfluss und bestimmen, was in der Welt geschieht?
1.7.3Zunehmende Mobilität, Zusammenwachsen von Kulturen
Die weltweite Liberalisierung unterstützt nicht nur einen weltweiten und freien Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr. Die damit einhergehende Niederlassungsfreiheit u. a. für Unternehmen unterstützt die Mobilität von Menschen als Arbeitnehmende genauso wie der weltweit deutlich vereinfachte Tourismus.
Viele Menschen weltweit
wachsen (mindestens) zweisprachig auf,
nutzen im privaten und im Arbeitsleben Auslandsaufenthalte für die eigene Entwicklung, und
knüpfen weltweite Kontakte auch über Social-Media-Plattformen wie beispielsweise Facebook, LinkedIn oder Instagram.
Dadurch gleichen sich die Bedürfnisse der Menschen immer weiter an: Man spricht die gleiche Sprache, trägt ähnliche Kleidung, hat vergleichbare Schönheitsideale und schaut weltweit die gleichen Serien (beispielsweise über Netflix, natürlich in englischer Sprache) wie beispielhaft Abbildung 1.11 anhand von Kleidung zeigt.
Abb. 1.11: Wie man sich wie ein Koreaner kleidet (Fitzgerald, 2021)
Nicht zuletzt deshalb beinhaltet der in Unterkapitel 1.4 vorgestellte Globalisierungsindex auch Indikatoren wie die Anzahl von McDonalds- oder Ikea-Filialen in einzelnen Ländern. Unzählige weitere Unternehmen wie beispielsweise Amazon, Starbucks, H&M oder Coca-Cola haben die Entwicklung von mittlerweile Generationen begleitet. Auf solche meist „transnationale Unternehmen“ wird im zweiten Teil dieses Buches weiter eingegangen.
Durch diese Entwicklungen ist eine neue globale Kultur entstanden, die jedoch auch zu Lasten der individuellen landesspezifischen Kulturen gehen kann, wie beispielsweise das NGO Terre des Hommes kritisiert (siehe Abschnitt 1.10.2).
Die Nutzung auch von Social-Media-Plattformen zur Desinformation der eigenen Bevölkerung oder der anderer Länder wird hier nicht weiter vertieft.
1.7.4Internationale Kommunikation in Krisenzeiten
Eine funktionierende Kommunikation in den internationalen Beziehungen ist schon immer ein Baustein, um internationale Krisen zu meistern. Dabei gibt es „rote Telefone“ beispielsweise als Direktverbindungen zwischen den Staatsoberhäuptern der USA und der damaligen Sowjetunion schon lange.
Videokonferenzen mit weltweiten Teilnehmenden haben jedoch die Reaktionszeiten verkürzt und der visuelle Eindruck aus der Mimik und Gestik, der an einer Videokonferenz Teilnehmenden ist durch ein reines Telefonat zwischen zwei Parteien nicht ersetzbar.
Die schnellere Erreichbarkeit jedes Ortes in der Welt per Flugzeug unterstützt darüber hinaus die Kommunikation in Krisenzeiten, gerade wenn es auf persönliche Vier-Augen-Gespräche ankommen sollte.
1.7.5Migration als Baustein zur Fachkräfte-Rekrutierung
Laut der UNO-Flüchtlingshilfe ist neben Kriegen und innerstaatlicher Menschenrechtsverletzungen sowie Klima und Umwelt auch das durch Globalisierung verschärfte Wohlstands- und Sozialgefälle bis hin zu Hungersnöten im Herkunftsland ein wesentlicher Grund für Migration. Dies gilt auch für die Migration zwischen Europa und Afrika (UNO-Flüchtlingshilfe Deutschland, 2024).
Die Aufnahme von Migrantinnen und Migranten beinhaltet Herausforderungen, beispielsweise bei der Integration. In ihrem Heimatland gut ausgebildete Migrantinnen und Migranten oder solche, die sich integrieren und etwas erreichen möchten, können jedoch helfen, den stark anwachsenden Fachkräftemangel aufgrund der Überalterung der westlichen Gesellschaft wenigstens abzumildern.
1.8Negative Aspekte von Globalisierung
In diesem Abschnitt sollen wesentliche negative Facetten von Globalisierung und die daraus resultierenden Herausforderungen auch an einen rechtlichen Rahmen verdeutlicht werden.
Alle Beispiele verbindet, dass die in Unterkapitel 1.7 beschriebenen Vorteile der Globalisierung auch direkte Schattenseiten haben können. Hier sei beispielsweise die die Wirtschaftskriminalität (siehe Abschnitt 1.8.4) begünstigende Liberalisierung der Märkte inklusive der Freizügigkeit für Personen und Unternehmen genannt.
1.8.1Ungleichverteilung der positiven Globalisierungseffekte und Einhaltung von Menschenrechten
In Unterkapitel 1.1 wurde bereits erläutert, dass
sich Globalisierung nur auf die Industrienationen Europas, Nordamerikas und Asiens, die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, die VR China, Südafrika) sowie wenige weitere Schwellenländer in Asien und Lateinamerika konzentriert;
rund 80 % aller Länder nur eine untergeordnete Rolle im Rahmen der Globalisierung spielen und nur einen geringen Nutzen daraus haben.
Der dann im Unterkapitel 1.4 vorgestellte Globalisierungsindex, bestehend aus wirtschaftlichen, politischen und sozialen Indikatoren, hat diese Aussage bestätigt.
Es geht aber nicht nur pauschal um die Ungleichverteilung der aus Globalisierung resultierenden Wohlstandseffekte oder um den Grad der Globalisierung, sondern bereits um die Einhaltung von grundsätzlichen Menschrechten.
Laut OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief, Oxforder Komitee zur Linderung von Hungersnot), Amnesty International und anderen haben die folgenden wesentlichen Verletzungen der Menschenrechte in den Lieferketten von weltweit tätigen Unternehmen eher zu- als abgenommen:
mangelnde Sicherheitsstandards / mangelnder Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,
Kinderarbeit,
Verhaftungen und Entlassungen von Gewerkschaftsmitgliedern,
Löhne unterhalb des Existenzminimums und weitere Arbeitsrechtsverletzungen, zum Beispiel bei der Herstellung von Kleidung,
Folter,
Landgrabbing inklusive Zwangsumsiedlungen,
Einsatz von Pestiziden und anderen Giften inklusive Verschmutzung u. a. von Gewässern,
Diskriminierung von und Gewalt gegen Frauen,
gewaltsame Niederschlagung von Protesten,
Finanzierung von Bürgerkriegen durch den Verkauf von Rohstoffen auch an deutsche Unternehmen,
Einschränkungen / Behinderungen in der (freien) Pressearbeit
(OXFAM Deutschland, 2024).