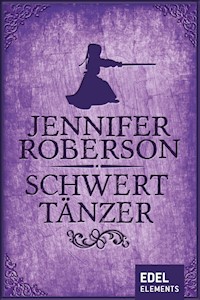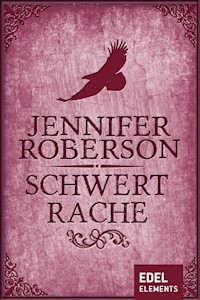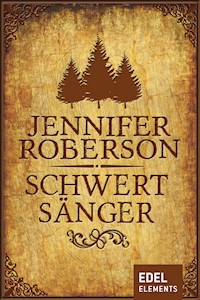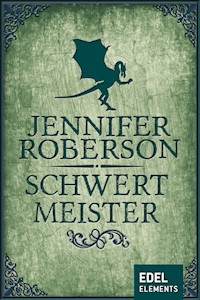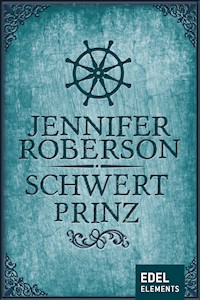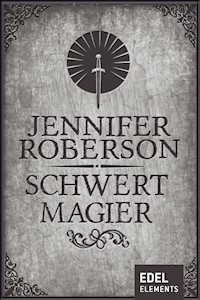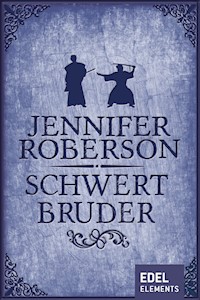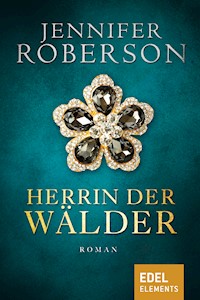
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihre Liebe war eine Legende ... England 1194. Als Robert von Locksley, genannt Robin, endlich vom Kreuzzug mit Richard Löwenherz zurückkehrt, belasten tiefe Schuldgefühle seine Seele. Denn Sir Hugh von Ravenskeep kam im Kampf gegen die Sarazenen ums Leben. Und Robin hat nun die bittere Pflicht, Lady Marian den Tod ihres Vaters und seinen letzten Wunsch mitzuteilen: dass sie den Sheriff von Nottingham heiraten möge. Doch Lady Marian, eine noble Frau, die von vielen Männern umworben wird, kämpft leidenschaftlich um ihre Ehre, ihr Gut – und um ihre Liebe zu Robin. Nicht ahnend, dass sie die Geliebte eines Geächteten werden wird ... "Das beste Buch, das ich seit Jahren gelesen habe." (Marion Zimmer Bradley)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 916
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ihre Liebe war eine Legende ...
England 1194. Als Robert von Locksley, genannt Robin, endlich vom Kreuzzug mit Richard Löwenherz zurückkehrt, belasten tiefe Schuldgefühle seine Seele. Denn Sir Hugh von Ravenskeep kam im Kampf gegen die Sarazenen ums Leben. Und Robin hat nun die bittere Pflicht, Lady Marian den Tod ihres Vaters und seinen letzten Wunsch mitzuteilen: dass sie den Sheriff von Nottingham heiraten möge.
Doch Lady Marian, eine noble Frau, die von vielen Männern umworben wird, kämpft leidenschaftlich um ihre Ehre, ihr Gut – und um ihre Liebe zu Robin. Nicht ahnend, dass sie die Geliebte eines Geächteten werden wird ...
"Das beste Buch, das ich seit Jahren gelesen habe." (Marion Zimmer Bradley)
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel "Lady of the Forest" Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2015 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © der Originalausgabe 1992 by Jennifer Roberson O´Green
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 1995 by Wilhelm Goldmann Verlag, München
Ins Deutsche übertragen von Janka Panskus
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-677-9
facebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Prolog
Nottingham Castle Spätes Frühjahr 1194
1. Kapitel
Huntington Castle Frühjahr 1194
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
Nachwort der Autorin
Prolog
Nottingham Castle Spätes Frühjahr 1194
Dunkelheit. Stille. Die Schwermut der Einsamkeit. Das waren die Waffen, die sie brechen sollten, die sie dazu bringen sollten, ihre trotzige Haltung aufzugeben und sich zu unterwerfen; die sie dazu treiben sollten, sich zu ergeben und um Gnade, Mitgefühl und Verständnis zu flehen.
Ein Geräusch zerriß die Stille, und Licht verbannte die Dunkelheit. Die schwere Tür öffnete sich und schabte über den Boden. »Marian.«
Sie hätte am liebsten gelacht. Ein sanftes, verführerisches Wispern, doch scharf wie eine Klinge – er war gewohnt, gehört zu werden.
Er trug eine Fackel und wurde nicht von den livrierten Soldaten begleitet; was er von ihr begehrte, wollte er in der Abgeschiedenheit bekommen – oder sich nehmen. Gibt er auf? fragte sie sich. Sucht er vielleicht gar Vergeltung?
Die Fackel verdrängte die Dunkelheit, und die Welt erstand wieder neu.
Mit gegen den Flammenschein zusammengekniffenen Augen setzte sie sich hastig auf, dann zwang sie sich zur Ruhe. Ihre Beine waren, von ihren verdrehten Röcken umschlungen, in die schweren Bettdecken gewickelt.
Sie wußte, was er sah: verfilztes schwarzes Haar, in dem noch Strohhalme aus dem Verlies steckten; ein verschmutztes, zerknittertes Kleid, das nach Pferd und Schweiß und Rauch roch; forsche blaue Augen, die von der Anspannung und dem Schlafmangel rotgerändert waren. Ich weiß sehr gut, was er sieht. Was er wollte, war ebenso offensichtlich, obwohl er es nicht sagen würde. Noch nicht. Sie wußte, er war feinsinnig und deshalb nur um so gefährlicher.
Er hielt die Fackel in die Höhe. Die Flamme loderte in der Dunkelheit und beleuchtete das Zimmer. Einen Moment lang blendete sie das Feuer in dem immerwährenden Tanz, dem gegenseitigen Umwerben von Luft und Flamme. »Marian.«
Er lächelte und entblößte dabei eine Reihe weißer Zähne. Sie ordnete ihre Röcke, um sicherzustellen, daß ihre Beine bedeckt wären. Sie würde sie ihm nicht freiwillig zeigen. Was er von ihr bekäme, müßte er stehlen.
Er kam mit der Fackel auf sie zu. Zum dritten Mal sprach er ihren Namen, als würde er ihn, indem er ihn in seinen Mund nähme, besitzen, und sie mit ihm. Sie versagte sich jedoch, darauf zu reagieren, ihm in irgendeiner Weise zu signalisieren, daß sie sich ergab oder daß sie es auch nur zur Kenntnis genommen hatte. Alles, was sie tat, war, gerade und herausfordernd zurückzustarren und ihm dadurch den Sieg zu verweigern, den er so sehr begehrte.
Sie befand sich nicht mehr im Verlies, wo sie die Gesellschaft von Ratten geteilt hatte, sondern in einem möblierten und edel ausgestatteten Schlafzimmer; er besaß gute Manieren. Ein bemaltes Leinentuch an der Wand minderte die Kälte der Steine. Aber nicht genug. Nicht annähernd genug. Ihr Blut konnte es nicht erwärmen.
»Ihr habt die Wahl«, sagte er. »Ihr habt immer die Wahl gehabt.«
Marian verspürte Lust zu lachen. Langsam und mit natürlicher Grazie streckte sie ihm ihre rechte Hand entgegen. Mit der Handfläche nach unten. Als er überrascht nach ihr langte – in der Annahme, merkte sie, daß sie das gewollt hatte –, drehte sie mit einer schnellen Drehung des Handgelenks die Handfläche nach oben. Augenblicklich zog sich seine Hand zurück; sie wußte, daß er seine Geste bereits bereute.
»Die Wahl«, sagte sie leise, mit ihrer rauchigen, tiefen Stimme.
»Vor dem Abt Buße tun, dann das Gelübde ablegen und Nonne werden – obgleich ich keine wahre Neigung dafür empfinde.«
Er wartete stillschweigend, gespannt. Die Fackel stieß Rauch und Flammen aus.
»Die Wahl«, sagte sie wieder. »Das Gelübde ablegen oder Eure Frau werden, obgleich ich keine wahre Neigung dafür empfinde« – sie lächelte, bevor er etwas sagen konnte –, »oder selbst die Spur eines Verlangens.«
»Was will ich schon mit Verlangen?« Seine Stimme war kühl, verriet nichts. »Ich kann Euch haben, mit oder ohne.«
»Außer der Scheiterhaufen bekommt mich zuerst.«
Er lächelte schwach. »Morgen werdet Ihr wegen Hexerei vor Gericht gestellt. Wir wissen beide, daß Ihr schuldig seid, und ich bezweifle, ob Ihr das überleben werdet.«
Sie wußte sehr gut, daß sie nicht überleben würde, obgleich Schuld nichts damit zu tun hatte. Niemand, Hexe oder nicht, überlebte den Scheiterhaufen.
»Es ist eine Tatsache«, sagte er ruhig. »Legt ein Gelübde ab und geht in ein Kloster, dann wird es keinen Prozeß geben.«
Bitterkeit schlich sich in ihren Ton. »Und meine Ländereien fallen an die Kirche ...«, sie hielt einen Augenblick inne, um nachzudenken, was noch dahinterstecken mochte, »es sei denn, Ihr habt vor, einen Teil davon als Zahlung für das entgegenzunehmen, was Ihr jetzt tut.«
Seine Stimme klang ironisch. »Eine angemessene Mitgift für eine Braut Jesu Christi, finde ich.«
Marian lachte. »Aber das ist es nicht, was Ihr wollt. Das würde Euch nicht gebührend anerkennen, und das könnt Ihr nicht billigen. Nicht William deLacey. Sein Stolz würde das nie zulassen.«
Er verbannte sein angedeutetes Lächeln. »Heiratet mich, dann wird es keinen Prozeß geben.«
Nun war sie es, die ihm ironisch antwortete. »Und Ihr werdet alle meine Ländereien besitzen.«
Seine Augen leuchteten vor stillem Lachen. »Eine angemessene Mitgift für den Sheriff von Nottingham, finde ich.«
Sie sah ihn fest an und behielt ihren ruhigen Tonfall bei. »Und wenn ich kein Gelübde ablege und in den Flammen umkomme, wird keiner von Euch gewinnen. Meine Ländereien werden an den König gehen.«
Er erlaubte sich ein Lächeln. »Euer Vater war Löwenherz treu ergeben. Er starb wegen Richard, wegen Richards heiligem Wahn.«
Er wußte, wie er sie reizen konnte. »Mein Vater würde nie –«
Der Sheriff unterbrach sie. »Aber nun heißt es, daß Richard von seiner Zelle in Heinrichs deutschem Gefängnis nicht heimkehren wird – in welchem Fall sein Bruder John, der jetzige Count of Mortain, den Thron von England besteigen wird.« William deLacey machte eine Pause. »Glaubt Ihr etwa, Euer Vater könnte in Frieden ruhen, wenn seine Ländereien an John fielen?«
Nein, nein und nochmals nein. Verbittert sagte sie: »Nach allen Gesetzen Englands gehören die Ländereien jetzt mir... und es mag mir wert erscheinen, sie John Lackland zu geben, und sei es nur, um Eure Pläne und die des Abtes zu vereiteln.«
Der Sheriff trat noch näher an sie heran. Ihr Blick fiel auf die Hand an der Fackel – seine Schwerthand, die, von langjähriger Kampferfahrung gestählt, kräftig war. Sie stellte sich die Hand in ihrem Haar vor. Sie stellte sie sich an ihrem Hals vor. Stellte sie sich an ihrer Brust vor.
Marian wollte sich übergeben.
Er stellte die Fackel in einen Halter und beugte sich über Marian.
Rasch schlug sie die Bettdecke zurück und rutschte seitlich aus dem Bett. Sie wollte wegrennen, die Tür aufschlagen und die Wendeltreppe hinunterstürmen, Nottingham Castle entfliehen.
Er erwischte sie jedoch und setzte sie auf das Bett zurück. Dann nahm er seine Hände wieder von ihr. »Wißt Ihr, was ich sehe?«
Sie holte keuchend Luft. Stumm schüttelte sie den Kopf.
»Ein kleines Mädchen«, antwortete er, »das rittlings auf dem großen Streitroß ihres Vaters sitzt. Mit verfilztem und staubigem schwarzen Haar, das sich aus ihren Zöpfen löst.«
Das hatte sie nicht erwartet.
»Sir Hugh FitzWalters Tochter, die kleine Lady Marian, geboren und aufgewachsen zu Ravenskeep am Rande des Sherwood Forest, ganz in der Nähe von Nottingham.« Er lächelte verbittert. »Ich heiratete zweimal und beerdigte beide. Ich liebte keine von ihnen.«
»Sie gebaren Euch Kinder«, sagte sie.
DeLaceys Stimme klang schmeichlerisch. »Einer Frau Kinder zu schenken hat nichts mit Liebe zu tun.«
Sie holte tief Luft. Sie hatte keine Angst vor ihm; sie hatte nie Angst vor ihm gehabt, aber sie wußte nun genug, um sich in bezug auf seine Absichten unsicher zu sein. »Ihr wart meines Vaters Freund.«
»Das war ich. Und bin ich, Marian. Er bat mich, für Euch zu sorgen, sollte ihn ein Unglück ereilen.«
Das wußte sie besser als er. »Aber das hier wollte er nicht!«
Seine Zähne schimmerten im Fackellicht. »Ihr macht es nötig.«
»Ihr seid ein Narr«, erklärte sie ihm. »Ein erbarmungsloser, kaltherziger Narr –«
»Und schlimmer«, stimmte er ihr zu, »aber ich lasse mich nicht dazu herab zu vergewaltigen.«
Marian hatte große Lust auszuspucken. »Ihr werdet mich auf keinem anderen Wege bekommen.«
Der Sheriff lächelte nur. »Wißt Ihr, was ich sehe? FitzWalters schwarzhaarige, blauäugige Tochter im Alter von nur vier Monaten und ohne einen Zahn im Mund. Die lacht und ohne Wirkung mit ihren Fäusten in das Gesicht des Sheriffs schlägt.«
Jetzt begriff sie, was er vorhatte, wie er hoffte, sie mit gemeinsamen Erinnerungen an ihre Kindheit, an ihre Jugend und an die Zeit, als ihr Vater noch lebte, zu entwaffnen.
Sein Lächeln wurde schwächer. Er zischte: »Wißt Ihr, was ich sehe?«
Unerschütterlich hielt sie ihr Schweigen.
Er antwortete ihr dennoch, barsch. »Eine Frau, die bereit zum Beischlaf ist und die mit den Augen darum bettelt.«
Ihre Kiefermuskeln spannten sich an. »Gebt mir ein Messer«, entgegnete sie, »und ich werde Euch zeigen, wozu ich bereit bin.«
Der Sheriff hob eine Augenbraue. »Lehrte er Euch das? Lehrte er Euch das Schwert?«
»Das Schwert? Das fleischliche Schwert, ja. Aber er lehrte mich auch, was Ihr nicht könnt: was es heißt zu lieben.«
Dunkle Flecken erschienen auf seinem Gesicht. Ihr Hieb hatte ihn uneingeschränkt getroffen, und tiefer, als sie es erhofft hatte. Ihre nüchterne Bestätigung seiner plumpen Anspielung hatte die Klinge gegen ihn gewendet.
Seine Augen glitzerten im Licht. »Wißt Ihr, was ich sehe?«
Sie wußte sehr wohl, was er sah. Und sie benannte es, bevor er es vermochte. »Robin Hoods Hure.«
1. Kapitel
Huntington Castle Frühjahr 1194
Marian lächelte schief. Dagegen ist Ravenskeep eine Hütte.
Das stimmte nicht, jedenfalls nicht ganz; ihr geliebtes Rittergut war ein sehr würdiger Wohnsitz und weit besser als die Hütte eines Leibeigenen. Doch Huntington Castle mit seiner erhabenen Größe und seiner fallgitterbewehrten Stattlichkeit war in der Tat tief beeindruckend und auch wunderbar neu; es konnte sich der neuesten Errungenschaften in Baukunst und Verteidigungsanlagen rühmen. Den Bergfried umgab eine neumodische Ringmauer, die zu Verteidigungszwecken mit Wehrgängen und Schießscharten überladen war, aber es waren weniger die Größe und die Massigkeit der Burg, die Marian überwältigten, als der Machtanspruch und der Reichtum ihres Eigentümers.
Nicht weniger beeindruckend war der große Saal mit seinen modernen massiven Steinwänden, die in Abständen von bemalten Wandteppichen bedeckt waren. Die Halle wurde von Kerzen und Lampen erhellt. Lautenklänge untermalten die Wärme der vielen Körper, den Duft nach Konfekt, Gewürzen und Wein und die angeregten Gespräche, die im gesamten Saal im Gange waren. Marian nahm das alles wahr, wenngleich auch distanziert, da sie statt dessen an den Anlaß dachte, aus dem sie und die anderen – selbst die Nichtgeladenen – gekommen waren.
Er wird sich nicht an mich erinnern. Er konnte es nicht; warum sollte er? Er war der Sohn eines Earls und sie die Tochter eines Ritters. Daß sie sich einmal begegnet waren als Kinder, würde ihm nichts bedeuten. Ich wünschte... Doch sie unterbrach sich. Es hatte keinen Zweck.
Sie spürte ein flaues Gefühl im Magen. Es ist falsch. Ich weiß es. Ich sollte ihn nicht damit belästigen; nur weil er zur selben Grafschaft gehört, kann ich nicht erwarten, daß er mehr weiß als ich. Sie holte tief Luft. Aber jetzt bin ich schon mal hier. Ich werde ihn ohnehin ansprechen. Was kann es schon schaden, ihn zu fragen?
Beinahe jeden Tag kehrten jetzt Männer vom Kreuzzug zurück, aber sie kannte keinen von ihnen. Nicht mehr jedenfalls, als ich Locksley kenne... und ich kann ihn doch zumindest fragen – Marian biß sich auf die Lippe. Es ist nichts dabei, ihn zu fragen, oder?
Robert von Locksley, Erbe des gewaltigen Vermögens, des alten Titels und der neuen Burg seines Vaters, saß ruhig und vollkommen reglos auf der Kante eines Stuhls. Wenn er sich nicht bewegte, wenn er nicht einmal zuckte, würde der Stuhl nicht zusammenbrechen.
Und ich auch nicht.
Durch die beschlagene Eichentür, die er sorgfältig geschlossen und verriegelt hatte, um allein zu sein, drangen Geräusche in sein Bewußtsein: Echos, die durch das Holz, den Stein und die Entfernung gedämpft waren; verzerrt von Sinneswahrnehmungen und ihren Deutungen, die von Erlebnissen in der Vergangenheit geformt waren, eigentümlicherweise aber dennoch in seine Gegenwart hineinreichten. Er fragte sich in einer seltsam abgelösten, gleichgültigen Art, ob dieselben Echos wohl auch seine Zukunft prägen würden.
Richard. Er schloß die Augen. Seine Hände, die schlaff auf seinen Oberschenkeln ruhten, zogen sich krampfartig zusammen und ballten sich zur Faust, wobei seine Fingernägel über den Hosenstoff kratzten. Ein Zittern erschütterte seine Unbeweglichkeit, dann erstarb es. Wenn ich mich weigere, es zu hören...
Doch der Lautengesang und das Gelächter jenseits der Tür verwandelten sich, ohne daß er etwas dagegen tun konnte. Die Geräusche waren nun dröhnend laut ...
... das Hämmern von Steinen, die gegen die Steinmauern der Christenheit geschleudert wurden und dort aufprallten ... die Schreie eines sterbenden Mannes, getroffen vom Geschoß eines Katapults ... die Flüche und die Gebete, die für die Kreuzfahrer so oft ein und dasselbe waren, da sie nur daran dachten, daß sie Gott und ihrem König dienten, und vielleicht ihrem eigenen Machttrieb...
Und das derbe Lachen von Löwenherz, das durch Schicklichkeit und Anstand nicht gehemmter war als seine Gelüste durch seinen Rang.
Locksley zuckte zusammen, als jemand seinen Namen rief. Seine Augen öffneten sich, ohne daß sie etwas wahrnahmen. Tastend kämpfte er sich den Weg empor zur Oberfläche. Die Stimme kannte er doch ...
Die Stimme drückte Ungeduld, Unannehmlichkeiten und strenge Autorität aus. »Robert –« Jetzt sprach sie ruhiger, aber nicht weniger scharf und eindringlich, »willst du meine Gäste denn die ganze Nacht warten lassen?«
Mit Mühe kam Locksley wieder zu sich, versetzte sich aus dem Heiligen Kreuzzug zurück zum Krieg des Willens, der nun, subtiler, in den Burghallen seines Vaters ausgefochten wurde. Einer tiefsitzenden Müdigkeit gewahr, erhob er sich und wischte sich die Feuchtigkeit auf seiner Stirn unterhalb seines dichten hellen Haarschopfes mit der Handfläche weg. Körperlich war er gesund. Was sein Vater jedoch von ihm wünschte, wollte er hingegen nicht. Es war besser, es sofort zu beenden.
Sich zum erwarteten höflichen Benehmen aufrufend, jedoch in der Absicht, es offen auszusprechen, um keinen Raum für Mißverständnisse zu lassen, öffnete er die Tür. Davor stand sein Vater. Und hinter ihm wandelte ein Großteil der englischen Adeligen, über die Richard I., genannt Löwenherz, herrschte.
Locksley erlangte die Selbstbeherrschung zurück. »Vergebt mir.« Er wählte einen freundlichen Ton. »Hättet Ihr mich gefragt, hätte ich Euch gesagt, daß Ihr Euch keine Umstände zu machen brauchtet. Mit – etwas Derartigem.« Er deutete kurz auf die Welt jenseits der Tür. »Ich würde lieber zu Bett gehen.«
Dem Earl, der inzwischen eingetreten war, blieb in Anbetracht seines unerwartet widerspenstigen Erben beinahe der Mund offenstehen. Dann ließ seine Verwunderung nach, und er wurde herrisch. »Bei Gott – du wirst jetzt herauskommen. Und zwar sofort. Ich habe alle eingeladen. Sie sind alle gekommen. Und alle erwarten –«
Locksley sprach leise, aber bestimmt. »Es kümmert mich nicht, was alle erwarten. Ihr gabt ihnen Anlaß zu dieser Erwartung, ohne mich vorher zu konsultieren.«
Der Earl schloß mit der Kraft beeinträchtigter Autorität und dem Verlangen, sie auf der Stelle wiederherzustellen, die Tür. »Bei Gott, Robert, ich bin dein Vater. Es ist an mir, zu planen, was ich planen möchte, sei es mit oder ohne vorherige Konsultation.« Doch dann wurde der wutentbrannte Ausdruck milder. Der Earl durchschritt das dunkle Zimmer und legte beide Hände auf die Arme seines Sohnes. »Ach Robert, laß es doch sein. Warum müssen wir uns jetzt streiten, und noch dazu über eine solch unwichtige Angelegenheit? Ich dachte, du seist tot – und indessen stehst du hier vor mir, gesund und in voller Lebensgröße ...« Seine blauen Augen leuchteten vor Freude. »Komm schon, Robert – du mußt zugeben, daß deine Rückkehr eine Feier wert ist! Der einzige Sohn des Earl of Huntington ist zurück vom Kreuzzug mit König Richard. Ich möchte, daß sie es sehen, Robert!«
«Sie wissen es doch schon«, erwiderte sein Sohn ruhig. »Dafür habt Ihr schon gesorgt.«
»Und machst du mir etwa einen Vorwurf daraus? Ja?« Der Earl gab seine rauhe Herzlichkeit auf und wurde nun eindringlicher, wenngleich auch eine väterliche Ungeduld mitschwang. »Ich dachte, mein Sohn sei tot. Man berichtete mir, mein Sohn sei tot, an Löwenherz’ Seite gestorben... und dennoch kommt anderthalb Jahre später ebenderselbe Sohn, versiegelten Mundes und trockenen Auges, in meine Burg und erzählt nichts, außer daß die Gerüchte nicht stimmen. ›Nicht tot‹, sagte er, ›sondern in Gefangenschaft der Sarazenen‹ ...« Die blauen Augen des Earls wurden feucht. »Bei Gott, Robert! – Kein lebender Vater könnte einer Feier widerstehen. Und zwei Jahre auf Kreuzzug mögen aus dem Knaben einen Mann gemacht haben, aber ich bin immer noch dein Vater. Du wirst tun, was ich sage.«
Das Alter hatte die Kanten abgeschliffen, aber der Tonfall war immer noch vertraut. Es war ein Tonfall, dem man Gehorsam leisten, den man fürchten mußte und der Strafe verhieß, doch der Sohn, der ihn hörte, war nicht mehr derselbe.
Die kämpferische Haltung des Earls ließ nach, während er seinen schweigenden Sohn betrachtete. »Bei Gott, Robert, laß mich stolz auf dich sein«, bat er. »Laß mich dich all denen in strahlendem Licht vorführen, mit denen du zu tun haben wirst, wenn ich im Grab bin.«
Locksleys Bauch krampfte sich zusammen. Während des Kreuzzugs war ihm die Willensstärke seines Vaters, seine Unnachgiebigkeit und seine selbstherrliche Autorität gegenwärtig geblieben. Niemals hatte es in seinen Erinnerungen oder Tagträumen jedoch eine weichere Seite an ihm gegeben.
Ich bin alles, was er noch hat... Es war den Kampf nicht wert. Er hatte schon zu viele gefochten. Sollte sein Vater doch diesen einen gewinnen: Die Gefangenschaft hatte Locksley die Gleichgültigkeit gelehrt. Zuviel zu wollen, schmerzte nur.
Seufzend zog Locksley die Tür weit auf. Dahinter schwirrte die Menge und erzählte sich Geschichten über seine Gefangenschaft, seine Heldentaten und seine Tapferkeit. Was sie nicht wußten, erfanden sie.
Als er das bemerkte, verfluchte der Sohn sich als Narr.
2. Kapitel
Marian preßte ihre feuchten Handflächen gegen das Kleid. Locksley war endlich erschienen, und sie unterschied sich schließlich, ungeachtet ihrer hochfliegenden Ideen, in nichts von den anderen. Sie war ebenso neugierig und fasziniert wie alle anderen auch.
Es quälte sie, denn sie hatte gehofft – darauf gezählt–, daß er nur ein Junge wäre, der vom Kriegspielen heimgekehrt war. Die Art von Mensch, an die sie herantreten konnte, ohne sich so offenkundig selbstbezogen zu fühlen.
Sie schluckte den Kloß wachsender Nervosität hinunter. Auch andere Frauen hatten ihre Väter verloren. Ich habe nicht mehr Recht als sie, diesem Mann eine Frage zu stellen.
Aber auch nicht weniger.
Erhöht auf dem Podest, stand er vor ihnen. Er hat sich sehr verändert. Der Junge, der in den Krieg gezogen war, war als Mann zurückgekehrt. Sie fragte sich, ob jemand anders ihn auch so sah wie sie oder ob sie alle völlig blind waren.
Aus der Entfernung konnte Marian nur den hellen Schopf seiner weißblonden Haare erkennen, die er unmodisch und viel zu lang trug. Er war immer ein heller Typ gewesen, wie sie sich erinnerte, und bleich wie eine Osterlilie bis auf seine haselnussbraunen Augen.
Ich erinnere mich an jenes Weihnachten... Es gab ihr einen unerwarteten Auftrieb erneuter Überzeugung. Ich werde ihn fragen... sicher kann er mir eine einzige einfache Frage nicht verwehren.
Sir Guy of Gisbourne gaffte. Nur mit Mühe konnte er seinen Mund schließen, wischte sich den Schweiß von der Oberlippe und benetzte seinen trockenen Mund mit Wein, zuviel Wein, den er in einem Zug trank, bis der Becher leer war.
Wieder sah er die Frau an, die ihn um den Verstand brachte. Er
konnte nicht aufhören, sie anzustarren. Wer –?
Ihm war der Schnitt und die Farbe ihres Gewands aufgefallen (ein schimmerndes Seidenkleid in einem kräftigen Blau, das am Ausschnitt und an den Ärmelaufschlägen silbern bestickt war und an der Taille von einem perlenbesetzten normannischen Gürtel eng zusammengehalten wurde); die Eleganz ihrer Körperhaltung; der Glanz ihres haubenbedeckten Haares; ihre tiefblauen Augen – und, als sie auf das Podium blickte, der unerwartet eigensinnige Zug ihres feinen Kinns.
Zitternd fuhr sich Gisbourne mit einer Hand über die Stirn. Er schluckte mühsam, seine Lungen waren wie verschnürt, und er versuchte, seiner wieder Herr zu werden. Seine Schenkel und sein Unterleib zogen sich, von der Erektion schmerzend, zusammen; er begehrte diese Frau nicht nur, er brauchte sie.
Es war bereits Monate her. Einmal hatte sich die Gelegenheit mit einem Serviermädchen ergeben, das ihm Erleichterung verschafft hatte, aber er fand solche Frauen nicht befriedigend. Er wollte mehr, aber er wußte nicht, wie er es bekommen konnte. Er hatte Fähigkeiten, wie sie Leute wie der Sheriff schätzten, da ja irgend jemand die Verwaltung der Burg und der Grafschaft organisieren mußte. Der Sheriff von Nottingham sprach Recht. Sir Guy of Gisbourne, sein Seneschall, führte es aus.
Er war nie übermäßig ehrgeizig gewesen, noch war er habsüchtig. Seine Gebieterin war die Pflicht, sein Gebieter William deLacey. Doch jetzt würde er sich von allen Treueschwüren lossagen, wenn es ihm nur sie in sein Bett bringen würde.
William deLacey, der Lord High Sheriff of Nottingham, packte seine jüngste Tochter am Arm und führte sie aus der Gruppe von Frauen, die sich um den Minnesänger scharten, heraus. Es war nicht so, daß er Musik nicht mochte oder gegenüber dem Können des Minnesängers taub war, aber es gab Wichtigeres zu regeln.
»Eleanor«, sagte er, als sie ihren Mund gerade zum Protest öffnete.
Sie beruhigte sich schnell wieder, aber er übersah ihre Verärgerung nicht. Sie war weder hübsch noch reizvoll, und daher wunderte es ihn nicht, daß sie sich jedem weibischen Musiker an den Hals warf.
Aber sie war intelligent. Was Eleanor an Aussehen fehlte, machte sie mit ihrer Schlauheit wieder wett.
Er zog sie hinter eine Trennwand und ließ ihren Arm los. »Du bist aus einem bestimmten Grund hier«, erinnerte er sie.
Die Lider über ihren wütenden braunen Augen niedergeschlagen, beugte sie sich kurz zu einem spöttisch gemeinten Knicks.
»Deine Zukunft hängt davon ab.«
Ihre Lider flatterten. Hoben sich. Sie sah ihm direkt ins Gesicht. »Eure Zukunft hängt davon ab.«
Sein Mund wurde schmal. »Ja. Gewiß. Du weißt, was ich möchte, genauso wie ich weiß, was du möchtest –«
»Ihr wißt nicht im geringsten, was ich möchte.« Ihr Ton war ruhig, aber feindselig. »Das habt Ihr niemals, und das werdet Ihr niemals, weil Ihr mir nie zuhört –«
»Genug!« Augenblicklich schloß sich ihr Mund, wie er es beabsichtigt hatte. »Du wirst dich benehmen, Eleanor. Ich habe keine Lust, mich dadurch demütigen zu lassen, daß du wie eine liebestolle Närrin um den Minnesänger herumhüpfst, wenn du zu einem anderen Zweck hier bist. Ich will das Beste für dich. Ich wünsche mir einen Mann für dich, der dir das geben kann, was du verdienst.«
Eleanor nickte wissend. »Auf daß ich das mit Euch teilen kann.«
Bedächtig schüttelte er den Kopf. »Vergeude dich nicht sinnlos, Eleanor. Schau in den Spiegel, den ich dir gegeben habe.«
Sie blinzelte. »In den ... Spiegel?«
»Anstelle von Ländereien und Mitgift wird ein Mann um der Schönheit willen heiraten. Ich habe kein eigenes Land, deine Mitgift ging an den König, und deine Schönheit ...«
Eleanors Gesicht verlor jede Farbe.
Aufmunternd tätschelte deLacey ihren Arm. »Ich bin sicher, du verstehst, daß das, was ich tue, genauso gut für dich ist wie für mich.«
Es wurde erwartet, daß jeder dem Sohn des Earls seinen Gruß entbot. Deshalb bestand Huntington auch darauf, daß sie, er und sein Erbe, auf dem Podest standen. Sein Sohn war von den Toten wiedergekehrt. Sein Sohn wurde zur Schau gestellt. Seht ihr, mein Sohn lebt, obwohl erzählt wurde, er sei an Richard Löwenherz’ Seite gestorben!
Auch Marian hatte das Gerücht gehört und um ihn getrauert. Eine Nacht lang hatte sie geweint, weil auch ihr Vater gestorben war und weil sie sich an ein Weihnachten erinnerte, an das sich niemand sonst erinnern konnte. Doch Robert von Locksley war, entgegen aller Wahrscheinlichkeit, wieder zurückgekehrt. Ihr Vater nicht. Nur sein Schwert war ihr überbracht worden.
Sie schloß die Augen, während sich ihre Hände an ihren Röcken zu Fäusten ballten. Es war nicht fair. Locksleys Heimkehr verdiente Gebete und Dankbarkeit, keinen Groll. Keine Eifersucht.
Ein Mann trat an ihre Seite. Seine Stimme klang ruhig und kultiviert. »Ich habe Euch ein wenig Wein gebracht, damit Ihr Eure hübsche Kehle kühlen könnt.«
Sie sah auf. Warm lächelnd drückte ihr William deLacey einen Kelch in die Hand. Sie schloß beide Hände darum und dankte ihm mit einem Nicken.
Die braunen Augen des Sheriffs blickten sie mitfühlend an. »Ich vermisse ihn auch, Marian. Und bestünde die Möglichkeit, würde ich diesen Jungen gegen Euren Vater eintauschen. Hugh von Ravenskeep ist drei von seiner Sorte wert.«
Seine Unverblümtheit überraschte sie. »Wir sollten Gott danken, daß er so barmherzig war, wenigstens einen von ihnen wieder nach Hause zu schicken.«
DeLacey lächelte. »Eure Güte spricht für Euch, aber Ihr wißt, daß ich die Wahrheit spreche. Locksley bedeutet Euch nichts. Euer Vater war Euch alles.«
War. Nicht ist; war. Ihr Vater gehörte der Vergangenheit an, während sie der Gegenwart angehörte.
Wie würde nun ihre Zukunft aussehen? Sie war Hugh FitzWalters einzige Erbin, und mit seinem Tod war sie ein Mündel des Königs geworden. Nach englischem Gesetz verwaltete sie ihren Gutsbesitz als Treuhänderin ihres zukünftigen Mannes, und obgleich sie keinerlei Heiratspläne hatte, würde man es ihr mit Sicherheit bald vorschlagen, nun, da ihre Trauerzeit beendet war. Ravenskeep war, wie andere Ritteranwesen auch, eine wertvolle Einkommensquelle.
Seine Hand legte sich kurz auf ihre Schulter. »Ihr hättet nicht zu kommen brauchen.«
Marian zwang sich zu einem Lächeln. »Ich kam wie alle anderen, um dem Earl die Ehre zu erweisen.«
»Und nicht, um seinen Sohn zu beeindrucken?«
»Seinen Sohn?« Als sie seinen Blick bemerkte, mußte sie lachen. »Ihr brachtet Eleanor mit.«
»Ihr habt mich durchschaut.«
Marian runzelte die Stirn. »Ihr habt sie also in der Hoffnung mitgebracht, daß sich Robert von Locksley für sie interessieren wird.«
»In der Hoffnung, daß sich der Earl für sie interessieren wird; es kümmert mich herzlich wenig, was Locksley von dem Mädchen hält. In der Angelegenheit hat er nichts zu sagen.« DeLacey lächelte und salutierte mit erhobenem Kelch. »Ich bitte Euch, mich zu entschuldigen – ich muß jetzt Eleanor vorführen.«
Er verließ sie und glitt geschmeidig durch die Menge, um seine jüngste Tochter aufzulesen und sie zum Podium zu geleiten. Seine Stellung ausnutzend, ignorierte er alle vor ihm, um den Ehrenplatz einzunehmen. Als Angehöriger einer weniger bedeutenden Normannenfamilie war er nicht Lord durch altes angestammtes Erbe, aber der Eroberer hatte alle, die ihm bei der Niederwerfung Englands vorbildliche Dienste geleistet hatten, belohnt, indem er beschlagnahmtes Land und Titel an sie verteilt hatte. Auf diese Weise war der Sheriff in den neuen Adel aufgestiegen und hatte mit jeder Heirat seinen Rang noch erhöht. Sein Machthunger war für Marian unverkennbar, aber merkwürdigerweise setzte es ihn nicht herab. Er gehörte zu der Sorte Mann, die überleben, gleich wie die Umstände sind.
Anders als der Sheriff wartete Marian, bis sie an der Reihe war. Sie trank den Wein aus, reichte den leeren Kelch einem Bediensteten und erreichte schließlich das Podium, wo sie in ein Gesicht blickte, das bar jeden Ausdrucks war, und in hellbraune Augen, die für alle, die vor ihm standen, verschleiert waren.
Sie öffnete ihren Mund, um ihm ihre simple Frage zu stellen, aber es kam kein Wort heraus. Wer war sie denn, daß sie ihn überhaupt etwas fragte, und warum sollte er die Antwort kennen?
Doch da stand sie bereits vor den beiden, war dem Earl und seinem Sohn ordnungsgemäß vorgestellt worden. Da sie sich nicht gut umdrehen und fliehen konnte, war das mindeste, was sie tun konnte, die Willkommensworte herauszustoßen, die sie in Ravenskeep geübt hatte. Sie hatte sie dazu gedacht, das Eis zu brechen; jetzt würden sie ihr das Gesicht wahren, zumindest ein wenig.
»Mylord Earl.« Sie knickste. Mechanisch sagte sie ihr kleines Gedicht auf. Sie nahm nicht mehr Anteil als Locksley, der gelangweilt neben seinem Vater stand.
Doch plötzlich war seine Langeweile verschwunden. Gerade als sie sich zum Gehen wandte, legte sich eine Hand auf ihren Arm. »Marian von Ravenskeep?«
Verwirrt nickte sie – und sah die Gefühlswallungen in seinen Augen.
3. Kapitel
Locksleys Griff auf ihrem Arm schmerzte, doch Marian ließ ihn gewähren und machte, erschreckt sowohl von seiner Frage als auch seiner Berührung, noch einen Knicks. Verblüfft von seiner unerwarteten Angespanntheit musterte sie ihn eingehender.
»Ja«, sagte sie deutlich. Dabei fragte sie sich, was an ihrem Namen ihn aus seiner Reglosigkeit in die plötzliche Hitzigkeit getrieben hatte. »Marian von Ravenskeep; Sir Hugh ist –«, sie überprüfte das, »war mein Vater.«
Als hätte er seine Hand vergessen, blieb sie auf ihrem Arm liegen. Durch den Stoff der Kleidung fühlte Marian den Griff seiner Finger. »An Euch sandte ich den Brief. Ich vertraue darauf, daß Ihr ihn erhalten habt.«
Sie drehte sich ein wenig und wand ihr Handgelenk, um sich zu befreien. Sofort ließ er sie los, ohne sich jedoch zu entschuldigen. »Ich erhielt keinen Brief, Mylord.«
Das hatte er augenscheinlich nicht erwartet. Er runzelte die Stirn. »Ich habe ihn aber an Euch losgeschickt«, erklärte er, ohne Raum für Zweifel zu lassen. »Vor Monaten schon. Ich dachte, Ihr solltet wissen, wie Euer Vater starb.«
Seine Direktheit nahm ihr den Atem. Wie kann er wissen, daß das meine Frage war? Ruckartig schüttelte sie den Kopf. »Ich erhielt keinen Brief...«
»Robert.« Das war der Earl, der ihr eilig ins Wort gefallen war. »Robert, die anderen warten. Wenn du unbedingt mit dem Mädchen sprechen mußt, dann vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt ...?«
Ihre Zeit mit dem Earl war um. Die Aufmerksamkeit seines Sohnes wurde woanders gebraucht.
Als schließlich das Essen vorbei und die Tische abgeräumt waren, wurde zum Tanz aufgespielt. Marian hätte es vorgezogen, sich unauffällig im Hintergrund zu halten, aber das verhinderte William deLacey, der darauf bestand, mit ihr zu tanzen. Das Trauerjahr war vorüber, hielt er ihr vor Augen, und ihr Vater würde keine solch strenge Frömmigkeit von ihr verlangen, wenn es ums Tanzen ging.
Und so tanzte sie mit deLacey und einer Handvoll anderen, und zuletzt mit Sir Guy of Gisbourne, der sich ihr in gutem normannischen Französisch vorstellte, wodurch er sofort seine Abstammung preisgab. Sie wußte nur wenig über ihn, außer daß er deLaceys Untergebener war und daß der ihm den Kreuzzug erspart hatte, da der Sheriff ihn vom Kriegsdienst freigekauft hatte.
Gisbourne war ein stämmiger, dunkler und gedrungener Mann mit kurzen Gliedmaßen und hatte, wie sie es von seiner Unterhaltung her beurteilte, nur wenig Phantasie.
Als Ritter stand ihm einige Ehrerbietung zu. Sie war die Tochter eines Ritters und verstand das nur zu gut. Gisbourne stammte jedoch aus einer einfachen Kaufmannsfamilie, die ihm den Stand gekauft hatte, und er war zu jung, um rechtmäßig in königlichem Dienst Land erworben zu haben. Er hatte deshalb keinen Besitz, kein Gut und war zwei Jahre vor Richards jüngstem Kreuzzug als Verwalter in die Dienste des Sheriffs von Nottingham getreten.
Seine Gesichtszüge waren kräftig und derb, und er bewegte sich schwerfällig. Seine Kleidung war aus gutem, schwarzgefärbtem Tuch. »Lady«, sagte Gisbourne heiser. »Mich dünkt, Ihr vergaßt die richtige Schrittfolge.«
Sie hatte sie tatsächlich vergessen. In Gedanken versunken, hatte sie sich falsch gedreht. Dadurch kamen sie einander zu nahe, zu nahe – flammenden Gesichtes machte sie einen Schritt zurück und sah das Aufflackern in seinen Augen. Die Augen eines Ebers, dachte sie. Klein, schwarz, glänzend.
»Lady«, wiederholte er. »Wünscht Ihr aufzuhören?«
Es lag nichts anderes in seinen Worten als eine verlegene Höflichkeit, die sie von einem Mann mit Eberaugen nicht erwartet hatte. Marian, die sich der Hitze in ihrem Gesicht bewußt war, schämte sich.
Sie schaffte es, ihre Stimme beiläufig klingen zu lassen. »Ich glaube, es ist besser, wir hören auf. Ich bin ein wenig überhitzt – vielleicht würde ein Becher kühlen Weines ...?« Sie fragte absichtlich nach Wein, da sie wußte, daß er dann weggehen würde und sie fliehen könnte.
Vom Funkeln in Gisbournes Augen her zu schließen, schien er das zu wissen. Steif verbeugte er sich. Marian beobachtete, wie er wegging, dann drehte sie sich um und wollte sich unter die Festgäste mischen.
Unvermittelt blieb sie stehen, da ihr ein großer Mann im Weg stand. Sie öffnete ihren Mund, um sich bei ihm zu entschuldigen. Dann schloß sie ihn jedoch wieder; es war Locksley. Seine haselnußbraunen Augen blickten sie sonderbar eindringlich an.
»Kommt mit mir«, sagte er. »Dies ist nicht der geeignete Ort, um zu reden.« Nein, das war er nicht, aber das hatte sie auch nicht erwartet. »Hier entlang«, verkündete er und faßte ihr rechtes Handgelenk.
Locksleys Verhalten war besitzergreifend, angespannt und mehr als nur ein wenig selbstbezogen. Er fragte nicht, er befahl. Auf der anderen Seite, mußte Marian ihm gerechterweise zugute halten, ist er jedoch Sohn eines Earls.
Er zerrte sie beinahe durch die Menge. Sobald die Leute ihn erkannten, machten sie ihm Platz, und dann fielen ihre Blicke auf sie.
Ihr Gesicht brannte, und ihre Brüste prickelten. Sie kamen am Minnesänger vorbei, dessen blaue Augen wissend funkelten; sein Lächeln galt ihr.
Im Zimmer schlug Locksley hinter ihr laut die Tür zu. Marian sah an ihm vorbei und erblickte Stühle, Kerzenständer und teppichbehangene Wände. Zumindest, dachte sie gewollt ironisch, hat es kein Bett. Wenigstens das wird er mir ersparen.
Er drehte sich zu ihr um. »Wißt Ihr, wie es ist, als Fremder nach Hause zu kommen und entdecken zu müssen, daß sich alles verändert hat?«
Sie war sich nicht sicher, ob er eine Antwort wollte. Er blickte sie nicht an.
»Wißt Ihr es?«
Sie legte ihre Hände auf den Rock und überlegte, was er wohl hören wollte. »Nenn ich fort war, vollziehe ich immer ein Ritual. Ich mache mich wieder mit allem vertraut, um zu sehen, ob sich etwas verändert hat. Ich gehe von Raum zu Raum. Von Saal zu Saal.«
»Ein Ritual«, wiederholte er. »Wie ein Ritter, der in die Schlacht zieht für Sieg, Ruhm und Ehre ... und für den König?«
»Ich weiß nicht, Mylord. Ich war nie im Krieg.«
»Nein. Sie schicken Frauen nicht in den Krieg.«
Sie zögerte nicht. »Nur in die Ehe.«
»Seid Ihr deshalb gekommen?« fragte er. »Um einen Köder auszuwerfen für den verlorenen Falken, der zuletzt zu seinem Käfig zurückgekehrt ist?«
Seine bittere Vehemenz verblüffte sie. Sie war wegen nichts dergleichen gekommen. Doch sie nahm es Locksley nicht übel.
Marian lächelte. »Da fragt Ihr besser den Sheriff. Oder all die anderen, die ihre schön gekleideten Töchter im Schlepptau hinter sich herziehen.«
»Was ist dann mit Euch?«
»Was mit mir ist? Ihr brachtet mich hierher.«
Er seufzte und wandte sich ab. Mit einer Hand fuhr er sich durch das blonde Haar. Dann schwang er wieder herum. »Wir sind uns schon begegnet.«
Marian brachte ein Nicken zustande. »In Ravenskeep, Mylord. Einen Heiligabend« – es war schwerer, als sie erwartet hatte – »wart Ihr und Euer Vater von London her auf dem Heimweg, als ein Sturm Euch zum Einhalten zwang. Ihr kamt zum Rittergut meines Vaters und verbrachtet den Abend mit uns.« Vielleicht wird ihn das zufriedenstellen. Möglicherweise erinnert er sich nicht an mehr.
»Ravenskeep ...« Seine Augen blieben unbewegt. »Ihr zogt mich unter die Mistel und fordertet den Preis von mir.«
Er erinnert sich noch daran. Hitze flutete über ihr Gesicht, gefolgt von Röte. Sie brauchte all ihren Mut, um seinem Blick, seinem Lächeln zu begegnen; um ihre Befangenheit zu verbergen. »Ich war sehr jung, wie Ihr auch«, begann sie, indem sie sich auf die Wahrheit verließ, gleich wie peinlich sie war, »und ich hatte bereits alle anderen geküßt. Ihr wart der einzige, der noch übrig war.«
Sie dachte, er würde vielleicht lachen, aber er tat es nicht. Sie erwartete, er würde zumindest lächeln, aber er wischte die Erinnerung nur mit einer selbstherrlichen Geste, die an seinen Vater erinnerte, weg. »Ich sandte Euch einen Brief«, erklärte er kategorisch. »Nachdem Euer Vater gestorben war, schrieb ich Euch«
Locksleys Art, ihre Gefühle und Erwiderungen nur als Antworten auf seine Fragen zu betrachten, verärgerte sie in hohem Maße.
Marian vergalt es ihm auf ihre Art. »Warum gerade Ihr, Mylord? Sicher hätte es jemand anders gegeben. Jemand von niedrigerem Rang –«
Er hörte den leisen Spott in ihrem Ton. Einen Augenblick lang leuchteten seine Augen, aber mehr aus Ärger denn aus Belustigung. »Mein Rang hatte nichts damit zu tun«, antwortete er ihr barsch. »Wenn ein Mann auf dem Schlachtfeld das Leben eines anderen rettet, zählen solche Dinge nicht mehr.«
Skeptisch wandte sie ein: »Löwenherz ernannte Euch zum Ritter.«
»Ich sagte, es zählt nicht.« Er biß die Zähne aufeinander und spannte die Kiefermuskeln an. Röte überzog sein Gesicht. Er war so hellhäutig, daß es leicht erkennbar war – und dann sah sie die Narbe.
Sie war dünn, schartig und verlief entlang der Linie seines Kieferknochens vom rechten Ohrläppchen hinunter bis zum Kinn, wo sie in einem kleinen Aufwärtsbogen so abrupt endete, wie sie begonnen hatte. Sie war fast nicht sichtbar: eine Naht aus ungleichmäßigen Stichen. Jemand hatte ihn übel erwischt. Jemand hatte ihn genäht. Es war keine frische Narbe, aber auch keine, an die sie sich erinnern konnte. Er war zwei Jahre fort... der Krieg verändert uns alle. »Es zählt nicht«, sagte sie, während sie ihre Augen von der Narbe losriß.
Seine Röte ließ nach. Die Narbe war nicht mehr zu sehen, außer sie suchte bewußt nach ihr. »Vergebt mir«, sagte er rauh. »Ich war zu lange nicht mehr mit Frauen von Schicklichkeit und Anstand zusammen ... ich habe alle Schmeicheleien vergessen.« Wieder spannte er die Kinnmuskeln an.
Es war ihm schwergefallen, das zu sagen. Marian lächelte schwach. »Sie werden Euch wieder einfallen. Was nun den Brief anbetrifft ...«
»Ich schrieb ihn, weil er mich darum bat ... und weil ich es Euch auch von mir aus berichten wollte. Ich fand es nur gerecht, daß ich mich persönlich für den Mann einsetze, der mein Leben gerettet hat.« Er machte eine linkische Geste der Hilflosigkeit. »Das war alles, was ich für ihn tun konnte.«
Die Wunde wurde wieder aufgerissen. »Mir wurde erzählt, er starb in der Schlacht.«
»Er starb zu Richards Füßen.«
Richard. Nicht der König. Nicht Löwenherz. Nicht einmal »Mylord«. »Er starb zu Richards Füßen, weil ich nicht auf meinem Platz war.«
Ausdruckslos starrte sie ihn an. »Ich verstehe nicht.«
Sein Blick geriet nicht ins Wanken, noch wich seine Bitterkeit. Doch die galt nicht ihr. »Ihr versteht es sehr gut; ich kann es an Euren Augen sehen.«
Marian schluckte und ermahnte sich zur Bedachtsamkeit. »Wollt Ihr mir mit anderen Worten sagen, er starb wegen Euch?«
»Nein.« Seine hellen Augen wurden seltsam schwarz. »Nicht wegen mir, sondern aufgrund dessen, was mir zustieß.« Sein Ton wurde äußerst scharf. »Er starb, weil er meinen Platz an Richards Seite einnahm.«
»Euren Platz«, sagte sie. Und dann konnte sie nicht umhin, ruhig und direkt anzufügen: »Warum wart Ihr denn nicht dort?«
Seine Selbstverachtung war unverkennbar. »Weil ein sarazenischer Kriegsherr mich bereits gefangengenommen hatte.«
Sie konnte es deutlich vor sich sehen. »Und deshalb nahm mein Vater Euren Platz ein. Um seinen König zu beschützen. Damit Löwenherz unversehrt bliebe.« Trauer huschte kurz über ihr Gesicht; sie unterdrückte sie mit Mühe, weil sie instinktiv wußte, daß dieser Mann Hilflosigkeit, oder was er als Schwäche der Frauen auslegte, verachten würde. »Und tat er es nicht, Mylord? Schützte er den König nicht? Löwenherz lebt noch.«
»Im Gefängnis«, sagte er finster. »In Heinrichs deutscher Festung.«
Wut loderte in ihr auf. »Zumindest lebt er! Mein Vater ist seit einem Jahr tot!«
Ein Muskel zuckte an seinem Kinn. Er gab ihr keine Antwort.
Marian holte tief Luft. Sie wollte, daß ihre Stimme ihr wieder gehorchte. Sie hatte nicht damit gerechnet, daß sie Wut verspüren würde, eine ruhige, aber mächtige Wut: Vor ihr stand schließlich der Sohn des Earls. Ohne Zweifel hatte auch er, die gebührende Ehrerbietung gewohnt, etwas anderes erwartet. Jetzt hatte sie jedoch bereits angefangen. »Wenn er zu Richards Füßen starb, während Ihr schon gefangen wart, wie erfuhrt Ihr dann davon, so daß Ihr mir schreiben konntet?«
»Er hatte mich an jenem Morgen darum gebeten. Wir saßen beim Wein zusammen.« Seine Narbe wurde kurz sichtbar. »Ob er es ahnte, kann ich nicht sagen. Manche glauben, daß einige Männer die Stunde ihres Todes spüren ... Er bat mich auf meine Ehre, Euch zu schreiben, wenn er zu Tode käme.«
Der alte Schmerz wurde wieder frisch, stechend in seiner Heftigkeit. Sie konnte nicht anders, als zu murmeln: »Das ist noch schlimmer als alles andere.«
»Nein«, antwortete er knapp. »Ich sah ihn sterben. Er starb an meinem Platz ... während Saladin mich zwang, dabei zuzusehen.«
»Saladin.« Sie starrte ihn an. »Der Sarazene selbst?«
»Salah al-Din. Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub.« Der Name wirkte auf einmal fremd auf sie, noch fremder als sonst, durch die andersartige Aussprache; ihr wurde bewußt, daß für ihn die ausländische Aussprache richtig und korrekt sein mußte und nur allzu vertraut.
Salah al-Din. Saladin selbst, Löwenherz’ Feind.
Wieder zuckte sein Kiefermuskel, als würde Locksley selbst den Unterschied wahrnehmen, der in einem Zimmer widerhallte, das vom Heiligen Land sehr weit entfernt war. Er fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. »Ohne Helm bin ich nicht leicht zu verfehlen. Richard behielt mich immer an seiner Seite –« Er unterbrach sich, dann fuhr er fort: »Die Sarazenen fanden sehr schnell heraus, daß sie nur nach mir Ausschau halten mußten, wenn sie Richard suchten. Richard war die Zielscheibe. Richard war das Ziel. Als wir das erfuhren, protestierte ich« – wieder leuchtete seine Narbe auf –, »aber Richard wollte nichts davon hören. Ich war sein Banner...« Locksleys Tonfall wurde unheilverkündend. »Sie ergriffen mich, dann töteten sie Euren Vater, als er versuchte, in die Bresche zu springen.«
Sie holte, um Stärke und Selbstbeherrschung ringend, Atem. »So«, sagte sie dann ruhig. »Eure Aufgabe ist damit getan. Euer Brief verirrte sich, aber der Überbringer nicht.«
Seine Narbe leuchtete noch heller. »Der Überbringer verirrte sich sehr«, sagte er, »und kann den Weg zurück nicht finden.«
Es überraschte sie, daß er sich ihr gegenüber so offen zeigte. »Mylord –«
»Es gibt da noch etwas«, sagte er. Er sah an ihr vorbei zur Tür, dann kehrte der Blick zu ihr zurück. »Euer Vater wünschte, daß Ihr den Sheriff von Nottingham heiratet.«
4. Kapitel
Das Klopfen an der Tür war laut. Marian rührte sich jedoch nicht. Das würde er doch nicht... mein Vater? Würde er das wirklich wollen?
Locksley, der sich von ihr abgewandt hatte, hob den Riegel, dann trat er zur Seite. Die Tür wurde mit resoluter Gewalt aufgestoßen. Der Earl persönlich kam, offenkundig verärgert, ins Zimmer. Sein Gesichtsausdruck blieb drohend, bis sein Blick auf Marian fiel. Augenblicklich verwandelte sich sein Gesicht in eine umgängliche, höfliche Maske. Sie bedeutete ihm nichts, war nur eine namenlose Frau für ihn, aber Pairs enthüllten Angehörigen niedrigeren Ranges gegenüber nichts.
In Anbetracht der Neuigkeiten von Locksley machte sie seine unterschwellige Vermutung wütend, doch sie sagte nichts. Hinter dem Earl stand der Sheriff. Sie würde ihre Gefühle zurückhalten, so wie Huntington.
»Robert«, sagte der Earl sanft, »draußen warten Gäste, die dich gerne sehen würden.«
Auch Locksleys Gesicht war leer wie eine Maske. »Sie haben mich bereits gesehen.«
Der Earl runzelte nur flüchtig die Stirn. Er warf Marian einen Blick zu, um abzuschätzen, wie sie Locksleys Antwort beurteilte, ehe er seinen Sohn väterlich anlächelte. »Ich verstehe, wie es für dich sein muß, wieder die Gesellschaft einer Engländerin zu teilen ... aber du darfst den Zweck des Abends nicht aus den Augen verlieren, Robert. Du kannst dich schwerlich zurückziehen, wenn so viele um deiner Ehre willen gekommen sind.«
Marian betrachtete den Earl genauer. Nichts in seinem Gesicht strafte den Sinn seiner Worte oder die Herzlichkeit seines Tons Lügen, aber sie war trotzdem von seinem mangelnden Verständnis wie vor den Kopf geschlagen. Es war offensichtlich, daß er nur an sich selbst dachte und an seine Pläne für das Fest und nicht an dessen Ehrengast.
»Marian.« Nun ergriff der Sheriff das Wort. »Marian, sicher könnt Ihr mir nicht die Freude eines weiteren Tanzes verwehren.«
Widersinnigerweise amüsierte sie das. Sicher kann ich Eurer Tochter nicht die Chance vermehren, sich Locksley zu angeln. Marian lächelte höflich. »Ich bitte Euch, kein Tanz mehr. Sir Robert brachte mir Neuigkeiten über meinen Vater. Er hielt es für das beste, sie mir unter vier Augen kundzutun; er ist ein überaus verständnisvoller Mann, der Rücksicht auf meine Trauer nimmt. Wenn Ihr mich jetzt bitte entschuldigen wollt –?« So, dachte sie, innerlich schmunzelnd, das sollen sie erst mal verdauen.
Doch ihre Genugtuung verlor sich, denn gerade als sie durch die Tür hinausgleiten wollte, erhob sich draußen Aufruhr. Sie hörte Rufe, eine formelle Verlautbarung – oder war es die Ankündigung eines Gastes? –, und dann schob sich ein Teil der Menge, einander anrempelnd, in den hinteren Teil des großen Saals, während andere am Platz stehenblieben und sich verbeugten oder knicksten.
»Was ist denn jetzt los?« fragte der Earl gereizt, als der Sheriff beiseite trat. »Bei Gott, was bedeutet denn all dieser Lärm –?« Plötzlich blieb er jedoch abrupt stehen und machte eine Verbeugung. »Prinz John!«
Er hatte sie, wußte der Minnesänger. Oder konnte sie haben, falls er sie wollte und falls er es ihr vorschlagen würde. Er war im Lauf der Jahre ein Experte darin geworden, den richtigen Zeitpunkt zu beurteilen – und die Willigkeit der Frau. Diese hier gehörte ihm.
»Schöne Eleanor«, murmelte er und sah als Antwort die Röte in ihrem Gesicht und das Funkeln ihrer dunkelbraunen Augen. Ihre Lippen öffneten und teilten sich. Ihr leichter Überbiß faszinierte ihn. »Schöne Eleanor, meine Liebste – ich werde ein Lied für Euch komponieren.«
Es war ein leichtes bei ihr. Wie bei so vielen Frauen. Ob von niedriger oder hoher Geburt, Frauen waren doch alle gleich. Schenk ihnen ein Lächeln, ein Lied; schon bald hatte man sie im Bett.
Er zupfte auf seiner englischen Laute eine einzelne Note. »Schöne Eleanor«, sagte er leise und warf ihr einen Blick zu, der sie zum Dahinschmelzen bringen sollte. Lächelnd fing er an zu singen.
Der Earl von Huntington legte eine Hand auf Marians Arm und schob sie zur Seite, um Platz für den Ankömmling zu machen: Prinz John, den Count von Mortain und Bruder des Königs.
John, der, wenn er nicht rundweg verflucht wurde, Softsword oder Lackland genannt wurde, betrat torkelnd den Raum. Seine schwere Amtskette und sein mit Edelsteinen besetzter Schmuck klimperten. John hatte dunkle, engstehende Augen, dunkle Haare, schmale Schultern und war von kleinem Wuchs. Sein Gesicht war gerötet, und sein Atem stank nach Wein. Er sprach heiser und undeutlich. »Feiert Ihr etwa ein Fest, ohne mich eingeladen zu haben?«
Es war nicht zu übersehen, daß der Count von Mortain bereits zuviel gebechert hatte. Der Earl, ein einflußreicher Pair, der nur dem König unterstand, war unverkennbar verärgert; aber ebenso unverkennbar wünschte er das nicht zu zeigen. Während er die Tür schloß, stellte er ein höfliches – und diplomatisches – Lächeln zur Schau. »Mylord, ich hörte, Ihr wärt in London.«
»War«, verkündete John, der leicht schwankte, bis er sich einen Ruck gab und aufrecht stand. »Nun bin ich hier. Mit oder ohne Einladung.« Sein glasiger Blick wanderte vom Earl zum Sheriff, den er nur mit einem lässig erhobenen Zeigefinger grüßte – der Sheriff beeilte sich, sofort darauf zu reagieren –, dann blieb er auf Marians Gesicht ruhen. Und erhellte sich merklich. »Huntington – ist dies Eure Tochter?«
Der Earl schaute sie kaum an. »Nein, Mylord. Ist sie nicht.«
»Aber –« Er fuchtelte unentschlossen mit einer Hand herum, auf der Suche nach der richtigen Antwort. »Doch bestimmt nicht Eure Frau! Oder seid Ihr etwa dazu übergegangen, Kinderwiegen auszurauben?« Sein Lächeln enthüllte die schlechten Zähne. »Sie war des Raubs wert. Nicht wahr?«
Marian hatte das Gefühl, als stünde sie nackt vor dem Prinzen. Ihr wurde erst kalt und dann wieder heiß. Sie wollte nichts lieber, als aus dem Raum zu fliehen oder unauffällig in den dunklen Ecken zu verschwinden.
Huntington lächelte nicht. »Nein, Mylord. Meine Frau ist verstorben.«
John schenkte Marian ein warmes Lächeln und trat näher zu ihr. Es verbesserte seinen Mundgeruch nicht. »Wie heißt Ihr?«
Mach, daß er es vergißt, flehte sie innerlich. Lenk seine Aufmerksamkeit ab – tu etwas, irgend etwas ... laß es bitte nicht weitergehen .. .
Geschmeidig gab der Sheriff Antwort, bevor Marian es hätte tun müssen. »Lady Marian«, sagte er ruhig. »Vom Gut Ravenskeep. Es liegt in der Nähe von Nottingham.«
John starrte ihn eindringlich an. »Da war ich soeben, doch Ihr wart hier. Aber ich könnte zurückkehren. Immerhin gehört es mir ... und die ganzen Abgaben auch.«
Darüber beklagten sich die Armen und viele der Kaufleute dazu. Der Sheriff sagte: »Mylord, Lady Marian erholt sich gerade erst von der Trauer um den Tod ihres Vaters.«
Johns dunkle Augen funkelten. »Er ist tot, ja? Wie starb er denn?«
Er stand nahe bei ihr, zu nahe. Sie konnte seine faulen Zähne riechen, den Geruch nach saurem Wein und schmutziger Kleidung. Sie mochte nicht recht glauben, daß John wirklich der Sohn eines Königs war. Wurden ihnen denn nicht bessere Manieren beigebracht?
Marian räusperte sich und bat innerlich Gott um Mut und Geduld. »Im Kreuzzug, Mylord ... mit Eurem Bruder, dem König.«
John lachte, dann machte er eine ausholende Geste und bekreuzigte sich höhnisch und übertrieben. »Bestimmt wird ihn Gott für seine Frömmigkeit und seinen Dienst belohnen. Und die Trauerzeit ist gerade vorbei, ja?« Er nahm eine ihrer Hände. »Sollen wir keine Zeit mehr verschwenden?«
»Mylord –« Sie fühlte sich hilflos und verängstigt. Er war der Bruder des Königs und hatte große Macht; es war durchaus möglich, daß John sogar unter dem Dach des Earls tun und lassen konnte, was er wollte. »Mylord, wenn es Euch genehm ist, bitte ich Euch darum, mich gehen zu lassen –«
»Was mir genehm wäre, Lady, ist, Euch mit ins Bett zu nehmen.« Er lallte nun weniger stark. »Habt Ihr ein Bett, Huntington? Das frei ist und in dem kein hiesiges Gesindel schläft?«
Marian riß sich los. »Mylord – nein.«
Im Zimmer wurde es still. John starrte sie aus blutunterlaufenen Augen an. Sein Jähzorn war legendär.
»Mylord, wenn es Euch genehm ist ... ich bin eine anständige, unverheiratete Frau, die gerade die Trauerzeit hinter sich hat –«
»Und ich bin Erbe des Throns von England.« Johns Ton war eisig. Seine dunklen Augen glitzerten, und eine fleckige Röte überzog sein Gesicht. Er wartete auf ihre Antwort.
Die Antwort erfolgte statt dessen von Robert von Locksley, der das erste Mal, seit John das Zimmer betreten hatte, das Wort erhob. »Mylord, ich bat Lady Marian in dieses Zimmer, um ihr Neuigkeiten über ihren Vater mitzuteilen. Ich war bei ihm, als er starb, und ich überbrachte ihr seine letzten Wünsche. Sicher kann ein Mann mit Eurem Feingefühl verstehen, daß eine Frau, die gerade solch betrübliche Nachrichten erfuhr, vielleicht den Wunsch verspürt, ein wenig allein zu sein.« Er machte eine Pause. »Außer der Count liebt Tränen ...?«
John starrte sie wieder an. Etwas von seiner Hitzigkeit war verschwunden. Schließlich war er noch immer betrunken. »Werdet Ihr weinen? Wird es Tränen geben?«
»Ja«, antwortete sie augenblicklich in dem Bewußtsein, daß Männer Tränen verachten.
»Bei Gott«, sagte John schweratmig, »du bist das hübscheste Ding, das mir seit Monaten untergekommen ist.« Er streckte seine schwerberingte Hand nach ihr aus und löste eine Locke aus ihrem schwarzen Haar, dann legte er ihr die andere Hand auf die Brust.
Gedemütigt machte Marian einen Satz vom Sheriff fort. Wenn sie nur an John vorbeikäme, wäre die Tür nicht mehr fern. Sie müßte nur aus dem Raum hinauskommen und in der Menge untertauchen.
Vier Männer starrten sie an. Doch nur in Robert von Locksleys Augen erblickte sie Verständnis und unerwartetes Mitgefühl. Für die anderen war sie Freiwild; John hatte sie dazu gemacht.
»Bei Gott«, flüsterte John. »Es ist genug da für alle von uns.«
Marian verlor endgültig den letzten Rest ihrer Fassung. Scham erfüllte sie. Steif drehte sie sich um, hob den Riegel und stieß die Tür auf. Gerade als John zu protestieren anhob, entfloh sie der überfüllten Kammer.
Sie konnte noch leise die Worte vernehmen, die Locksley mit ruhiger Stimme äußerte: »Mylord, ich war mit Eurem Bruder zusammen. Gibt es etwas, was ich Euch berichten kann?«
Das sagte er um ihretwillen. Und sie segnete ihn dafür.
5. Kapitel
Der Earl von Huntington musterte seinen Sohn besorgt. Er fand, daß Robert John nicht mit der erforderlichen Umsicht behandelte; genauer besehen, ließ er jedoch nichts gegenüber Umsicht walten.
»Nun?« bellte John.
Der Earl hielt den Atem an, während sein Sohn sich von der Tür abwandte. Locksleys Gesicht entbehrte jeden Ausdrucks. »Nun?« gab er zurück.
Ist er denn verrückt geworden, sich John gegenüber so zu benehmen? Huntingtons Lippen lösten sich leicht.
Nicht als geduldiger oder toleranter Mann bekannt, zeigte der Count von Mortain jetzt, wie unmäßig schlecht gelaunt er sein konnte. »Mein Bruder«, erklärte er zwischen zusammengepreßten Zähnen. »Ihr sagtet, Ihr wärt mit ihm zusammengewesen?«
Locksley neigte seinen Kopf. »Das war ich, Mylord. Im Heiligen Land.«
Der Earl preßte eine Hand auf sein Herz, das etwas unregelmäßig unter der teuren Kleidung schlug. Glaubte Robert etwa, irgendeine kleine Begünstigung, die der König ihm Tausende von Meilen entfernt gewährt hatte, könnte ihn gegenüber Johns unvermittelterem Zorn unverletzbar machen? Jeder wußte, daß John unberechenbar, engstirnig und nachtragend war ... und daß ihm die Wünsche seines Bruders vollkommen gleichgültig waren.
»Was sagte er, mein Bruder? Das letzte Mal, als Ihr ihn saht?« fragte John kühl lächelnd.
»Vieles, Mylord. Er gab Befehle aus, besprach Strategien –«
»Mit Euch?«
Locksley machte einen Moment Pause, dann ließ er die Anspielung auf sich beruhen. »Er sprach mit vielen von uns, Mylord. Ich hatte die Ehre, bei vielen Gelegenheiten sein Vertrauen zu genießen ... es war seine Art, Mylord, Männer um sich zu versammeln, um zu erfahren, was sie von bestimmten Situationen dachten –«
»›Bestimmten Situationen‹«, fiel John ihm ins Wort. Auf einmal war der schwankende, nuschelnde Banause wie ausgewechselt. Er wirkte listig und hellwach, seine Worte kamen klar und beißend. »Wir wissen doch alle, welche Art von ›Vertraulichkeiten‹ mein Bruder teilte, oder nicht? Muß ich dann etwa annehmen, daß Ihr einer seiner – besonderen Gefährten wart?«
Locksley blieb unverändert ruhig. »Er nannte viele von uns ›Freund‹, Mylord. Nennt er nicht auch seinen Bruder so?«
John ließ sich dadurch nicht abschrecken. Seine Stimme klang wie eine Peitsche. »Er hat eine Frau und trotzdem kein Kind. Es sind Gerüchte im Umlauf, daß Berengaria unfruchtbar ist – während wieder andere behaupten, daß es nicht ihr Fehler ist; daß man von einer Frau wohl kaum erwarten kann, daß sie schwanger wird, wenn sie noch Jungfrau ist. Eine verheiratete Jungfrau, Locksley!«
Locksley stand regungslos und merkwürdig entspannt da. »Er bedauerte zutiefst, daß England keinen Erben hat.«
Überrascht hielt der Earl die Luft an. Vielleicht hatte Robert im Kreuzzug doch gelernt, die Staatskunst und das Ränkespiel – so oft ein und dasselbe – zu beherrschen.
»Keinen Erben?« zischelte John. »Aber natürlich gibt es einen Erben! Ich bin Erbe, von Gottes Gnaden, zwei toten Brüdern, einer alten Vettel von Mutter und einem Narren an Vater, welcher jedoch Richard ernannte statt meiner –« Unvermittelt hielt er jedoch, tiefdüsteren Gesichts und vor Wut zitternd, inne und ließ das Geschrei verhallen. Langsam verlor sich seine Röte, und er lächelte Locksley auf einmal wieder ruhig an. »Selbstverständlich gibt es einen Erben. Er muß gemeint haben, kein Erbe seines eigenen Blutes – kein Same seiner eigenen Lenden.... Er wechselte das Thema, und sein Ton wurde leiser und durchdringender. »Ob er Lenden hat, was glaubt Ihr?«
Locksley zögerte nicht. »Alle nennen ihn einen Bullen, Mylord.«
Die Worte hingen im Raum.
Johns dunkle Augen wurden schmal. Dann hob er eine Braue. »Wie nennt Ihr ihn denn?«
Locksley neigte seinen Kopf. »König von England, Mylord.«
»Seid verflucht – ich will die Wahrheit von Euch wissen!« Er machte einen Schritt nach vorne, wobei er seine Amtskette so fest umklammerte, daß seine Knöchel weiß schimmerten. »Glaubt Ihr denn, ich sei ein Narr? Glaubt Ihr denn, ich hätte nicht meine Quellen?«
»Vergebt mir, aber ich war zwei Jahre fort. Vielleicht könntet Ihr mich aufklären –«
»Euch aufklären!« Mit drei Sätzen stand John vor Locksley. »Man sagt, er schläft mit Knaben. Und Ihr wart einer von ihnen!«
Im Sonnenuntergang leuchteten die Mauern von Huntingtons Burg golden. Sir Guy von Gisbourne pausierte außerhalb der Tür, die zur Hauptburg führte, um seinen Schweiß in der Dämmerung trocknen zu lassen. Er lehnte an der Steinmauer.
Wie gedemütigt hatte er sich gefühlt, als er entdecken mußte, daß die Frau, nachdem sie ihn weggeschickt hatte, um Wein zu holen, verschwunden war.
Gisbourne schloß die Augen. Ich kann nicht sein wie sie. Ich kam als Kaufmannssohn zur Welt... Es nagte an ihm. Er war nie arm gewesen, aber immer ein gewöhnlicher Mann ... und das würde wahrscheinlich auch so bleiben, wenn er nichts unternahm. Sein Vater hatte sicher den ersten Schritt für ihn getan, indem er ihm die Ritterswürde gekauft hatte – aber was hatte er schon davon? Er konnte einer Frau nichts bieten, außer sich selbst, und das war nicht eben viel. Überhaupt nicht viel. Es sei denn, ich würde mehr darstellen – irgendwie.
Er hörte Schritte. Gisbourne öffnete, halb fürchtend, es könnte sie sein, seine Augen, aber es war nur ein Mann, den er nicht kannte. Er war in Samt und Brokat gekleidet.
Als der Mann Gisbourne entdeckte, grüßte er in normannischem Französisch. Automatisch antwortete Gisbourne ihm in derselben Sprache. Gisbourne wurde bewußt, daß der Fremde Normanne war wie er. Er sprach ohne Akzent.
Sie tauschten Namen und Positionen aus: Der Mann war Gilbert de Pisan, der Seneschall von Prinz John.
Gisbournes Erwiderung erfolgte prompt. »Aber ich bin ebenfalls Seneschall! Vom Sheriff von Nottingham.«
Da war sie: die Gelegenheit. Gisbourne spürte es instinktiv. In deLaceys Diensten würde er nicht höhersteigen können, außer deLacey erwarb ein höheres Amt und Gisbourne würde zu seinem Nachfolger ernannt werden – was er für unwahrscheinlich hielt, aber schließlich gab es noch andere Arbeitgeber als den, dem er diente.
»Ich habe ein recht gutes Geschick als Kämmerer«, verkündete er freimütig und eifrig; in Diplomatie war er unerfahren.
De Pisan zuckte mit den Schultern. »Daran habe ich keinen Zweifel.«
Schwach flackerte Befangenheit in Gisbourne auf; war ihm dieser Mann wohlgesonnen? Im Bewußtsein, daß er sich jedoch schon ausgeliefert hatte, machte er einen weiteren Vorstoß. »Und doch wäre ein Mann wie ich ein Narr, eine Stelle mit einem Herrn, wie Ihr ihn habt, scheel anzusehen.«
De Pisan lächelte frostig. »Gerade im Moment hat er einen Seneschall.«