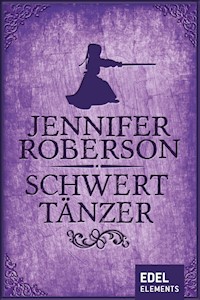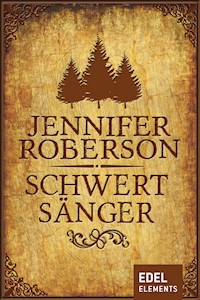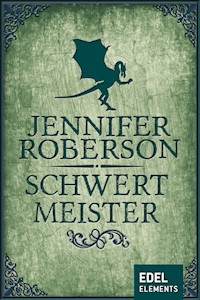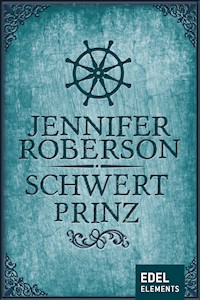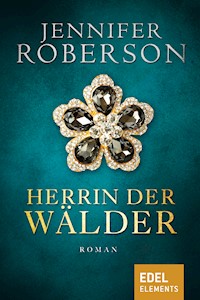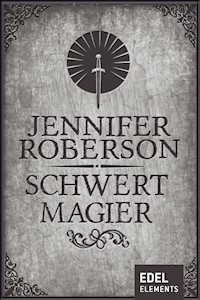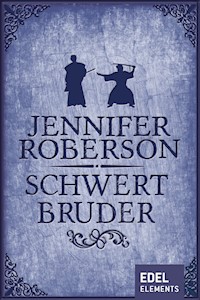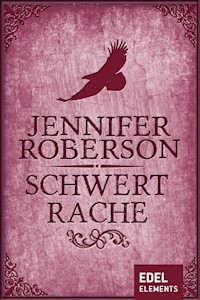
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schwerttänzer-Zyklus
- Sprache: Deutsch
Sosehr er sich auch sträubt - eines Tages muß sich Tiger, der legendäre Schwertkämpfer, der Wahrheit stellen und eingestehen, daß er magische Kräfte besitzt. Nur so vermag er dem Rätsel seiner ungeklärten Herkunft näher zu kommen. Doch sobald er die einzigartige Macht einzusetzen weiß, verwandelt sie sich in eine tödliche Gefahr - nicht zuletzt für die schöne Klingengefährtin Del...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jennifer Robersons "Schwertänzer-Zyklus" – sieben einzigartige Romane voller Magie, Geheimnisse und funkelnder Dialoge. Ein Meisterwerk der modernen Fantasy!
Jetzt erstmals als eBook lieferbar.
Sosehr er sich auch sträubt - eines Tages ist für Tiger, den legendären Schwertkämpfer, die Zeit gekommen, sich der Wahrheit zu stellen: Er muss sich endlich eingestehen, dass er magische Kräfte besitzt. Nur so vermag er die Wahrheit über seine ungeklärte Herkunft aufzudecken. Doch Tigers einzigartige Macht bedeutet zugleich tödliche Gefahr – nicht zuletzt für seine schöne Klingengefährtin Del…
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel "Sword-Born - A Novel of Tiger and Del, Part II" Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2015 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © der Originalausgabe 1998 by Jennifer Roberson O´Green Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2001 Ins Deutsche übertragen von Karin König
Covergestaltung: Eden & Höflich, Berlin.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-707-3
facebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Cover Page
Kurzbeschreibung
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
Geographie
1
Ich stand dort auf dem Gipfel und drohte zu fallen. Nur dass ich nicht fallen würde, weil ich fliegen konnte. Weil man von mir erwartete zu fliegen.
Weil ich fliegen musste.
Der Wind peitschte auf mich ein. Er wischte mir die Feuchtigkeit aus den Augen und trocknete sie aus. Strich mir das Haar aus dem Gesicht. Bedrohte den Atem in meiner Nase und so den Atem in meinen Lungen. Zerrte an meiner Kleidung wie eine Frau, die es nach Intimität verlangt, bis der Stoff riss, zerfetzt wurde, mir vom Körper gerissen wurde.
Und ich stand nackt oberhalb des Abgrunds und sollte fliegen. Oder sterben.
Die Zehen bohrten sich in das Gestein. Schwielen platzten auf und bluteten. Ich hob die Arme, breitete die Arme aus, spreizte sie wie Schwingen, die Finger ebenfalls gespreizt und starr. Der Wind prallte gegen die Handflächen, fing sich in den Achselhöhlen. Ich schwankte gefährlich auf dem Berg. Auf der Säule der Götter das Gleichgewicht suchend.
»Ich kann«, sagte ich. »Ich werde.«
Der Wind heulte um mich herum. Liebkoste mich. Ergriff mich.
»Ich kann. Ich muss. Ich werde.«
Der Wind erfüllte mich, drängte sich durch meine Lippen in den Mund, in die Kehle, in den Körper. Er war kein sanfter Geliebter, keine zärtliche und bedächtige Frau, sondern eine bedrohliche Macht, die eine Erlösung und Erleichterung versprach wie keine andere dem Menschen bekannte.
Ich beugte mich mit ausgebreiteten Armen vor. Und dann ließ der Wind nach. Erstarb, verließ den Berg, ließ mir die freie Wahl.
Ich beugte mich vor, suchte den Wind. Wartete darauf, dass er mich anheben würde.
Stieg auf.
Stürzte ab ...
... und prallte auf den Boden.
»Tiger?« Del setzte sich auf, beugte sich über die Bettkante. »Bist du in Ordnung?«
Ich lag zusammengekauert auf dem Steinboden. Ich fragte benommen: »Was ist passiert?«
»Du bist aus dem Bett gefallen.«
Ich setzte mich stöhnend auf. Betastete meine Ellenbogen, die Knie. Spähte in die Dunkelheit. »Hast du mich gestoßen?«
»Nein, ich habe dich nicht gestoßen! Du hast mich da durch geweckt, dass du etwas zu rufen versuchtest, und bist dann über die Bettkante gesprungen.«
»Gesprungen.«
»Gesprungen«, wiederholte sie entschieden.
Ich betastete meine Stirn, als ich mir einer wunden Stelle bewusst wurde. Am Morgen würde daraus vermutlich eine Beule erwachsen sein. »Warum sollte ich über die Bettkante springen?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Del. »Ich habe keine Ahnung, was dich zu irgendetwas treibt. Einschließlich: zu viel zu trinken.«
Waren wir also wieder beim alten Thema? Ich stand auf, richtete meine Tunika, drehte mich in eine Richtung und dann in die andere, um mein Rückgrat knacken zu lassen. Das Geräusch klang laut in der Dunkelheit.
»Ein Traum?«, fragte sie.
Ich dachte darüber nach. »Ich erinnere mich an keinen Traum. Ich erinnere mich nicht daran, überhaupt geträumt zu haben.« Ich rieb mir kurz über mein Stoppelkinn. »Das kommt wahrscheinlich, weil ich mich ohne Schwert so hilflos fühle. Irgendwie ... unruhig.«
»Unruhig?«
»Als würde etwas Schlimmes geschehen.«
Del stieß einen abwehrenden Laut aus. »Zu viel Wein.« Und legte sich wieder hin.
»Komm«, sagte ich, »lass mich wenigstens zwischen dich und die Wand. Wenn ich dann wieder aus dem Bett stürze, kann ich auf dir landen.«
Del rückte rüber. Zur Wand. Überließ mir die offene Seite und darunter den Steinboden.
»Danke, Bascha.«
»Gern geschehen.«
Ich kletterte ins Bett zurück, befühlte meine Bettseite, fand aber keine schwache Stelle. Wahrscheinlich war ich zu weit an den Rand gerollt, war aus dem Gleichgewicht geraten und einfach über die Kante gekippt. Gleichgültig, was Del über das Springen gesagt hatte.
Da sie nicht mitmachen und mir die Wandseite überlassen wollte, entschädigte ich mich, indem ich beide Arme um sie schlang. Wenn ich fiel, fiel auch sie.
Rachsüchtig lächelnd, schlief ich wieder ein.
Am Morgen hatte ich tatsächlich eine Beule, wenn auch keine schlimme. Del erwischte mich, als ich sie betastete, das Haar beiseiteschob, um sie zu betrachten, und wedelte dann mit der Hand. »Du riechst wie eine Weinkellerei.«
Ich grinste. »Was nicht unangemessen ist, da wir zur Zeit in einer leben.«
»Sieh dich nur an.« In anklagendem Tonfall.
Das brauchte ich nicht. Ich wusste, was sie meinte. Meine vor vergossenem Wein in der Farbe alten Blutes befleckte Tunika. Ich ergriff mit gekreuzten Armen den Saum und riss mir die Tunika über den Kopf. »So«, sagte ich, »alles weg.«
Sie sah mich fragend an, während sie ihr langes helles Haar richtete. Sie war zerzaust, zerknittert und wirkte in ihrer ärmellosen, kurzgeschnitten Tunika, die fast ihre ganzen außergewöhnlich langen und wundervollen Beine freigab, schläfrig, aber trotz ihrer Morgenstimmung unbestreitbar großartig. Ich sah sie lüstern an und gab vor, mich auf sie stürzen zu wollen.
Del duckte sich fort. »Erst wenn du gebadet hast!«
»Das wird warten müssen«, sagte ich. »Und du ebenfalls, wenn du glaubst, es ertragen zu können.«
Sie runzelte die Stirn und fuhr weiter mit den Fingern durch ihr Haar. »Wovon sprichst du?«
»Ich fange heute damit an, aus Herakleio einen Mann zu machen. Es ist eine schmutzige, schweißtreibende Angelegenheit. Das Bad kommt später.«
Sie fragte vorsichtig: »Wie gedenkst du ihn zu einem Mann zu machen? Indem du ihn unter den Tisch trinkst?«
»Oh, ich zweifle nicht daran, dass ich ihn unter den Tisch trinken kann. Ich erwarte, offen gesagt, ihn in den meisten Dingen ausstechen zu können.« Ich erinnerte mich an Prima Rhannets Bemerkung über Herakleios Verlangen nach Frauen. »Obwohl ich im Laufe der Zeit einige Selbstbeherrschung gelernt habe.«
»Tatsächlich?«
»Mühsam vielleicht, aber es bleibt dennoch Selbstbeherrschung.« Ich streckte mich ausgiebig und wartete darauf, dass sich meine Knochen wieder an ihren Platz begaben. An einigen Morgen taten sie dies langsamer als an anderen.
»Du«, sagte sie zweifelnd. »Du willst ihn zu einem Mann machen.«
Ich drehte meinen Rumpf erst in die eine und dann in die andere Richtung. »Traust du mir das nicht zu?«
Del dachte über die Antwort nach. »Ich glaube, dass es tatsächlich Dinge gibt, die du jedermann beibringen kannst«, sagte sie schließlich. »Aber ... du weißt nichts über Skandi.«
»Ich weiß ein wenig darüber, ein Mann zu sein.«
Sie betrachtete sinnend meine Miene und entschied, mir nicht mehr Leine zu lassen, damit ich sie nicht nehmen und sie damit aufhängen konnte. »Darf ich zusehen?«
Ich beugte mich vor, um meine Zehen zu berühren, und ergriff sie. »Später«, sagte ich angespannt. »Du musst zuerst noch etwas für mich tun.«
»Ich?«
»Such Simonides auf, den Diener der Metri. Er hat einiges für dich.«
»Für mich.«
»Nun, tatsächlich für mich und Herakleio, aber wir werden zunächst einmal beschäftigt sein. Wenn du siehst, was Simonides zusammengetragen hat, wirst du es wissen.«
»Wird er wissen, dass ich weiß?«
Ich verschränkte die Hände hinter dem Kopf und beugte mich herab, drehte mich, ließ die Anspannung in meinem Nacken sich lösen. »Wahrscheinlich nicht.«
»Du bist rätselhaft, Tiger.«
»Nein, das bin ich nicht.« Ich schüttelte die Arme aus und ließ meine Hände zappeln wie frisch vom Haken genommene Fische. »Ich bin unterhaltsam.«
Sie sagte in ernstem Tonfall: »Du wirst nicht so hinausgehen.«
»Nein?« Ich trug nicht viel – eine weite Hose, die von einer über meinen Hüftknochen festgebundenen Kordel gehalten wurde. Kein Hemd, keine Schuhe. Ich war so unbehindert, wie ich es mochte. »Warum nicht?«
»Du wirst den armen Jungen halb zu Tode erschrecken.«
Der ›arme Junge‹ war ein Jahr älter als Del. »Gut.« Ich lächelte grimmig. »Komm her.«
»Warum?« Wachsam.
»Vertraust du mir nicht, Bascha?«
»Manchmal.«
»Komm her.« Ich hielt inne. »Bitte?«
Del erhob sich ein wenig besänftigt und näherte sich mir.
»So.« Ich ergriff ihre Arme, hob sie an, legte sie um mich. »Fest.«
»Tiger ... du stinkst nach Wein!«
»Würdest du es bitte tun?«
Sie seufzte und schlang ihre Arme um mich.
»Drück zu«, wies ich sie an. »Fest.«
Sie drückte.
»Fester.«
»Fester als so?«
Wir waren wie zusammengeschweißt. »So fest du kannst, Bascha.«
Sie drückte, und mehrere meiner Wirbel beschlossen, wieder an ihren Platz zu springen. Geräuschvoll.
»Götter«, sagte sie und ließ mich entsetzt los.
»Schon besser«, seufzte ich und grinste sie dann an. »Jetzt riechst du nach Wein.«
»Was du wahrscheinlich die ganze Zeit beabsichtigt hast.«
»O nein. Zumindest nicht als Einziges.« Ich beugte mich vor, gab ihr einen heftigen Kuss, der halb auf ihrem Mund und halbwegs auf ihrem Kinn landete, und eilte aus dem Raum. »Vergiss nicht, Simonides aufzusuchen.«
»Nach meinem Bad«, murrte sie.
Herakleio war verzogen. Verweichlicht. Ich öffnete die Tür zu seinem Raum und trat ein, woraufhin er mich nicht einmal ansah. Wahrscheinlich weil seine Augen in einem so tiefen Schlaf, dass er fast an Bewusstlosigkeit grenzte, fest geschlossen waren.
Er lag auf dem Bett ausgebreitet, die Glieder in den Laken verfangen. Er war nach dem Essen anscheinend in die Stadt gegangen. Ich roch Wein und härtere Alkoholika, wie auch eine Spur Rauch. Es war nicht Huvakraut – ich bezweifelte, dass es in Skandi wuchs –, aber etwas Ähnliches, selbst in kleiner Menge sehr Starkes, wenn es mit dem traditionellen Perfume of Cantina, wie Del es einmal beschrieb, vermischt wird.
Die erste Prüfung: nicht bestanden.
»Hoch«, sagte ich ruhig.
Nicht die geringste Reaktion. Zweite Prüfung: nicht bestanden.
Der mir nächstgelegene Fuß hing über die Bettkante. Ich verschränkte die Hände um den Knöchel und strebte zur Tür, zog den schlaffen Körper vollständig aus dem Bett, sodass er auf den Boden plumpste.
Das weckte ihn.
Der größte Teil des Bettzeugs hatte ihn begleitet, sodass er selbst auf dem Boden noch darin verfangen blieb. In einem Durcheinander von Leinen und Flüchen grub sich Herakleio schließlich frei und erkannte mich.
»Sie!«
»Ich.«
»Was wollen Sie?«
»Sie.«
»Mich?«
Es wurde schnell zu einer monotonen Unterhaltung. »Sie.«
»Warum?«
Nun, das war zumindest eine Veränderung. »Befehle.«
»Befehle? Befehle? Wessen Befehle?«
Vielleicht konnte er nach einer durchzechten Nacht nur noch in einzelnen Worten oder Silben denken. »Der Metri«, antwortete ich. »Erinnern Sie sich? Ich soll einen Mann aus Ihnen machen.«
Er setzte sich in dem Gewirr von Bettzeug und nackter brauner Haut jäh auf. »Dies soll mich zu einem Mann machen? Mich aus dem Bett zu ziehen und auf den Boden zu werfen?«
»Es ist ein Anfang. Zugegebenermaßen kein großartiger Anfang, aber doch ein Anfang.«
Er wurde allmählich wach. Er blinzelte mich zornig an und konzentrierte sich dann mühsam, die Augenbrauen über seiner Nase zusammengezogen. Er sah mich an, und dann veränderte sich sein Gesichtsausdruck. »Götter«, murmelte er, während er starr auf meinen Bauch blickte.
Ah. Die berüchtigte Narbe.
»Hoch«, sagte ich und winkte mit dem Finger.
»Wer hat Ihnen das angetan?«
»Eine Frau. Und jetzt stehen Sie auf.«
Er regte sich nicht. »Eine Frau hat Ihnen das angetan?«
»Sie hatte ein Schwert«, erklärte ich. »Hoch, Herakleio.«
»Eine Frau hat Sie verletzt? Mit einem Schwert?«
»Eine Frau. Mit einem Schwert.«
»Götter«, sagte er erneut.
»Ich bin voller kleiner Erinnerungen«, belehrte ich ihn. »Nihko trägt Tätowierungen, ich trage Narben.« Ich beugte mich herab, um ein Handgelenk zu ergreifen, aber er wich zurück. »Dann stehen Sie freiwillig auf«, sagte ich. »Sie können nicht viel lernen, wenn Sie auf dem Boden sitzen.«
»Viel worüber?«, fragte er misstrauisch.
»Über alles. Hören Sie, dies war nicht meine Idee, erinnern Sie sich? Ich schulde der Metri etwas, und so möchte sie diese Schuld beglichen wissen.«
Da erhob er sich, ließ das Bettzeug ganz fallen. Er trug nur düsteren, schwelenden Groll. »Und was sollen Sie mich darüber lehren, ein Mann zu sein?«
»Kommen Sie mit und finden Sie es heraus.«
»Wohin mitkommen?«
»Nach draußen.«
»Wohin draußen?«
»Hoolies, Herakleio, können Sie noch etwas anderes als Fragen stellen? Warum kommen Sie nicht einfach mit und sehen selbst?«
»Frühstück«, forderte er mich heraus.
»Danach. Wenn Sie dann noch Appetit haben.«
Das saß. »Ich habe jetzt Appetit.«
»Kann sein, aber wir werden dem jetzt nicht nachgeben. Jetzt werden wir Sie in den Tanz einführen.«
»Den was?«
»Den Tanz.«
»Mit Ihnen?«
»Nicht diese Art Tanz.«
»Ich will mit Ihnen in keine Art Tanz eintreten.« Er hielt inne und bemerkte dann im Tonfall der Erkenntnis: »Sie meinen einen Schwerttanz.«
»Ja, ich meine einen Schwerttanz.« Ich machte eine Geste. »Kommen Sie.«
Wieder Zorn. »Ich habe nichts an!«
»Wollen Sie einer Schwertklinge keine wertvollen Körperteile opfern?« Ich grinste. »Warum nicht, Herakleio? Zu langsam nach letzter Nacht?«
Er sah mich finster an. »Ich weiß nichts über den Gebrauch eines Schwertes oder das Tanzen mit Männern.«
»Das ist richtig – Sie ziehen es vor, mit Frauen zu tanzen. Das habe ich gehört.« Ich deutete auf die Tür. »Dann ziehen Sie sich eine Hose an, wenn Sie sich damit besser fühlen.«
Er warf das wirre Haar aus dem Gesicht. »Ich würde mich besser fühlen, wenn ich wieder ins Bett ginge.«
»Zweifellos, nach allem, was Sie letzte Nacht getrunken – und geraucht? – haben. Aber das können Sie bereits. Jetzt ist es an der Zeit, etwas anderes zu lernen.«
»Den Umgang mit einem Schwert?« Verächtlich gefragt.
»Unter anderem.« Ich nahm eine schmutzige Tunika von einer Bank neben der Tür. »Dies sollte genügen.«
Er fing sie auf, als ich sie ihm zuwarf und verzog das Gesicht.
»Seien Sie ein guter kleiner Erbe«, riet ich ihm. »Tun Sie, was die Metri verlangt.«
Es war die Mahnung, dass sich noch ein potenzieller Erbe im Haus der Metri befand. Er schüttelte die Tunika aus und zog sie sich über den Kopf. Dann fragte er mit großartiger Geringschätzung: »Kann ich zuerst noch pissen gehen?«
»Das sollten Sie besser tun«, riet ich ihm, »sonst werden Sie sich beschmutzt haben, bevor der Morgen vorüber ist.«
Dann sagte ich ihm, wo er mich treffen sollte, und überließ ihn seinem Kater.
Das Haus selbst war auf einer massigen Anhäufung faltigen, porösen, windgeprägten Gesteins erbaut. Es war keine hohe Erhebung – bis auf die Klippe an der Vorderseite war kein Teil der halbmondförmigen Insel erheblich höher als das Übrige –, aber sie war irgendwie doch höher als das umgebende Land. Akritara war von hervorgewachsenen Nischen gefliester Höfe und Terrassen umgeben, die von niedrigen, weißgetünchten Mauern begrenzt wurden. Man stelle sich eine Reihe sich ausbreitender Lachen vor, die sich hier und da mit in die Mitte geworfenen, verschachtelten Reihen von Räumen verbinden, auf verschiedenen Halbebenen von schrägen Steintreppen verbunden, und man hat eine Vorstellung. Trotz der von Hand geglätteten, abgerundeten äußeren Ecken der Räume war das Haus keineswegs ganz gerundet und keinesfalls durch einen quadratischen Raum hier und einen quadratischen Raum dort klar einzuordnen. Es war eine große Anzahl von Räumen, die zusammengeballt und mit Mörtel verbunden waren und irgendwie ein Ganzes bildeten.
In den Hyorts der Salset aufgewachsen, in individuellen rundlichen Zelten, die zu Gruppen um den größeren Hyort des Häuptlings aufgestellt waren, kam ich zu dem Schluss, dass sich Akritara nicht wesentlich von einem Stammesdorf unterschied. Aber es war aus Stein gebaut, weil es, wie man mir sagte, auf der Insel kein anderes Holz gab als das, was von anderen Ländern herbeigebracht wurde, und keine der mit Kuppeln versehenen, bogenförmigen Dachlinien folgte einem Vorrecht oder der Symmetrie.
Aber eine mit einer niedrigen Mauer versehene, steingeflieste Terrasse auf der Hausseite war größer als der Rest und überschaute den Teil der Insel, der zur Stadt und dann zum Rand des Kessels führte. Hierhin ging ich, hier befreite ich die Fliesen von größeren Kieseln, Sand und über die Mauer gewehtem totem Laub. Ich ging barfuß über den Stein, erspürte mit den Fußsohlen, wie die Fliesen aneinandergepasst waren, wie der Mörtel sie beständig verband. Ich ging langsam, vorsichtig über die Terrasse, ließ meine Füße den Ort erkunden. Ich suchte die Oberfläche auch mit Blick und Fingerspitzen ab. Einige der Fliesen waren an den Ecken abgesprungen, von Zeit und Wasser angenagt. Haarfeine Risse verliefen durch viele der Quadrate und bildeten in anderen größere Spalten. Aber es war guter, geschickt zusammengefügter Stein. Es gab keine regelrecht losen Fliesen, keine gebrochenen oder zerschlagenen Stücke, nichts, woran ein Fuß hätte hängenbleiben, stolpern und aus dem Gleichgewicht geraten können.
In Alimat, in der Ausbildung durch den Shodo, lernten wir, auf allen Oberflächen zu tanzen. Die Punja, die tiefe Wüste, bestand überwiegend aus Sand, aber der Süden war auch noch aus etwas anderem gemacht. Der Shodo hatte Proben dieser anderen Oberflächen von den Grenzen des Südens heranbringen lassen, und es waren aus jeder dieser Materialien Kreise gestaltet worden. Sand, Kiesel, Schotter, Ortstein, gerissene und von der Sonne gehärtete Schlammflächen, die bröckelige Grenzerde, der durch Muscheln scharfe Sand der Küste nahe Haziz, per Hand geglättete Lehmziegelplatten, die durch darübergegossenes, Regen simulierendes Wasser geglättet wurden. Auf allen diesen Oberflächen, in allen diesen Kreisen lernten wir zu stehen, zu warten, uns zu bewegen, zu tanzen – lange bevor uns jemals ein Schwert in die Hände gegeben wurde.
Eine schwache Spur vom Wind verwehten, pudrigen Sandes war auf den Fliesen zu sehen. Ich würde Simonides bitten, die Oberfläche täglich abspritzen zu lassen, um alle Hindernisse von den Fliesen zu entfernen, die Stiefelsohlen, Sandalen oder schwielige Fußsohlen ausgleiten lassen könnten, aber im Augenblick konnte man es nur ertragen. Und wir würden uns noch nicht so viel bewegen. Zunächst nicht.
Als Herakleio schließlich kam, fand er mich die Mauer abschreitend vor. Sie war vielleicht kniehoch und zwei Handbreit tief. Ich folgte ihrem gebogenen, die Terrasse umgebenden Grat, von der Ecke eines Raumes zur Ecke eines anderen Raumes, und maß die dazwischenliegende Entfernung ab.
Er beobachtete mich verwirrt. Seine Haltung wirkte ungeduldig, steif, ganz angespannt. Es war keine Anmut in ihm, wie er dort stand, keine innere Ausgewogenheit. Der Tanz erfordert den Einklang des Körpers. Im Augenblick besaß er keinen.
Er war, dessen war ich sicher, rasch gewachsen. Ich vermutete, dass seine Hände und Füße altersmäßig zu groß gewirkt hatten. Er stolperte über Dinge, ließ etwas fallen. Er schlug mit den Ellenbogen gegen Türrahmen, die Oberschenkel waren von Tischkanten gezeichnet, die Schienbeine von blauen Flecken übersät. Dem war er schließlich entwachsen und hatte seine Hände und Füße jetzt unter Kontrolle, fühlte sich so, wie seine Knochen, seine Gelenke, die weiche Bewegung der Muskeln und Sehnen unter der braunen Haut, die Verteilung des Gewichts zusammenpassten, wohl. Aber Knochen und Haut wohnt ein Geist inne, der nichts damit zu tun hat, wie ein Mensch gemacht ist, sondern nur damit, wie er denkt.
Ich schritt die Mauer ab. Fersen bis Zehen und umgekehrt, stellte mich dann seitlich darüber und markierte meinen Weg bei jedem Schritt durch den Spann. Schließlich wurde ihm langweilig, er wurde ärgerlich und nicht einmal annähernd neugierig.
Als er den Mund öffnete, um etwas zu sagen, trat ich von der Mauer weg. »Springen Sie hinauf, Herakleio.«
»Hinauf«, echote er ungläubig. Dann, herablassend: »Das glaube ich nicht. Ich kann mir bessere Möglichkeiten vorstellen, meine Zeit zu verschwenden.«
Ich deutete mit einem Daumen. »Hinauf.«
»Ich bin kein Kind mehr, Scharlatan, dass ich mich mit solchen Dingen abgebe.«
»Nun, die Metri hält Sie anscheinend dafür.« Ich zuckte die Achseln. »Stellen Sie sie zufrieden, indem Sie mich zufriedenstellen.«
Zahlreiche Empfindungen schwemmten über sein Gesicht. Groll, Erkenntnis, Verärgerung, Ungeduld. Aber er bewegte sich. Er stieg mit einer leichten Bewegung auf die Mauer, die Muskeln streckten sich unter der Haut seiner Oberschenkel – unter dem Saum seiner Tunika verborgen – geschmeidig, und dann stand er dort.
»Nun?«, fragte er überaus verächtlich.
Ich stieß ihn hinab.
Er fiel nicht. Wankte nicht. Schlug nicht mit den Armen um sich. Aus dem Gleichgewicht geraten, trat er einfach herab. Jetzt lag die Mauer zwischen uns.
»Was ...?«, begann er heftig.
»Steigen Sie wieder hinauf«, sagte ich mit einer entsprechenden Geste. »Und bleiben Sie dieses Mal oben.«
Er starrte mich finster an. »Sie werden mich nur erneut hinabzustoßen versuchen.«
»Ja«, stimmte ich ihm zu. »Und Sie werden versuchen, nicht hinabgestoßen zu werden.«
»Das ist Zeitverschwendung!«
»Das dachte ich zuerst auch.« Ich zuckte die Achseln. »Ich habe es besser gelernt.«
»Gelernt?«
»Viele Dinge«, erklärte ich ihm. »Unter anderem, wie man fällt ... und wie man nicht fällt.«
»Aber das ist ...«
Ich trat über die niedrige Mauer, legte meine flache Hand auf sein Rückgrat und schob.
Wie erwartet, wie beabsichtigt, machte Herakleio in dem Versuch, sein Gleichgewicht wiederzugewinnen, einen großen Schritt, stieß sich an der Mauer die Zehen und rettete sich nur dadurch vor einem schlimmen Fall, dass er ein Bein hoch und über die Mauer riss und einen Fuß fest aufsetzte. Er schürfte sich dabei das Schienbein ab und stand dann in eher ungelenker Haltung über der Mauer, nachdem er sich gefangen hatte, fiel aber nicht.
»Da«, sagte ich. »Nicht so schwer, oder?«
Er hatte drei Wahlmöglichkeiten. Er konnte ein Bein hochziehen und auf der entgegengesetzten Seite der Mauer absetzen, sich dadurch von mir fortbegeben. Er konnte das andere Bein hochziehen und über die Mauer setzen, sich dadurch auf mich zubewegen. Oder er konnte genau dort bleiben, wo er war, jeweils ein Bein auf einer Seite der Mauer.
Herakleio entschied sich für Letzteres.
»Gut«, kommentierte ich. »Behalten Sie beide Füße am Boden, wann immer es möglich ist.«
Er war wütend. Er sagte es mir in knappen, zischend ausgestoßenen Worten in einer Sprache, die ich für Skandisch hielt.
»Springen Sie hinauf«, sagte ich. »Gehen Sie auf der Mauer entlang, Herakleio. Stellen Sie sich vor, dass Sie sterben müssen, wenn Sie auch nur einen Schritt auf einer Seite herabsteigen.« Ich hielt inne. »Das heißt, wenn Sie überhaupt die Vorstellungskraft besitzen.«
»Während Sie darauf warten, mich wieder hinabstoßen zu können?«
Ich schlug sanft vor: »Dann lassen Sie es doch nicht zu.«
Er atmete tief genug ein, um mich mit allen möglichen ungehobelten Kommentaren zu attackieren, aber gerade in diesem Augenblick kam Del um die Ecke, und er schloss geräuschvoll den Mund.
Sie hielt zwei vier Fuß lange Stöcke in Händen – Simonides hatte wertvolle Besenstiele gestiftet –, sowie zwei kürzere, schmalere Holzstücke, Lederstreifen, ein Obstmesser, Stoff und einen Wasserschlauch. Sie trug, wie schon seit ihrer Ankunft in Akritara, eine lange ärmellose Leinentunika, sehr dünn, die um die Taille von einer karmesinroten Schärpe gehalten wurde. Flache Ringe getriebenen Messings waren in den Stoff eingenäht. Sie glitzerten im Sonnenlicht.
Sie betrachtete Herakleio, wie er mit gespreizten Beinen über der Mauer stand, und mich, wie ich gelassen daneben wartete, und entschloss sich, sich in einiger Entfernung von uns auf die Mauer zu setzen. Sie breitete die mitgebrachten Gegenstände aus und begab sich schweigend an ihre Aufgabe.
»Treten Sie über die Mauer«, sagte ich.
Herakleio warf mir einen Blick schwelenden Zorns zu. Aber Del war in Hörweite. Del konnte sehen, was er tat oder nicht tat. Del war eine Frau. Eine wunderschöne Frau. Die Art Frau, für die ein Mann zu Boden sinken und Schmutz essen würde, bis er erstickte, wenn sie auch nur andeutungsweise Interesse daran zeigte, dass sie ihn das tun sehen wollte.
Er stieg auf die Mauer und begann, darauf entlangzugehen.
2
Schließlich ließ ich Herakleio von der Mauer herabsteigen und sich wieder auf den Boden stellen. Er war erhitzt, staubig, verschwitzt und ungeheuer niedergeschlagen. Manchmal hatte er vor sich hingemurmelt, aber sehr leise und auch erst, nachdem er sich versichert hatte, dass Dels Aufmerksamkeit ihrer Arbeit galt. Als sie in unsere Richtung schaute, stellte er sich sehr gerade hin, die Schultern gestrafft, die Arme locker an den Seiten, den Kopf stolz erhoben.
Oh, er war zweifellos ein gutaussehender junger Draufgänger. Eine wahrhaftige Gottheit, wie ich schon zuvor bemerkt hatte. Er war mit dem Handwerkszeug gesegnet, das ihn zu einem geschickten Schwerttänzer machen konnte: das Gleichgewicht, die Reichweite, die Anmut, die Kraft, die explosive Schnelligkeit. Sein Körper war nicht für Geziertheit, für Biegsamkeit geschaffen, verstand aber dennoch auszugleichen. Und er wollte unbedingt siegen. Dass er es nicht tat, lag darin begründet, dass mein Körper ihn zu besiegen wusste.
Herakleio betrachtend und die Bedürfnisse eines jungen und vitalen, nach Aktivität und angemessenem Zweck hungernden Körpers verstehend, begriff ich letztlich auch, warum der Shodo von Alimat, der wöchentlich von eifrigen Jungen mit Bitten bedrängt wurde, in dem Jahr, in dem er niemanden sonst annehmen wollte, unerklärlicherweise einen früheren Sklaven als Schüler angenommen hatte.
Ungefähr fünfzehn Jahre – und der Wunsch zu lernen. Das war es, was zwischen uns lag, zwischen dem Erben der Metri und mir. Eine schmale Linie, dachte ich, obgleich aus Spannung aufgebaut.
Ich schaute an ihm vorbei zu Del, wobei ich wortlos fragend die Augenbrauen wölbte. Als Antwort kam sie zu uns und präsentierte mir zwei aus Besenstielen, Weinstöcken und Leder zusammengeflickte Übungsschwerter. Eines reichte ich Herakleio.
»Jetzt bekommen Sie Ihre Chance«, sagte ich. »Nutzen Sie sie.«
Er betrachtete schreckensbleich das Schwert und dann mich. »Was?«
»Schlagen Sie mich«, forderte ich ihn heraus. »Verlangen Sie mir die Hoolies ab.«
»Das würde ich gern«, sagte er mit kalter Boshaftigkeit, »aber ...« Und brach jäh ab.
»Aber?«, hakte ich unverzüglich nach.
Er warf Del einen Blick zu, reckte dann das Kinn und schaute wieder zu mir. »Ich bin kein Narr. Ich weiß, was Sie sind. Ich weiß, was Sie tun werden.«
»Und was bin ich? Außer all den ungehobelten Dingen, als die Sie mich insgeheim bezeichnen.«
»Ein Schwerttänzer«, sagte er verbittert.
»Ah.« Ich lächelte. »Ist das ein Zugeständnis, dass ich vielleicht weiß, was ich tue?«
»Dass Sie wissen, wie man Menschen tötet, ja.«
»Aber es geht beim Tanz, wie ich bereits beim Essen erklärte, nicht darum, Menschen zu töten.«
Er höhnte. »Worum sollte es sonst gehen?«
Ich schüttelte freundlich den Kopf. »Einige Fragen werden besser vom Schüler beantwortet, wenn er die Antworten gelernt hat.«
Er hätte das Holzschwert am liebsten hingeworfen. Und noch lieber hätte er es mir wahrscheinlich übers Gesicht gezogen. Aber Del war bei uns – und seine Augen sagten mir, dass er wusste, dass ich als Sieger aus dem Streit hervorgehen würde, ob in Worten oder körperlich.
»Versuchen Sie es«, schlug ich vor. »Vielleicht haben Sie Glück.«
Er versuchte es lange Zeit.
Er hatte kein Glück.
Später, viel, viel später, entzog ich meinem schmutzigen Körper den Schweiß und den Schmutz und die Wundheit – und die Überreste des Weins. Ich hatte Herakleio um die Mittagszeit entlassen, hatte beobachtet, wie er erwog, das Besenstiel ›schwert‹ über seinen Knien zu zerbrechen, und wie er schließlich beschloss, einfach davonzustapfen. Aber er nahm das Schwert mit, wie ich es ihm befohlen hatte.
Jetzt vertrödelte ich meine Zeit im Wasser, während Del neben dem Becken saß und meine Holzwaffe erneut mit Lederstreifen umwickelte. Das Wasser war warm, entspannend, und ich spürte, wie sich die Muskeln lockerten und Knoten und Steifheit wichen.
Del, die mein geräuschvolles, zufriedenes Seufzen hörte, schaute von ihrer Arbeit auf. »Müde?«
»Er ist kräftig.«
»Er hat dich nicht einmal berührt.«
»Es kostete mich einige Mühe, ihn daran zu hindern, mich zu berühren.« Ich tauchte die Arme ins Wasser. »Und ich bin nicht in Form. Aus der Übung.«
Del war erstaunt. »Das gibst du zu?«
»Hoolies, ich gebe vieles zu, Bascha. Du musst nur sicherstellen, dass ich entweder betrunken oder erledigt bin wie jetzt.«
»Ich werde daran denken.« Sie hielt inne. »Warum hast du ihn so früh gegen dich antreten lassen?«
»Jedermann, der jemals eine Fertigkeit erlernen will, will sie am liebsten gestern schon erlernt haben«, erklärte ich. »Es interessiert sie nicht, was davor kommt. Ich erinnere mich, wie enttäuscht ich war, dass ich so viele Wochen lang nicht einmal ein Schwert halten durfte, während ich die Beinarbeit lernte. Nicht einmal ein Übungsschwert.«
»Und?«
»Und so habe ich es ihn halten lassen. Es ihn ausprobieren und ihn gegen mich antreten lassen. Ihn erkennen lassen, dass es nicht so leicht ist, wie er vielleicht glaubt.«
»Ich bezweifle, dass er das glaubt.«
»Bengel in dem Alter glauben immer, dass es leicht sei.«
Del wandte den Blick ab. »Manchmal ist es das auch.«
»Manchmal. Für einige Leute. Aus besonderen Gründen.« Ich wusste, was sie meinte. Sie war eine geschickte Schwertschülerin gewesen, die den Ishtoya auf Staal-Ysta, der vor ihr begonnen hatte, überwiegend, wenn auch nicht in allem übertroffen hatte. Weil sie mit dem dafür notwendigen Körper gesegnet war, aber auch weil sie so dringend besser sein musste, um ihr Ziel zu erreichen – um als gut genug angesehen zu werden. »Jetzt versteht er, dass die Grundlagen unumgänglich sind. Man sollte besser wissen, wie man eine Klinge meidet, bevor man versuchen kann, eine zu benutzen.«
»Die Verteidigung ist weitaus schwerer zu lernen als der Angriff«, stimmte Del mir zu. »Und im Kreis weitaus lebenswichtiger.«
Ich tauchte unter die Wasseroberfläche und mit zurückgeneigtem Kopf wieder auf. Wasser lief mein Haar herab. »Also, Bascha, wen hältst du für besser? Mich oder Abbu Bensir?«
Sie blinzelte überrascht. »Das kann ich nicht beantworten.«
»Warum nicht? Du weißt, wozu ich fähig bin. Du hast mit Abbu geübt und getanzt. Und du hast uns in Sabras Kreis tanzen sehen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann das nicht beantworten, Tiger. Ich glaube, nur ein Tanz könnte es entscheiden.«
»Aber es wird niemals einen Tanz geben. Keinen richtigen.« Ich bewegte eine angespannte Schulter und verlieh meiner Stimme eine Nüchternheit, die ich nicht empfand. »Niemals mehr richtige Tänze mit niemandem. Nur Entschuldigungen fürs Töten.«
Sie legte das Schwert neben sich und wandte ihre ganze Aufmerksamkeit mir zu. »Das erwartet die Metri von dir, nicht wahr? Herakleio ausbilden zu müssen, hat dich in diese Stimmung versetzt.«
»Er könnte gut sein.«
»Aber er wird nicht gut sein.«
»Er will es nicht. Braucht es nicht. Aber das ist andererseits nicht der Standpunkt der Metri.«
»Nein«, stimmte Del mir zu.
»Disziplin«, sagte ich fest und belehrend. »Festhalten an den Erfordernissen der Verantwortung. Ein reifes Verständnis dafür, wie Geist und Körper dem Willen der Aufgabe gebeugt werden. Ich soll ihn lehren, was sie ihm nicht beibringen kann, damit er sein wird, was sie braucht. Was die Familie braucht.« Ich grinste Del an. »Ist das nicht so ungefähr das Dümmste, was du jemals gehört hast? Ich soll diesem Kind etwas über Verantwortung beibringen?«
Del lächelte nicht. »Ich halte es für sehr klug.«
»Komm schon, Bascha. Du hast drei Jahre damit verbracht, mich wegen Dingen zu tadeln, die ich gesagt und getan habe, wegen meiner Weigerung, Verantwortung zu übernehmen ... meiner Vorliebe für Aqivi.«
Sie neigte ergeben den Kopf. »Wenn ich das Gefühl hatte, dass Erklärungen geeignet wären, damit du vielleicht besser verstündest, wie solche Gedanken verletzen können, oder wenn ich das Gefühl hatte, dass du Verantwortung übernehmen solltest. Ja, dann habe ich dich getadelt.«
Ich ergriff eine Seifenkugel und seifte mich heftig ein. »Ich verletze stets jemanden.«
»Manchmal absichtlich. Aber ich meine die Gelegenheiten, bei denen es nicht absichtlich geschieht, wenn es nur eine Widerspiegelung von Unwissen ist ...«
»Wie zu glauben, Frauen seien überwiegend nur zum Beischlaf geeignet?«
»Wie das«, bestätigte Del. »Und noch andere Dinge.«
»Wie zu glauben, eine Frau könne kein Schwert auf die Art handhaben, wie ein Mann es versteht?«
»Und andere Dinge.«
»Wie zu glauben ...«
»Tiger, wenn es drei Jahre gedauert hat, dir solche Dinge abzugewöhnen, wird es gewiss noch drei zusätzliche Jahre dauern, sie dir zu erklären.«
Ich grinste. »Dies scheint mir ein geeigneter Ort, um hier drei Jahre zu verbringen.«
Sie wurde sehr still. »Willst du das? Bleiben?«
»Glaubst du nicht, dass ich Herakleio aus dem Rennen werfen und mich von der Metri zum Erben ernennen lassen will?« Ich kratzte mir die Haut unter meinem Brusthaar. »Das ist ein Gedanke.«
Del wusste zweifellos nicht, was sie antworten sollte.
»Aber da bist auch du«, sagte ich.
»Ich?«
»Was möchtest du tun?«
»Ich«, sagte sie erneut.
Ich wartete.
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie schließlich.
»Bleiben?«, fragte ich. »Gehen?«
»Ich weiß es nicht.«
»Aber du hast die Wahl, Del.«
»Ja«, erwiderte sie stirnrunzelnd.
»Du musst nicht bleiben, wenn du nicht willst.«
»Das weiß ich.«
»Was bedeutet, dass du heute zum Dock hinuntergehen und ein Schiff nehmen könntest, wenn du es wolltest.«
»Ich habe kein Geld.«
»Oh, nicht praktisch werden«, sagte ich ernst. »Wir wollen hier das Herz sprechen lassen, nicht den Kopf.«
»Wollen wir das?«
»Und das Herz ist niemals praktisch.«
»Nein.«
»Das Herz ist tatsächlich ein eher eigensinniger Teil des Körpers, wenn man darüber nachdenkt. Ein Herz will nur alle möglichen Dinge, mit denen der Kopf nichts zu tun haben will.«
»Das stimmt.«
»Und mein Herz ist sich gerade jetzt nicht sicher, was es will. Es ringt.«
»Wirklich?«
»Tatsächlich möchte es zu gerne wissen, was dein Herz will.«
»Mein Herz«, sagte sie matt.
Ich musste fast über ihren Gesichtsausdruck lachen. »Del, was möchtest du tun?«
»Bis wir wissen ...«
»Nicht ›wir«‹, unterbrach ich sie. »Du.«
Sie wurde gereizt. »Was willst du von mir hören?«
»Nein, nein. Das ist es nicht, Bascha. Es geht hier darum, was du willst. Es geht nicht darum, was ich will oder was ich von dir hören will, sondern darum, was du selbst entscheiden musst.«
Del runzelte die Stirn. »Mit wem hast du gesprochen?«
»Willst du damit andeuten, dass mir solche Fragen nicht selbst einfallen können?«
»Der Kapitän«, sagte sie misstrauisch. »Ihr habt zusammen Wein getrunken und über ... mich gesprochen?«
»Wir haben über alles Mögliche gesprochen, der Kapitän und ich. Über Männer, Frauen, dich, mich, Nihko, Herakleio.« Ich machte eine Geste. »Sie erwähnte, dass ihr Seelenschwestern wärt.«
»In einigen Dingen ja. Wir glauben an die Wahlfreiheit, ungeachtet der Tatsache, ob man ein Mann oder eine Frau ist. An die Freiheit, unseren Herzen zu folgen.«
»Ja!« Ich nickte heftig. »Davon spreche ich. Und ich möchte wissen, was du erwählst. Was dein Herz will.«
Del betrachtete mich genau. »Hat Herakleio dir einen Schlag über den Kopf versetzt, als ich nicht hingeschaut habe?«
»Kannst du nicht einfach die Frage beantworten?«
Sie öffnete den Mund. Schloss ihn wieder. Sah mich stirnrunzelnd an und schwieg rebellisch.
»Del«, sagte ich sanft, »du bist jetzt anders.«
Ihr Gesicht wurde jäh hart. »Was meinst du?«
»Du bist nicht mehr dieselbe Frau, der ich vor drei Jahren begegnet bin.«
»Du bist auch nicht mehr derselbe Mann.«
»Aber wir sprechen nicht über mich.«
Sie erwog, nicht zu antworten. Tat es aber dennoch. »Ich fühle mich auch ... anders. Aber was meinst du damit?«
»Nicht mehr so getrieben.« Ich hob eine Hand. »Ich meine nicht, dass du verweichlicht bist, Bascha. Du kannst hart sein, wenn es nötig ist, wenn du es heraufbeschwörst ... Ich meine nur, du scheinst weniger ...« Ich zögerte und sagte es dann dennoch. »... besessen. Als du noch vor zwei Monaten warst.«
Del blickte ins Wasser. »Mein Gesang ist beendet.«
Das hatte der Kapitän gesagt. »Ganz?«
»Oh, es wird noch weitere Gesänge geben. Die unentdeckten, die entstehen, wenn wir weiterziehen. Aber ... was ich war, der Gesang, den ich all diese Jahre gesungen habe, während ich meinen Körper und Geist und mein Schwertkönnen schulte, ist beendet.«
»Und?«
»Und«, sagte sie, »ich lerne gerade, was ich sein soll. Wer ich sein soll.«
»Du bist du, Delilah. Immer.«
»Mehr«, sagte sie. »Und weniger. Tagesabhängig.«
»Heute?«
»Heute«, sagte sie schroff, »bin ich durch deine Stimmung ein wenig verwirrt.«
Ich grinste. Und dann fragte ich: »Warum kannst du Prima Rhannet gegenüber eingestehen, wie du dich fühlst und was du willst, aber mir gegenüber nicht?«
Sie errötete. Wenn sie zornig oder verlegen ist, verrät ihre helle Haut sie häufig, trotz ihrer sorgsamen Bemühungen, ihre Gefühle zu verbergen, damit niemand sonst sie erkennt.
Schließlich sagte Del: »Seelenschwestern.«
»Ist das etwas anderes, als Bettgefährten zu sein?«
»O ja«, antwortete sie sofort und so leichthin, dass ich wusste, dass es die ungeschminkte Wahrheit war. »Frauen können ... miteinander reden.«
»Und Männer und Frauen können das nicht? Ist es nicht ein wenig ungerecht, Frauen Dinge zu erzählen, die du Männern nicht erzählen würdest?«
»Erzählen Männer nicht auch Männern Dinge, die sie Frauen nicht erzählen würden?«
»Fast nie, Bascha. Aber das kommt daher, weil Männer miteinander ohnehin nicht so viel über ernste Dinge reden.«
Jetzt war sie verwirrt. »Warum?«
»Männer tun das einfach nicht.«
»Aber sie könnten es tun.«
»Natürlich könnten sie es tun. Sie tun es nur nicht.« Ich zuckte die Achseln. »Für gewöhnlich.«
»Manchmal?«
»Vielleicht ein wenig. Aber nicht sehr viel. Nicht sehr häufig.«
»Aber ... du sprichst mit mir, Tiger.«
Dieses Mal war es meine Wahrheit, die ebenso ungeschminkt klang. »Du erweckst in mir den Wunsch.«
Del verstand diese Wahrheit, das Gefühl, das sie hervorbrachte. Ich sah das rasch aufspringende Schimmern von Tränen in ihren Augen, obwohl sie hastig fortgeblinzelt wurden. »So sollte es sein«, sagte sie fest. »Zwischen Männern und Frauen. Immer die Wahrheit. Immer der Wunsch zu sagen, was das Herz bewegt.«
Ich stand jetzt an der Seite des Beckens, die Hände um den Steinrand gelegt. »Dann lass mich dir sagen, was mein Herz bewegt.«
»Warte ...«, platzte sie heraus, als hätte sie plötzlich Angst vor solcher Ehrlichkeit.
»Ich will dich bei mir haben«, sagte ich einfach, »wo auch immer ich hingehe. Aber nicht auf Kosten des Verlusts deiner Freiheit.«
»Tiger ...«
»Tu, was du tun möchtest. Geh, wohin du gehen möchtest. Sei, was du sein möchtest.«
»Bei dir«, sagte sie ruhig. »Bei dir, zu dir gehörig. So sehr, wie ich jemals etwas gewollt habe.«
Das war mehr, als ich von ihr zu hören erwartet hatte. Jemals. Es erschreckte mich. Erschütterte mich.
»Das«, sagte ich leichthin, unfähig, ihr zu zeigen, wie groß meine Erleichterung war, »klingt für mich nicht sehr praktisch.«
»Das Praktische hat nichts mit dem Herzen zu tun«, konterte sie erhaben und nahm das Holzschwert auf. Dels Augen strahlten, als sie es mir leicht auf den Kopf schlug. »Und jetzt wirst du mir erzählen, was das so ernste Gespräch bewirkt hat.«
»Herakleio.«
»Herakleio?«
»Und Eitelkeit. Alter.« Ich zuckte die Achseln, als sie die Klinge auf meine Schulter legte. »Ich sehe ihn an und sehe, was ich war. Und was ich niemals wieder sein kann.«
»Tiger, du bist doch wohl kaum alt!«
»Älter«, sagte ich. »In der Pferdesprache bin ich hart geritten und nass abgestellt worden.«
Del sah mir forschend ins Gesicht, in die Augen. Dann warf sie das Holzschwert mit einer fließenden Bewegung beiseite und streckte sich auf dem Stein aus, die Finger über den Beckenrand legend. Ich konnte ihren Atem auf meinem Gesicht spüren. »Ich werde dich hart reiten«, erklärte sie und zog sich von den Steinen in meine Arme.
Von der Luft gebauschte Leinenröcke trieben auf der Wasseroberfläche, erwiesen sich aber nicht als Hindernis.
Als Herakleio in den Baderaum kam, war Del – glücklicherweise – bereits gegangen. Ich war dem Becken entstiegen, aber noch nicht trocken, sondern tropfte auf den hellen Stein. Ich strich mir das Haar aus den Augen und hielt inne, als ich die Größe seines Interesses an meinem Körper bemerkte. Nachdem ich mit Prima Rhannet über solche Dinge gesprochen hatte, konnte ich nicht umhin zu fragen: »Würden Sie mir gern etwas sagen?«
Er reckte mit funkelnden Augen das Kinn. »Sie sagte, Sie hätten kein Keraka.«
Ich brauchte einen Augenblick, um das Wer und das Was zu verstehen: die Metri und ihre Betrachtung meiner Person in der ersten Nacht meiner Ankunft. »Nein, kein Keraka. Was auch immer dieses Keraka ist.«
»Wir haben es, jeder von uns.« Er hielt gezielt inne. Jene, die Stessoi sind, und jene, die von den Göttern abstammen. Es kommt von der Götter ...« Er hielt inne und übersetzte: »... Liebkosung, die uns vor der Geburt zuteil wird.«
Ich seufzte. »Herak, ich weiß nicht einmal, wie dieses Zeichen aussehen soll ...«
»Ein Fleck auf der Haut«, antwortete er. »Wie von altem Blut oder sehr altem Wein. Doch er lässt sich nicht entfernen.«
Ich grinste. »Nun, meine Haut ist viele Male mit Blut und mit Wein befleckt worden, aber beides hat sich immer entfernen lassen.« Ich beugte mich herab, um ein Handtuch zu ergreifen.
»Warten Sie.« Sein Tonfall klang barsch und erinnerte mich so sehr an die Salset, dass ich seinem Befehl folgte. Bevor ich die Reaktion verhindern konnte, war er schon neben mir. »Hier«, sagte er und zeigte die Rückseite seines linken Ellenbogens.
Es erinnerte tatsächlich an einen Fleck von Wein oder altem Blut. Rötlich wie eine frische Verletzung, von der Größe eines Daumennagels. Ein Keraka, eine ›Liebkosung‹ – was vermutlich eine ebenso gute Beschreibung wie alle anderen war.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Es muss nicht dort sein, wo meines ist, und muss auch nicht die gleiche Form haben.«
»Nein. Nichts. Nirgendwo.«
Triumph flackerte in seinen Augen auf. »Alle Stessoi haben es.«
»Dann bin ich vermutlich kein Stessa.« Ich hob das Handtuch auf.
»Warten Sie«, sagte er erneut.
»Ich habe genug vom Warten, Herak.«
»Sie sagte – sie sagte, es könnte sein, dass eine Narbe das Keraka entfernt habe.«
Ich schwieg und begann mich einfach abzutrocknen. Ich bin nicht prüde. Nacktheit stört mich nicht. Obwohl ich zugeben muss, dass mir solch genaue Prüfung nicht gefiel: von vorn, von hinten, von der Seite. Ich überlegte, ihm anzubieten, den Teil meines Körpers zu betrachten, den Männer über alle anderen schätzen, hielt mich aber zurück. Gleichgültig was Prima über seine Vorliebe für Frauen gesagt hatte, ich kannte Herakleio nicht. Er könnte es vielleicht tun.
Dann wandte sich Herakleio jäh um und ging davon. Blieb stehen und fuhr linkisch wieder herum. Ich war trocken. Hatte die weite Hose angezogen. Die Hälfte meines Körpers war bedeckt. Die andere Hälfte nicht. Er betrachtete erneut das dicke, faustgroße Narbengewebe, das die ausgehöhlte Haut unterhalb der Rippen auf der linken Seite meiner Brust umgab.
»Warum sind Sie nicht gestorben?«, fragte er.