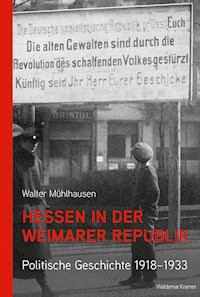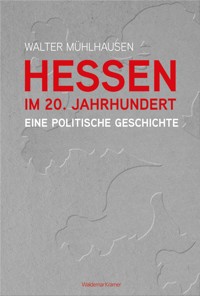
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Waldemar Kramer ein Imprint von Verlagshaus Römerweg
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es ist ein Pionierwerk, die Geschichte Hessens im 20. Jahrhundert. Denn Hessen, wie wir es heute kennen, ist erst 1945 entstanden. Ungeachtet der erst später erfolgenden Herausbildung der politischen Einheit ist es legitim, eine Geschichte des Landes vorzulegen, also für einen Raum, der integral zunächst gar nicht existierte. Denn es gab auch vor 1945 Gemeinsamkeiten in den seinerzeit durch politische Grenzen getrennten hessischen Gebieten, die über die Zeit hinwegstrahlten. Diese Geschichte ist auch eine Geschichte des Ringens um Demokratie. Walter Mühlhausens fundiert recherchierter Überblick, der kein wichtiges Ereignis auslässt, geht kritisch mit unreflektiert übernommenen Mythen der Geschichtsschreibung ins Gericht, präsentiert neue Erkenntnisse und schildert straff die politische Historie aller hessischen Gebiete mit den jeweiligen Unterschieden. Dabei stellt er die Besonderheiten des Raumes heraus, der sich immer durch eine starke demokratische Bewegung auszeichnete. Das Land nach 1945 war anders, wollte als progressiv gesehen werden, als Vorreiter und Vorzeigeland – »Hessen vorn«. Dem stand das Schlagwort von den »hessischen Verhältnissen« gegenüber, wo Politik stagniert oder gesellschaftliche Irrwege eingeschlagen werden. Hessens Weg zwischen dem Besonderen und der Normalität wird hier ausgewogen präsentiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1304
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kundgebung zum Ersten Mai 1952 in Frankfurt.
Walter Mühlhausen
HESSENIM 20. JAHRHUNDERT
Eine politische Geschichte
Prof. Dr. Walter Mühlhausen, geboren 1956 im nordhessischen Eichenberg, war bis März 2023 Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg. Er studierte Germanistik, Geschichte, Politik und Pädagogik und promovierte in Kassel. Er lehrt als apl. Professor an der TU Darmstadt, wo er sich 2006 habilitierte. Er ist u. a. Mitglied der Kommission für Politische und Parlamentarische Geschichte des Landes Hessen beim Hessischen Landtag, der Hessischen Historischen Kommission (Darmstadt), der Historischen Kommission für Nassau (Wiesbaden) und der Historischen Kommission für Hessen (Marburg).
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Eine Geschichte Hessens im 20. Jahrhundert
1. Von der Jahrhundertwende zur Revolution 1918
1.1. Prolog: Hessen an der Schwelle zum 20. Jahrhundert – eine Bestandsaufnahme
Grundlegendes zu Politik und Territorium
Über politische Kultur und Verfasstheit
Von Wahlen, Wählern und Gewählten
Moderne Zeiten jenseits von Politik
1.2. Zwischen Reform und Verharren – bis zum Ersten Weltkrieg
Von Trägern und Gegnern des Obrigkeitsstaates
Wahlpolitische Kontinuitäten und Diskontinuitäten
1.3. Heimatfront – der lange Schatten des Ersten Weltkrieges
August 1914 zwischen Enthusiasmus und Besorgnis
Kriegsalltag: Entbehrung und Vorahnung
Politik zwischen Verharren und Vorwärts
Verspäteter Reformwille
2. Demokratischer Anker in unsicherer Republik (1918–1933)
2.1. Zwischen Neuanfang und Kontinuität
Revolutionäre Morgenröte
Kooperation und Konfrontation
Auftakt in die Demokratie
Von den Frauen in der Republik
2.2. Grundlagen und Belastungen
Territoriale Planspiele
Verfassungsrechtliche Unterbauten
Über die Republik – Anhänger und Widersacher
Außenpolitisches mit Innenwirkung
2.3. Republikanische Bastionen
Standhaftigkeit und Konsequenz
Risse im republikanischen Fundament
2.4. Republik im Überlebenskampf
Vom Aufstieg der Demokratiegegner
Brandbeschleuniger Wirtschaftskrise
Der gelähmte Parlamentarismus
3. Zeiten der Unmenschlichkeit (1933–1945)
3.1. Auf- und Ausbau der Diktatur
Die Zerstörung der Republik
Stationen der Machteroberung
Erste Verfolgungen
Gleichschaltung jenseits der Amtsstuben
Rivalitäten unter Diktatoren
3.2. Ausgrenzung und Rassenwahn
Gegen das »Undeutsche«
Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bürger
Verbrechen gegen Sinti und Roma, Euthanasie-Morde und Verfolgung weiterer Minderheiten
3.3. Verfolgung und Widerstand Andersdenkender
Repression und Flucht
Von Opposition, Verweigerung und Resistenz
3.4. Kriegsvorbereitungen und Kriegsgesellschaft
Auf dem Weg in den zweiten Krieg
Alltag in der Extremsituation
4. Besatzungszeit und Wiederaufbau (1945–1950)
4.1. Demokratiegründung unter amerikanischem Schutzschirm
Befreiung, Besetzung und Neubeginn
Ein Land, eine Hauptstadt, eine Regierung
Demokratische Organisationen und Reorganisation
Stufen des Demokratieaufbaus
4.2. Weichenstellungen im Zeichen von Kriegsfolgelasten und Weststaatgründung
Notlagen und Hoffnungen
Sühne und Wiedergutmachung
Reformwille und Gegenkräfte
Hessen und der Weg in den Weststaat
5. Das sozialdemokratische Musterland (1951–1969)
5.1. Vom »roten« Hessen
Parteien, Koalitionen und eine Person
»Hessen vorn« – Pragmatismus und Realismus
5.2. Markenzeichen des Modells
Zwischen Landesinteresse und Bundestreue
Reformen von Schule und Dorfleben
Von Integration und Identität
Allgemeines und Besonderes
»68« – Zwischen Fakt und Mystifikation
Das Ende einer Ära
6. Wechselspiele: Normalität und Stabilität (1969–2000)
6.1. Bewegung und Bewegungen – Vom Drei- zum Vierparteiensystem
Veränderte Lebenswelten
Wandlungen von Wählerschaft und Milieus
Konsolidierung und Neujustierung
Eine außerparlamentarische Bewegung und eine neue Partei
6.2. Konstante Inkonstanz zum Ende des Jahrhunderts
Bürgerliches Zwischenspiel
Experimentlose Normalität
Zuspitzungen und Machtkämpfe
6.3. Epilog: Hessen nach der Jahrtausendwende – ein Ausblick mit Rückblick
Tendenzen der Politik im 21. Jahrhundert
Ein kurzer Schluss: Ein Jahrhundert hessischer Geschichte zwischen Besonderheit und Normalität
Anmerkungen
Abkürzungen
Literaturverzeichnis
Personenregister
Ortsregister
Bildnachweis
Vorwort
Die vorliegende Studie stellt gewissermaßen den Endpunkt meiner hessischen Forschungen seit den Tagen der Promotion dar. Zu danken habe ich vielen, die sich in hessischer Geschichte bestens auskennen: Friedrich Battenberg, Heike Drummer, Ulrich Eisenbach, Udo Engbring-Romang, Georg D. Falk, Markus Häfner, Martin Hoppe, Zoë Felder, Nadine Freund, Melanie Hanel, Irene Jung, Gunnar Richter, Hans-Georg Ruppel, Werner Schmachtenberg, Axel Ulrich, Christina Vanja, Thomas Weichel, Kerstin Wolff und Stephanie Zibell. Sie haben Teile kritisch gegengelesen und mit konstruktiven Hinweisen das Manuskript zum Besseren befördert. Dank schulde ich den aufgrund ihrer Vielzahl namentlich nicht zu nennenden studentischen Hilfskräften bei der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg, die über die Jahre hinweg immer wieder die diversen Fassungen Korrektur gelesen und mich bei den Recherchen unterstützt haben. Daneben habe ich von zahlreichen weiteren Privatpersonen, Archiven, wissenschaftlichen Institutionen, Bildarchiven und lokalen Geschichtsvereinen wertvolle Unterstützung erfahren. Das war wohltuend. So konnte mit der Hilfe vieler Archive und Privatpersonen Hessen regional (einigermaßen zumindest) visuell abgebildet werden.
Am Ende des Anfangs steht der tief empfundene Dank an meine Familie, an Julia und Marius, an Lucie und Matthias, zuvorderst an meine Frau Iris – ihr vor allem für ihre Nachsicht, dass ich mich immer wieder an den Schreibtisch zurückziehen und in die hessische Geschichte eintauchen konnte. Danke, nicht nur dafür. Und da sind dann noch die umwerfenden Ida, Tim, Nora und Max. Sie machen es mir leicht, mich künftig auf einem gänzlich anderen Terrain auszutoben. Ihnen allen sei der Band gewidmet.
Neckarsteinach, im November 2022
Walter Mühlhausen
Die hessischen Gebiete im Zeitraum von 1918 bis 1933.
Einleitung:Eine Geschichte Hessens im 20. Jahrhundert
»Es ist keine Frage: der Hesse von heute hat ein Staatsbewusstsein. Es ist ein Staatsbewusstsein, das aus dem Zusammenschluss der Waldecker, der Kurhessen, der Nassauer, der Darmstädter Hessen und der Bürger der freien Reichsstadt Frankfurt entstand und vom Geiste der Toleranz, der Geistesfreiheit und des Bürgerstolzes getragen wurde. Toleranz, Geistesfreiheit und Bürgerstolz sind die Charaktermerkmale der Hessen. Sie haben sie immer wieder unter Beweis gestellt, angefangen von der Aufnahme der wegen ihres Glaubens verfolgten und außer Landes gewiesenen Hugenotten bis zur Eingliederung der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge in unseren Tagen.«1 Mit diesen Worten auf dem ersten Hessentag am 2. Juli 1961 in Alsfeld umriss Ministerpräsident Georg August Zinn (SPD) das sich nach dem Zweiten Weltkrieg insgesamt doch herausbildende gesamt-hessische Bewusstsein, obwohl das Land erst am 19. September 1945 durch einen Verwaltungsakt der Amerikaner gebildet worden war. Dabei verliefen Gründung und Festigung des neuen Landes ohne Spannungen zwischen den Regionen, die eben keine gemeinsame politische Geschichte hatten. Unterschiedliche landsmannschaftliche Traditionen flossen ineinander, die so fremd sich nicht waren, sieht man einmal von dem großen Kontingent an Neubürgern ab, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge von Flucht und Vertreibung in die hessischen Lande strömten und in einem langwierigen, mitunter schmerzvollen Prozess ein neues Zuhause fanden. Gleichwohl, so analysierte die Wochenzeitung Die Zeit 20 Jahre nach der Premiere des Hessentags, sei das hessische Staatsbewusstsein ein »Konglomerat historisch und konfessionell unterschiedlich geprägter Teile«. Historische Traditionen und regionale Identitäten erweisen sich als fest implementiert. So schreibt die Zeit weiter: »Da gibt es nicht nur Nord- und Südhessen.«2 Also entwickelte sich etwas »Gesamthessisches« nur ganz allmählich.
Obwohl letztlich die Amerikaner die Geburtshelfer des heutigen Hessen waren, so standen doch die Hessen als Eltern und Paten an der Wiege des neuen Landes, dessen nach dem Krieg zusammengefügte Territorien gemeinsame historische Traditions- und Entwicklungslinien vorweisen konnten, sodass der Zusammenschluss von 1945 in gewisser Weise zu Formen eines Zusammengehörigkeitsgefühls führte, trotz unterschiedlicher historischer Wurzeln und unterschiedlicher Identitäten der Räume. Dabei existiert ein »Historikerstreit« en miniature, ob Hessens Gründung im ersten Nachkriegsjahr eine künstliche Schöpfung der amerikanischen Sieger, ja gar ein »ahistorischer Willkürakt einer landesunkundigen Besatzungsmacht« oder im Gegenteil die »nachvollziehbare Vollendung einer historischen Tradition« gewesen sei.3 Hier nur so viel: »Separatistische« oder sich dem Gesamthessischen vehement verweigernde Bewegungen kamen nicht auf, auch wenn das Land eine Zusammenfügung unterschiedlicher Territorien war und dabei noch um wesentliche Teile (das volksstaatliche Rheinhessen und vier nassauische Kreise) beschnitten wurde. Aber: Keineswegs erweist »sich die moderne Forschung einig, dass es sich dabei um eine ›Kunstschöpfung der amerikanischen Besatzungsmacht handelte‹«, wie 2010 konstatiert wurde.4
Ungeachtet der erst später erfolgenden Herausbildung der politischen Einheit Hessen ist es legitim, eine Geschichte Hessens für das 20. Jahrhundert vorzulegen, die den territorialen Rahmen des heutigen Landes als Betrachtungsgegenstand nimmt. Es gab auch vor 1945 Gemeinsamkeiten und Verbindungslinien in den seinerzeit durch politische Grenzen getrennten hessischen Gebieten. So handelt es sich bei der vorliegenden Darstellung also um eine Geschichte eines Raumes, der als Einheit zunächst gar nicht existierte. Bislang wurden immer die unterschiedlichen Territorien einzeln behandelt. Karl E. Demandt tut dies in seiner großen Geschichte Hessens5 wie auch Uwe Schultz und Walter Heinemeyer in ihren Sammelbänden der 1980er-Jahre.6 Auch das umfassende Projekt »Handbuch der hessischen Geschichte« bringt zum Auftakt neben den bis 1945 reichenden weiten Überblicken zur preußischen Provinz Hessen-Nassau und zum Großherzogtum bzw. Volksstaat Hessen – im Folgenden wird beides zur Verdeutlichung zumeist mit dem Zusatz (-Darmstadt) versehen – auch ein eigenes Kapitel über Waldeck bis zum eigenstaatlichen Ende 1929.7
Man wird also zunächst nicht von der hessischen Politik sprechen können, zumindest nicht bis zum Jahr 1933, als mit der nationalsozialistischen Diktatur über Zentralisierung und Gleichschaltung Nivellierungen spürbar wurden, welche die politischen Unterschiede verwischten.8 In der Fortsetzung des Handbuches der hessischen Geschichte von 2010 wird nunmehr – jedenfalls da, wo es sich anbietet und es möglich ist – die gesamthessische Perspektive eingenommen.9 Dieser Blick auf das Hessen in seinen 1945 festgelegten Grenzen liegt auch hier zugrunde. »Hessen« bezieht sich also folglich auf das Land in seinem heutigen Staatsgebiet, was freilich nicht stringent eingehalten werden kann. Das Gemeinsame und das Verschiedenartige der Territorien wird beschrieben, ohne dass eine künstliche Vereinheitlichung kreiert wird.10 Es geht eben um die Einheit aus der Vielfalt – um den Titel einer 1990 begründeten kleinen Reihe der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung aufzugreifen –, aber auch um die Vielfalt vor der Einheit.11
Dennoch gilt: Es ist nicht die Geschichte des heutigen Landes im 20. Jahrhundert, sondern es ist eine Geschichte Hessens über diese Zeitspanne, denn auf rund 650 Seiten kann der politische Weg nicht in aller Breite aufgezeichnet werden, zumal der Historiker immer eine individuelle Sicht auf die Ereignisse hat. Mathematische Eindeutigkeit gehört nicht zu den Kennzeichen der Geschichtswissenschaft. Ewige historische Wahrheiten jenseits des bloßen Faktischen gibt es nicht; Kenntnisstand und Blickwinkel der Betrachtung verändern sich. Gleichwohl bemüht sich eine historische Darstellung, mit der ihr eigenen Interpretation von Vergangenheit(en) der tatsächlichen Entwicklung möglichst nahe zu kommen.
Das geschieht hier in unterschiedlicher Dichte. So fällt das Kapitel 1945 bis 1950 im Vergleich zu den zeitlich längeren anderen Perioden naturgemäß ausführlicher aus, wurde doch in dieser Periode der Grundstein für eine dauerhafte Demokratie gelegt, und zwar in einer Zeit der Trümmer, nicht nur in (städte-)baulicher Hinsicht, sondern auch in politischer, wirtschaftlicher, sozialer, gesellschaftlicher und mentaler. Umso mehr bedarf es der ausführlichen Schilderung, warum auf diesen Trümmern die Pfeiler für eine stabile und seit mehr als einem Dreivierteljahrhundert funktionierende Demokratie errichtet werden konnten. Die Betrachtung der 14 Jahre der ersten Republik ist im Vergleich zu jener der nachfolgenden zwölfjährigen Diktatur signifikant umfangreicher. Das liegt zum einen daran, dass der hessische Raum in der nationalsozialistischen Zeit die weitgehend gleichen Entwicklungen wie die in den anderen größeren Verwaltungseinheiten jenseits des Hessischen durchlief, zum anderen, und dies ganz entscheidend, weil in der Terrorherrschaft die wesentlichen Elemente von demokratischer Politik fehlten: Wahlen und Wahlkämpfe, Parteien und Interessengruppen, Kompromiss und Konfrontation im Parlamentarismus auf der Basis des Volkswillens. Dagegen verlangt die Betrachtung der Diktatur eine eingehende Analyse von Leben und Lebensverhältnissen, vor allem des Unmenschlichen, das sich im Hessischen wie andernorts auch manifestierte.
Periphere Einzelaspekte wie etwa die Zuwanderung werden nicht der Zeit entsprechend in den chronologisch geordneten Großkapiteln zu finden sein, sondern dort in Gänze abgehandelt, wo sie erstmals in Erscheinung treten, um dann bis zum Ende unseres Betrachtungszeitraums beschrieben zu werden. Andererseits werden immer wieder auftauchende Themen wie die Stellung der Frau und Frauenpolitik auch über den Zeitrahmen des Einzelkapitels hinaus bis hin zu einer Zäsur dargelegt. Und je mehr wir uns dem Jahr 2000 nähern, desto dünner in Aussage und Analyse wird die Darstellung, denn die Zahl der historischen Studien, auf die zurückgegriffen werden kann, ist wesentlich geringer als für die davorliegenden Zeiträume. Neben dem Mangel an diesbezüglicher Literatur spielt natürlich auch die begrenzte Verfügbarkeit von Quellen eine Rolle. Diese unterliegen teils noch der Sperrfrist und dürfen weder eingesehen noch publik gemacht werden. Dort, wo die Quellen noch unter Verschluss liegen, übt sich der Historiker in vorsichtiger Zurückhaltung. Das gilt auch für diesen Band und erklärt den doch eher kursorischen Blick auf die Endzeit des 20. Jahrhunderts – und darüber hinaus. Zudem waren die Entwicklungen in den Krisenzeiten etwa in der ersten Republik viel dramatischer und stärker von Wendungen geprägt als in den doch eher geruhsamen bundesrepublikanischen Jahrzehnten.
Dabei geht es hier in erster Linie um die politische Geschichte. Markante Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft finden nur insofern Eingang, als sie Politik verständlich machen, weil sie diese herausforderten, oder aber andersherum von Landespolitik wesentlich geprägt oder gar gezielt gesteuert wurden. Die Darstellung ist eine primär staatspolitisch konzipierte Arbeit, eine traditionell historiografische und zeitgeschichtliche Studie. Die vor einiger Zeit aus sozialgeschichtlicher Perspektive eröffnete Diskussion um die Periodisierung, die die überwundene Kontroverse um Neuordnung und Restauration ablöste, schlägt sich hier insofern nur bedingt nieder, als längerfristige Trends und Kontinuitäten der Gesellschaftsgeschichte festzumachen sind.
So betont die sozialgeschichtlich orientierte Forschung die Kontinuitäten, welche die Zäsuren von 1918 und 1945 überdauerten, und hält zu Recht fest, dass die Gesellschaftsgeschichte nicht synchron mit der politischen Geschichte verlief, dass politischer Kontinuitätsbruch und sozialpsychologische Stetigkeiten eben nebeneinander bestanden. Gerade die Wahlforschung hat in der Betonung der Einstellungen, die die politischen Umbrüche von 1918, 1933 und 1945 überlebten, beachtliche Beiträge zur Frage der Kontinuität vorgelegt. Wir bewegen uns also im Kernbereich der politischen Geschichte, in dem es um Parlamentarismus und parlamentarische Praxis, um Ausformung und Prägekräfte der Demokratie, um Wahlen12 und Regierungen geht, somit um die von jeher klassischen Felder dieser Sparte.
Die politische Kultur – definiert als Summe von Orientierungsparametern, also etwa Meinungen, Einstellungen, Wertvorstellungen, darüber hinaus auch als der Zusammenhang von Mentalitäten, Denkgewohnheiten, Traditionen und Weltbildelementen – kann nur grob rekonstruiert werden. Die moderne Sozialgeschichte und ihr Segment »Alltag und Alltägliches«, im Zentrum die Lebensverhältnisse der Bevölkerung bzw. einzelner Gruppen, werden nur gestreift, sofern sie bedeutsam für das Verständnis von Politik sind.
Dies ist also nur einer von möglichen zahlreichen Wegen, die politische Geschichte Hessens im 20. Jahrhundert zu ergründen, das als »Zeitalter der Extreme« bezeichnet worden ist. Sie wird angereichert mit Seitenblicken auf zentrale soziale, ökonomische und gesellschaftliche Tendenzen sowie deren Interdependenzen zur Politik. Geschichte wird hier mitunter erzählerisch präsentiert, dabei das einzelne Schicksal oder das singuläre Ereignis als exemplarisch oder aber als exzeptionell geschildert. Diese werden immer eingebettet in die Strukturen. Es bleibt unvermeidlich, dass hier vieles übergangen werden musste, Thematisches wie auch Geografisches. Die Auswahl der Themenbereiche bleibt eine subjektive, wobei der Autor sich immer bewusst ist, dass einiges von Interesse dem Gesamtkonzept geopfert werden musste.
Gewiss werden einige die Erwähnung von Heimatort oder Heimatregion vermissen, obwohl auch hierzu Studien vorliegen, die ebenso das Recht der Erwähnung gehabt hätten. Zahlreiche Autoren und Autorinnen, die für die Geschichte des lokalen Raums Großes geleistet haben, werden ihre Werke hier vergeblich suchen. Manche Betrachtung der spezifischen kleineren oder größeren Region hätte herangezogen und genannt werden können. Das aber wäre schlicht nicht leistbar gewesen. Gewiss: Die Geschichte Hessens ist letztlich auch die Summe lokaler und regionaler Entwicklungen. Doch kann sich die gesamthessische Perspektive, also der Blick von oben, dem Beispielhaften oder dem Prägenden im örtlichen und regionalen Raum nur vereinzelt widmen. Flächendeckende Vollständigkeit kann sie nicht erzielen. Sie kann nur punktuell Lokalgeschichte auffächern.
Lediglich sporadisch kann zudem das Verhältnis der Gliedstaaten zur Zentralgewalt geschildert werden. Das geschieht immer dann, wenn Dissonanzen die Landespolitik tangierten. Gerade die Dichotomie von SPD-geführter Landesregierung und CDU-dominierter Bundesregierung, jene markante Konstellation in der Ära Zinn (1951–1969), eröffnet ein interessantes Feld. Und noch ein weiterer Hinweis: Landesgeschichtsschreibung ist immer im Fluss, sodass das Projekt der hessischen Geschichte im 20. Jahrhundert stets unter Berücksichtigung neu erschienener Abhandlungen fortzuschreiben wäre. Aber irgendwann muss man bei einem gedruckten Werk einen Schlusspunkt setzen. Dieser ist hier, was die Literatur betrifft, im Wesentlichen der Jahreswechsel 2021/22.
Bei alledem bezieht die Darstellung Position. Das liegt in der Natur der Sache, wenn ein Einzelner Urheber ist, auch wenn der Autor für die Durchsicht von Teilen des Manuskripts, für Anregungen und Kritik vielen zu danken hat. Letztlich aber ist und bleibt er der Verantwortliche für das Dargebotene. Es bleibt seine Sicht auf die Zeitläufte. Ohnehin gibt es nicht die eine (einzige) historische Wahrheit, sondern eine ganze Fülle von Wahrheiten. Der redliche Historiker hat die Aufgabe, den Weg zum Verständnis des Vergangenen zu ebnen. Dabei fungiert er als Filter, immer im Bemühen, unter subjektivem Interesse möglichst Objektives zu liefern. So bleibt es die Hoffnung des Verfassers, das Interessanteste und Prägnanteste, das Entscheidende und Charakteristische aus der vielschichtigen und vielfältigen politischen Geschichte Hessens im 20. Jahrhundert extrahiert zu haben.
Die Geburtsurkunde des Landes Hessen: Proklamation der US-Militärregierung vom 19. September 1945.
Gekrönte Vettern motorisiert mit Tempo im neuen Jahrhundert, das ihr Ende als Regenten bringen wird: Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein (vorn l.) und Kaiser Wilhelm II., zugleich König von Preußen (im Fond l.) – zwei Monarchen, die die Zeitläufte in ihren Monarchien vor und nach der Jahrhundertwende prägen. Das Foto datiert vom 1905.
1. Von der Jahrhundertwende zur Revolution 1918
1.1. Prolog:Hessen an der Schwelle zum 20. Jahrhundert – eine Bestandsaufnahme
Grundlegendes zu Politik und Territorium
Zum Jahreswechsel 1899/1900 schreibt das bürgerliche Darmstädter Tagblatt von der »Wende des Jahrhunderts«. Rückschauend werden die letzten hundert Jahre als wesentlicher Fortschritt gesehen, in politischer Hinsicht mit der Etablierung einer »konstitutionellen Regierungsform«, auf sozialem Feld mit einer Hebung des Lebensstandards aller Schichten des Volkes, vor allem aber mit einem »riesenhaften Aufschwung der Technik«. Negativ werden ein »weit greifender Klassenhass« und ein »sich abstoßendes Parteiengezänk« mit unwürdigen Tumulten in den Parlamenten angeprangert. In die neue Epoche blickt das nationalliberale Blatt mit Zuversicht, getragen von der Hoffnung, dass nach dem »gewaltigen Jahrhundert der Technik« ein Jahrhundert des hohen »moralisch-geistigen Aufschwungs« folgen werde.1 Das 19. Jahrhundert ist eine Periode der Umwälzungen, des Aufbruchs und des Fortschritts gewesen, gesellschaftlich, politisch, kulturell, wirtschaftlich und wissenschaftlich.2
Überwiegend eine frohe Erwartung bestimmt das Bild beim Eintritt in das 20. Jahrhundert. Auch der 1900er Wein des Rheingaus verspricht ein guter Jahrgang zu werden.3 Vier Tage nach dem Jahreswechsel, am 4. Januar 1900, konstituiert sich im Rathaus von Kassel, das im letzten Friedensjahr 1913 mit Pomp seine Tausendjahrfeier begehen wird, die neu gewählte Stadtverordnetenversammlung. Zum ersten Mal gehören dem Kommunalparlament in der kurhessischen Metropole mit August Jordan und Gustav Garbe zwei Sozialdemokraten an, die sich trotz des erst zwei Jahre zuvor mit der neuen Städteordnung eingeführten Dreiklassenwahlrechts in den Stichwahlen Ende November 1899 in ihren Wahlkreisen durchgesetzt haben.4 Garbe, der in der Revolution 1918 in Kiel als Vorsitzender des Arbeiterrats eine Rolle spielen wird, leitet das Gewerkschaftskartell Kassels. Sind der Zeitungsartikel, der eine Zeit der moralischen und geistigen Weiterentwicklung heraufziehen sieht, und der Beginn der Legislaturperiode im Kasseler Stadtparlament mit Vertretern der organisierten Arbeiterbewegung wegweisend für das anbrechende Jahrhundert? Nur bedingt. Es wird insgesamt kein Millennium des stetigen moralisch-geistigen Aufschwungs. Prägend ist vielmehr, dass es eines mit einer von Deutschland ausgehenden Barbarei unvorstellbaren Ausmaßes sein wird. Die zum Ende des 19. Jahrhunderts hin immer drängender werdende soziale Frage entschärft sich im Laufe des kommenden Jahrhunderts wesentlich, doch die Fortführung der sozialen Verantwortlichkeit von Politik gerät immer wieder in wirtschaftlichen Krisen unter Druck.
Festumzug zur Tausendjahrfeier Kassels 1913.
Insgesamt wird es in Hessen ein weitgehend sozialdemokratisches Jahrhundert; nahezu exakt zwei Drittel der 100 Jahre stehen Sozialdemokraten als Ministerpräsidenten an der Spitze des Landes und der seiner Vorläufer. Nur fünf Jahre in den demokratischen Perioden der Landesgeschichte (1919–1933 und ab Ende 1946) stellt nicht die SPD den gewählten Regierungschef, und zwar von 1987 bis 1991, als der Christdemokrat Walter Wallmann das höchste Amt bekleidet, und ab 1999, als Roland Kochs Regierungszeit beginnt. Von 1898 bis 1930 ist die SPD wie im Reich so auch in Hessen nach der Stimmenzahl die stärkste Partei. Im demokratischen Hessen nach der Hitler-Diktatur erringt die SPD wieder diese führende Position, die sie bis 1978 verteidigen kann. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wechseln sich SPD und CDU als stärkste Parteien ab.
Wählerzuspruch bedeutet nicht sogleich politische Macht, schon gar nicht in der Monarchie. Der zu Beginn des Jahrhunderts bestehende monarchische Konstitutionalismus verweigert den Sozialdemokraten die verfassungsrechtliche Teilhabe an der Macht – bis 1918. An die Stelle der sich erst viel zu spät zu Reformen durchringenden Monarchie tritt die parlamentarische Demokratie. Die einstigen Reichsfeinde im Kaiserreich, die Sozialdemokraten, sind die Träger der Weimarer Republik: Im 1918/19 begründeten Volksstaat Hessen(-Darmstadt) regieren bis zum Ende der ersten Republik von der SPD geführte Koalitionen; das mächtige Preußen, in dem Hessen-Nassau eine Provinz bildet, formiert sich zu einer sozialdemokratisch-republikanischen Bastion, die allerdings am Ende der ersten Demokratie auf deutschem Boden zerschlagen werden wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich das durch amerikanische Verfügung im September 1945 gebildete geeinte Hessen unter Ministerpräsident Georg August Zinn (Amtszeit 1950–1969) zum sozialdemokratischen Musterland in der CDU-regierten Bonner Bundesrepublik. Aber das ändert sich im letzten Fünftel des 20. Jahrhunderts. Hessen wird »normal«, mit einer offenen Parteienlandschaft und wechselnden Regierungen, unter Verlust seiner bundesrepublikanischen Vorreiterrolle. Es wird zu einem Glied unter vielen der mit dem Anschluss der DDR größer gewordenen Bundesrepublik, eingebettet in eine enorm erweiterte Europäische Union, den Herausforderungen der Globalisierung ausgesetzt. In einer kleiner werdenden Welt verkleinert sich das Gewicht eines kleinen Bundeslandes dramatisch, sodass die Frage nach der Existenzberechtigung der auf alte dynastische Gliederungen und besatzungspolitische Interessen Rücksicht nehmenden Neugründungen nach dem Zweiten Weltkrieg – und Hessen, wie wir es heute kennen, ist eine solche Schöpfung des Moments – durchaus nicht unberechtigt ist.
Doch zurück zum Anfang. Der Beginn des 20. Jahrhunderts war ganz geprägt vom wilhelminischen Geist. Auch wenn sich nach der Reichsgründung von 1871 die Verfassungsrealität langsam zu ändern begann, blieb das Kaiserreich ein Obrigkeitsstaat mit dem Adel an der Spitze. Reich und Verfassung waren insgesamt doch eine »fürstliche Versicherungsanstalt gegen die Demokratie«, wie der aus Gießen stammende sozialdemokratische Parteiführer Wilhelm Liebknecht, der die ersten 20 Jahre seines Lebens in der oberhessischen Universitätsstadt verbracht hatte, die demokratische Unvollkommenheit des nicht mal 50 Jahre währenden Kaiserreichs schon vor dessen Gründung bei der Beratung der Bundesverfassung im Reichstag des Norddeutschen Bundes so treffend charakterisierte.5 Den politischen Kräften, die den Status quo entschieden verteidigten, standen ein aufstrebendes, in Teilen durchaus reformbereites und selbstbewusstes Bürgertum und eine ebenso Reformen einfordernde, stetig wachsende Arbeiterbewegung gegenüber, die beide sich in der Reichsgründungszeit auseinander dividierten und dann politisch jedoch nicht wieder annäherten, um den Beharrungswillen der alten aristokratischen Eliten in gemeinschaftlicher Aktion zu brechen. Gleichwohl erodierte mit der Parlamentarisierung im Zuge der Reichsgründung das politische Adelsprivileg. Ganz im Gegensatz zur politischen Versteinerung erfolgte eine Modernisierung; in vielen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft kam es zu einem kräftigen Schub nach vorn. In diesem Rahmen vollzog sich auch die Entwicklung im (heutigen) Hessen.
Das heutige Hessen bestand um 1900 aus vier unterschiedlichen Territorien: aus der zum dominierenden größten Flächenstaat Preußen gehörenden Provinz Hessen-Nassau mit der Hauptstadt Kassel, unterteilt in die Regierungsbezirke Kassel und Wiesbaden, daneben aus dem Großherzogtum Hessen(-Darmstadt) mit seinen drei Provinzen, den beiden rechtsrheinischen, durch eine Schiene Hessen-Nassaus getrennten Starkenburg und Oberhessen und dem linksrheinischen Rheinhessen, sowie dem halbsouveränen Fürstentum Waldeck-Pyrmont, seit 1893 regiert von Fürst Friedrich und aufgrund des Akzessionsvertrages von 1867 (1877 und 1887 verlängert) in preußischer Abhängigkeit.6 Nachfolgend entschied Preußen-Berlin über das Wohl und Wehe des fürstlichen Landes, installierte in Arolsen an der Spitze der Verwaltung einen Landesdirektor zur Umsetzung der Vorgaben und zur Wahrnehmung der vormals der landesherrlichen Regierung obliegenden Verantwortlichkeiten. Gegen den Landesdirektor besaß der Fürst ein Beanstandungsrecht. Zugleich sicherte Preußen die Funktionalität der Verwaltung über steigende Zuschüsse. Der Fürst wurde in seinen Kompetenzen begrenzt; das Bild von der Eigenständigkeit war nur noch Fassade.7 Wie Waldeck 1929, so kam 1932 der seit 1815 zur preußischen Rheinprovinz, hier dem Regierungsbezirk Koblenz zugehörige Kreis Wetzlar auch zu Hessen-Nassau. Die ehemalige Reichsstadt Wetzlar war im Zuge der Wiener Friedensverhandlungen dem Königreich Preußen zugeschlagen worden und blieb nach territorialen Verschiebungen im Gefolge des preußisch-österreichischen Krieges 1866 von nassauischen Gebieten umschlungen. Das sind im Wesentlichen die Teile, aus denen 1945 das Land Groß-Hessen geschaffen werden sollte, unter Verlust von Gebieten an die französische Zone und somit an das später gegründete Land Rheinland-Pfalz.
Über die Jahrhunderte hinweg war Hessen keine homogene Einheit gewesen, sondern ein »verwirrendes Mosaik an Kleinterritorien«, »ein territoriales Puzzlespiel irgendwelcher Herren«.8 Der historische Flickenteppich konsolidierte sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Zuge der napoleonischen Herrschaft, die für Hessen bedeutende Gebietsveränderungen brachte. Es entstanden erstmals größere Territorialstaaten. Nach Napoleons Niederlage und dem anschließenden Wiener Kongress 1814/15 gab es im Gebiet des heutigen Hessen sechs Gliedstaaten: das Kurfürstentum Hessen(-Kassel), das Großherzogtum Hessen(-Darmstadt), die Landgrafschaft Hessen-Homburg, das Herzogtum Nassau, das Fürstentum Waldeck-Pyrmont und die Freie Stadt Frankfurt, die »trotz aller Umwälzungen ihren reichsunmittelbaren Status bis 1866« halten konnte.9 In der Revolution von 1848 erklang der Ruf nach »Drei Hessen unter einem Hut« – und meinte damit Kurfürstentum Kassel, Großherzogtum Darmstadt und die kleine Landgrafschaft Homburg, nicht Nassau. Andere dachten großräumiger und ordneten Frankfurt und Nassau dazu. Eine in dieser Zeit in Darmstadt verbreitete Landkarte zeigte eben dieses geeinte Hessen, allerdings ohne die dem Großherzogtum Hessen(-Darmstadt) nach dem Wiener Kongress angegliederte linksrheinische Provinz Rheinhessen mit den Städten Mainz, Worms und Alzey.10 Das in dieser Karte umrissene Gebiet entsprach damit in etwa dem Territorium des 1945 begründeten Hessen. So fühlte sich »Hessen« immer als Region der Mitte mit Brückenfunktion, die der seit 1911 amtierende hessen-darmstädtische Gesandte beim Reich, Maximilian Freiherr von Biegeleben, im März 1919 vor dem Verfassungsausschuss der in Weimar tagenden Nationalversammlung einmal so definierte: »Hessen speziell ist ein Bindeglied zwischen Nord und Süd und hat die ihm daraus erwachsenden politischen Aufgaben stets erfüllt.«11 Das, was hier auf Hessen-Darmstadt in Kaiserreich und Weimarer Republik projiziert wurde, galt auch für das Selbstverständnis des geeinten Hessen nach 1945.
Die räumliche Gliederung der hessischen Territorien zu Beginn des 20. Jahrhunderts resultierte zuvorderst aus dem preußisch-österreichischen Krieg von 1866. Dort hatten sich Kurfürstentum Hessen und Herzogtum Nassau auf die Seite des letztlich unterlegenen Österreich geschlagen und die bis dahin Freie Stadt Frankfurt Österreich die Bundestreue gehalten. Kurhessen, Nassau und Frankfurt verloren ihre Existenz als souveräne Staaten und gingen mit der Landgrafschaft Hessen-Homburg, die nach dem Tod des letzten, kinderlos gebliebenen Landgrafen Ferdinand im März 1866 durch Erbvertrag soeben erst an das Großherzoglich Hessen-Darmstädtische Haus gefallen und in Personalunion mit dem Großherzogtum Hessen verbunden war12, in Preußen auf. Demgegenüber wurde durch den im September 1866 mit dem Königreich Preußen unterzeichneten Friedensvertrag das unterlegene Großherzogtum zwar territorial beschnitten – es verlor insbesondere die Kreise Biedenkopf und Vöhl sowie einen Teil des Kreises Gießen, erhielt aber auch neben dem kurhessischen Bad Nauheim einige enklavierte Orte13 – und musste zudem neben der Leistung von drei Millionen Gulden Kriegsentschädigung seinen Verzicht auf das soeben erst hinzugekommene Hessen-Homburg erklären, das von Preußen dauerhaft annektiert wurde. Das Großherzogtum behielt seine Selbstständigkeit, auch dank einer Drohung des Zaren Alexander II., Schwager des hessischen Großherzogs Ludwig III., gegenüber dem Preußenkönig Wilhelm I., bei einer Annexion russische Truppen in Ostpreußen einmarschieren zu lassen. So zog Hessen-Darmstadt schließlich als Bundesstaat in das 1871 gebildete Deutsche Reich ein. Seine nördlich des Mains gelegene Provinz Oberhessen wurde so »zu einer vorgelagerten Insel der süddeutschen Länder im preußischen Meer« – ein »bisschen verloren zwischen Rhein-Main und Kassel« liegend.14 Auch wenn Formationen der Hitler-Jugend im November 1933 in wildem Aktionismus preußisch-hessische Grenzpfähle niederrissen, so blieb die von einem jugendlichen Überschwang getragene Aktion ohne politische Folgen.15 Erst nach dem Zweiten Weltkrieg fielen die Schranken.
Es gibt sie also nicht, die eine hessische Politik, erst ab 1933 unter dem Nationalsozialismus setzte eine die Unterschiede einebnende Gleichschaltung über den hessischen Räumen ein. Darüber hinaus unterschieden sich die hessischen Gebiete insbesondere dadurch, dass das Großherzogtum eine eigene politische Einheit bildete, während Hessen-Nassau nur ein (kleiner) Teil des im Kaiserreich und in der ersten Republik dominierenden Flächenstaates Preußen war, also die zentralen politischen Entscheidungen in Berlin fielen und auf die Provinz wirkten. Durch Verordnung vom Februar 1867 wurden dort zwei Regierungsbezirke (Kassel und Wiesbaden) gebildet, die Ende 1868 zur neuen Provinz Hessen-Nassau unter einem Oberpräsidenten im Königreich Preußen vereinigt wurden.16 Die Exklaven Schmalkalden und Rinteln – der Kreis wurde 1905 umbenannt in Landkreis Grafschaft Schaumburg17 – gehörten weiterhin dazu, jedoch nur bis 1932 bzw. 1944. Kassel und Wiesbaden verloren ihre Funktionen als Residenzen deutscher Mittelstaaten und besaßen keine eigenständigen Regierungen mehr. Es gab ein Für und Wider zu diesen fundamentalen Änderungen, aber ein nennenswerter Widerstand gegen die Einverleibung war nicht zu vernehmen.18 Kassel tröstete es über den Statusverlust hinweg, dass man Sitz des Ober- und zugleich eines Regierungspräsidenten wurde. In der Provinz blieb der Raum für (Politik-)Gestaltung eng, die Handlungsmöglichkeiten für eine eigenständige, gar von der preußischen Zentrale abweichende Politik begrenzt. Das ist eine banale, aber für die folgende Darstellung zentrale Feststellung.
1886 wurde die Ordnung bestätigt: Unter dem preußischen Adler überlebte die Provinz nunmehr mit zwei (Bezirks-)Kommunalverbänden in Kassel und Wiesbaden, während der bisherige für Frankfurt aufgelöst wurde, in der überlieferten Struktur: Die (Bezirks-)Kommunallandtage erhielten eine veränderte Zusammensetzung. Das ständische Element wurde zurückgefahren. Die Vorsitzenden wurden nunmehr gewählt, nicht mehr vom König ernannt. Ausschlaggebend für die getrennte Existenz waren außer einem fehlenden Zusammengehörigkeitsgefühl von Nassauern und Kurhessen auch die ganz unterschiedlichen Ausgangslagen bei der Einverleibung in Preußen gewesen.19 Als gemeinsame Klammer – eher ein lockeres Dach über den Regierungsbezirken – wurde ein aus sämtlichen Vertretern beider Kommunallandtage beschickter Provinziallandtag geschaffen, gegen den Willen der nassauischen Vertreter im Abgeordnetenhaus von Preußen, die eine Kasseler Dominanz fürchteten und als Ziel eine eigene Provinz Nassau vor Augen hatten.
An der Spitze der Provinz stand der Oberpräsident als eigentlicher Repräsentant und ständiger Kommissar des Königs (und später der preußischen Staatsregierung), nicht als Regierender in der Provinz. Als »Statthalter« übte er die Gesamtaufsicht über die Behörden in der Provinz aus und nahm gewisse Aufgaben der Staatsregierung gegenüber den übrigen Behörden wahr, besaß aber keine Anordnungsbefugnis. Als Amtsperson verlor er im Bewusstsein der Bevölkerung an Bedeutung. Der Dualismus von Oberpräsident und Regierungspräsident, besonders wenn diese an einem Ort wie in Kassel saßen und später im demokratischem System zudem unterschiedlichen politischen Lagern angehörten, mochte sich mitunter als hemmend erweisen.20 Der Regierungspräsident als Leiter der wichtigsten Verwaltungsbehörde in der Mittelinstanz besaß umfassende Zuständigkeiten in der allgemeinen Landesverwaltung. Oberpräsident und Regierungspräsident, in der Kaiserzeit mit einem vermeintlich »unpolitischen« Amtsverständnis, aber gewiss mit konservativ-monarchistischem Weltbild, sollten zugleich »Brücke und Mittler« zwischen Provinz und Regierungsbezirk auf der einen und der Zentralregierung auf der anderen Seite sein.21 Das preußische Staatsministerium war vom König abhängig und nur ihm und nicht dem Parlament verantwortlich. Reformbestrebungen wurden bis zum Ende des Ersten Weltkrieges abgeblockt. In Nassau wurde 1867 eine neue Gliederung vorgenommen: Aus Amtsbezirken wurden zwölf Kreise, dann mit der neuen Kreisordnung zum 1. April 1886 18 Kreise (mit erheblichen Grenzverschiebungen), während im Kurhessischen die Kreiseinteilung wesentlich mit in die preußische Zeit genommen wurde und bis 1932 weitgehend so blieb. Die im Juni 1885 erlassene Kreisordnung für Hessen-Nassau erhöhte die Befugnisse der Kreistage. Der Landrat an der Spitze des Landkreises besaß eine Doppelfunktion, als Vorsitzender von Kreistag und Kreisausschuss war er Chef der Selbstverwaltung des Kreises und als Organ der preußischen Regierung der Leiter der allgemeinen Landesverwaltung.22
Das verhältnismäßig kleine Großherzogtum, gegliedert in die drei Provinzen Starkenburg, Oberhessen und Rheinhessen – in Größe, Kompetenzen und Aufgaben nicht mit den preußischen Pendants zu vergleichen23 –, war durch eine zweistufige Verwaltung, unter Verzicht auf Regierungsbezirke und einer Aufhebung von Finanz- und Steuermittelbehörden, gekennzeichnet. Bei der Einführung einer neuen Kreisordnung 1874 wurden aus den 19 Kreisen in Starkenburg und Oberhessen (also auf dem Gebiet, das heute zu Hessen gehört) 13 neue gebildet; Rheinhessen behielt seine fünf Kreise. Zugleich wurden die bisherigen, lediglich mit begrenzten Kompetenzen versehenen Bezirksräte durch Selbstverwaltungsorgane ersetzt.24 Das blieb so bis in die Zeit der Diktatur.
In den Kreisen lag die Verwaltungsleitung in den Händen von geschulten Laufbahnbeamten25, mit wenigen Ausnahmen durchweg Söhne des Landes. Demgegenüber kamen – in deutlichem Kontrast zu den großherzoglichen Karrieremustern – von den im Zeitraum von der Annexion 1868 bis zum Kriegsende 1918 ernannten Landräten im preußischen Regierungsbezirk Kassel lediglich 43 %, in dem von Wiesbaden gar nur 14 % aus dem eigenen Lande. Bemerkenswert ist dabei auch, dass von den Landräten in Kurhessen 60 % und in Nassau 45 % dem Adel entstammten26, von denen eine ganze Reihe nicht einmal eine juristische Ausbildung vorweisen konnte, was allgemein doch als Grundvoraussetzung für eine solch herausgehobene Verwaltungsposition erachtet wurde. Im Großherzogtum spielte der Anteil der Adligen in der inneren Verwaltung eine weitaus geringere Rolle. Erstaunlicherweise überstand eine Vielzahl von adligen Landräten den Systembruch von 1918/19 und versah weiter ihr Amt, nun in Diensten der Republik.
Söhne Hessens – oder zumindest Politiker mit Stationen im Hessischen – machten nach der Jahrhundertwende auch im Reich und in Preußen Karriere. Der gebürtige Darmstädter Bernhard Dernburg, Sohn des nationalliberalen hessischen Landtags- und Reichstagsabgeordneten und späteren Chefredakteurs des Berliner Tageblatts Friedrich Dernburg, stand von 1907 bis 1910 dem Reichskolonialamt vor. Zur gleichen Zeit leitete der aus Worms stammende Wilhelm von Schoen, 1885 in den hessischen Adelsstand gehoben, als Staatssekretär das Auswärtige Amt. 1916 trat der gebürtige Marburger Siegfried von Roedern das Amt des Staatssekretärs im Schatzamt an, das er bis zum Kriegsende innehaben sollte. Indirekt sein Nachfolger wurde dann im Februar 1919 Bernhard Dernburg, der als Mitbegründer der liberalen DDP im ersten Kabinett der Republik unter Philipp Scheidemann (SPD) als Reichsfinanzminister und Vizekanzler fungierte. Dass der kaiserliche Reichskanzler (1900–1909) Bernhard von Bülow in Frankfurt für einige Zeit die Schulbank gedrückt hatte, sei nur am Rande erwähnt.
Ein Blick ins Preußische: Bis 1901 amtierte der vormalige Frankfurter Oberbürgermeister Johannes von Miquel als preußischer Finanzminister, ernannt 1890. Eine Zeitlang Kabinettskollege als Justizminister (1894–1905) war Karl Heinrich (ab 1911: von) Schönstedt, der zuvor Richter in Frankfurt und Kassel gewesen war. Der auf dem nordhessischen Stammsitz geborene August von Trott zu Solz, nach Landratstätigkeiten in Höchst und Marburg Regierungspräsident in Kassel (1899–1905), fungierte von 1909 bis 1917 als preußischer Kultusminister und kehrte dann als Oberpräsident von Hessen-Nassau zurück nach Kassel.27 Nach 1900 bekleideten zwei gebürtige Kasselaner das Amt des preußischen Kriegsministers: zunächst Josias von Heeringen (1909–1913), Sohn des gleichnamigen kurhessischen Oberhofmarschalls, und mitten im Ersten Weltkrieg Adolf Wild von Hohenborn (1915/16), der schließlich Opfer seines Gegenspielers Paul von Hindenburg wurde.
Über politische Kultur und Verfasstheit
Für das Großherzogtum galt die Verfassung von 1820.28 Demnach setzten sich die Landstände (Landtag) aus zwei Kammern zusammen. Die Erste bestand aus erblichen (adligen) Vertretern, daneben weiteren, die kraft Amt einen Sitz hatten, sowie aus den vom Großherzog ernannten Mitgliedern. Die 50 Vertreter der Zweiten Kammer wurden in einem dreistufigen, später dann zweistufigen indirekten Verfahren gewählt. Nach einer Wahlreform in den 1870er-Jahren kamen zehn aus den größeren Städten, 40 aus den neu abgegrenzten ländlichen Wahlbezirken im gesamten Großherzogtum. Mit der Reform entfiel der Zensus in der ersten Stufe; zudem wurde die Steuerbarriere für Wahlmänner erheblich gesenkt (»Normalsteuerkapital von 40 Gulden«29). Das Wahlrecht war lediglich an die Zahlung der neuen Einkommenssteuer geknüpft. Zugleich wurde die mündliche Wahl durch Stimmzettelabgabe ersetzt. Die Hälfte des Parlaments, deren Mitglieder auf sechs Jahre zu wählen waren, wurde alle drei Jahre neu bestimmt. Das alles blieb Praxis bis zur Novellierung 1911.
Der Landtag besaß zwar Mitwirkungsrechte bei der Gesetzgebung und bei der Budgetbewilligung, aber die Gesetzesinitiative lag bei der großherzoglichen Regierung. Die beiden Kammern konnten nur über Petitionen die Regierung zum Gesetzeshandeln auffordern; das Großherzogtum war eben »eine konstitutionelle Monarchie, keine parlamentarische«30, in der der »Monarch stets das letzte Wort hatte«.31 Auf den seit 1877 amtierenden Großherzog Ludwig IV. von Hessen und bei Rhein, »vorrangig Offizier und leidenschaftlicher Jäger«, folgte nach seinem überraschenden Tod 1892 sein erst 23-jähriger Sohn Ernst Ludwig, ein Mann der schönen Künste. Er war nicht nur Förderer der Kultur, sondern schrieb selbst Gedichte und Dramen, spielte Theater und führte Regie.32 Das verfassungsrechtliche Gewicht lag eindeutig bei der vom Großherzog ernannten Regierung, dem »Gesamt-Ministerium« als Spitze der Verwaltung des Großherzogtums, wie es in der diesbezüglichen Verordnung von 1874 hieß. Seit 1898 leitete der Jurist Karl Rothe als Staatsminister die Regierung. Die Minister waren in Teilbereichen auf eine Zusammenarbeit mit der gewählten Volksvertretung angewiesen, nicht aber aus dieser erwachsen. Großherzog Ludwig IV. verkörperte den treuen Bundesfürsten, der sein Handeln an einem nationalliberalen Wertekanon ausrichtete, dabei seinem Ministerium doch weitgehend Freiraum ließ. Im Waldeckschen wurde der Landtag in indirekter Wahl nach dem Dreiklassenwahlrecht bestimmt. Eine Fraktionierung der Mandatsträger, ausschließlich bäuerliche und städtische Honoratioren, nach Parteien erfolgte nicht.33
Herrscher eines kleinen Fürstentums: Fürst Friedrich von Waldeck-Pyrmont mit seiner Ehefrau Bathildis und den Kindern Josias (3. v. l.), Max (r.), Helene und Georg Wilhelm (um 1910).
In politischer Hinsicht zeigte sich das Großherzogtum Hessen liberaler als Preußen. Gemeinhin kennzeichnete eine rigorose Politik gegenüber der aufstrebenden sozialistischen Arbeiterbewegung das Kaiserreich, die ihren sinnfälligen Ausdruck im reichsweiten »Sozialistengesetz« (1878–1890) fand. Das unaufhaltsame Anwachsen der Sozialdemokratie als einer höchst dynamischen, auf Veränderung drängenden Kraft resultierte aus der mit der Industrialisierung immer größer werdenden Industriearbeiterschaft.34 Denn das Kaiserreich erlebte eine wirtschaftliche Prosperität, die zur Herausbildung und stetigen Ausweitung der industriellen Produktion führte. Das Sozialistengesetz, mit dem Reichskanzler Otto von Bismarck die weithin als »gemeingefährlich« eingestuften Aktivitäten der Sozialdemokratie eindämmen wollte, erwies sich als glatter Fehlschlag, weil es die organisierte Arbeiterbewegung nicht niederhielt, sondern nur »nährte« und bei den Sozialdemokraten das Gefühl des Ausgestoßenen verfestigte. Das wiederum stärkte den Zusammenhalt innerhalb der Bewegung, denn der wegen sozialistischer Umtriebe aus seinem Heimatort Ausgewiesene und vom Arbeitgeber Entlassene fand Unterstützung bei den Genossen andernorts.35 Es entwickelte sich eine sozialdemokratische Wagenburgmentalität. Die verbotenen sozialdemokratischen Vereine konstituierten sich neu unter harmlosen Namen wie »Gemütlichkeit« (so in Marburg).
Im preußischen Hessen-Nassau wurde das Sozialistengesetz konsequent zur Verfolgung der Sozialdemokratie umgesetzt. Hier profilierte sich offensichtlich der Chef der königlichen Polizeidirektion von Kassel in besonderer Weise als Scharfmacher.36 Demgegenüber kam es im Großherzogtum nicht in solcher Schärfe zur Anwendung, wenngleich später, ab dem Wahlkampf 1884, auch dort unter dem Druck von Preußen gegen Ende des Gesetzes die Behörden stärker gegen die »Umsturzbewegung« vorgingen.37 Seit der Ermordung des Frankfurter Polizeirats Ludwig Rumpff im Januar 1885 durch einen Anarchisten wurden härtere Maßnahmen gegen die Sozialdemokratie erwogen, was dann im Dezember 1886 in den Kleinen Belagerungszustand mündete. Als dann einige der aus Frankfurt ausgewiesenen Sozialdemokraten – bis Ende 1887 sollten insgesamt 48 die Mainmetropole verlassen müssen – sich ins benachbarte großherzogliche Offenbach zurückzogen, ließ die Darmstädter Regierung, die sich bis dahin dem Drängen der preußischen Behörden auf ein gemeinsames Vorgehen widersetzt hatte, im Februar 1887 ebenfalls den Kleinen Belagerungszustand über den Kreis Offenbach verhängen. So mussten die aus Frankfurt Vertriebenen auch das großherzogliche Offenbach verlassen, darunter der sozialdemokratische Kopf Wilhelm Liebknecht.
Das Bild vom Repressionsstaat verfestigte sich zudem durch tragische Vorfälle: Bei einer Rangelei im Zuge einer polizeilichen Hausdurchsuchung in Frankfurt 1886 kam ein Mitglied des sozialdemokratischen Landagitationskomitees durch Sturz aus dem Fenster seiner Wohnung im vierten Stock zu Tode. Überzogene Maßnahmen sorgten auch bis weit ins Bürgertum für Unverständnis. Bei einer von einem 40-köpfigen Polizeiaufgebot überwachten Beerdigung eines sozialistischen Parteiwirts in Frankfurt im Sommer 1885 kam es zum Skandal: Nachdem ein Trauergast bei seiner kurzen Ansprache die allseits verbotene rote Schleife, ein Erkennungszeichen der sozialistischen Arbeiterbewegung, aus der Brusttasche hervorgeholt hatte, zog die Polizei blank, als ihre Aufforderung zum Auseinandergehen der Trauergemeinde nicht befolgt wurde. Resultat der sogenannten »Friedhofsschlacht«: 50 zumeist leicht Verletzte. Die Öffentlichkeit missbilligte das Vorgehen der Polizei, das die anti-preußischen Ressentiments am Main nährte, als »die Schmach Frankfurts« schlechthin.38
Auch nach Ablauf des Sozialistengesetzes 1890 wurde die Sozialdemokratie, für die nun eben nicht eine »Epoche völliger Freiheit« begann, überwacht, ausgegrenzt und verfolgt, wiederum im großherzoglichen Hessen gewiss mit geringerer Intensität als im benachbarten nassauischen und kurhessischen Preußen.39 Mit gutem Grund konnte der aus dem preußischen Kassel stammende Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, der einige Zeit auch im kurhessischen Marburg und im großherzoglichen Offenbach tätig gewesen war, in seinen Erinnerungen davon schreiben, dass Hessen(-Darmstadt) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das »freieste deutsche Land« im Reich gewesen sei.40 Ungeachtet solcher Feststellung: Nach dem Fall des Sozialistengesetzes suchten die Behörden weiterhin auf vielfältige Weise, die Sozialdemokratie einzudämmen, dabei gezielt die Stimmabgabe im Sinne der staatstragenden Vertreter zu beeinflussen. Doch insgesamt liefen die Wahlen korrekt ab; Manipulationen seitens des Staates wurden nicht registriert.41
Der Aufstieg der Sozialdemokratie bei den Wahlen war auf eine hohe agitatorische Präsenz zurückzuführen, wie die Behörden registrierten. So verteilten »junge, noch nicht wahlberechtigte Burschen«42 auch jenseits der Wahlkämpfe Flugblätter und Stimmzettel und trugen so zu einer nunmehr einsetzenden permanenten Politisierung des öffentlichen Raums bei. Die Partei widmete ihr Augenmerk nach Aufhebung des Sozialistengesetzes vor allem der Organisation der Presse43 und der weiteren Agitationsarbeit, Fragen, die den nach dem Fall des Sozialistengesetzes ersten Parteitag der SPD im Großherzogtum im November 1890 in Mainz und auch den ersten Parteitag der SPD von Nassau und Hessen(-Darmstadt) im Februar 1891 in Frankfurt dominierten.44 Das Programmatische oblag in erster Linie den Parteitagen auf Reichsebene. Nach dem Ende des Sozialistengesetzes dominierte nicht nur in Frankfurt der Reformismus45, der insgesamt im Hessischen bis zum Kriegsausbruch 1914 vorherrschte.
Die sozialistische Arbeiterbewegung wuchs nach Bismarcks Abgang 1890; sie gewann den Arbeiter gerade, weil er sich politisch, sozial und rechtlich in der SPD und den ihr nahen freien sozialistischen Gewerkschaften, der wichtigsten Vorfeldorganisation der Partei, vertreten fühlte. In den Städten schlossen sich die örtlichen Zahlstellen unterschiedlicher Gewerkschaften Ende der 1880er, aber vor allem zu Beginn der 1890er-Jahre zu mehr oder weniger lockeren Gewerkschaftskartellen oder Unterstützungsvereinen zusammen, um ihre Schlagkraft im Kampf gegen die Unternehmer zu bündeln.46 Die wachsende wirtschaftliche Macht der Gewerkschaften in den industriellen Ballungszentren fand Ausdruck in den Gewerkschaftshäusern, die in den Großstädten entstanden, wie 1901 in Frankfurt und 1907 in Darmstadt und in Wiesbaden. Allerdings kam das 1907 in Kassel eingeweihte Gewerkschaftshaus zwei Jahre später wegen Überschuldung zur Zwangsversteigerung.47 Der 1900 eingeweihte, durch Spenden der Arbeiterorganisationen finanzierte Saalbau in Offenbach, mit einem großen Versammlungssaal von bis zu 1 500 Sitzplätzen, entwickelte sich zu einem kulturellen Zentrum.48 Gewerkschaften bildeten die Stützen in den Arbeitskämpfen, die auch in Hessen um Lohn- und Arbeitsverbesserungen geführt wurden. Dort, wo die sozialistischen Gewerkschaften nicht Fuß fassen konnten, füllten die christlichen die Lücke wie im katholischen Fulda, wo sich die Arbeitnehmerorganisation auf christlicher Grundlage im Jahr 1900 bildete.49 Auf der anderen Seite formierte sich das Handwerk: Im Mai 1900 konstituierte sich in Darmstadt die Handwerkskammer des Großherzogtums – neben jenen in Kassel und Wiesbaden. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem Aus- und Fortbildung durch Lehrwerkstätten.
Neben der Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Löhnen standen die Gewerkschaften in Form von Auskunftsstellen dem einzelnen Arbeiter mit Rat und Tat zur Seite. Hieraus gingen gewerkschaftliche Arbeitersekretariate hervor. Ab 1899 öffneten in den größeren Städten derartige Hilfsbüros, in denen der Proletarier in allen juristischen Fragen, in erster Linie bezüglich der von Bismarck eingeführten Sozialversicherungsgesetze sowie bei Streitfällen vor den Gewerbegerichten, von geschulten hauptamtlichen Mitarbeitern – in der sozialistischen Bewegung »Volksjuristen«50 genannt – Unterstützung erhielt. Die anderen Orte folgten: 1910 gab es in Kassel, Frankfurt, Hanau, Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach (dazu im rheinhessischen Mainz und Worms) solche Sekretariate, von denen die Behörden befürchteten, sie könnten »weitere Arbeiter in das Netz der Sozialdemokraten« locken.51
Auch über die Arbeitskämpfe rekrutierten sozialistische Gewerkschaften und Partei neue Anhänger. Streiks konterten die Unternehmer, die sich örtlich – wie in Frankfurt die metallverarbeitenden Industrien – zu schlagkräftigen Vereinigungen zusammenschlossen, mit Aussperrung. So setzte der Frankfurter Verband der baugewerblichen Unternehmen im November 1899 etwa 1 200 Maurer auf die Straße.52 Bei einem Streik in einer Segeltuchfabrik in Kassel 1905 stellten die Unternehmer neue Arbeitskräfte von auswärts ein, sodass die Streikenden sich um die Möglichkeit einer Wiederbeschäftigung beraubt sahen. Einer der Streikenden schoss daraufhin auf zwei der neu Eingestellten und verletzte sie. Zwischen Streikenden und Streikbrechern waren – wie beim Ausstand der Kasseler Möbeltransportarbeiter 1913 – tätliche Auseinandersetzungen an der Tagesordnung. Andernorts führten Streiks zu raschen Erfolgen wie in den Gummiwerken Fulda im gleichen Jahr, wo eine geforderte 25-prozentige Lohnerhöhung für Überstunden nach nur einem Tag Ausstand von der Betriebsleitung bewilligt wurde.53
Nachwuchs für die Sozialdemokratie: die Industriearbeiterschaft – Belegschaft der Schlauch- und Reifenabteilung der in Frankfurt ansässigen Peters-Union Gummifabrik im Zweigwerk Korbach mit jugendlichen Arbeitern und Arbeiterinnen (um 1912).
Für die Zeit von 1899 bis 1913 wurden für das Territorium des heutigen Hessen insgesamt 1 220 Streiks und 174 Aussperrungen errechnet, wovon 134 000 Arbeitnehmer betroffen waren. Der jährliche Höchstwert mit 163 Streiks und zwölf Aussperrungen wurde für 1906 registriert, das Jahr mit der besonders geringen Arbeitslosigkeit. Mitte des Jahres 1895 hatte man in den heutigen Grenzen Hessens rund 9 100 Arbeitslose, darunter 2 200 Frauen, gezählt, Ende des Jahres, in einem milden Winter, 26 200, darunter 6 500 Frauen. Die Arbeitslosenquote betrug Mitte des Jahres 1,6 %, am Ende dann 4,6 %. Viele ohne Anstellung dürften sich nicht registriert haben, galt doch Arbeitslosigkeit als Makel.54 Also lag die Zahl doch wesentlich höher. Die Städte richteten Vermittlungsbüros ein; der erste »Arbeitsnachweis« öffnete 1894 in Frankfurt seine Tore. 1909 gab es im (heutigen) Hessen Einrichtungen dieser Art in Frankfurt, Kassel, Friedberg, Hanau, Weilburg, Gießen und Offenbach.55 Die gemeinnützigen Arbeitsnachweise, einige unter paritätischer Beteiligung von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden, schlossen sich – territoriale Grenzen überschreitend – für das Großherzogtum, für Hessen-Nassau und Waldeck sowie für weitere anrainende hessische Gebiete 1907 zum »Mitteldeutschen Arbeitsnachweisverband« zusammen, vor allem auch zur Regulierung des Ungleichgewichts zwischen Arbeiterüberschuss in den Städten und Arbeitermangel auf dem platten Land.56
Als starker Arm der Sozialdemokratie etablierte sich nach der Jahrhundertwende die proletarische Frauenbewegung, die für die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft – und in der Partei – stritt. Die SPD schrieb die Einführung des Frauenwahlrechts ganz oben auf ihre Fahnen und mobilisierte für entsprechende Kundgebungen eine stattliche Anzahl von Personen »beiderlei Geschlechts«, wie in Kassel 1912 um die 1 500 Köpfe.57 Politisch durften sich die Frauen in Preußen zunächst nicht organisieren, da dies ein restriktives Vereinsgesetz untersagte. Als um 1900 diese Regelungen nicht mehr konsequent umgesetzt wurden, entstand 1902 in Frankfurt ein sich nach außen hin unpolitisch gebender »Bildungsverein für Frauen und Mädchen der Arbeiterklasse«, deren Mitgliederzahl im ersten Jahr etwa 120 betrug. Es ging ihm vor allen Dingen um den Zugang des weiblichen Geschlechts zur höheren Bildung. Nach einer Liberalisierung des Vereinsgesetzes 1908, das auch den Frauen die Mitgliedschaft in Parteien erlaubte, traten die 514 Mitglieder des Bildungsvereins der SPD bei.58
Auch die bürgerliche Frauenbewegung wuchs. Dabei ging es zuvorderst um die Bildung: 1869 gründete sich der »Casseler Frauenbildungsverein«; es folgten weitere wie in Frankfurt einige Jahre später oder aber erst nach der Jahrhundertwende wie in Gießen.59 Konfessionelle Vereine kamen hinzu. So formierte sich in Kassel auf dem Evangelischen Kirchentag im Juni 1899 mit dem Deutsch-Evangelischen Frauenbund die erste Gruppierung mit eigenständiger Organisation innerhalb der konfessionellen Frauenbewegung. Der Bund erklärte sich zur Bewahrerin der politischen Ordnung. Bis 1901 mit Sitz in Kassel, setzte er sich für Mädchenbildung und bessere Arbeitsbedingungen für Frauen ein, sprach sich aber gegen das Frauenwahlrecht aus und erklärte das Thema Gleichberechtigung zur Privatsache von Mann und Frau. 1904 rief Bertha Pappenheim in Frankfurt als Zusammenfassung jüdischer Wohlfahrtsvereine den »Jüdischen Frauenbund« ins Leben.60 In Kassel schlossen sich 1902 verschiedene örtliche Frauenvereine, darunter der 1869 gegründete »Casseler Frauenbildungsverein« und der im gleichen Jahr entstandene »Vaterländische Frauenverein«, zum »Verband Casseler Frauenvereine« zusammen. Kassel verzeichnete 1910 mit 62 Frauenvereinen und insgesamt 8 500 Mitgliedern (bei 153 000 Einwohner:innen) einen proportional äußerst hohen Organisationsgrad von Frauen in den deutschen Städten. Etwa zur gleichen Zeit konsolidierte sich auch in der preußischen Provinz der »Verein für das Frauenstimmrecht«.61 1907 organisierte der liberal-bürgerliche »Frankfurter Verband für das Frauenstimmrecht« eine Generalversammlung für ganz Deutschland in der Mainmetropole. Im gleichen Jahr fand ein Kongress für die höhere Frauenbildung in Kassel statt, wo sich der Verein »Frauenbildung – Frauenstudium« für eine Verbesserung der Bildungschancen für Frauen einsetzte. Auch die Ausbildung der Grundschullehrerinnen wurde gestärkt; 1902 eröffnete im Darmstädter Stadtteil Bessungen das Seminar für Elementarlehrerinnen, deren erste Absolventinnen drei Jahre später an die Volksschule gingen.
Die Mädchenschulreformen in Preußen (1908) und in Hessen (1909) waren wichtige Etappen auf dem Weg zur Erweiterung der Bildungsmöglichkeiten von Mädchen, die zur Öffnung der Universitäten für das weibliche Geschlecht führten. Die Etablierung höherer Mädchenschulen in Preußen lag auch in der Tatsache begründet, dass dort die Koedukation offiziell nicht erlaubt war. Fortschrittlicher ging es da im Großherzogtum zu, wo Mädchen zu höheren Knabenschulen zugelassen waren und dort auch das Abitur ablegen konnten.62 1906/07 durfte erstmals ein Gießener Mädchen zur Knabenschule wechseln, um sich auf die Reifeprüfung vorzubereiten. Ab 1909 geschah dies dann ohne Sondergenehmigung. Da das Abitur aber Grundvoraussetzung für die Aufnahme eines Studiums war, waren es zunächst Ausländerinnen, vornehmlich Russinnen, die nach der 1908 verfügten Zulassung von Frauen zum Studium – zuvor hatten sie als Hospitantinnen die Hochschule besuchen können – mit einer Sondergenehmigung ihren wissenschaftlichen Weg mit einer Promotion vollendeten. Die erste, die 1904 in Gießen einen Doktorgrad erwarb, stammte aus Russland, die erste Deutsche 1908 aus Preußen. Ab dem Wintersemester 1908/09 konnten Frauen nicht mehr nur als Hörerinnen, sondern als regelrecht Studierende die Marburger Universität besuchen. Im ersten Semester zählte man 27; bis zum Ersten Weltkrieg stieg die Zahl auf 206.
Am Vorabend des Ersten Weltkrieges, im Sommersemester 1914, gab es an der Universität Gießen 32 Studentinnen (Anteil von 2,2 % an den Studierenden), davon kamen acht aus Russland, die bei Kriegsausbruch ausgeschlossen wurden; 15 waren Landeskinder des Großherzogtums.63 Im Oktober 1908 schrieb sich an der Technischen Hochschule die erste Architekturstudentin ein, die aus dem hessen-nassauischen Hanau stammte. 1910 studierten an den wissenschaftlichen Hochschulen Hessens 1 199 Frauen (2,2 % der Studentenschaft); zwanzig Jahre später sollten es dann 1 769 (14,8 %) sein, um dann in der Zeit des Nationalsozialismus (1938/39) auf 510 (11,3 %) abzufallen.64
Gegängelt wurde die Jugend in ihren politischen Aktivitäten. Durch das im April 1908 verabschiedete Reichsvereinsgesetz wurde Jugendlichen unter 18 Jahren die politische Vereinstätigkeit verboten. Ein Jahr zuvor, im April 1907, hatte in Darmstadt die erste Landeskonferenz des Verbandes junger Arbeiter und Arbeiterinnen stattgefunden, bei der die SPD mit 42 Delegierten aus 30 Orten und die Jugendorganisationen mit 30 Delegierten aus 13 Orten vertreten gewesen waren. Eine der ersten Jugendorganisationen war 1904 mit dem »Jugendbund« in Offenbach im liberalen Großherzogtum begründet worden.65
Von Wahlen, Wählern und Gewählten
Bei den Reichstagswahlen offenbarten die hessischen Gebiete gravierende Unterschiede.66 Die Beteiligung an den Wahlen für Reich und Land unterschied sich im Großherzogtum frappierend: bei jenen zum Reichstag zwischen 1871 und 1898 lag sie zwischen 60 und 70 %, bei jenen für die zweite Kammer 1884/1887 bei 16,4 und 1897/1899 bei 31,8 %.67 Auf dem Gebiet des heutigen Hessen gab es im Kaiserreich um die 20 Reichstagswahlkreise68, von denen die Nationalliberalen 1871 elf, 1877 dreizehn und 1887 acht gewannen, dann aber 1893 von den Antisemiten mit acht gegen fünf überholt wurden. In diesem Jahr hatte die SPD bei fast 24 % der Stimmen nur drei Mandate erringen können.69
Die acht kurhessischen Wahlkreise waren zunächst dominiert von den Nationalliberalen (1871: 61 %), während dem Linksliberalismus nur eine Nebenrolle zukam. Die katholische Zentrumspartei hielt ihren Stamm während des Kaiserreiches bei etwa 15 %. Sie stützte sich auf ein von reicher Vereinskultur geprägtes katholisches Milieu. Ein Viertel der Hessen war katholisch (dagegen 70 % evangelisch). Hochburg war das katholische Fulda, wo die Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts zur steten Mobilisierung der katholischen Bevölkerung führte, sodass die Orte in Osthessen, insbesondere die Landgemeinden um den Bischofssitz Fulda herum, zu festen Zentrumsbastionen wurden – und dies bis zum Ende der Weimarer Republik auch blieben. Schon bei den ersten Reichstagswahlen 1871 verzeichnete Fulda-Land einen Zentrumsanteil von 90 %.70
In den 1880er-Jahren verloren die Nationalliberalen (1884: 21 %; 1887: 10 %) dramatisch zugunsten der Konservativen. Das konservative »Zwischenspiel«71 wurde durch die Antisemiten mit der Reichstagswahl 1890 beendet. Sie konnten erstmals 1887 im kurhessischen Wahlkreis Marburg/ Frankenberg ein Mandat erringen und eroberten bei den Wahlen 1893 fünf, 1898 vier der acht Kreise, drei davon gleich im ersten Wahlgang. Hessen-Nassau war zur Jahrhundertwende in der Tat »antisemitisch verseucht«.72 Das alte Kurhessen wuchs zum Zentrum rassistischer Kreuzzügler. 1886 fand in Kassel der »Deutschnationale Antisemitentag« statt, auf dem als Dachverband antisemitischer Gruppen die »Deutsche Antisemitische Vereinigung« begründet wurde. In Waldeck siegte 1898 der von der Deutsch-Sozialen Reformpartei und dem Bund der Landwirte gemeinsam getragene antisemitische Kandidat in der Stichwahl.
Motor der Antisemiten in Hessen, die vor allem in der bäuerlichen Bevölkerung auf Zustimmung stießen, war der Bibliotheksassistent der Marburger Universität, Otto Böckel, Gründer und Vorsitzender des Mitteldeutschen Bauernbundes, der von 1887 bis 1903 für die Deutsche Reformpartei/Antisemiten im Reichstag saß. In demagogischer Weise – »lautstark, drastisch, mitreißend sprechend und monoman auf die Juden […] schimpfend«73 – befeuerte der Brunnenvergifter die soziale Missgunst in der bei jüdischen Land- und Viehhändlern stark verschuldeten nordhessischen Bauernschaft für seinen antisemitischen Feldzug. Böckel wurde populär; der Name »Böckel« zu einem richterlich bestätigten »Schimpfwort«.74
Der in Kurhessen vertretene Antisemitismus wandte sich also gezielt an den bäuerlichen Mittelstand75, der in seinen Gefühlen der Deprivilegierung bestärkt wurde. Er war eine Protestbewegung der ländlichen Gebiete, in denen er an die Stelle des Konservatismus trat. Der Siegeszug des Antisemitismus war somit Symptom für eine Vernachlässigung landwirtschaftlicher Regionen. Daraus wuchs ideologischer Wahn. Böckels Reichstagskollege Ludwig Werner, der ab 1890 zunächst für den auch Hofgeismar und Wolfhagen umfassenden Wahlkreis, dann ab 1893 für den von Hersfeld-Hünfeld-Rotenburg im Reichsparlament (bis 1918) saß, schürte einen demagogischen Antisemitismus76, der Judentum mit ausbeuterischem Kapitalismus gleichsetzte, was er mithin für die Verwerfungen und sozialen Konflikte der modernen Wirtschaftswelt verantwortlich machte. Zu den primär religiös motivierten antijüdischen Tendenzen der Vorzeit, die auf getaufte, konvertierte Juden nicht abzielten, trat immer mehr eine rassebiologische Komponente als Kriterium, das »Anderssein«, das dann der Nationalsozialismus später auf die Spitze trieb. Die militant-populistische Bewegung des Kaiserreiches verzeichnete einen enormen Zulauf und strahlte schließlich über Kurhessen hinaus auch ins Darmstädtische.
»Bauernkönig« Böckel, seit 1898 in Diensten des Bundes der Landwirte, verlegte schon bald den Schwerpunkt seiner Arbeit und Agitation nach Oberhessen, wo seine Bewegung einen »sehr fruchtbaren Boden« vorfand.77 Großherzog Ludwig IV. missbilligte öffentlich die »gehässigen Anfeindungen« gegenüber den Juden »auf das Ernsteste« und hielt über seinen Staatsminister Finger die Verwaltungen zur sorgfältigen Beobachtung der »das friedliche Zusammenleben der Bevölkerung gefährdenden Agitation« an.78 In der Tat scheint besonders der 1898 aus dem Amt scheidende Staatsminister Finger ein Eindringen der Böckelbewegung in das Großherzogtum behindert zu haben. So zumindest registrierte diese es selbst.79 Dennoch: 1890 gewannen die Antisemiten im großherzoglichen Oberhessen zwei Reichstagsmandate (Lauterbach/Alsfeld und Gießen, dort in einer Nachwahl einen Monat nach den regulären Wahlen), 1893 auch eines in der Provinz Starkenburg (Erbach/Bensheim). 1911 saß der antisemitische »Hessische Bauernbund«80 mit 15 Mandaten in der zweiten großherzoglichen Kammer und bildete die zweitstärkste Fraktion.
Bei den errungenen Mandaten bleibt jedoch zu berücksichtigen, dass der Sieg der Antisemiten auch dem Wahlsystem geschuldet war, weil sie gerade in den Stichwahlen die Kandidaten von Listenverbindungen waren. So hätte der durchschnittliche Stimmenanteil von einem Viertel eigentlich nur zwei Mandaten (der insgesamt acht kurhessischen Sitze im Reichstag) entsprochen, aber durch das reine Mehrheitswahlrecht mit Stichwahl wurden daraus bis zu sechs, dies bei den Wahlen 1907. Das damit entstandene Bild überzeichnete die tatsächliche Stärke der Böckelianer, denn immerhin drei Viertel der Wählerschaft gaben dem erklärten Antisemitismus nicht ihre Stimme.81 In Hessen-Nassau erreichten die Antisemiten 1898 einen Wahlkreisdurchschnitt von 22 % und verzeichneten den Höchststand 1907 mit fast 25 %. Im Großherzogtum lag der Zenit bei 18 % schon im Jahr 1893. Gegen die Antisemiten sammelten sich Kräfte über Parteigrenzen und über Konfessionen hinweg und organisierten sich in Anti-Antisemiten-Vereinen.
In Nassau eroberten die Antisemiten erst 1903 einen der sechs Reichstagswahlkreise. Der Regierungsbezirk Wiesbaden offenbarte ohnehin eine andere politische Prägung als der Nachbarbezirk Kassel. Im Nassauischen dominierten bis in die 1890er-Jahre hinein die Linksliberalen (jeweils um die 35 %), die danach kräftige Einbußen hinnehmen mussten. Die Zentrumspartei behauptete mit einem Viertel der Wähler (1898) eine führende Position, vor allem dank ihrer starken Verankerung im ländlich-katholischen Raum. 1898 gingen von den sechs Mandaten im Regierungsbezirk Wiesbaden drei auf das Konto des katholischen Zentrums, jeweils ein Mandat erhielten SPD, Nationalliberale und Linksliberale; im Regierungsbezirk Kassel stellten die Antisemiten vier, SPD, Zentrum, die Nationalliberalen und konservative DRP jeweils einen Abgeordneten. Im Kreis Wetzlar, der zusammen mit dem Kreis Altenkirchen einen Wahlkreis bildete, setzte sich 1898 im zweiten Wahlgang ein nationalliberaler Kandidat durch, was 1903 erneut gelingen sollte.
Im Großherzogtum führten zunächst unangefochten die Nationalliberalen, die 1874 zwei Drittel der Stimmen erhalten hatten und 1877 mit noch 48 % in sechs der insgesamt neun Reichstagswahlkreise (einschließlich Rheinhessen) ihre Kandidaten durchbrachten (daneben DRP und Linksliberale je ein Mandat). Die (großherzoglich-)hessischen Nationalliberalen okkupierten als großbürgerlich-industrielle und agrarisch ausgerichtete Partei weithin auch die Funktion der Konservativen, die im Großherzogtum keine Rolle spielten. 1890 eroberten neben den Antisemiten (zwei Wahlkreise) die Nationalliberalen drei Mandate, die linksliberalen Deutschfreisinnigen und die Sozialdemokraten jeweils zwei. 1898 verloren die Antisemiten ein Mandat. Die Sozialdemokraten (insgesamt 33,9 %) behielten ihre zwei, während die bürgerlichen Parteien unterschiedlicher Couleur die restlichen sechs eroberten, darunter das Zentrum ein Mandat im katholisch dominierten Wahlkreis Mainz/Oppenheim, und zwar in der Stichwahl – unterstützt von den Nationalliberalen – knapp mit 51,8 % gegenüber den Sozialdemokraten.
Die Zentrumspartei des Großherzogtums stand vor der Jahrhundertwende auch vor der Frage, wie der SPD Einhalt zu gebieten war. Ein Flügel wollte den Forderungen der Arbeiterschaft weit entgegenkommen, um der Sozialdemokratie die Gefolgschaft abspenstig zu machen, andere zielten auf die Formierung eines festen Bollwerks der bürgerlichen Kräfte. Kurz vor dem Ausbruch des Weltkrieges setzten sich dann innerhalb des hessen-darmstädtischen Zentrums in der für die Partei intern entscheidenden Frage nach dem Einfluss von Kirche und kirchlichen Behörden auf die Politik die sogenannten Modernisten, angeführt von Otto von Brentano, durch, die im Gegensatz zu den Integralisten die Eigenständigkeit der politischen Entscheidungsträger verfochten.82
Gemeinsam in allen hessischen Gebieten vollzog sich ein durch das Sozialistengesetz nur kurzzeitig gestörter kontinuierlicher Aufschwung der Sozialdemokratie. Die SPD entwickelte sich im Wiesbadener Regierungsbezirk später als im Kasseler, erreichte aber in beiden Regionen zum Ende des Jahrhunderts mit knapp über 30 % gleiche Ergebnisse. Frankfurt war einer der Mittelpunkte im Reich, wo um die Jahrhundertwende innerhalb der SPD noch die handwerklich-kleinbetriebliche Struktur dominierte und sich nach dem Fall des Sozialistengesetzes bereits 1891 der Deutsche Metallarbeiterverband gründete. Die sozialistische Arbeiterbewegung besaß ihre Zentren in Kassel83 und Darmstadt sowie in Frankfurt und dessen Umland, darunter in Hanau mit einer radikal ausgerichteten Gruppierung, die später, nach der Spaltung der SPD 1917, mehrheitlich zur linken USPD übergehen sollte. In der Universitätsstadt Marburg kam es erst nach der Jahrhundertwende zur Gründung eines sozialdemokratischen Wahlvereins, der von Robert Michels mitbefördert wurde, dem Gründervater der modernen Politikwissenschaft, der sogleich im Wahlkreis Alsfeld für den Reichstag kandidierte, jedoch erfolglos.
Führende Sozialdemokraten aus dem und im Hessischen: die befreundeten Wilhelm Liebknecht (3. v. l.) und Carl Ulrich (2. v. l.), mit Liebknechts Frau Natalie (4. v. l.) und Ulrichs Haushälterin Lina Mörch (r.) sowie Bekannten, dem Lokaldichter Lorenz Berg (l.) und Wilhelm Stein (2. v. r.), um 1895 in Offenbach.
1881 hatten Karl Frohme im kurhessischen Wahlkreis Hanau84 und der aus Gießen stammende charismatische Parteigründer Wilhelm Liebknecht im hessen-darmstädtischen Offenbach/Dieburg für die Sozialdemokratie erstmalig Reichstagsmandate errungen. Dabei war Liebknecht 1881 auch im rheinhessischen Wahlkreis Mainz/Oppenheim gewählt worden, nahm aber das Mandat in Offenbach an. Obwohl bei der notwendigen Nachwahl im Mainz/Oppenheimer Wahlkreis der sozialdemokratische Parteiführer August Bebel, der Schulzeit und Lehrjahre in Wetzlar verbracht hatte, dann dem linksliberalen Kandidaten Adolph Phillips unterlag, markierten die Wahlen von 1881 den lang ersehnten Durchbruch der hessischen Sozialdemokratie.85 Insgesamt bewirkte das Auftreten der immer stärker werdenden SPD eine Politisierung und Mobilisierung der Wählerschaft – nicht nur während der Wahlkämpfe. Wilhelm Liebknecht avancierte zum großen Mann der SPD auf der nationalen und der internationalen Bühne, dem nach seinem Tod 1900 in Berlin weit mehr als 100 000 Menschen das letzte Geleit gaben. Bereits früh, 1886 noch unter dem Sozialistengesetz, gelang den Sozialdemokraten die Wahl eines Parteigenossen zum Bürgermeister von Fechenheim, eines Fischerdorfes am Main (1928 zu Frankfurt eingemeindet). Er wurde freilich vom zuständigen Hanauer Landrat nicht bestätigt.86
Das eklatante Missverhältnis von Wählerstimmen und Abgeordnetenzahl für die SPD bei den Reichstagswahlen resultierte zum einen aus der im Kaiserreich unveränderten Wahlkreiseinteilung, die der Verstädterung keineswegs Rechnung trug. 1912 nominierten 19 000 Wahlberechtigte im kleinsten hessischen Wahlkreis Fritzlar/Homberg/Ziegenhain (85 000 Einwohner) ebenso einen Abgeordneten wie die 89 000 Wahlberechtigten im größten Frankfurt (341 000 Einwohner). Für den Sieg im großstädtischen Frankfurt waren also fast fünfmal so viele Stimmen wie in dem ländlichen Wahlkreis erforderlich.87