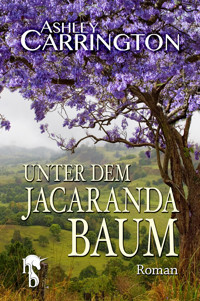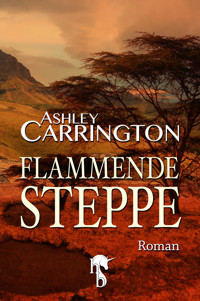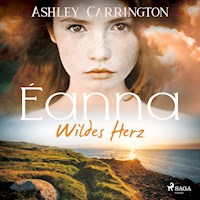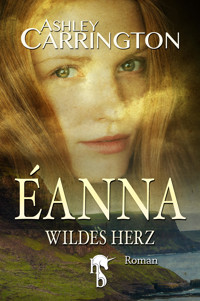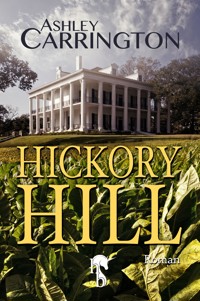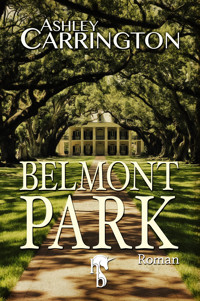4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jessica beschließt, nicht in ihre Heimat England zurückzukehren, sondern »Seven Hills«, die Farm ihres verstorbenen Mannes weiterzuführen. Dort trifft sie nun wieder auf Mitchell, den Mann, den sie einst liebte. Die Situation hat sich zwar geändert – sie wurde begnadigt und ist eine freie Frau –, aber es sind viele Jahre vergangen, seit sie sich liebten. Werden die beiden wieder zueinander finden können? Band 2 der Jessica-Reihe von Ashley Carrington.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ashley Carrington
Jessica
Das Ziel aller Sehnsucht
Roman
Für R. M. S., der am Zustandekommen dieses Buches so viel Anteil hat, als hätte er mir selber die Feder geführt.
1
Die Laterne, die an der Wand der Schiffskabine hing, brannte mit kleiner, ruhiger Flamme und warf einen schwachen Schein auf ihren nackten Körper. Das warme Licht schmeichelte ihrer zarten Figur, die im weniger vorteilhaften Tageslicht ausgesprochen zerbrechlich wirkte und ihre von Natur aus kränkliche Konstitution verriet. Doch hier im Halbdunkel verwandelte der Laternenschein die Blässe ihrer Haut in einen schwach goldenen, samtenen Glanz und entlockte ihrem braunen Haar einen fast kupfernen Schimmer.
Rosetta Forbes hatte die Haarbänder gelöst und wollte gerade zum Nachtgewand aus aprikosenfarbener Seide greifen, als sich zwei kräftige Hände von hinten auf ihre nackten, schmalen Schultern legten.
Wie unter einem Peitschenhieb zuckte sie zusammen, stieß einen Laut des Erschreckens aus und fuhr herum. Kenneth stand vor ihr und musterte ihren Körper mit unverhohlenem Begehren. Sie hatte nicht gehört, dass er die Kabine betreten hatte. Das ewige Ächzen und Knarren von Sparren und Spanten, von Masten und Tauwerk machte es schwer, das Geräusch einer sich öffnenden Kabinentür herauszuhören.
»Was bist du so schreckhaft, Rose?« Kenneth ließ seine Hände von ihren Schultern über ihren Rücken abwärts gleiten.
Sie versteifte sich. »Du hast nicht angeklopft!«
Ein spöttisches Lächeln zuckte um seine Mundwinkel. »Seit wann hat ein Mann anzuklopfen, wenn er die Schlafgemächer seiner ihm angetrauten Frau zu betreten gedenkt? Zudem scheinst du vergessen zu haben, dass diese bescheidene Kabine für die Dauer unserer Überfahrt auch mein Quartier ist.«
»Trotzdem brauchst du mich nicht so zu erschrecken!«, hielt sie ihm vor und versuchte, sich seinen Händen zu entziehen, die nun immer fordernder über ihren Körper tasteten.
»Lass uns von was anderem reden«, sagte Kenneth mit belegter Stimme. »Ich habe dich schon lange nicht mehr so gesehen, Rose. Und fast hätte ich vergessen, wie du dich anfühlst.« Er versuchte, sie an sich zu ziehen und seinen Mund in die Mulde ihres Halses zu drücken.
Doch Rosetta stieß ihn zurück. »Rühr mich nicht an!«, zischte sie, am Rande einer Panik. »Hast du keinen Anstand, mich so zu bedrängen? Ich verabscheue es, wenn du dich so zügellos benimmst wie … wie ein Tier!«
Kenneth atmete heftig. »Du bist meine Frau, verdammt noch mal!«, stieß er hervor und begann, seinen roten Uniformrock aufzuknöpfen. »Und ich bin dein Mann! Der Teufel soll mich holen, wenn ich mir von dir Vorschriften machen lasse, wann ich zu dir ins Bett steigen darf! Du hast deine ehelichen Pflichten zu erfüllen. Und wenn du es nicht freiwillig tust, werde ich dich eben mit Gewalt nehmen!«
»Wage es ja nicht!«, flüsterte Rosetta und wich nicht einen Schritt vor ihm zurück. Ihre schutzlose Nacktheit vergaß sie einen Moment lang völlig. Trotzig reckte sie das Kinn mit dem Grübchen in der Mitte. »Wage es ja nicht, mich gegen meinen Willen zu berühren, Ken! Ich bringe dich um, das schwöre ich!«
»Du willst mich umbringen? Wie denn? Du bist ja kaum in der Lage, den Suppenlöffel länger als fünf Minuten in der Hand zu halten. Dann musst du dich ja schon wieder vor Erschöpfung in die Kabine zurückziehen!«, höhnte er und lachte verächtlich, blieb jedoch stehen, wo er war. »Komm, mach dich doch nicht lächerlich!«
Rosetta schüttelte den Kopf. »Ich mag schwach und kränklich sein, Ken. Aber ich werde niemals so schwach sein, um dich nicht dafür bezahlen zu lassen, falls du versuchen solltest, mich zu vergewaltigen!«, drohte sie.
»Du bist meine Frau!«, donnerte Ken wutentbrannt, senkte aber sofort wieder seine Stimme, um nicht den Mitreisenden Stoff für gehässigen Klatsch zu liefern. »Und du hast mir ewige Liebe, Treue und Gehorsamkeit geschworen, verdammt noch mal!«
»Ich hatte eine Fehlgeburt, das weißt du genau!«, antwortete sie ausweichend.
»Das ist ja bei dir nichts Neues!«, stieß er mit bitterem Vorwurf hervor. Es war schon die dritte Fehlgeburt in zwei Jahren Ehe. Diesmal hatte sie die Krämpfe schon im vierten Monat gehabt. Eine Woche nachdem sie aus dem Hafen von Kapstadt ausgelaufen waren, wo die Andromeda neu verproviantiert worden war und zwei weitere Passagiere an Bord gekommen waren, hatte ihr Körper das Baby abgestoßen. Die Totgeburt war auf See bestattet worden. Rosetta hatte ihm damals tränenreiche Vorwürfe gemacht, dass er die Reise nach Australien nicht in Kapstadt bis zur Geburt ihres Kindes unterbrochen hatte, wie sie es mehrfach von ihm verlangt hatte. Denn die mehr als sechsmonatige Seereise stellte für ihre sowieso schon kränkliche Verfassung eine arge Strapaze dar, die dann nicht ohne schwerwiegende Folgen geblieben war. Doch seine Befehle hatten ihm keine Wahl gelassen. Sie hatten die Reise fortsetzen müssen, obwohl auch er es im Nachhinein bedauerte. Denn nichts wünschte er sich mehr als einen Sohn.
»Außerdem liegt das jetzt schon fast drei Monate zurück«, fuhr Kenneth Forbes, Lieutenant des New South Wales Corps, nun mit fast versöhnlichem Tonfall fort. »Du hast dich mittlerweile von dem tragischen Verlust unseres Kindes recht gut erholt, wie ich mich jetzt mit meinen eigenen Augen in natura vergewissern kann.«
»Ich brauche mehr Zeit!«
Er verzog das Gesicht. Verraucht war der Zorn, der in ihm das Verlangen nach Gewalt geweckt hatte. An seine Stelle war eine kraftlose Verdrossenheit getreten. Verflüchtigt hatte sich auch das Begehren, das in ihm bei ihrem Anblick aufgelodert war.
»Was erwartest du überhaupt von mir? Dass ich dir ein ganzes Jahr Schonung zubillige? Der Schiffsarzt …«
»… ist ein alter Trottel!«, fiel Rosetta ihm selbstbewusst ins Wort. Sie wusste, dass sie in dieser hässlichen Auseinandersetzung die Oberhand gewonnen hatte. Ihre entschlossene Drohung hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. »Ich werde dich wissen lassen, wann ich bereit bin, meine … ehelichen Pflichten wieder aufzunehmen.«
Kenneth starrte sie aus zusammengekniffenen Augen an. »Manchmal habe ich den schrecklichen Verdacht, dass es dir lieber wäre, ich würde dich überhaupt nicht begehren und niemals mehr berühren.«
Hitze flutete durch ihr Gesicht. Sie wich seinem stechenden Blick aus und fuhr schnell in ihr Nachtgewand. »Ich habe dir nie etwas vorgemacht«, antwortete sie, »und so getan, als ob mir an dieser Seite unserer Ehe besonders viel läge.«
»Nein, das hast du wahrlich nicht«, sagte er voller Groll.
»Vielleicht hättest du doch besser meine pummelige Schwester heiraten sollen und nicht mich«, hielt sie ihm gereizt vor. »Abigail wäre dir sicherlich willenlos wie eine dumme Kuh überallhin gefolgt und hätte dir ein gesundes Kind nach dem anderen geboren!«
Kenneth fuhr wieder in seinen Uniformrock. »Ja, dein Verhalten hat diesen Gedanken in mir auch schon geweckt«, zischte er und stürmte aus der Kabine. Er brauchte frische Luft, um sich abzuregen, und stiefelte polternd den Niedergang zum Achterdeck hoch.
2
Unter Vollzeug und auf Steuerbordbug durch die nur mäßig bewegte See pflügend, segelte die Andromeda in den Sonnenuntergang. Der feuerrote Glutball war am westlichen Horizont schon tief gesunken und schien nun im Meer zu verglühen. Während das Schiff schon im Dunkel der Nacht lag, loderte über der Kimm noch ein letzter Streifen feuerroten Lichtes.
Lieutenant Kenneth Forbes stand an der Reling, eine schlanke Gestalt von siebenundzwanzig Jahren und mehr als attraktivem Aussehen. Er hatte die vollendeten Gesichtszüge einer klassischen Marmorbüste. Unter schmalen, schwungvollen Brauen lagen Augen, die von einem tiefen Braun waren und von langen Wimpern überschattet wurden, um die ihn schon so manche Frau beneidet hatte.
Er wusste aus Erfahrung, dass er zu jenen wenigen, von der Natur reichhaltig bedachten Männern zählte, denen die Frauen fast ohne Ausnahme zu Füßen lagen und die mit einem einzigen Lächeln jeglichen weiblichen Widerstand dahinschmelzen ließen wie Butter in der Sonne.
Genauso war es bei ihm bisher auch der Fall gewesen, seit er die Macht seines Äußeren und die Unersättlichkeit seines Triebes erkannt hatte – und das eine skrupellos eingesetzt hatte, um die Befriedigung des anderen zu erreichen.
Alle waren sie ihm verfallen – ausgenommen Rosetta. Und gerade sie hatte er, welch eine Ironie des Schicksals, zur Frau genommen! Wenn auch auf massiven Druck seiner Eltern, Sir Wesley und Lady Catherine, hin, die seiner Skandale leid geworden waren und ihm mit Enterbung gedroht hatten, nachdem seine Affäre mit der Frau seines Rechtswissenschaftsprofessors ein mittleres gesellschaftliches Erdbeben in Eton ausgelöst hatte. Hätten seine Eltern ihn nicht quasi zur Ehe gezwungen, wäre ihm das Missgeschick mit Rosetta sicherlich nicht passiert, und er würde immer noch von einer sinnesfreudigen Schönheit zur anderen flattern wie ein Schmetterling von einer duftenden Blume zur anderen.
Doch die angedrohten Repressalien konnte er noch nicht einmal vor sich selbst als Entschuldigung für seinen katastrophalen Missgriff gelten lassen. Denn wenn sie ihn auch zur Ehe gezwungen hatten, so hatten sie ihm doch immerhin noch so viel Freiheit zugestanden, sich aus einer Anzahl möglicher Ehekandidatinnen die ihm in Charakter und Äußerem gefälligste auszuwählen.
Und ich musste mich ausgerechnet für Rosetta entscheiden!, machte er sich im Stillen bittere Vorwürfe. Wie konnte ich nur so von Blindheit geschlagen sein, dass ich nicht erkannt habe, was sich hinter ihrem puppenhaften Äußeren verbarg? Wie konnte ich nur so tölpelhaft sein, eine Frau in mein Ehebett zu nehmen, die so anschmiegsam wie ein Reibeisen und so leidenschaftlich wie ein Stück Holz ist! Sie hat recht: Da hätte ich mit ihrer einfältigen Schwester Abigail sicherlich eine tausendmal bessere Wahl getroffen. Sie hätte mir nicht zu widersprechen gewagt und mir zweifelsohne einen kräftigen Sohn geschenkt, statt ständig zu kränkeln und eine Fehlgeburt nach der anderen zu haben! Ein gefühlskaltes, aufsässiges Weib. Und das mir! Ausgerechnet mir!
Wütend schlug er mit der flachen Hand auf die Reling, während der Wachhabende die Seeleute in die Wanten schickte. Geschmeidig enterten die Männer auf, um die Segel zu reffen. Zu nahe war die fremde Küste, als dass Captain Browder es gewagt hätte, auch bei Nacht mit prall geblähten Segeln seinen Kurs beizubehalten. Nur bei sternenklarer Nacht würde er mit einem zusätzlichen Mann im Ausguck weiter gen Nordwesten segeln, statt bis zum Tagesanbruch beizudrehen.
Schritte wurden auf dem Deck hinter ihm laut, dann trat ein kräftig gebauter Mann in dunklem Wollrock neben ihn an die Reling und sog die milde Meeresbrise hörbar ein.
Es war Edward Chambers, einer der beiden Passagiere, die in Kapstadt an Bord gekommen waren. Er war ein großer, breitschultriger Mann in den Vierzigern mit einem schon ergrauten Backenbart und einem Gesicht, das wie eine weite flache Landschaft ohne besondere Merkmale war. Wenn man seinen eigenen Worten Glauben schenken durfte, was Kenneth tat, war er in der Sträflingskolonie New South Wales ein erfolgreicher Geschäftsmann.
»Können Sie Land riechen, Lieutenant?«, begann Chambers ein Gespräch in der ihm eigenen leutseligen Art. Er schnupperte wie ein Hund, der eine Witterung aufnimmt. »Ich jedenfalls kann Land riechen. Zwei Tage noch, mein Wort drauf, und wir sehen die Einfahrt von Sydney Cove!«
Kenneth bedachte ihn mit einem flüchtigen Seitenblick und war versucht zu erwidern, dass man nicht unbedingt in der Lage zu sein brauchte, Land zu riechen, um solch eine Behauptung aufzustellen. Denn dafür genügte ein kurzes Gespräch mit Captain Browder, aus dessen Quelle Chambers' Voraussage höchstwahrscheinlich auch stammte. Doch Edward Chambers hatte sich bisher als unterhaltsamer Mitreisender erwiesen. Und in Anbetracht seines möglichen Einflusses in der jungen Kolonie erschien es ihm höchst unklug, seine freundlich gemeinten Worte mit einer sarkastischen Erwiderung zu vergelten.
»Ich hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn sich Ihre Vermutung als zutreffend herausstellen sollte«, antwortete Kenneth deshalb mit der gebotenen Höflichkeit und war plötzlich recht froh, einen Gesprächspartner zu haben, der ihn auf andere Gedanken brachte. »Die Faszination einer Seereise, von der andere zu berichten wissen, ist mir und ganz bestimmt meiner Frau verschlossen geblieben.«
Edward Chambers sah ihn mitfühlend an. »Ein zutiefst tragisches und betrübliches Schicksal, das Sie und Ihre Gemahlin zu ertragen hatten. Ich hoffe sehr, dass ihre Gesundung auch weiterhin rasche Fortschritte macht.«
»Danke, ich will nicht klagen«, erwiderte Kenneth ausweichend und lenkte das Gespräch auf ein ihm angenehmeres Thema. »Ich kann es noch gar nicht glauben, dass diese grässlich lange Reise in ein paar Tagen endlich hinter uns liegen soll. Und ich versuche, mir vorzustellen, was mich dort erwartet. Sagen Sie, wie sieht die Lage dort unten eigentlich aus?«
»Sie meinen politisch?«
»Ja. Mir ist so einiges zu Ohren gekommen, demnach es gewisse Reibereien zwischen dem Corps, dem ich angehöre, und dem Gouverneur geben soll.«
Edward Chambers lachte trocken auf. »Reibereien ist gut gesagt, Lieutenant. Das ist ein offener Machtkampf, der schon so lange dauert, wie diese Kolonie existiert – und das sind jetzt, anno 1807, gut neunzehn Jahre. Doch er ist längst zugunsten Ihrer Offiziere vom New South Wales Corps entschieden, Lieutenant. Keinem Gouverneur ist es bis heute auch nur ansatzweise gelungen, die Vormachtstellung des Corps in der Kolonie ins Wanken zu bringen.«
»Man erzählt sich aber, dass Captain William Bligh, der neue Gouverneur, vom Kolonialamt nach Sydney geschickt worden ist, um gerade dies zu erreichen«, wandte Kenneth ein.
Chambers machte eine verächtliche Handbewegung. »Ach, was! Wissen Sie, wie sie Bligh bei uns nennen? Brotfrucht-Bligh! Oder auch Bounty-Bligh! Nein, von dem geht keine Gefahr aus. Der Kerl ist ja noch nicht einmal mit den Meuterern seines Schiffes damals, der Bounty, fertig geworden!«
»Aber ist er nicht von Lord Nelson höchstpersönlich für seine Tapferkeit während der Seeschlacht auf der Reede von Kopenhagen 1801 geehrt worden?«, wandte Kenneth ein wenig skeptisch ein. »Hat ihm das und sein Ruf, ein eisenharter Mann zu sein, der keine Disziplinlosigkeit duldet, nicht einen starken Rückhalt verschafft?«
»In London mag der Name Bligh vielleicht noch immer den Klang eines Volkshelden haben«, räumte Chambers geringschätzig ein. »Der Pöbel ist so leicht zu blenden. Aber in der Kolonie, zwölftausend Meilen von England und der Admiralität entfernt, gelten andere, viel rauere Gesetze, gegen die auch ein Captain Bligh nicht anstinken kann. Er ist erst seit August letzten Jahres in der Kolonie, Lieutenant, aber er hat sich in diesem einen Jahr schon mehr Feinde auf allen Seiten gemacht als manch einer jener glücklosen Gouverneure in seiner gesamten Amtszeit. Nein, nein, er steht auf verlorenem Posten, lassen Sie sich das von mir gesagt sein. Es sind Männer Ihres Schlages, die Offiziere des New South Wales Corps, die bei uns die wahre Macht in den Händen halten, und ich bin zuversichtlich, dass das auch noch lange der Fall sein wird. Seien Sie froh, dass Sie den roten Rock des Königs tragen und ein Offizierspatent besitzen! Damit stehen Ihnen alle Tore und Chancen offen.«
»Das klingt ja fast wie eine Verheißung«, gab sich Kenneth belustigt, brannte jedoch darauf, mehr über diese Chancen zu erfahren.
»Nun, so meinte ich es auch. Ich weiß natürlich nicht, welcher Natur Ihre Beweggründe sind, die Sie veranlasst haben, dem New South Wales Corps beizutreten und nach Australien zu kommen«, sagte Edward Chambers und ließ eine fragende Pause eintreten.
Kenneth hütete sich, seine Beweggründe zu nennen und zu offenbaren, dass sein Vater ihm unter Androhung der Enterbung verboten hatte, sich vor Ablauf von mindestens fünf Jahren wieder in England blicken zu lassen. Und so beschränkte er sich in Ermangelung einer plausiblen Antwort auf die wenig überzeugende Behauptung: »Nun, es war vorwiegend wohl die Abenteuerlust in mir, die mich dazu bewogen hat, dieses Wagnis einzugehen.«
Edward Chambers nickte, als akzeptierte er dies als hinreichende Erklärung. Dabei wusste wohl niemand besser als er, dass fast jeder, der nicht als Sträfling nach New South Wales kam, schwerwiegende Gründe hatte, über die er sich sogar neuen Freunden gegenüber lieber ausschwieg. Doch das behielt er für sich. Die Vergangenheit eines freien Siedlers, Kaufmannes oder Soldaten war tabu in der Kolonie. Und wer seine Neugierde nicht zu bezähmen wusste, konnte sich schneller Todfeinde schaffen als auf irgendeine sonstige Art und Weise. »Wenn Sie das Wagnis suchen, werden Sie ganz ohne Frage dort auf Ihre Kosten kommen, Lieutenant«, versicherte er. »Für einen Mann, der über genügend Tatkraft verfügt und seine Position zu seinem Vorteil zu nutzen weiß, gibt es heute wohl keinen besseren Ort als New South Wales, wo man mit wenig Einsatz schnell zu einem ansehnlichen Vermögen kommen kann.«
»Sie scheinen aus eigener Erfahrung zu sprechen, wenn ich mir diese hoffentlich nicht indiskrete Bemerkung erlauben darf«, sagte Kenneth, in höchstem Maße interessiert, wie er denn ausgerechnet an so einem gottverlassenen Ort sein Glück machen könnte.
»Sie dürfen, Lieutenant. Ich spreche in der Tat aus eigener Erfahrung. Als ich vor gut einem Jahrzehnt nach Sydney kam, hatte ich einen … nun, sagen wir mal geschäftlichen Tiefstand erreicht«, gestand Edward Chambers offenherzig. »Ich hatte ein nicht unbeträchtliches Vermögen verloren, als die verdammten Kolonisten in Amerika, Gott möge sie für ihren schändlichen Verrat ewig in der Hölle schmoren lassen, als dieses elende Verräterpack sich gegen unseren König erhoben und ihre Unabhängigkeit mit Hilfe der verfluchten Franzmänner erstritten hatte.«
»Ich weiß, der Verlust unserer amerikanischen Kolonie war ja der Anlass für die Gründung einer neuen Kolonie, um unser Land vom Abschaum der Verbrecher zu befreien, die unsere Gefängnisse überfüllten«, erinnerte sich Kenneth.
»So ist es. Aber mir war sofort klar, dass sich die Besiedlung von New South Wales ähnlich wie damals in unseren ehemaligen amerikanischen Kolonien entwickeln würde und sich nach einigen schweren Anfangsjahren Möglichkeiten bieten würden, mit wie gesagt wenig Einsatz viel Profit zu machen. Und so ist es auch geschehen. Ich habe in Kapstadt nicht nur Merinoschafe, Vieh und ein paar Pferde sowie landwirtschaftliche Gerätschaften eingekauft, die mir beim Verkauf in der Kolonie einen Gewinn von mindestens vierhundert Prozent sichern«, offenbarte Chambers ihm stolz, »sondern ich habe mich vor allem auch mit jeder Menge Kapbrandy und Rum eingedeckt. Denn Rum, mein lieber Freund, ist bei uns mehr wert als pures Gold!«
Kenneth hob fragend die Augenbrauen.
»Ohne Rum läuft in der Kolonie gar nichts«, erklärte Chambers. »Kein Sträfling, der nicht sein Quantum verlangt und erhält. Ob Männer oder Frauen, sie sind süchtig danach – und das ist auch gut so. Mit Rum halten wir dieses Pack unter Kontrolle. Haben die Deportierten ihre Strafe verbüßt oder sind sie begnadigt worden, dann werden sie auch mit Rum bezahlt. Rum ist die Währung für all diejenigen armen Tölpel, ob nun freie Siedler oder Sträflinge, die irgendetwas kaufen oder verkaufen wollen. Wenn man selbst Zugang zu den Rumquellen hat, ist das ein spottbilliger Weg, Arbeitskräfte oder anderes zu kaufen. Mich kostet die Gallone keine vier Shilling, doch wer bei mir kauft, muss zwanzig Shilling und mehr bezahlen.«
»Ich denke, es gibt in der Kolonie keine Münzwährung?«
Chambers lachte. »Das trifft auch für die meisten armen Schlucker zu. Wir achten darauf, dass sie kein Geld in die Finger bekommen. So nehmen wir eben Vieh, Getreide und anderes in Zahlung, wobei wir natürlich ein Schaf nicht zu dem Preis akzeptieren, zu dem wir es verkaufen würden. Den Leuten bleibt keine andere Wahl. Sie sehen also, wir haben alles bestens durchdacht.«
»Wer ist wir?«, wollte Kenneth wissen.
»Wir? Das ist das Rum-Monopol, und es wird vom New South Wales Corps und einigen weitsichtigen Leuten meines Schlages kontrolliert!«, prahlte Chambers. »Auch ein William Bligh wird daran nichts ändern können.«
»Interessant …«
Chambers beugte sich zu ihm. »Ich gebe Ihnen einen guten Rat, Lieutenant. Wenn Sie in der Kolonie sind, überlassen Sie das Farmen anderen oder kaufen Sie sich eine Farm, die Sie bewirtschaften lassen. Als Offizier kommen Sie leicht an ein Arbeitskommando aus Sträflingen. Vertrödeln Sie also selbst keine Zeit mit solchem langwierigen Unfug, sondern verschaffen Sie sich Zugang zum Kreis derjenigen, die das Heft fest in der Hand halten.«
Kenneth lachte auf. »Ich habe nicht das Geringste dagegen einzuwenden. Die Frage ist nur, ob man mich auch an dem fetten Kuchen teilhaben lässt. Es gibt niemanden in New South Wales, den ich auch nur im Entferntesten kennen würde.«
»Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Ich werde Ihnen die notwendigen Kontakte schon verschaffen«, versprach Chambers. »Wir können Männer wie Sie in unserem Kreis immer gebrauchen.«
»Ein großzügiges Angebot, das mich tief in Ihrer Schuld stehen lässt«, bedankte sich Kenneth mit unverhohlener Begeisterung.
»Sollte ich einmal Ihre Unterstützung benötigen, werde ich nicht zögern, Sie darum zu bitten«, versicherte der gerissene Kaufmann.
Kenneth zweifelte nicht daran.
»Und nun kommen Sie. Der Erste und Mister Marwick werden schon ungeduldig auf uns warten, damit wir uns zu unserer abendlichen Spielrunde an den Tisch setzen können. Vielleicht werden Sie auf meine Hilfe überhaupt nicht angewiesen sein, wenn Sie auch weiterhin so viel Glück mit den Karten haben«, scherzte Chambers.
»Ja, gern«, sagte Kenneth und starrte einen Augenblick versonnen in die Dunkelheit. Es stimmte nicht ganz, was er gesagt hatte. Es war möglich, dass er doch einen Menschen in der Sträflingskolonie kannte – Jessica.
Ob sie überhaupt noch lebte?
3
Jessica Brading stand im warmen Licht der australischen Mittagssonne neben ihrer Kutsche am Hafen und blickte zur Southwind hinüber, die in der weiten Bucht von Sydney Cove neben einem amerikanischen Segler vor Anker lag. Ein versonnenes Lächeln lag auf ihrem zartgeschnittenen Gesicht, das eine ganz besondere Art von Schönheit ausstrahlte, die mehr von innen kam, als auf äußerlichen Vorzügen beruhte. Fast so seegrün wie das Wasser der geschützten Bucht waren ihre Augen, die nun die eleganten Linien des Dreimasters bewunderten. Sie hatte für sich und ihre Kinder Edward und Victoria, die etwas abseits der Kutsche spielten, eine Passage auf der Southwind gebucht, von der es hieß, dass sie ein schnelles Schiff sei und die Überfahrt nach England in weniger als fünf Monaten bewältigen könne.
Jessica seufzte unwillkürlich. England! Wie lange war es her, dass sie England als Deportierte an Bord eines Sträflingsschiffes verlassen hatte? Fast sechs Jahre! Gerade achtzehn war sie damals gewesen.
Sechs Jahre waren nicht viel in England. Doch hier in Australien, unter dem Kreuz des Südens, war das wie ein ganzes Leben. Wer hier als Deportierter von Bord eines Sträflingsschiffes ging, hatte die Unbekümmertheit der Jugend auf der Überfahrt längst verloren, wie jung an Jahren er auch sein mochte. In dieser von Naturkatastrophen heimgesuchten Kolonie starben in der alles versengenden Sonne des Sommers nicht nur die Schwachen und Willenlosen wie die Fliegen. Auch erfahrene Siedler, die ihren Mann standen und sich tagaus, tagein den Rücken krumm schufteten, zählten immer wieder zu den Opfern, die dieses wilde Land forderte. Nur wer über eine eiserne Willenskraft und unbeugsame Härte verfügte, wie das bei Jessica Brading der Fall war, hatte in dieser Sträflingskolonie eine Chance, zu überleben und sich zu behaupten.
Jessica wandte ihre Aufmerksamkeit nun dem kleinen Ruderboot zu, das vor wenigen Minuten von der Southwind abgelegt hatte und von einem Matrosen mit kräftigen, gleichmäßigen Riemenschlägen über die stille Bucht ans Ufer gerudert wurde. Ian McIntosh, der Verwalter ihrer Farm Seven Hills am Hawkesbury River, saß vorn im Boot, steil und aufrecht, wie es seine Art war. Doch an diesem Tag wirkte er besonders starr und verschlossen, wie ein Granitblock.
»Ich hätte es nicht so weit kommen lassen dürfen«, dachte sie und machte sich nun Vorwürfe. »Vor allem hätte ich Ian nicht die Last der Verantwortung allein tragen lassen dürfen.«
Sicher, nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes, der so sinnlos gewesen war und sie mit der niederschmetternden Wucht eines Axthiebes getroffen hatte, war sie verzweifelt gewesen und hatte auf Seven Hills in nichts mehr einen Sinn gesehen. Genug der Opfer und der Leiden!, hatte sie sich gesagt. Doch der Schmerz über seinen Verlust war keine Entschuldigung, bestenfalls eine Erklärung. Sie hätte sich nicht so lange treiben lassen dürfen. Hätte Ian sich damals nicht um alles gekümmert, stände es heute schlecht um die Farm.
Eine scharfe Stimme drang zu ihr herüber und riss sie aus ihren Gedanken. Sie wandte den Kopf und blickte zur regierungseigenen Anlegestelle hinüber, die den privaten Handelsfahrern der Kolonie verwehrt war.
»Bewegt euch, verdammtes Gesindel! Ich werde euch gleich Beine machen, wenn ihr weiter so trödelt!«, brüllte dort drüben ein stämmiger Korporal. Er trug die rote Uniform des New South Wales Corps, das in der Sträflingskolonie eigentlich nur für Ruhe und Ordnung sorgen sollte, in Wirklichkeit aber schon längst die Macht an sich gerissen und dem jeweils regierenden Gouverneur seinen Willen aufgezwungen hatte. Der Handel mit Rum, der in New South Wales noch immer die einzig gültige Währung darstellte, war fest in seiner Hand. Und weder das Kolonialamt in London noch der Gouverneur der Kolonie hatten dieses Rum-Monopol der korrupten Offiziersclique zerschlagen können.
Der Korporal ließ seine Reitgerte warnend durch die Luft zischen. Es gab ein scharfes Klatschen, als der schmale, biegsame Stock auf einen der aufgestapelten Säcke traf und eine sichtbare Einkerbung hinterließ. Ein wenig mehr Wucht, und das Sackleinen wäre aufgeplatzt – wie die Haut der Sträflinge, die sich etwas hatten zuschulden kommen lassen und öffentlich auf dem Exerzierplatz vor den Militärbaracken mit der Neunschwänzigen ausgepeitscht wurden. Schon eine Klage über die kargen Tagesrationen genügte, um sich einige Dutzend Peitschenhiebe einzuhandeln.
»Hoch mit den Säcken, ihr versoffenen Pestbeulen!«, schrie der Korporal.
Sechs ausgemergelte, in Lumpen gekleidete Sträflinge mühten sich ab, einen Lastenkahn zu entladen. Sie schufteten schon seit dem Morgengrauen, wuchteten schwere Fässer und Säcke auf die Anlegestelle und karrten sie zu einem nahe gelegenen Lagerhaus. Eine Tasse Eukalyptustee und ein Kanten Brot, der schon vom Schimmel befallen war, das war ihre karge morgendliche Ration gewesen. Genug zum Überleben, wenn man in einer Zelle saß und von robuster Natur war. Doch lächerlich wenig, wenn man als Sträfling einer sogenannten Street Gang, einem Arbeitskommando unter freiem Himmel zugeteilt war und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Schwerstarbeit verrichten musste.
Erschöpfung zeichnete ihre Gesichter, die nur noch aus Haut und Knochen zu bestehen schienen. Die Augen lagen in tiefen Höhlen, und nur ab und zu wich ihr trüber, apathischer Blick einem Aufflackern von Hass. Doch zur Auflehnung fehlte ihnen die Kraft. Keuchend nach Atem ringend und schweißüberströmt, so wankten sie über das schmale Brett vom Lastkahn auf die Anlegestelle hinüber, einen schweren Sack auf dem schmerzenden Rücken.
Einer der Sträflinge, ein schmächtiger Bursche von kaum achtzehn Jahren, tat sich besonders schwer. Ihm war anzusehen, dass ihm schwere körperliche Arbeit vor seiner Verbannung in die Sträflingskolonie Australien fremd gewesen war. Möglicherweise hatte er Londons Straßen und Märkte als Taschendieb unsicher gemacht, oder aber er zählte zu den irischen Rebellen, die sich ebenso heldenhaft wie aussichtslos gegen die britische Vorherrschaft auf ihrer Insel zur Wehr zu setzen versuchten.
Zu schwer war die Last auf seinem Rücken. Die Beine versagten ihm den Dienst, und er stürzte auf der Anlegestelle in den Dreck.
Mit einem Satz war der Korporal bei ihm. »Hoch mit dir, du irischer Hund!«, schrie er und schlug zu. Der Stock sauste auf den ausgelaugten jungen Mann nieder, der sich unter den Hieben aufbäumte. »Wenn du erst dein eigenes Blut schmecken willst, bevor du zu arbeiten bereit bist, kannst du das haben!«
Jessica zuckte zusammen, als sie das hässliche Klatschen der Gerte hörte, die auf nackte Haut traf. Ihr Magen zog sich zusammen, und ihr war, als spürte sie wieder die Peitsche, die ihren Rücken damals in ein Stück rohes, aufgefetztes Fleisch verwandelt hatte. Nur mit großer Willensanstrengung unterdrückte sie das Verlangen, gegen die unmenschliche Behandlung der Sträflinge einzuschreiten. Es wäre nicht nur zwecklos, sondern für sie auch in höchstem Maß gefährlich gewesen. Die Macht und Willkür der Rumsoldaten kannte in diesen Monaten des Jahres 1807 keine Grenzen. Wer sich mit ihnen anlegte, konnte sich schnell in Ketten gelegt wiederfinden. Und da machte es kaum einen Unterschied, ob er als freier Siedler nach New South Wales gekommen oder mittlerweile ein sogenannter Emanzipist war, ein Deportierter, der begnadigt worden war oder seine Strafe abgebüßt hatte. So blieb nur ohnmächtiger Zorn.
»Edward! Victoria!«, rief sie ihre Kinder, die erschrocken und fasziniert zugleich die Züchtigung beobachteten. »Kommt sofort her!«
Widerstrebend nahm der fünfjährige Junge seine zwei Jahre jüngere Schwester an die Hand und kehrte zu seiner Mutter zurück.
»Warum schlägt der Soldat den Mann, nur weil er müde und gestürzt ist, Mami?«, fragte Edward verstört.
»Weil er kein Herz hat … und ihm die Uniform mehr Macht über andere Menschen verleiht, als es sein dürfte«, sagte Jessica bitter.
»Dann will ich später auch eine Uniform tragen!«, verkündete Edward. »Ich will viel Macht haben …«
»Nein, das wirst du nicht! Und ich will nie wieder so etwas Ungehöriges aus deinem Mund hören, hast du mich verstanden?« In ihrer Erregung packte sie ihren Sohn fester an der Schulter, als es ihre Absicht war.
»Du tust mir weh, Mami!« Erschrocken über ihre heftige Reaktion blickte Edward zu ihr hoch.
Jessica löste ihren Griff und fuhr ihm entschuldigend über sein dunkles Haar. »Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber was du da gesagt hast, hat mich ärgerlich gemacht. Die Männer in den roten Röcken des Königs tun viel Unrecht! Wie also kannst du einer von ihnen sein wollen?«
Edward senkte den Kopf und schwieg.
»Die Soldaten waren nie unsere Freunde und werden es auch nie sein!«, sagte Jessica eindringlich. Wie alt sie auch werden mochte, nie würde sie vergessen und verzeihen können, was man ihr im Namen des Königs angetan hatte. Die Narben auf ihrem Rücken würden bis zu ihrem Tod ein beredtes Zeugnis von der Grausamkeit ablegen, die sie hatte erdulden müssen. »Behalte es für dich und rede mit keinem darüber, mein Junge, aber vergiss das nicht!«
»Nein, Mami«, versprach Edward kleinlaut.
»Ich mag keine Uniformen«, sagte Victoria und spielte mit einer Locke ihres blonden Haares, das unter ihrem Strohbonnet hervorquoll und einen herrlichen Kontrast zu ihrem blassrosanen Musselinkleidchen bildete. »Und ich möchte auch nicht nach England. Ich will nach Hause … zu Anne und Lisa.«
»Schst«, machte Jessica, als sie das Ruderboot anlegen sah, und öffnete den Schlag der Kutsche. »Rein mit euch. Ich bin gleich wieder zurück.«
Ian McIntosh sprang aus dem Ruderboot an Land, bedeutete dem Matrosen, dort zu warten, und kam Jessica entgegen. Er war ein hochgewachsener, gewöhnlich wortkarger Mann mit blassblauen Augen und einem dunkel gebräunten Gesicht. Von seinen achtunddreißig Jahren hatte er ein gutes Drittel in Australien verbracht und war beim Aufbau von Seven Hills in der Wildnis am Hawkesbury River von Anfang an mit dabei gewesen. Die ersten fünf Jahre als irischer Sträfling und Zwangsarbeiter, nach seiner Begnadigung dann als Aufseher und später sogar als Verwalter.
»Jessica, ich …« Er brach ab, als fiele ihm das Sprechen schwer.
Seit sie ihm eröffnet hatte, dass sie Seven Hills aufgeben und nach England zurückkehren wollte, war er nicht mehr derselbe. Wie oft hatte er nach dem Tod ihres Mannes Steve, der einem hinterhältigen Anschlag zum Opfer gefallen war, sie zu überreden versucht, ihre Meinung zu ändern und von ihrem Vorhaben Abstand zu nehmen. Doch ohne Erfolg. Dass Jessica mit ihren Kindern an Bord des Schiffes gehen und der Kolonie für immer den Rücken kehren wollte, traf ihn mehr, als er sich anmerken ließ – ja sogar mehr, als er sich selbst gegenüber eingestehen wollte.
»Ja? Was ist, Ian? Ist irgendetwas mit der Southwind oder dem Captain nicht in Ordnung?«
Er schüttelte den Kopf. »Der Captain ist in Ordnung und das Schiff auch«, brummte er fast widerwillig. »Sauber, gut in Schuss und ein verteufelt schneller Segler, wenn man den Worten der Mannschaft Glauben schenken kann.«
Jessica nickte und blickte mit einem fröhlichen Lächeln, das seine Niedergeschlagenheit noch verstärkte, zum Dreimaster hinüber. »Ja, es ist ein wirklich schmucker, eleganter Segler und bestimmt auch schnell. Welch ein Unterschied zu dem Ostindienfahrer, der mich nach acht Monaten qualvoller Enge im Zwischendeck hier an die Küste warf«, sinnierte sie, und ihr Gesicht verdunkelte sich.
»Ich habe mit Captain Foster gesprochen, wie Sie mich gebeten haben«, sagte er mit bedrückter Stimme. »Für Ihre Unterbringung ist gesorgt. Die Kajüte für Sie und die Kinder ist hergerichtet, und Sie können sie in Augenschein nehmen. Ich habe dem Matrosen gesagt, dass er warten soll.« Er deutete über die Schulter zum Ruderboot hinüber und fuhr dann mit einem grimmigen Unterton in der Stimme fort: »Es ist die beste Passagierkabine, wie Sie gewünscht haben, Jessica. Sie werden also Ihre Genugtuung bekommen.«
Jessica hob die Augenbrauen. »Genugtuung? Wie meinen Sie das, Ian?«
»Sie wissen verdammt gut, wie ich das meine!«, entfuhr es ihm unbeherrscht, und er vergaß völlig seine sonstige Zurückhaltung und Wortkargheit. »Die verrückte Idee, nach England zurückzukehren, entspringt doch nur Ihrem Verlangen nach Genugtuung und Vergeltung für angetanes Unrecht. Man hat Sie nach New South Wales ans andere Ende der Welt verbannt, und damit haben Sie faktisch nicht nur für die Justiz aufgehört zu existieren, sondern auch für alle anderen, denen Ihr Name jemals etwas bedeutet hat. Und nun wollen Sie als wohlhabende Dame und zahlender Passagier nach England zurückkehren und aller Welt beweisen, dass man Sie hier trotz größter Anstrengungen nicht kleingekriegt hat. Sie wollen sie beschämen und Ihre Genugtuung, so ist es doch!«
Jessica sah ihn an und nickte. »Ich glaube, Sie haben das besser und früher erkannt als ich, Ian.«
»Und ob ich das erkannt habe!«, polterte er weiter, da er schon mal in Fahrt war. »Doch da ist etwas, was Sie vielleicht nicht bedacht haben, Jessica. Was immer Sie suchen sollten, ob Seelenfrieden oder Vergeltung, in England werden Sie es nicht finden! Dort gibt es niemanden, der an Ihnen oder Ihrem Schicksal auch nur so viel interessiert ist!« Er schnippte mit den Fingern.
Jessica hob die Hand. »Ian, bitte, erregen Sie sich nicht. Ich weiß genau …«
Heftig schüttelte er den Kopf. »Gar nichts wissen Sie! Sonst würden Sie ja nicht die bodenlose Dummheit begehen, dieses Land zu verlassen. Was erwartet Sie denn in England? Und was wird vor allem aus Ihren Kindern? Ich weiß, Sie sind eine willensstarke Frau, und das Leben hier hat Sie hart gemacht. Zu hart, will mir manchmal scheinen. Und Sie werden die Demütigungen, mit denen man Ihnen in England begegnen wird, zu ertragen wissen. Aber nicht so Edward und Victoria! Sie werden dort immer die Kinder einer Deportierten sein, bis an ihr Lebensende. Die Gesellschaft wird sie schneiden und sie spüren lassen, dass sie einen lebenslangen Makel haben wie Aussätzige!«
»Da mögen Sie recht haben, Ian.« Jessica war von seinem Wortstrom betroffen und gerührt zugleich.
Ihr Verwalter machte eine unwillige Geste. »Gut, auch hier in der Kolonie gibt es Klassenunterschiede, und die freien Siedler sehen auf uns Emanzipisten, die begnadigten Sträflinge, herab. Aber die Dinge ändern sich. Wir bauen die Kolonie mit auf und gewinnen an Respekt und Ansehen. Eines Tages wird man nicht umhinkönnen, unsere Leistungen anzuerkennen. Außerdem ist für Ihre Kinder Seven Hills die geliebte Heimat, ein Ort voller Erinnerungen an ihren Vater, der für die Farm gekämpft und sein Leben gelassen hat. Dagegen muss England für sie so etwas sein wie für uns damals die Deportation. Können Sie das auf Ihr Gewissen nehmen, Jessica? Der Teufel soll mich holen, wenn ich es könnte!«
»Sie haben mit jedem Wort, das Sie gesagt haben, recht, Ian«, sagte Jessica ernst.
Das Blut schoss ihm ins Gesicht, als ihm bewusst wurde, was er sich da herausgenommen hatte. Es stand ihm nicht an, so mit ihr zu reden. Immerhin war sie die Besitzerin der Ländereien am Hawkesbury River und er nur der Verwalter. Auch seine langjährige Treue gab ihm nicht das Recht, sich so zu verhalten. Zerknirscht schaute er auf die Spitzen seiner derben Schuhe.
»Entschuldigen Sie«, murmelte er verlegen. »Ich verstehe nicht, wie mir das passieren konnte, Jessica. Es tut mir leid, dass ich mich habe hinreißen lassen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Sie werden schon wissen, was Sie tun. Das haben Sie immer gewusst, und dafür habe ich Sie stets bewundert. Kommen Sie, ich bringe Sie jetzt zur Southwind hinüber. Um Ihr Gepäck kümmere ich mich später.«
»Ich fahre nicht mit.«
Ian sah sie erstaunt an. »Sie wollen sich Ihre Kabine nicht anschauen?«
»Nein, weil ich keine Kabine brauche, Ian. Ich werde nicht nach England segeln. Sie haben völlig recht. Seven Hills ist der Ort, wo ich und meine Kinder hingehören.«
Ungläubiges Staunen trat in seine Augen. »Sie … Sie bleiben? Ist das Ihr Ernst, Jessica?«, stieß er hervor.
»Ja, das ist es!«, versicherte sie.
Ian ergriff ihre Hände, drückte sie und wusste vor Freude überhaupt nicht, was er sagen sollte. »Das ist wunderbar! … Ich kann es noch gar nicht glauben! … Sie bleiben wirklich! Dem Himmel sei Dank, dass Sie es sich doch noch überlegt haben. Dabei hatte ich die Hoffnung schon aufgegeben. Wir kehren also alle nach Seven Hills zurück?«
Sie lächelte ihn an. »Ja, ich hab den Entschluss schon gefasst, als Sie noch an Bord des Schiffes waren. Auf einmal habe ich klar erkannt, wie blind ich doch gewesen bin. So hart dieses Land auch sein mag, es ist meine Heimat geworden. Hier sind meine Kinder zur Welt gekommen, hier habe ich gelernt, der Wildnis fruchtbaren Boden abzuringen und Naturkatastrophen zu überstehen, hier leben die einzigen Freunde, die ich auf der Welt habe und hier liegt mein Mann und der Vater meiner Kinder begraben.«
»Und hier liegt Ihre Zukunft, Jessica«, fügte er bewegt hinzu. »Und die Ihrer Kinder.«
»Ja, so ist es«, stimmte sie ihm zu. »Wofür würde es sich für mich zu kämpfen lohnen, wenn nicht für die Farm, die Edward eines Tages erben wird? Hier ist mein Platz. Es hat lange gedauert, bis ich das erkannt habe, doch glücklicherweise ist mir die Einsicht nicht zu spät gekommen.«
Sein von Wind und Wetter gezeichnetes Gesicht strahlte. »Wissen es die Kinder schon?«
»Nein, aber warum sagen Sie es ihnen nicht?«, schlug Jessica vor, die wusste, wie sehr Ian an ihnen hing.
»Nichts lieber als das!«
Edward und Victoria waren vor Freude, dass ihnen die lange Reise mit dem Schiff und ein Leben in England erspart blieben, wie aus dem Häuschen. Sie fielen erst Ian und dann ihrer Mutter um den Hals. So jung sie auch waren, hatte das Land sie doch schon geprägt. Sie hatten sich deshalb auch nie mit dem Vorhaben ihrer Mutter anfreunden können, Seven Hills zu verlassen und in diesem fremden Land, das auch noch eine monatelange Schiffsreise entfernt lag, ein neues Leben zu beginnen – und das ausgerechnet noch in einer Stadt namens London, die tausendmal größer sein sollte als Sydney. Die Farm und der Fluss, die Tiere und ihre Freunde, das war ihre Welt. Schon das kleine Sydney, das ihnen so hektisch und eng erschien wie ein Bienenkorb, verabscheuten sie.
»Dann kann mir der alte Baker also doch noch ein neues Pferd schnitzen und mir zeigen, wie man Dingofallen baut! Und dann brauchen wir ja auch nicht länger diese schrecklichen Sachen anzuziehen, die ein Gentleman angeblich in England trägt!«, jubilierte Edward, der sofort den praktischen Nutzen der veränderten Situation erkannte. Auf Seven Hills hatte er nie so unbequeme Hemden mit Halskragen und enge Schnallenschuhe tragen müssen, wie er sie jetzt anhatte. »Fahren wir gleich zur Farm zurück, Mami?«
Jessica lachte. »Morgen, mein Kind. So lange werdet ihr es ja wohl noch bei den Keltons aushalten, oder?« Robert und Martha Kelton waren Freunde, die sie in ihrem Haus in Sydney für die Dauer ihres Aufenthaltes bis zur Einschiffung aufgenommen hatten – und die sich jetzt genauso freuen würden, wenn sie von ihren veränderten Plänen erfuhren.
»Und es werden sich noch einige mehr freuen, dass Sie sich eines Besseren besonnen haben«, sagte Ian McIntosh. »Ich sage jetzt dem Matrosen im Boot Bescheid, dass Captain Foster die Rückreise nach England ohne die Ehre Ihrer Gegenwart wird antreten müssen.«
Ian McIntosh lief schnell zum Ufer hinunter, um den Seemann mit der Nachricht zurückzuschicken, und eilte dann zur Kutsche zurück, wo er neben Jessica auf der samtbezogenen Sitzbank Platz nahm. Edward und Victoria saßen ihnen gegenüber. Die Kutsche ruckte an.
Kaum hatten sie die Anlegestelle hinter sich gelassen, als Jessica sich ihrem Verwalter und treuen Vertrauten zuwandte. »Würden Sie mir einen Gefallen tun, Ian?«
»Jederzeit. Aber das sollten Sie eigentlich längst wissen«, sagte er, und ein leichter Vorwurf schwang in seiner Stimme mit. »Was haben Sie auf dem Herzen?«
»Mir ist jetzt nicht nach Fahren mit der Kutsche zumute. Ich möchte ein wenig laufen und wäre Ihnen für Ihre Begleitung überaus dankbar«, sagte Jessica, die innerlich zu aufgewühlt war, um sich jetzt sofort der herzlichen, aber nichtsdestoweniger anstrengenden Beredsamkeit und übertriebenen Fürsorge ihrer Gastgeber aussetzen zu wollen. Sie hatte das Verlangen nach etwas Abstand und Ruhe, um selbst erst einmal Ordnung in ihre Gedanken zu bekommen und sich mit den Konsequenzen ihres Entschlusses auseinanderzusetzen. Dafür war Ian sicher ein besserer Gesprächspartner als die Keltons, deren überschwängliche Art sie gelegentlich als erdrückend empfand.
»Ein Spaziergang? Nichts lieber als das, Jessica!« Seine Augen leuchteten. Schnell beugte er sich aus dem Fenster und rief Craig, dem alten halbtauben Kutscher, lauthals zu, er solle anhalten. Als die Kutsche zum Stehen kam, öffnete er den Schlag und half Jessica beim Aussteigen.
Edward und Victoria maulten, weil sie nun allein zu den Keltons fahren mussten.
»Wir werden nicht lange weg sein«, versprach Jessica und gab Craig den Auftrag, die Kinder zu ihren Gastgebern zu bringen und auch sicherzugehen, dass sie ins Haus gingen und sich nicht draußen auf der Straße herumtrieben.
»Werd die Kleinen wie meinen eigenen Augapfel hüten, Misses«, versicherte Craig nuschelnd, tippte an die ausgefranste Krempe seines breiten Strohhutes und schnalzte mit der Zunge.
Die Pferde legten sich wieder ins Geschirr, und die Kutsche rumpelte weiter.
4
Jessica spannte ihren Parasol auf, um sich vor dem Licht zu schützen, das schon jetzt im Frühjahr von einer Intensität war, wie man sie nördlich des Äquators kaum während der Sommermonate kannte.
Die Septembersonne warf ihren warmen Schein auf Sydney und die kaum bewegte See der weiten Bucht, die von zwei langgestreckten Landzungen mit schroffen Erhebungen an ihren Enden schützend umschlossen wurde. Keine zwanzig Jahre waren seit der Gründung der Siedlung an diesem weiten, wunderbaren Naturhafen und der Sträflingskolonie New South Wales vergangen. Und wenn Sydney auch noch weit davon entfernt war, den Charakter einer richtigen Stadt zu haben, so zeigten sich doch schon Ansätze dazu. Auf jeden Fall war die Zeit vorbei, als sich hier nur einige Dutzend schäbige Lehmhütten am Ufer drängten. Von Jahr zu Jahr wurden mehr solide öffentliche Gebäude und auch Privathäuser sowie Ladengeschäfte aus Ziegelsteinen errichtet, die unweit von Sydney auf Brickfield Hill gebrannt wurden. Doch noch immer gab es Viertel, in denen die Behausungen nur aus primitiven Lehmhütten bestanden.
Am Hafen hatten sich neben der regierungseigenen mittlerweile schon mehrere private Werften angesiedelt, die sich jedoch auf den Bau kleiner Boote beschränkten. Es gab neue Warenlager und Getreidespeicher. Die alten Militärbaracken waren neuen, dauerhafteren Unterkünften gewichen. Und auf der Westseite von Sydney Cove erhob sich das trotzige Fort, das noch Gouverneur King hatte errichten lassen. Dahinter erstreckte sich das Lasterviertel der Stadt, das The Rocks genannt wurde, weil die unzähligen Grog- und Rumkneipen, die Spielschuppen und Bordelle eine felsige Halbinsel überwucherten, die weit in die Bucht hinausreichte. Hier rann der Rum Tag und Nacht durch die durstigen Kehlen von freien Siedlern, Emanzipisten und Sträflingen, wurden Existenzen am Spieltisch ruiniert und suchten Männer bei Prostituierten ein kurzes, käufliches Glück. Kein Laster, das hier nicht seinen Anbieter hatte und seinen Abnehmer fand.
»Was für ein prächtiger Tag!« Ian McIntosh ging neben ihr her und wusste mit seinen großen, schwieligen Händen nicht wohin. Mal verschränkte er sie auf dem Rücken, mal hakte er die Daumen hinter den breiten Gürtel aus Känguruleder. Sie überquerten die kleine Brücke, die nahe des Gouverneurspalastes über das kleine Flüsschen namens Tank führte, und wandten sich nach links.
»Ja, ein herrlicher Frühlingstag«, stimmte Jessica ihm zu und atmete die angenehm warme Luft, die den Geruch des Meeres mit sich trug, tief ein. »Von mir aus könnte es immer September bleiben. In ein paar Monaten werden wir nachts vor Hitze nicht mehr schlafen können, der Boden wird unter der Glutsonne aufbrechen, und die Angst vor Buschbränden wird uns bis in den Februar nicht verlassen.«
»Denken Sie noch nicht an den Sommer, Jessica, denken Sie an das Jetzt«, erwiderte Ian für seine Art ungewöhnlich aufgekratzt. »Die Siedler oben am Hawkesbury werden sich freuen, Sie wiederzusehen … und wenn Sie mir die Bemerkung verzeihen, so wäre es doch vielleicht ganz angebracht, die Nachbarn auf Seven Hills einzuladen.«
»Ein Fest?«
Ian warf ihr einen schnellen prüfenden Seitenblick zu, um zu sehen, ob er sie mit seinem Vorschlag vielleicht nicht verletzt hatte. Steves Tod hatte sie tief getroffen und aus dem inneren Gleichgewicht geworfen. Aber immerhin waren schon fast neun Monate vergangen, seit sie ihn auf Seven Hills begraben hatte. Das war eine lange Zeit der Trauer, wenn man die eigenen Gesetze dieser Kolonie zum Maßstab nahm. Noch immer litt New South Wales unter einem Mangel an Frauen. Und zusammen mit der Tatsache, dass hier jeder Tag aufs Neue einen Kampf ums Überleben mit sich brachte, waren lange Trauer und Alleinsein ein Luxus, den sich kaum jemand leisten konnte – ob nun Mann oder Frau. Auch Jessica würde an dieser Einsicht nicht vorbeikommen. Sie musste sich wieder unter Menschen begeben und einen Mann finden, der das Bett mit ihr teilte, in guten und bitteren Zeiten an ihrer Seite stand und ihren Kindern ein Vater war. Mit Liebe hatte das wenig zu tun, sondern mit unumgänglichen Notwendigkeiten. Aber vielleicht war das hier für eine solche Anspielung weder der rechte Ort noch die rechte Zeit.
Doch er sah ein versonnenes Lächeln auf ihrem Gesicht und atmete innerlich erleichtert auf. »Ja, warum eigentlich nicht? Es hat auf Seven Hills schon lange kein Nachbarschaftsfest mehr gegeben. Viel zu lange nicht. Es ist in der Tat an der Zeit, dass wir auch in dieser Hinsicht zu einem normalen Gang der Dinge zurückkehren«, sagte sie und brachte damit auf sehr zurückhaltende, aber nichtsdestotrotz unmissverständliche Weise zum Ausdruck, dass sie sich nach dem Tod von Steve lange genug von allen gesellschaftlichen und geschäftlichen Belangen abgekapselt hatte.
»Ian, welches Geschäft hat zurzeit die beste Auswahl hier in Sydney?«, fragte Jessica, einer spontanen Eingebung folgend. Seit dem Tod von Steve hatte sie nicht mehr diese Unbekümmertheit, diese Fröhlichkeit und Lebensfreude empfunden, die sie nun erfüllte, da ihr Entschluss, in Australien zu bleiben, gefasst war. Dies war ein Tag, der eine kleine Extravaganz rechtfertigte. Sie würde etwas für sich, für die Kinder und für Ian erstehen.
Er sah sie verwundert an. »Wieso fragen Sie?«
»Mir ist nach ein wenig Verschwendung zumute«, gestand Jessica mit einem Anflug von Verlegenheit. »Wir sollten wirklich ein Fest geben, Ian. Ich werde Steve nie vergessen. Wenn er damals nicht gewesen wäre …« Sie führte den Satz nicht zu Ende, weil sie sich nicht wieder in schmerzliche Erinnerungen flüchten wollte. Einmal musste Schluss sein mit Flucht in die Vergangenheit und der Verbitterung, die ihre Tatkraft gelähmt hatte. »Doch Steve ist tot. Nichts kann ihn in diese Welt zu mir zurückholen, und damit muss ich mich abfinden. Und die beste Art, sein Andenken zu bewahren, ist, den Weg fortzusetzen, den er begonnen hat.«
Ian nickte. »So gefallen Sie mir schon bedeutend besser, Jessica. Sie sind noch viel zu jung und zu schön, um den Rest Ihres Lebens als sich grämende Witwe zu verbringen«, sagte er unbedacht, und das Blut schoss ihm augenblicklich ins Gesicht, als er sich seiner eigenen Worte bewusst wurde. Nicht einmal in all den vergangenen Jahren hatte er sich von seiner stillen Bewunderung, die er für Jessica empfand, so weit fortreißen lassen, dass er auch nur ein Wort über ihre Anmut und erregende Ausstrahlung hätte fallen lassen. Eher hätte er sich die Zunge herausgerissen. Und nun war ihm diese höchst unschickliche, schwärmerische Bemerkung herausgerutscht. Er hätte sich selbst ohrfeigen mögen. War das nicht mal wieder ein Beweis, dass er seiner eigenen Zunge nicht halb so gut vertrauen konnte wie seinen Händen, die seinem Willen auch gedankenlos gehorchten und ihm niemals Schande gemacht hatten? Was war nur in ihn gefahren, dass er sich heute so vergaß?
Jessica bemerkte es nicht. Sie lachte verhalten auf und genoss sein Kompliment. Es war herrlich, wieder frei durchatmen und lachen zu können. Wie lange hatte sie schon nicht mehr gelacht?
»Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie auch die Kunst der Schmeichelei beherrschen, Ian«, sagte sie amüsiert und wich schnell einem Ochsengespann aus, das um eine Straße gerumpelt kam.
Ian hielt es für ratsamer, das Gespräch auf weniger gefährliche Themen zu lenken. »Sie fragten mich vorhin nach dem Geschäft mit der besten Auswahl …«
»Da mir nun die nicht unerheblichen Kosten der Schiffspassage erspart bleiben, denke ich, mir den Luxus einiger neuer Kleider nach langer Zeit mal wieder leisten zu können. Zumal Sie mich dazu überredet haben, auf Seven Hills demnächst ein Fest zu geben.«
Ian McIntosh strahlte. Ihr Wunsch, Einkäufe zu tätigen, die ihrer weiblichen Eitelkeit galten, erschien ihm als das sicherste Zeichen, dass sich ihre schmerzenden Wunden zu schließen begannen – und sie bald wieder die Jessica sein würde, die er kannte und verehrte.
»Und was das für ein Fest sein wird, Jessica!«, versicherte er überschwänglich. »Man wird noch Jahre später am Hawkesbury davon sprechen, ach was, in der ganzen Kolonie! Das verspreche ich Ihnen!«
Er fühlte sich leicht berauscht und hatte das unendlich erleichternde Gefühl, als hätte man ihm eine Zentnerlast von den Schultern genommen. Die letzten Monate waren nicht nur für sie, sondern auch für ihn schlimm gewesen. Das Leben auf Seven Hills war von ihrer Trauer und ihrem blinden Zorn auf das ungerechte Schicksal überschattet gewesen. Jessica war nicht sie selbst gewesen. Doch nun war ihm, als wäre sie endlich wieder zu ihnen, zu den Lebenden zurückgekehrt. Und er wusste, dass sie sich nicht länger treiben lassen würde.
Es war wie das erste goldene Licht nach einer Nacht, von der sie geglaubt hatte, dass sie niemals enden würde. Die Träume und die Tränen würden sie wohl noch in vielen Nächten begleiten, doch die Tage würden wieder voller Licht und froher Farben sein.
5
Mühelos teilte der Bug der Andromeda die sanft anrollenden Wellen der nachtschwarzen See. Das von Wind und Wetter gebleichte Segeltuch an den Rahen hob sich als fahle, graue Fläche vor dem Kreuz des Südens ab. Fünf Sterne, die verloren an einem gewaltigen Firmament standen und bald schon verblassen würden, wenn die aufsteigende Sonne die nächtliche Schwärze mit ihrer Lichtflut davonschwemmte.
Doch noch war es zu früh, um nach den Vorboten des Sonnenaufgangs am östlichen Horizont zu suchen. Mannschaft, Passagiere und Sträflinge lagen noch im Schlaf – bis auf die Wache an Deck und die vier Männer in der Offiziersmesse. Tabakwolken hingen unter der Decke und vermischten sich mit dem intensiven Geruch von Kapbrandy und schwerem Port.
Lieutenant Kenneth Forbes hatte seinen Uniformrock schon um Mitternacht abgelegt und dem Alkohol nur in Maßen zugesprochen. Lange Nächte am Spieltisch waren ihm vertraut, und er wusste sich darauf einzustellen. Ein Trottel, der seinen Verstand vernebelte und sich unter dem Einfluss von Brandy dazu verleiten ließ, mehr zu wagen, als seine Karten hergaben – oder seine finanziellen Verhältnisse erlaubten.
»Und ich sage Ihnen, dass es für dieses Gesindel nur einen einzigen passenden Ort gibt, Gentlemen!«, verkündete Silas Collway, der Erste Offizier der Andromeda, und mischte die Spielkarten. »Und das ist weder das Zwischendeck eines Ostindienfahrers noch die Wildnis einer Sträflingskolonie, egal, wie weit sie von England auch entfernt liegen mag!«
»Sondern?«, fragte Edward Chambers mit höflichem Interesse, obwohl ihm an den oftmals obskuren Ansichten dieses sehnigen, schmalgesichtigen Mannes nicht viel gelegen war.
Silas Collway war für ihn und wohl auch für Lieutenant Forbes und Mister Jonas Marwick nur als Partner beim Kartenspiel von bescheidenem Interesse.
»Der Galgen!« Der Erste fuhr sich mit der flachen Hand demonstrativ über die Kehle. »Aus und weg mit ihnen! Ich sage Ihnen, dass man nur so der überhandnehmenden Kriminalität in unserem Land Herr werden kann!«
»Ein Lösungsvorschlag, der in seiner Radikalität zweifelsohne seinesgleichen sucht und gewiss seine Vorzüge hat«, bemerkte Jonas Marwick, ein Mann von schwergewichtiger Statur, und fügte dann mit sarkastischem Unterton hinzu: »Nur scheint mir dabei der Aspekt der Verhältnismäßigkeit der Mittel und der Barmherzigkeit ein wenig zu kurz zu kommen.«
»Barmherzigkeit?«, stieß der Erste verächtlich hervor. »Haben sie denn Barmherzigkeit ihren Opfern gegenüber gezeigt? Nein, Auge um Auge, Zahn um Zahn! So steht es schon in der Heiligen Schrift! Außerdem: Wer bezahlt denn die Passage der Deportierten, Gentlemen? Das Geld kommt aus der Staatskasse, und die haben wir gesetzestreuen Bürger mit unseren Abgaben zu füllen! Wir sind es, die für dies Gesindel zu bezahlen haben. Sechs, sieben Monate Unterkunft und Verpflegung!«
Kenneth hob spöttisch die Augenbrauen. »Die Ausgaben dürften nicht sehr hoch sein, wenn ich bedenke, welcherart Unterkunft und Verpflegung sind«, hielt er ihm vor. Die Andromeda hatte hundertvierzehn Sträflinge an Bord, die schlimmer als das Vieh im Laderaum im Zwischendeck eingepfercht waren. Zwar empfand er nicht das geringste Bedauern für diese ausgemergelten Gestalten, die täglich einmal für eine halbe Stunde an Deck getaumelt kamen und ins Tageslicht blinzelten, doch die Argumentation des Ersten Offiziers erschien ihm als zu übertrieben, um sie unwidersprochen hinzunehmen.
»Jedes Pfund, das diese Verbrecher uns kosten, ist ein Pfund zu viel!«, beharrte Silas Collway. »Der Strick ist billiger!«
Edward Chambers schenkte sich Port nach und tauschte mit Jonas Marwick, der ihm gegenübersaß, einen gelangweilten Blick. »Sie mögen Ihre Gründe für Ihre Einstellung haben, Mister Collway. Doch Sie vergessen dabei, dass diese Sträflinge, deren Passagen ein paar Pfund kosten, für den Aufbau der Kolonie unersetzlich sind.«