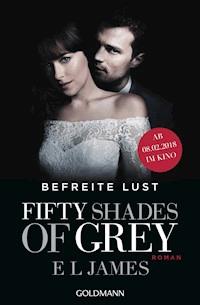Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
12 Liebesgeschichten - jede einzelne ein bunter Splitter im Spiegel der Jahreszeiten. Gefunden und zum 'Himmelgelb' zusammengefügt. 'Himmelgelb' - eine kindliche Wortschöpfung der Autorin. Scherzhaft und zugleich ernsthaft für einen strahlend blauen Himmel mit leuchtender Sonne. In Bezug auf diese Sammlung von Contemporary Romances, Erotischen Kurzgeschichten und Lovestorys bedeutet 'Himmelgelb' aber weit mehr. Das strahlend Schöne scheint sich unheilschwanger zu färben in gefährliches Gelb. Die Paare zwischen 17 und 70 erleben Krisen und entscheiden sich überraschend. Die Leserin, der Leser - plötzlich mittendrin im Geschehen – würden sie ähnlich denken, fühlen und handeln? Ob nun das Tanzenlernen, ein verwechseltes Hotelzimmer, Sprachlosigkeit, eine besondere Malerei, ein heimlicher Beobachter oder eine ernsthafte Erkrankung im Fokus stehen: trotz jugendlicher Achtzehn oder junggebliebener Achtzig - man wird sich auf jeden Fall zwischen One-Night-Stand und Happy End in wechselnden Erzählperspektiven voll intensiver Poesie wiederfinden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gudrun Baruschka
Himmelgelb
zwölf Liebesgeschichten mit dem gewissen Etwas
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Himmelgelb
Bilder und Verse
Nacht der Teelichter
Himmelgelb
Rot wie Blut
Date
Sandige Rose
Der Falter in der Regenhaut
Lotosblüteningwer
Der Kranich
Rügenherbst
Zimmer 69
Grünes im Sack - Die etwas andere Weihnachtsgeschichte
Impressum neobooks
Himmelgelb
Himmelgelb
zwölf Liebesgeschichten
mit dem gewissen Etwas
von
Gudrun Baruschka
Bilder und Verse
Wie immer ließ sie die Öffnungszeiten unbeachtet und fand das Museum verschlossen vor. So ging sie durch den Personaleingang über den verwinkelten Hof und traf dort auf eine ältere Frau mit hellblauem Kopftuch, die gerade einen Eimer voll Wischwasser ins vorjährige Gras goss. Betty wechselte die Mappe unter den anderen Arm und streckte der Putzfrau die Hand entgegen. Die schob sich erst Grausträhnen unters Kopftuch zurück und strich ihre Rechte an der Schürze ab.
„Tag, Betty! Der Doktor sagte heut früh, dass Sie kommen werden. Aber nu’ hab ich mich doch erschreckt.“
„Aber Frau Krug“, lachte Betty, „mit Ihrem Schrubber jagen Sie doch jeden Strolch in die Flucht!“
„Jawohl“, bekräftigte die Frau. „Der Doktor lässt ausrichten, dass Sie alles auf seinen Schreibtisch legen sollen. Er bittet Sie, die Kleine Galerie aufzusuchen.“
Nickend hörte Betty noch im Weitergehen die geheimnisvoll anmutende Bemerkung:
„Sonntag wird eine neue Ausstellung eröffnet. Sie werden staunen. ’Metamorphosen’. Ein ganz junger Künstler...“
Aus der Frühlingshelligkeit in den Hausflur getreten, umfing sie wie so oft jene eigenartige Atmosphäre. Die alten Holzwände, die hohen schweren Türen in den dämmrigen Gängen und die Stuckdecken betrachtete sie wie eine Fremde. Und doch überströmte sie eine Welle des Zuhauseseins.
Zielsicher drückte sie eine Messingklinke und betrat einen kleinen Raum. Die dunklen gedrechselten Holzstühle, den runden Tisch mit Mamorplatte, die Bücherregale ringsum, das schmale hohe Fenster, ja selbst den Topf mit blutroten Alpenveilchen kannte Betty gut.
Hier war einmal ihr Büro gewesen. Das angrenzende Zimmer gehörte Dr. Christoph, einem Philologen und Altertumsforscher, dem Direktor des Museums. Die Tür war offen, und sie ging hinein, warf einen einzigen Blick über Ordner und Bücher, die aufgeschlagen oder mit Zetteln markiert auf Tischen und Stühlen herumlagen. Das Telefon stand auf dem Erdboden, lose über einer Stuhllehne zerknautschte ein Jackett; ein voller Aschenbecher verpestete die Luft.
Wie früher, dachte Betty, schob ein paar Zeitungen und beschriebene Blätter beiseite und legte ihre Manuskripte dazu.
Seit fast einem Jahr brachte sie Dr. Christophs handgeschriebene Abhandlungen für Fachzeitschriften maschinenschriftlich ins Reine, gab sie zurück und holte sich neue Heimarbeit. Seit sie ihre beiden Kinder bekommen hatte und daheim aufzog, war diese Honorararbeit nicht nur Mittel zum Zweck für sie und den Doktor, sondern enges Kontakthalten, da sie sich aus vier Jahren gemeinsamer Museumstätigkeit achteten.
Als Betty die Galerie betrat, in der oftmals Glanzstücke namhafter oder auch unbekannter Maler, Grafiker oder Bildhauer die ständige heimatgeschichtliche Präsentation des Museums bereicherten, fand sie auch hier niemanden vor.
Sie sah aber, dass jemand nur kurzzeitig seine Arbeit unterbrochen haben konnte, denn mehrere Aquarelle waren schon aufgehängt worden, andere standen sortiert an den Wänden entlang; Scheren, leere Rahmen, Rollen mit Angelsehne und Passepartouts unterschiedlicher Größen lagen verstreut. So beschloss Betty, zu warten und vertiefte sich in den Anblick einiger Zeichnungen in ihrer Nähe. Zuerst nur interessiert, blickte sie bald überrascht, ja fasziniert in eine Welt voller Farben und Linien mit unerhörter Kraft. Und hatte sie beim ersten Bild jene winzige Farbnuance fast übersehen, so tauchte sie in anderen Arbeiten immer wieder auf. Sie war sparsam verwendet worden, zwang jedoch magisch die Augen auf sich und – Betty kannte diese Farbe irgendwie.
Sie grübelte. Hatte Frau Krug nicht von einem jungen Künstler gesprochen? Hatte sie nicht orakelt, sie, Betty, würde erstaunt sein? Was meinte sie nur?
Gerade Neunzehn war sie gewesen und hatte als Sekretärin im Museum zu arbeiten begonnen. Zu dieser Zeit wohnte ein Praktikant für ein halbes Jahr in einem Kämmerchen unterm Museumsdach, war Mieter, Wächter, Hausmeister, Führungspersonal und Künstler zugleich und fühlte sich offensichtlich wohl. Die Abende und Wochenenden hockte er vor seiner Staffelei und malte. Sie hatten ihn alle Simba genannt, wohl, weil sein Nachname Loewe lautete.
Betty entsann sich seiner Gestalt. Schlank war er und bewegte sich lässig, hatte dichtes wildes Haar. Ein Bart umgab seinen vollen Mund. Er lächelte oft. Die Stimme klang angenehm weich; auffallend die unruhigen Hände mit den sauberen rundgeschnittenen Nägeln. Betty kam gut mit ihm zurecht. Simba war ihr Interesse für Kunst und Literatur aufgefallen. Als Betty das seine dafür entdeckte, zeigte sie ihm vertrauensvoll und auch mit leisem Zaudern ihre Gedichte. Noch sagte er dazu nicht viel, aber ließ Betty als ebenso vertrauensvolle Antwort in seine Arbeit als Maler schauen.
Als Betty sich das erste Mal bewundernd den Bildern gegenübersah, fühlte sie sich klein und unscheinbar in ihren Versuchen, sich anderen Menschen mit Worten mitzuteilen. Welch eine Kraft aber steckte in den Farben und Formen! Simbas Ideen fesselten Betty; die fertigen Malereien beschäftigten sie eindringlich. Es lag etwas Phantastisches, Irreales, Verinnerlichtes in ihnen.
Aber bald wandelte sich ihre friedliche Bewunderung in heftigen Streit, denn nach und nach zeigte er ihr seine neuesten Arbeiten, und die erschreckten Betty, stießen sie ab. Meist nur in Grau, Braun oder Schwarzweiß gehalten, mit menschlichen Körpern, denen etwas fehlte, ein Bein, ein halber Arm, der Kopf oder ein Fuß; kastenförmige Bauten dahinter oder daneben. Der Gegensatz zu seinen Bildern vom Anfang ihrer Bekanntschaft war ungeheuerlich.
„Was soll das?“
„Das ist unsere Welt, Betty.“
„Wo sind denn die Farben, wo ist die Natur?“
„Hast du sie beim Leben in Betonblöcken? Siehst du da Wiesen und Wälder?“
„So liegt es an uns. Wir müssen sie mehr in unseren Lebenskreis holen.“
„Falsch! Wir sollten sie nicht vernichten. Wir grauen uns selbst ein.“
„Warum zerstückelte Menschen, Simba?“
„Die Erde ist so im Großen: Länder. Die in sich selbst: Parteien. Du kannst das fortführen bis zu einem einzelnen Individuum. Alles ist uneins, zerstört, wirkt auf anderes ebenso ein.“
„Das ist deprimierend. Ich seh’s anders. So hör doch!“
Sie deklamierte:
„Dunkles Atmen, friedlicher Schlaf,
haschende Nebelfiguren,
da ein schmaler Lichtstreif sie traf,
verschwanden sie ohne Spuren,
im frischen Wind ein Wispern lag,
es regten die Wipfel sich bald,
im Lärmen der Vögel nahte der Tag
und Sonnenfinger neckten den Wald.“
„Deine Verse... sie sind mir zu banal, zu lyrisch!“, entschied Simba energisch.
„Was hast du gegen Poesie?“
„Nichts gegen Schiller und Heine... aber heutzutage solche Worte zu verwenden, haut nicht hin. Siehst du nicht, wie gefährdet unser Leben ist? Autos überfahren Menschen und Tiere, Flugzeuge stürzen ab, Bäume werden zu Tausenden gefällt...“
„Ich bin ja nicht blind. Das geschieht. Schlimm genug. Wir Menschen sind schuld. Das ist erkannt; wir ändern es doch schon. Idylle zu lassen, ist uns nicht gegeben. Wir könnten nicht mehr existieren.“
„Warum schreibst du dann sowas ohne den Schrei, dass der Regenwald stirbt?“
„Es besteht ja aus reiner Beobachtung. Ich empfinde so und gebe ein romantisches Bild weiter an Freunde, die es nicht sehen konnten oder einfach nicht darauf geachtet haben. Manche Leute erleben gleiches. Das bestärkt doch. Was du hineinhaben möchtest, verdirbt diese Verse. Sie sind eine lyrische, zugegeben romantische, Impression.“
„Romantik... Kitsch ist das!“
„Halt, Simba. So red nicht mit mir! Sind dein ‚Schlangenmensch’ oder der ‚Kophta’ keine romantischen Bilder?“
„Ja, verflucht noch mal. Doch die Sachen verkauf ich. Hab schon lange das Gefühl, der Ramsch müsste verschwinden. Wie konnte ich das malen?“
Auf und ab wanderte Simba mit raumgreifenden Schritten in der engen Kammer, fuhr sich durch die Haarflut und funkelte Betty aufgebracht an. Die schwieg nun, war verletzt und verstimmt, verabschiedete sich auch bald und verließ seine Dachkammer zum ersten Mal ohne Bedauern.
Sie wusste schon, dass sie Simba gern hatte. Ihre gemeinsame Arbeit verband. Mit Witz und Lachen meisterten sie viele Schwierigkeiten. Sie fühlte oft, wenn er sie ansah, dass auch sie Simba etwas bedeuten mochte. Deshalb konnte sie ihre steten Reibereien über seine Grafiken und ihre Gedichte nicht verstehen. Es machte sie verrückt, dass sie sich in ihren Auffassungen so voneinander entfernt hatten und keiner dem anderen ein Recht einräumen wollte.
Sie hätte viel darum gegeben, zu sagen: „Also gut, jetzt hast du mich überzeugt.“
Dann wäre in seinem Gesicht etwas Frohes gewesen. Vielleicht auch hätte er sie dann an sich gezogen und geküsst, wie sie es sich wünschte in manchen Augenblicken. Aber... es ging nicht.
Ihre Verse mit den zarten Umschreibungen und kraftvollen Eindrücken zu tauschen gegen seine faden quälenden Zeichnungen... nein, so waren das Leben und die Welt nicht. Und, dass sie nie so sein werden, dafür wollte sie mit Worten eintreten, wollte bewahren, was sie sah und fühlte.
Betty wusste nicht, wie es Simba erging. Ob er wohl manchmal ebenso innig gewollt hatte, sie zu verstehen?
Die Praktikumszeit verging. Simba zog aus der Dachkammer und verließ die Stadt.
Eine fröhliche bunte Collage lag zum Abschied auf Bettys Schreibtisch.
Betty ertappte sich eben dabei, immer noch auf eines der Bilder in der Kleinen Galerie des Museums zu starren, genau in diese silberkühle glasblaue Stelle hinein. Warum war ihr nur all das wieder eingefallen? War dieses atemberaubende Blau daran schuld?
Sie vernahm ein Geräusch und wandte sich um. Dr. Christoph war hereingekommen. Kleinwüchsig, mit schütterem Haar und wie immer rauchend eilte er auf sie zu, fasste ihre Hand und strahlte:
„Gut, dass Sie hier sind, Betty ... über die Manuskripte lassen Sie uns nachher reden... Was sagen Sie zu den Malereien? Sie haben sich doch sicher schon umgesehen, nicht wahr? Der Mann zeigt Talent, finden Sie nicht ... und er wollte seine Bilder unbedingt in unserer Stadt, in unserer Galerie ausstellen...“
Ehe Betty darauf antworten konnte, erschien ein junger Mann in der Tür. Während er herankam, sagte er, und die Stimme kannte sie:
„Unser Streit von damals hat mir keine Ruhe gelassen.“
Als er sehr nah war, flüsterte er fast fassungslos, weil er es wohl selbst erst in diesem Moment erkannte:
„Es ist die Farbe deiner Augen, die mich verfolgt hat. Ich habe es immer wieder malen müssen, dieses silberkühle, glasreine Blau...“
Nacht der Teelichter
Als sie die Gartenpforte öffneten, summten beide noch immer. Drei Stunden live Electric Light Orchestra. Die Autorückfahrt hatte der Stimmung des Konzerts nichts anhaben können, immer wieder hatten sie sich verliebt angesehen und berührt.
Ihr Haus war dunkel, barg eine zärtliche Stille, in die sie eintauchten mit pochenden Herzen, mit verstohlenem Lächeln. Diese Nacht würde ihre sein...
Sie hatten ein bisschen nachgeholfen. Ihr Zwölfjähriger war begeistert darauf eingestiegen, bei seiner Lieblingsoma übernachten zu dürfen. Ihr mittelster Sohn und die große Tochter gingen schon lang eigene Wege, verbrachten natürlich diese Freitagnacht mit Freunden in der Disco, würden sowieso erst beim Hellwerden heimkommen.
Bereitwillig überließ Bea Arno das Bad, nahm geschliffene Weingläser aus der Bar, stellte sie neben ihre Betten, zog aus ihrem Nachtschränkchen das schwarze Negligé, legte ihren Silberschmuck ab, kleidete sich aus...
Arno stöhnte überrascht auf, als sie zu ihm in die Dusche kam und sich unter den warmen Wasserstrahlen an ihn schmiegte. Er suchte und fand ihren Mund. Weicher Schaum floss von seinen Armen über ihren Rücken zu den Füßen hinab...
Als sie sich etwas atemlos von seinen Lippen löste, griff er fast ohne hinzusehen nach Beas Duschgel und begann, ihren Körper langsam damit einzuseifen. Sie half ihm dabei, führte seine Hände über ihre üppigen Brüste, über ihre runden Hüften, lehnte sich verspielt gegen ihn, spürte und sah seine Erregung. Mit kleinen schnellen Küssen lenkte sie ihn jedoch in Richtung Kabinentür, stupste ihn sacht fort und sagte lächelnd: „Den Rest mach ich allein.“
Ihre Stimme vibrierte leicht.
Als er endlich ausstieg, pfiff er.
Ein Meer aus brennenden bunten Teelichtern empfing Bea, als sie das Schlafzimmer betrat. Rings um ihre Betten hatte Arno sie auf den Nachttischen und Regalen angeordnet und ins Fenster gestellt.
Er trat ihr jetzt mit den gefüllten Gläsern in den Händen entgegen.
„Mhm, Rotwein“, schwärmte Bea und nahm ihr Glas.
Sie stießen an, und bevor sie tranken, küssten sie sich. So hatten sie es seit jeher getan, über zwanzig Jahre lang. Durstig trank Bea gleich aus, Arno füllte nach und schaltete Musik ein. Ihre CD. Electrik Light Orchestra. Innig tanzten sie. Fast auf der Stelle.
„Weinrot steht dir“, neckte Bea, und Arno war für einen winzigen Moment irritiert. Meinte sie seinen Pyjama? Kecker Augenaufschlag. Ach so, seine Wangen, die der Wein gerötet hatte. Es war einfach immer so, er konnte es nie verhindern.
„Und das kleine Schwarze dir...“, lenkte er ab und streifte den dünnen Träger von ihrer noch sommerbraunen Schulter.
„Du stehst mir“, seufzte Bea überzeugt und hielt ihn ganz fest.
„Wir stehen uns beide“, beeilte er sich, die drei unsichtbaren Punkte in ihrem Satz zu vollenden.
„Wie recht du doch hast“, flüsterte sie, ganz an ihn gedrückt.
„Ich hab doch immer recht.“
Da boxte sie ihn leicht, traf nicht, weil er auswich. Aber ganz schnell hatte er sie wieder im Arm, hörte ihr Murmeln: „Für heute Abend jedenfalls hast du recht. Das ist mal sicher. Früher aber, da hatte ich immer recht...“
Dieses Du-und-ich-Spiel amüsierte sie beide wie immer, wer was und wann sagte und ungesagt hörte. Jetzt verschloss Arno gerade ihren Mund mit wilden Küssen und versuchte, ihre freche Zunge zu bändigen.
Bea kam zu sich durch die glatte Kühle des Lakens unter ihrem bloßen Rücken. Sie hielt sich an Arnos Oberarmen fest, gab sich seinen fordernden Händen hin, stöhnte schon auf in Gier nach jener warmen reißenden Berührung in ihrem Schoß. Dann kam ein Rausch aus Gefühlen und Erleben, stieg an und ebbte ab, gipfelte in einem spitzen Lustschrei, der Arno eine Gänsehaut über den Körper trieb, die Bea wiederum unter ihren Fingerkuppen fühlen konnte.
Als sie später ihren Wein austranken, wechselte Arno auch eine Reihe der Teelichter aus und entzündete sie. Und dann rieb er jeden Zentimeter von Beas Körper mit warmem, würzig duftendem Massageöl ein. Er wusste ganz genau, wie gern sie das mochte. Er konnte sie fast wie eine Katze schnurren hören, und wenn sie sich zwischendurch an seine Brust verkroch, kneteten ihre Finger rhythmisch seine Haut, und ihre Nägel gruben sich manchmal hinein und verursachten einen kleinen Schmerz.
Und sie fühlte oft die Bewegung seiner Wimpern als leichtes Kribbeln an ihrem Hals, wenn er die Augen öffnete und schloss...
Sie mochten beide nicht aufhören, sich zu streicheln und zu küssen.
Irgendwann aber, als seine ruhigen Atemzüge verrieten, dass Arno zufrieden eingeschlummert war, zog Bea die Decke über ihn und sich und erwartete im verglimmenden Teelichtermeer den Schlaf.
Inmitten der leisen Musik hörte sie noch, wie sich ein Schlüssel hart im Schloss der Wohnungstür drehte, wie das Licht im Korridor angeknipst wurde.
„Hey, Leute“, flüsterte eine Mädchenstimme vorsichtig, „ich bin zurück.“
Aber das war vielleicht schon ein Traum.
Himmelgelb
Unvergesslicher April. Die Sonne wärmt schon. Das fühlt sie auf ihrer Lederjacke. Im Gesicht den Fahrtwind drückt sie sich enger in den Rücken des Motorradfahrers, umschließt seine Taille mit den Armen.
Ein Tag wie gelbe Chrysanthemen. Hell und fedrig. Und begonnen hatte er auf dem Bahnhof.
Die Reisetasche vor sich her balancierend war sie im altmärkischen Stendal ausgestiegen und ließ die Eiligen an sich vorbei.
„Darf ich helfen, schöne Frau?“
Ein ovales Gesicht. Fröhliche Augen. Über den vollen Lippen bog sich ein Bärtchen. Sprachlos nickte sie.
„Müsste ich... Sie kennen?“, fragte sie ironisch.
Gestattete, dass er die Tasche nahm. Er wiegte den Kopf und schmunzelte.
„Wir sind uns sicher schon öfter begegnet.“
Sein Blick senkte sich kurz in ihre Augen, verstärkte eine Vertrautheit, die vom ersten Moment in ihr war. „Katzenaugen“, stellte er fest.
„Kaffee?“, fragte sie spontan. „Da drüben im Bahnhofshotel?“
„Zeit hätte ich ja... und Lust auch.“ Wie er das sagte, erzeugte Kribbeln in ihrem Bauch.
„Ich bin gebürtige Berlinerin“, plauderte sie, als sie sich im Restaurant gegenüber saßen. „Mit 19 bin ich daheim weg. In die große weite Welt. Das war die Altmark damals für mich. Ein fremder Landstrich. Ein Abenteuer.“
„Dann sind Sie mit dem ICE vorhin aus Berlin gekommen.“
„Ja, meine Eltern leben noch dort. Seltsam, dass man sich bei ihnen wieder wie ein Kind fühlt...“
„... und noch die Schrammen an den Möbeln findet, die man selbst verursacht hat“, vollendete er schmunzelnd ihren Gedanken.
„Oder den Geruch in den Zimmern...“, sinnierte sie.
„Wie meinen Sie das?“
„Ach, da gibt’s so 'ne Kohlrouladen-Geschichte. Und ich spiel' die Hauptrolle... Ist schon ziemlich her... Damals war ich vielleicht 15. Aber an den Schreck erinner' ich mich noch heut.“
Sie goss Sahne in ihren Kaffee und rührte um.
„Wir wohnten damals gemeinsam mit einem Wellensittich parterre in einem großen Häuserblock.
An einem Sonnabend um die Mittagszeit erhielt mein Vater, als Taxifahrer in Bereitschaft, einen Einsatzruf. Während ich Geschirr spülte und sich meine beiden Geschwister das Abtrocknen teilten, bereitete meine Mutter noch schnell Kohlrouladen für den Sonntag vor und schob sie im Brattiegel in den Ofen.
Und weil wir zur Kaffeezeit mit unserer Oma verabredet waren, zogen wir uns danach noch rasch um.
Meine Mutter, beim Haare toupieren, bestimmte noch, dass wir die Rosen aus der Vase nehmen und ins Seidenpapier wickeln und das Päckchen neben dem Telefon nicht vergessen sollten.