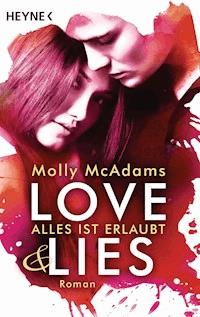14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Wenn aus purer sexueller Begierde bedingungslose Liebe wird Auf einmal ist Suiza da in dem spanischen Dorf und verdreht allen Männern mit ihrer blonden Zartheit den Kopf. Angeblich kommt Suiza aus der Schweiz, genau weiß man das nicht, denn sie spricht kein Spanisch. Der einzelgängerische, etwas raubeinige Großbauer Tomás ist elektrisiert und packt sich das junge Mädchen, das sich ihm wortlos hingibt. Aber Suiza schenkt ihm nicht nur ihren Körper, sondern kümmert sich hingebungsvoll um ihn, verwandelt seinen verwahrlosten Hof in eine Wohnstatt, und gibt ihm endlich das Gefühl, zu jemandem zu gehören. Als ihre reine und tiefe Liebe bedroht ist, trifft Tomás eine fatale Entscheidung, Bénédicte Belpois erzählt in »Hingabe« von einer außergewöhnlichen Liebe, in der Sexualität und Gewalt, Extase und Zärtlichkeit, Fürsorge und Leidenschaft keine Gegensätze mehr sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Bénédicte Belpois
Hingabe
Roman
Über dieses Buch
Wenn aus purer sexueller Begierde bedingungslose Liebe wird
Auf einmal ist Suiza da in dem spanischen Dorf und verdreht allen Männern mit ihrer blonden Zartheit den Kopf. Angeblich kommt Suiza aus der Schweiz, genau weiß man das nicht, denn sie spricht kein Spanisch. Der einzelgängerische, etwas raubeinige Großbauer Tomás ist elektrisiert und packt sich das junge Mädchen, das sich ihm wortlos hingibt. Aber Suiza schenkt ihm nicht nur ihren Körper, sondern kümmert sich hingebungsvoll um ihn, verwandelt seinen verwahrlosten Hof in eine Wohnstatt, und gibt ihm endlich das Gefühl, zu jemandem zu gehören. Als ihre reine und tiefe Liebe bedroht ist, trifft Tomás eine fatale Entscheidung,
»Hingabe« erzählt von einer außergewöhnlichen Liebe, in der Sexualität und Gewalt, Extase und Zärtlichkeit, Fürsorge und Leidenschaft keine Gegensätze mehr sind.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Bénédicte Belpois ist Hebamme. Das Körperliche, der Schmerz, Naturgewalt, Tod und Glück gehören zu ihrem Alltag. »Hingabe« ist ihr erster Roman. Sie wusste nicht, wohin sie das Manuskript schicken sollte, ihre Töchter empfahlen Gallimard, den einzigen Verlag, den sie namentlich kannten. Gallimard, einer der bedeutendsten Verlage Frankreichs, entschied sich sofort zur Publikation.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Deutsche Erstausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel
›Suiza‹ bei Éditions Gallimard, Paris
© Éditions Gallimard 2019
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114
D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Coverabbildung: Robert Brackman, Arrangement No.9 with Figure (Detail) / Privatsammlung / Foto: Christie's Images / Bridgeman Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491202-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für Élisabeth, Adélaïde und Éléonore
»Zwei große, ruhige Naturwesen sind sie jetzt, ihre Seelen sind einfach wie Feldblumen.«
Jean Giono
Die Leute hier werden alles Mögliche über mich erzählen, lauter Geschichten mit ähnlichen Schlagzeilen. Gewalt und Probleme lägen mir in den Genen, ich sei der Sohn meines Vaters, und es habe ja so kommen müssen. Sie werden meine Geschichte sogar jenen erzählen, die sich gar nicht dafür interessieren, die zufällig vorbeikommen, einen Bekannten im Dorf besuchen oder sich die Gegend anschauen wollen. Aber keiner kennt die Geschichte wirklich, mit Ausnahme von Ramón. Und Agustina, wenn ich es recht bedenke, aber sie ist alles andere als neutral, ich war wie ein eigener Sohn für sie. Vor allem Ramón hätte das Recht gehabt, meine Geschichte zu erzählen, denn er lebte praktisch bei uns.
Er war der Erste, der wusste, dass ich krank war. Wirklich ernsthaft krank, nicht bloß ein Schnupfen. Ja, so hat diese Geschichte angefangen, mit einer fiesen, ziemlich abscheulichen Krankheit.
Und tückisch dazu, denn ich merkte es nicht sofort. Am Anfang spuckte und hustete ich nur, hatte Fieber, ich dachte, es wäre eine einfache Grippe. Nicht einmal das Rauchen gab ich auf. Don Confreixo verschrieb mir Antibiotika, aber es wurde nicht besser. Es ging mir dreckig. Eine Woche später schickte er mich in die Notaufnahme nach Lugo, und dort wurde ich auf den Kopf gestellt. CT der Lunge, dann des ganzen Körpers, die Ärzte wuselten um mich herum, diskutierten an meinem Bett über das weitere Vorgehen, neue Untersuchungen und Diagnoseverfahren, während ich unruhig wurde, als ich an den Haufen Arbeit zu Hause dachte: In ein paar Tagen wäre es Zeit für die Heuernte, ausgerechnet jetzt hatte einer meiner besten Traktoren den Geist aufgegeben, außerdem standen die Gesundheitskontrollen für das Vieh an, und das drohte haarig zu werden: In Terra Chá gab es noch immer einige Fälle von Katarrhalfieber, die uns die Exporte verhagelten. Schließlich entließ ich mich gegen den Rat der Ärzte selbst, bat sie, mich an meinen Hausarzt zu überweisen, wenn sie sich über die Diagnose und das weitere Procedere endlich geeinigt hätten. Aber ich spürte, dass es riskant war.
Gleich am nächsten Tag, in aller Früh nach dem Melken, rief Don Confreixo an.
»Tomás? Bist du zu Hause? Du musst heute Vormittag vorbeikommen, das Krankenhaus hat mich angerufen, ich habe die Ergebnisse.«
»Das geht nicht, Doktor. Heute steht die Kontrolle der Viehbestände an. Ich muss nach Orense, nach einem Traktor schauen. Ich bin schon spät dran.«
»Das war keine Frage, Tomás, du musst kommen, es ist dringend. Bitte.«
Gerade war Ramón gekommen, ich rannte zum Traktor, wehrte ihn mit einem »jaja« ab. Ich war auf hundertachtzig, weil ich wusste, dass ich meinen Plan, heute Morgen eine Menge wegzuschaffen, vergessen konnte.
Im Sprechzimmer setzte er seine Brille auf, die einen echten Arzt aus ihm machte, und öffnete den Mund, dann schloss er ihn wieder, ohne etwas zu sagen, holte nur tief Luft. Zwei- oder dreimal machte er den Karpfen, das ging mir auf die Nerven, also stieß ich hervor:
»Schlimm?«
»Ja.«
»Krebs?«
»Ja«, antwortete dieser Idiot.
Einfach so. Er schluckte schwer und sah mich an wie ein blinder Lemur, ich verstand, mit Samthandschuhen würde er mich nicht anfassen, da war ich hier an der falschen Adresse.
»Wie lange hab ich noch?«
Ich sagte es, ohne wirklich nachzudenken, denn in Filmen sagt man das immer, wenn man eine solche Nachricht bekommt. Mit angsterfülltem Gesicht. In Schwarz-Weiß pressen die Hauptdarsteller ihre Zähne zusammen und flüstern biblische Phrasen, dass man meint, sie hauchten ihr Leben aus.
»Das ist aber ein bisschen voreilig, Tomás! Wir wollen nicht über deine Überlebenschancen sprechen, sondern über deine Heilung.«
Ach, immerhin ließ er sich zu einer Ermunterung herab, dieser Quacksalber.
Ich schaute auf meine Hände, meine großen Bauernpranken, trotz allem ziemlich saubere Nägel, fand ich, und fragte mich, ob ich Zeit für einen Rioja haben würde, bevor ich wieder an die Arbeit ging.
Gemäß Protokoll machten wir Termine aus, die ich einzuhalten hatte, Don Confreixo kümmerte sich um alles, aber vermied es, mir in die Augen zu schauen. Er nestelte an meiner Akte herum und räusperte sich regelmäßig, rief Kollegen an, um schnell einen Termin bei einem renommierten Pneumologen für mich auszumachen.
In der Kneipe traf ich Ramón.
»Ich habe eine Rippenfellentzündung. Ich muss wahrscheinlich noch mal für ein paar Tage ins Krankenhaus, bekomme Antibiotika, und neue Röntgenbilder müssen gemacht werden, vielleicht sogar ein Eingriff. Frag Alberto, ob er dir zur Hand gehen kann, während ich in Lugo bin.«
Der Hof war kein Problem, der Alte wusste genauso gut wie ich, was zu tun war. Schwieriger war, was ich einpacken sollte: Ich hatte noch nicht einmal einen Schlafanzug. Ich schlief nackt. Oder in meinen Kleidern, wenn ich zu besoffen war.
Ich hatte also Zeit für einen Rioja. Trank sogar drei, während der Alte mich auf den neuesten Stand brachte, was die Felder anging.
So hatte es eigentlich angefangen. Den Rest werde ich versuchen, einfach zu erzählen. Denn vielleicht mag ich nicht die hellste Kerze auf der Torte sein, aber auch nicht der Psychopath, für den die Leute mich halten. Ich habe mein Bestes gegeben, aber darauf bin ich nicht vorbereitet gewesen, und ich weiß nicht, was ich sonst hätte tun können.
Beinahe war ich froh, endlich ins Krankenhaus zu gehen.
Der Schlafanzug war kein Problem gewesen, ich war wohl kein Einzelfall. Ich hatte den zwölfjährigen Waisenjungen gemimt, dem niemand einen Schlafanzug fürs Ferienlager einpackt, die Krankenpfleger hatten mir mitleidig ein großes Nachthemd gegeben, das hinten offen war. Jedes Mal, wenn ich aufstand, um pinkeln zu gehen, sah mein Zimmernachbar meinen Hintern, sosehr ich auch versuchte, das offene Hemd mit meiner linken Hand zusammenzuhalten. Aber da ich gleichzeitig mit der rechten Hand den Infusionshalter schieben musste und mich sowieso immer wie ein Elefant im Porzellanladen benahm, endete es damit, dass ich doch meinen Allerwertesten präsentierte, um nicht gegen das Bett zu stoßen, die Tür, den Stuhl, all die absichtlich dort aufgestellten Hindernisse, die mich den letzten Nerv kosteten und mir unter die Nase rieben, dass ich zu groß war, zu schwerfällig, zu dämlich.
Am liebsten hätte ich zu den Weißkitteln gesagt: Operiert mich. Schneidet mir alles raus, was rauszuschneiden ist: Lunge, Leber, Milz und Herz. Ich will dieses verdorbene Fleisch nicht mehr, in dem gegen meinen Willen etwas Grauenvolles wächst. Die Ärzte waren nicht alle dafür, sie brauchten zwei Tage für die Entscheidung, ja, sie würden mich schließlich aufschneiden, um diesen Dreck rauszuholen, der meine Lunge zerfraß.
Gleich nach dem Eingriff glaubte ich, es gehe mir gut. Ich hatte keine Schmerzen, sie setzten mir regelmäßig einen Schuss, zusätzlich sickerte durch die Morphinpumpe ein sedierendes Glück in meine Adern. Sie kümmerten sich um mich, das muss ich schon sagen. Die Krankenschwestern waren nett, aber dick und hässlich: nicht eine, die den Schnitt anhob, nicht mal eine, die mich heißmachte. Von den Strapsen und aufreizenden Dekolletés aus den Pornoheften keine Spur, sie rannten ununterbrochen durch das ganze Krankenhaus, kamen nur, um mich umzudrehen wie einen Crêpe und mir den Rücken mit irgendetwas Stinkendem zu waschen, so in der Art wie teures Kölnischwasser. Sie standen drauf, mir den Rücken zu waschen, ich wusste nicht, warum, hinterher fragten sie mich immer, ob ich mich »frischer« fühlte. Es brannte, aber ich sagte nichts, ich wollte ihnen nicht den Spaß verderben. Sie wuschen mir auch den Penis, aber mit Gummihandschuhen, kein Scherz, das machte mich überhaupt nicht scharf.
Abgesehen davon schien seit zwei Tagen die Sonne, und wir hatten eine Affenhitze, ungewöhnlich, selbst für die Jahreszeit. Kein Gewitter, auf meinem Plastiklaken schwitzte ich wie ein Bulle, und ich dachte an meine Felder, scheiße … Normalerweise hätte ich jetzt Heu machen müssen. Ich hoffte, Ramón würde mit den Feldern am Hang anfangen, da war es immer am schnellsten reif. Aber das wusste er besser als ich.
Ich hatte ihm verboten, mich zu besuchen, er sollte sich lieber um meine Felder kümmern, und ich wollte nicht, dass er mitkriegte, dass ich kränker war, als ich vorgab. Er kannte mich in- und auswendig, ich wusste, dass er sich alles zusammenreimen würde. Wegen einer Rippenfellentzündung schnitt man niemanden auf.
Was meinen Fall betraf, verstand ich gar nichts, obwohl man mir alles erklärte wie einem Schwachsinnigen. Ich war zum Analphabeten geworden. Nichts zu machen, dieses Fachchinesisch ging nicht in meinen Schädel. Das hier betraf jemand anderen, ich sah mich durch die Gänge gehen, essen und pinkeln, hatte das Gefühl, in einem Film zu sein und eine andere Person dabei zu beobachten, wie sie das erlebte, was ich erlebte: Der Kerl war stark, er spielte gut. Er würde den Oscar für den besten Krebskranken abräumen.
Ich lächelte sogar, als ich mich nackt und komplett mit Betadine® bepinselt im Spiegel sah, baumelnde Schläuche, um den Oberkörper ein Druckverband, es sah aus, als hätte ich super Brustmuskeln. Mit der Wunde würde ich den Mädchen erzählen können, ich sei Söldner in Zaire gewesen und hätte einen Machetenschlag abbekommen, der mich eine ganze Weile außer Gefecht gesetzt hätte. Die Sache war nur, dass ich nie mit Mädchen sprach.
Zwei Wochen später wurde ich an einem Vormittag aus dem Krankenhaus entlassen. Abends ging ich mit Ramón ein Estrella trinken, ich fühlte mich fit, nur ein bisschen langsam, wenn ich so drüber nachdachte, mit einem leicht wattigen Gefühl, das sicher mit der Anästhesie zu tun hatte. Ich hielt große Stücke auf die Medizin und sagte mir, Hand aufs Herz, Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ramón nahm sich ein Mädchen, es juckte mir in den Fingern, es ihm gleichzutun, um diese Angst zu vergessen, aber ich musste vernünftig bleiben. Ich schnorrte nur eine Zigarette von Felipe, die bei mir einschlug wie ein Tütchen. Zum Glück war der Alte schon blau, sonst hätte ich mir sicher dieselbe Moralpredigt wie am Nachmittag anhören können, als ich mir von ihm eine Ducados schnorren wollte.
Auf dem Weg zu der alten Edelmira, seiner Vermieterin, stützte ich ihn, das ging also noch, der Alte musste immerhin um die siebzig Kilo wiegen, und er stützte sich fröhlich auf mich, immerhin auf meine gesunde Seite ohne Operationswunde. Ich achtete aber darauf, dass er die noch immer schmerzende Wunde nicht berührte. Der Trottel sabberte an meinem Hals und säuselte, er liebe mich. Allerdings gefolgt von einem »Mein dreckiges kleines Häschen«.
Als ich wegen meiner Krankheitstage wieder zu Don Confreixo ging, damit er die Formulare ausfüllte, sagte er nichts weiter, nur, dass er den Operationsbericht bekommen habe.
Er hielt das zweimal gefaltete Blatt in den Händen und las.
Ich wartete abwesend, leicht schläfrig – seit einer Woche Dauerzustand. Ich beobachtete eine Fliege, die über den Stapel Akten hinter ihm krabbelte. Mach die Biege, Fliege. Kleines vages Lächeln. Er las immer noch mit ernstem Gesicht.
Mein Blick blieb an dem Brief hängen, und spiegelverkehrt sah ich den ersten Teil, das obere Drittel, bis zu dem Knick. Ich saß nicht sehr dicht, konnte nur die fettgedruckten Buchstaben lesen: Tomás López Gabarre, und dann zwei Zeilen darunter: nicht kleinzelliges Karzinom, Stadium IIB, T2N1M0. So etwas in der Art. Aber nur Tomás und Karzinom kamen bei mir an.
Es war wie eine Ohrfeige. Eine schallende Backpfeife, dass dir die Birne wegfliegt. Ich war die Fliege, auf die gerade die Fliegenklatsche niedergesaust war, tot, zerquetscht, nur die Beine bewegen sich noch ein bisschen, aus Reflex.
Ich erinnere mich nicht an das Ende des Termins, ich erinnere mich nur noch, dass ich aus der Praxis ging und auf die Straße stolperte. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber in Zeitlupe. Verwirrt sah ich die Passanten, die wenigen Autos auf der Straße, diesen morgendlichen Trubel. Dieses Leben, an dem ich plötzlich nicht mehr teilhatte. All die Leute, die nicht wussten, dass ich sterben würde, bestimmt unter schrecklichen Qualen. Ich wollte schreien. Krebs, verdammt. Krebs. Als hätte ich es mit einem Mal verstanden: Die Krankheit drang in mein Gehirn vor, ich hatte sie mir gerade auf die Stirn tätowieren lassen. Ich begriff, dass ich die Nachricht bisher komplett ausgeblendet, sie in den letzten Winkel meines Bewusstseins verbannt hatte, ohne ihr auf den Grund gegangen zu sein, weil zu heftig, zu ungerecht. Ich war wie erschlagen, versteinert, und schob es schnell beiseite, um mich aufrecht halten zu können, nicht zusammenzubrechen wie ein Häuflein Elend, mich nicht auf dem Boden zu wälzen und zu heulen wie eine alte Frau. Um ganz einfach weiter lebendig zu bleiben und den Tod zu verjagen, der mich soeben auf den Nacken geküsst und mir zärtlich ins Ohr gesäuselt hatte. Krebs war die Realität für mich, in mir, er spielte gegen mich. Endlich realisierte ich die Dimension der Angst, Panik lähmte meine Beine, Wut brachte mein Herz zum Rasen, Traurigkeit ließ mir die Tränen in die Augen steigen.
Ich gab Ramón ein Zeichen, der bei einem Bier an der Theke auf mich wartete. Er stürzte auf mich zu. Ich murmelte:
»Bring mich nach Hause, ich muss mich hinlegen.«
Ich konnte damit nicht alleine nach Hause gehen.
Der Alte verstand, er schaute auf seine Schuhspitzen.
»Ich komme mit, wenn es dich nicht stört, Junge. Ich habe im Moment mit Rückenschmerzen zu tun, würde mich auch gern ein bisschen hinlegen. Dann müssen wir die nächsten Tage aber schuften wie die Berserker.«
Während der kommenden Tage musste ich trotz allem weiterleben, schlafen, essen, arbeiten. Tausend alltägliche Dinge erledigen. Als ich im Supermarkt in Lugo an der Kasse stand, war mir danach, all diesen ahnungslosen Leuten entgegenzuschreien, ich hätte Krebs. Und ich rechnete aus, wie viele von uns hier betroffen waren. Zehn Prozent hatte ich gehört. Ich zählte zehn, einem unter ihnen ging es wie mir. Vielleicht konnte ich ihn erkennen. Er musste traurig aussehen, krank, niedergeschlagen. Ich flüsterte: »Wo bist du, mein Leidensbruder?«
Ich fand ihn nicht. Wir hatten nicht denselben Tätowierer.
Ich durfte mir nichts anmerken lassen, um mir die Jeremiaden zu ersparen. Jedem, der mir den Rat gegeben hätte, nicht den Mut zu verlieren, hätte ich eine Kopfnuss verpasst. Dennoch hatte ich Angst. Diese große Angst, die dich lähmt, versteinert, dich weich in den Knien werden lässt.
Seit ich mit meinem Kumpel, dem Karzinom, lebte, passierten mir seltsame Dinge: Sobald ich einen alten Menschen sah, packte mich eine Welle der Wut. Ich hasste graue Haare, zahnlose Münder, vor Arthritis gekrümmte Gestalten, weil ich wusste, dass ich davon ausgeschlossen war. Diese Alten lebten, wohingegen ich sterben würde, mit gerade einmal vierzig Jahren. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Diese Alten jammerten in einer Tour. Wussten über alles und jeden Bescheid. Verurteilten dich mit ihrem Maßstab von gestern oder verkauften dir ihr erbärmliches Leben und ihre armseligen Erfahrungen wie Grundgesetze. Ich wollte ihnen ihre Erinnerungen stehlen, die Zeit, die ihnen blieb. Ihren Ruhestand, um den sie so große Angst hatten, Angst, sie könnten ihn verlieren.
Ich beneidete sie um ihr Alter, es machte mir keine Angst mehr, ich sehnte mich danach, missgönnte es ihnen. Ich wollte knorrige Hände und eine Vergangenheit, Rheumaschmerzen, wenn sich Regen ankündigte. Ich wollte Enkelkinder, die ich auf meinen Knien schaukeln konnte, einen Rollator, um damit mein Brot einkaufen zu gehen. Ich wollte mich in meine Windeln erleichtern, das Pflegepersonal in meinem Altersheim ärgern, Karten spielen, und dabei mit meinem Gebiss mampfen. Ich wünschte mir sehnlichst all diese Wehwehchen, diese Kompromisse, diese bescheidenen kleinen Freuden als Belohnung für ein arbeitsreiches Leben. Das stand mir zu wie jedem anderen. Vielleicht sogar eher als anderen.
Nur der alte Ramón fand vor meinen Augen Gnade. Schon allein deshalb, weil er den Mund halten konnte.
Mit Kirchen war es das Gleiche. Sobald ich eine sah, wollte ich sie anzünden, die Buntglasfenster mit Steinen einschmeißen. In Dauerschleife sagte ich mir den Vers dieses französischen Dichters auf, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere: Und am Abend warfen wir Speere in die Sterne. Über der Tür stand graviert: »Gott ist ein ungebet’ner Gast.«
Gott? Dieser Mistkerl ließ mich im Regen stehen.
Vergiss ihn.
Es war ein Tag wie jeder andere, als ich sie zum ersten Mal sah. Ich drehte mich zur Bar um und sah diese Frau.
Die Sekunden dröhnten in meinem Kopf, einzeln, intensiv wie eine Totenglocke. Verlangen überkam mich, wie der Sturm, der dem Hagel vorausgeht. Mein Herz pumpte sich unweigerlich auf, platzte fast in meinem Brustkorb, der plötzlich zu klein war. Was von meiner Lunge noch übrig war, war verschwunden, eingefallen, denn ich hatte aufgehört zu atmen.
Ich schloss die Augen, kurz vor dem Kollaps, schnappte nach Luft.
»He! Junge! Alles in Ordnung? … Tomás?«
Die Stimme des Alten holte mich wieder runter. Ich tat einen tiefen Zug an meiner Zigarette, um mich zu vergewissern, dass ich wieder atmen konnte, dass ich noch am Leben war.
»Doch, doch. Keine Sorge. Ist fast schon zu kühl hier, der Unterschied zur Hitze draußen ist zu groß. Es geht mir nicht so gut. Ein bisschen müde wahrscheinlich, die Antibiotika. Keine Sorge … Keine Sorge, es wird schon.«
Damit wollte ich mich selbst überzeugen.
»Du machst mir Angst, Kleiner! Sogar bei deiner dunklen Haut bist du grün wie eine Mandel. Und kannst du verdammt nochmal nicht aufhören zu rauchen?«
»Erschöpfung, ich hab’s dir gesagt. Ich mache eine Siesta. Und das Rauchen … dafür ist es zu spät.«
»Tja, hast recht, schaufel dir dein eigenes Grab, Junge, ich mein ja nur …«
Ich grinste wie ein Idiot. Ich wusste, den Alten dazu zu bringen, mich in Ruhe zu lassen, würde kein Problem sein. Hier interessierte er sich nur für den Fernseher. Beruhigt durch mein Lächeln, wandte er sich wieder seiner Nachrichtensendung zu. Der Alte betete diesen riesigen Flachbildschirm geradezu an, den einzigen Luxus dieser verrauchten Kneipe. Das war seine Droge, sein Koks, er schnupfte es jeden Mittag, injizierte die Sprecherin mit den blutrot angemalten Lippen, den kleinen, makellos runden Brüsten und der eng anliegenden Designerbluse in seine Pupillen. Die Nachrichten strotzten wie üblich vor Elendsschicksalen, vor Angst und Ungerechtigkeit, aber das war dem Alten ziemlich egal, denn alles war ja in HD.
Ich hatte wieder Gelegenheit, die Frau zu mustern, aus wenigen Metern Entfernung. Fast hatte ich Angst, sie anzuschauen. Ich ließ den Blick ganz langsam nach links schweifen, hatte Schiss, dass sie verschwinden oder anders aussehen würde, so etwas in der Art. Sie spürte meinen Blick nicht, wischte mit einem nassen Tuch und langsamen Bewegungen die lange Kupferverkleidung der Theke auf der Seite der Gäste: Ich hatte freie Sicht auf sie.
Sie beugte sich ein bisschen vor, ich stellte mir den Ansatz ihrer weißen, leicht hängenden Brüste vor, die empfindliche Haut wie Milch, die sich unter dem Stoff ihres luftigen Kleides verbarg. Ihre rotblonden Haare fielen ihr in weichen, dünnen Locken ins Gesicht.
Ihre großen, leeren Hundeaugen ließen sie leicht dümmlich wirken, doch ihre Farbe, azurblau wie die Sommertage, machte das wett. Vor Eifer leicht geöffnete Lippen, feucht und zartrosa wie Perlmutt. Weil sie so klein war und so unglaublich weiß, wirkte sie zerbrechlich. Sie hatte etwas übertrieben Weibliches an sich, unglaublich sanft, unglaublich blass, was in mir den starken Drang weckte, sie zu packen, zu schütteln, zu ohrfeigen, sie letztendlich zu besitzen. Sie besitzen. Sie eben vögeln. Aber zuerst schlagen.
Ich wurde hart, die Erektion, eingeschnürt in meiner Hose, war schmerzhaft. Ich wollte aufstöhnen. Ich versuchte, mich zusammenzureißen, sah zur Decke hinauf, wollte noch tiefer atmen, ohne Ramóns Aufmerksamkeit zu wecken. Ich streckte die Beine aus, um den Druck auf meinen Penis erträglicher zu machen, verschränkte die Arme, trank einen Schluck Bier, zog die Beine nervös wieder an, und dann das Ganze wieder von vorn. Ich schwitzte wie ein Schwein, spürte, wie mir der Schweiß den Rücken runterlief, an den Innenseiten der Oberschenkel … Ich hätte wirklich brüllen können. Ich reagierte mich an meiner Zigarette ab, drückte sie im Aschenbecher aus. Für eine Sekunde dachte ich daran, sie mir auf der Hand auszudrücken, damit der Schmerz mich auf andere Gedanken brachte.
»Was ist denn mit dir los? Hast du dich immer noch nicht beruhigt? Der hat Hummeln im Hintern …«, sorgte Ramón sich plötzlich.
»Nerv nicht, guck Fernsehen. Meine Beine tun weh.«
Ich konnte nicht die Augen von ihr lassen, obwohl ich wusste, dass ich sie sogar, ohne sie anzusehen, hätte spüren können, wie sie durch den Raum ging, nur anhand der Schwingungen, des Luftzugs und des Rauschens ihrer Bewegungen.
Álvaro, der Chef, rettete mir das Leben. Er kam mit seinem obligatorischen Tablett mit Brot, Serranoschinken und Schafskäse aus der Küche.
»Also, Leute? Jetzt, wo es gerade ruhig ist: Wie sieht’s aus?«
Wie immer war der alte Knacker wie aus dem Ei gepellt. Sein babyrosa Hemd mit weißem Kragen und feinen Streifen spannte über seinem gewaltigen Bauch. Die hochgekrempelten Ärmel setzten seinen protzigen Schmuck in Szene. Die Uhr mit quadratischem Ziffernblatt und breitem Krokodillederarmband, römischen Ziffern, Datumsanzeige und Sekundenzeiger. Dreifacharmband aus massivem Gold, so wuchtig wie Handschellen, ein Siegelring mit seinen Initialen, der ein ganzes Fingerglied seines linken Ringfingers beanspruchte. Auf der Brust das gleiche Spiel: eine dicke Goldkette, an der ein Jesus am Kreuz hing und auf den noch schwarzen krausen Brusthaaren hin und her rutschte. Dieser Kerl war nicht nur ein wandelnder Juwelierladen, sondern auch eine Reklame für den Friseursalon: Seine weißen Haare fielen in pomadigen Locken in seinen Nacken, während sein makelloser feiner Schnauzbart, mit scharfer Schere zu einem Schatten getrimmt, an dezenten Bierschaum erinnerte. Der ganze Mann war in eine Wolke schweren Aftershaves gehüllt, wie Toilettenduft, aber das Beste vom Besten.
Álvaro mochte mich eigentlich. Ich war – neben Ramón, für den ich jede Rechnung übernahm – sein treuester Kunde. Wir aßen jeden Mittag hier und manchmal, wenn wir lange arbeiteten, auch abends. Tagsüber kamen wir oft auf ein Gläschen vorbei. Ich hatte meine eigene Flasche, ein guter alter Rioja aus dem Eichenfass, für den er mir weit mehr als den realen Preis berechnete, aber ich wusste, dass er ihn extra für mich bestellte und sich sonst niemand so einen Wein leisten konnte. Das Leben hier war hart, wir waren fernab von allem, lebten nahezu komplett autark. Wir waren es gewohnt, auf alles zu verzichten, zu haushalten. Das kleinste Stück Fleisch, der kleinste Pulpo war von unschätzbarem Wert. Generationenlanges Leben unter dem Joch der Armut, eine Krise, die uns sehr hart getroffen hatte, alles andere als leicht. Wir waren immer härter geworden, waren wie Steine, überrascht von winterlichem Frost. Am auffälligsten war, dass wir, einmal daran gewöhnt, uns einzuschränken – und das bis zur Perfektion zu steigern –, auch mit unseren Gefühlen sparsam geworden waren, den Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Wir redeten wenig, nur das Wesentliche, eigentlich sogar nur das Nötigste. Wir hielten uns an das absolute Minimum. Wir hatten Zärtlichkeit verlernt. Die Werte waren immer noch dieselben, Freundschaft, Ehre, Liebe, Respekt, aber wir drückten sie nur in unseren Taten aus, auch hier auf ein Mindestmaß beschränkt. Die Wörter waren verschwunden. Glück war vergänglich, fast schon ein Wunder, und wenn, dann kulinarischer Art. Ein gutes Glas Wein, ein gutes Stück Fleisch, dunkles Brot, das satt machte, erfreuten uns eher als ein Kompliment. Wir waren keine schlechten Menschen, aber die Entbehrungen hatten uns zurückhaltend mit Gefühlen werden lassen. Ich hätte eigentlich gesprächiger sein müssen, da ich reicher war, aber leider war ich noch rauer als die anderen, weil ich während meiner Kindheit nicht viel Liebe erfahren hatte und niemand imstande gewesen war, sie mir nahezubringen.
Álvaro anzustarren, ihn unter die Lupe zu nehmen, brachte mich auf andere Gedanken, tat mir gut. So konnte ich meine Aufmerksamkeit ein bisschen von dieser Frau ablenken.
»Na, Freunde? Wie geht’s, hab ich gefragt? … Hat’s euch heute die Sprache verschlagen?«
»Kann nicht klagen, Álvaro, kann nicht klagen, immer mit der Ruhe …«
Auch Ramón ließ nicht vom Fernseher ab.
»Alles okay, alles okay.«
Ich stimmte ihm zu, es kostete mich ungeheure Kraft, mich zu konzentrieren.
»Habt ihr das Heu eingefahren?«
»Machst du Witze? Nicht mal die Hälfte haben wir geschafft. Mit dem kaputten Traktor und meiner Rippenfellentzündung hängen wir total hinterher.«
Mir war eigentlich nicht nach Smalltalk. Ich antwortete widerwillig, wollte nur, dass Álvaro ruhig war und zur Seite ging, er versperrte mir die Sicht auf die Frau.
»Setz dich, Álvaro. Ich geb dir ein Bier aus, ja?«
Das war der einzige Weg.
Er schaute mich erstaunt an. Einen auszugeben war normalerweise nicht meine Art. Ich galt als Geizkragen, schon seit ewigen Zeiten hatte ich diesen Ruf, aber wenn man der Reichste im Dorf ist, hat man natürlich viele Neider.
Er antwortete mir mit misstrauisch zugekniffenen Augen:
»Da sag ich nicht nein … Besonders, wenn ausgerechnet du einlädst, das ist ja eine Seltenheit … Und dann diese Hitze, ich bin schon ganz ausgetrocknet. Hundertjährige in spe wie ich müssen genug trinken, jeden Tag trichtern sie uns das im Fernsehen ein.«
Ramón horchte auf:
»Bier zählt als Flüssigkeit? Darf ich dich erinnern, dass ich in deinem Alter bin, du alte Mumie!«
Álvaro drehte sich zu der Frau um und schrie sie an:
»Suiza!«
Langsam wandte sie ihm den Kopf zu. Ihr Gesicht war ausdruckslos, man hätte meinen können, sie wäre taub, blind und stumm, so unbewegt schaute sie.
»Bring mir ein Bier!«
Álvaro brüllte. Er hackte die Wörter ab, als wollte er jedes buchstabieren.
»Warum schreist du? Ist sie taub?«
Er drehte sich zu mir um.
»Nein, aber … sie spricht kein Spanisch. Sie versteht nur zwei, drei Wörter, ›hallo‹, ›Wein‹, ›schlafen‹ und ›essen‹. Unter uns: Das reicht auch für eine Frau, stimmt’s?«
Er lachte laut, wobei er sich, stolz auf seinen Witz, den Bauch hielt.
Sie verschwand in der Küche. Jetzt konnte ich mich auf das Gespräch konzentrieren.
»Ist sie deine neue Kellnerin?«
»Ja … na ja, wenn man so will, ja, Kellnerin … Sie ist halt nicht sehr helle. Paula hat sie zu mir gebracht. Sie hat sie in ihrem Hühnerstall gefunden. Verdreckt und am Verhungern. Anscheinend hat sie da eine ganze Weile geschlafen.«
»Woher kommt sie?«
»Aus der Schweiz, wie es aussieht. Daher der Name. Eigentlich wissen wir nicht mal, wie sie heißt. Ein Schweizer Name natürlich, was Exotisches. Aber alle nennen sie Suiza. So fühlt sie sich ein bisschen zugehörig, weißt du. Allerdings … mit der Hautfarbe kann sie selbst in Galicien keinem lange was vormachen!«
Álvaro brach wieder in schmieriges, lautes Lachen aus, was Ramón vor seinem Fernseher zur Besinnung brachte, so dass er sich auch an der Unterhaltung beteiligte.
»Aus der Schweiz, sagst du?«
»Tja, mein Freund, das ist die Globalisierung! Früher ging man von hier fort, um seine Familie zu ernähren und wie ein Sklave für einen Hungerlohn zu arbeiten, und heute sind es die Schweizer, die nach Galicien kommen, um ihr Glück zu suchen.«
»Wenn die Schweizer zu dir kommen, um ihr Glück zu suchen, Álvaro, haben sie’s noch nicht geschafft!«
Auch Ramón fing an zu glucksen wie ein Truthahn, wobei er Álvaro mit seiner schweren Pranke auf die Schulter schlug. Was für ein Haufen seniler Tattergreise.
Die Frau, diese Suiza, kam mit einem Tablett und dem Bier wieder an den Tisch.
»Ein Tablett nur für ein Bier, das ist doch überflüssig wie ein Kropf«, wollte Álvaro lospoltern.
»Warum redest du mit ihr, als wäre sie beschränkt?«, fragte Ramón.
»Hör mal, Opi, hör doch einfach zu, wenn einer redet! Sie spricht kein Spanisch. Du kannst ihr sagen, dass sie dumm ist, sie versteht es nicht. Kannst sie beschimpfen, sie zuckt nicht mal. Die perfekte Frau, ich sag’s dir.«
Sie verstand wirklich nicht. Jedenfalls hörte sie nicht zu. Sie sah uns nicht einmal an, war ganz eingenommen von ihrer Aufgabe: das Bier und das Glas hinstellen, ohne etwas zu verschütten. Mit ihren kleinen weißen Babyzähnchen knabberte sie an ihrer Unterlippe.
Ich drehte noch durch, ich wusste es. Wegen ihres Geruchs, der mir in die Nase stieg. Eine einfache Mischung, sinnlich und eigenartig, milder Schweiß und Milch. Ein mehliger, süßer Duft nach Frau, den ich vergessen hatte. Jetzt konnte ich ihre blonden Haare mit einem eindeutigen roten Schimmer von nahem sehen. Das war etwas anderes als die vollen schwarzen Fluten der Mädchen aus dem Dorf, die sie zu einem Dutt oder komplizierten Kunstwerken aus kräftigen Knoten und locker fallenden Strähnen eindrehten, diese Haare waren absolut fein, umspielten in zarten Locken ihr Gesicht. Ich erahnte die Ohren, auch sie klein, den Halsansatz, wo sich ein pulsierendes blaues Adernetz scharf abzeichnete.
Wieder wurde ich fast verrückt. Ein Raubtier. Ich wollte meine Zähne in sie schlagen, da, wo die Adern pochten, und ihren Hals erst wieder loslassen, wenn sie sich endlich nicht mehr wehrte. Eine ähnliche Szene kam mir in den Sinn: ein Fuchs, der eine Wachtel tötet, die blitzende Kälte seines unbeirrbaren, entschlossenen Blicks.
Ich stand ganz langsam auf, in Zeitlupe, um sie, unvorbereitet, möglichst schnell zu erwischen. Ich war mindestens drei Köpfe größer als sie, das würde einfach sein. Mein Blick war so durchdringend, dass sie, als sie es geschafft hatte, das Bier und das Glas endlich unfallfrei hinzustellen, zu mir aufsah. Prompt schien sie erschrocken. Ich spürte, dass sie mein Verlangen wahrnahm, meine Kraft, und dass ich ihr Angst machte. Ihre Verunsicherung machte sie noch starrer, mein Blick fesselte sie an Ort und Stelle.
Beide versteinerten wir in dem Bewusstsein, dass der Erste, der eine Bewegung andeutete, entweder Angriff oder unwiderrufliche Flucht provozieren würde. Ich stand in den Startlöchern, bereit vorzuschießen.
»He! Verzieh dich!«
Álvaros Schrei kappte wie eine Axt den Augenblick, der uns verband. Ich hörte ihn den Befehl wiederholen, vielleicht schon zum dritten Mal. Ich ließ von ihr ab. Sie ebenso, begriff plötzlich, machte mit absurder Schnelligkeit eine Kehrtwende, als wäre der Teufel hinter ihr her, und stakste wie ein Roboter Richtung Theke.
»Die ist wirklich dämlich«, seufzte Álvaro. »Was soll’s, putzen kann sie gut … Und den Rest hat sie auch drauf«, betonte er mit einem eindringlichen Augenzwinkern in Ramóns Richtung.
»Du bumst sie? Verarsch mich nicht, Álvaro, du bumst sie?«
»Manchmal. Sie hat nichts dagegen.«
Dieser Mistkerl. In seinem Alter!
Und mit einem Blick auf mich:
»Wo willst du denn hin?«
Ach ja, ich war aufgestanden. Ich musste weg. Ich konnte nicht hierbleiben, mit ihr, da sie womöglich wiederkam.
»Muss los … Hab zu tun. Setz alles auf meine Rechnung … Wie immer.«
»Schon? Aber Junge, wir sind doch gerade erst gekommen, hm? Essen wir denn heute nichts?«, fürchtete Ramón.
»Es gibt Kabeljau, interessiert mich, ob’s euch schmeckt.«
»Ich muss los. Du isst was und kommst nach der Siesta wieder, wenn du so weit bist. Ich muss Besorgungen machen.«
»Einverstanden! Du bist der Boss, Junge, hab ich nicht vergessen, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, du weißt schon. Mit vollem Bauch arbeitet es sich gleich noch mal so gut …«
Dann wandte er sich an Álvaro:
»Kabeljau, das hört sich gut an. Was gibt’s dazu?«
»Kartöffelchen von Marta, die an der Brücke wachsen, zergehen auf der Zunge.«
»Wunderbar! Geh nur, Chef, ich bleibe hier.«
Ich hatte mich noch nicht ganz umgedreht, als Ramón wieder anfing:
»Álvaro, du alter Bock! Erzähl mal, wir haben ja Zeit. Und schalte mal um, zu den amerikanischen Musikvideos von den dicken Negern mit den Halsketten und den Miezen in den heißen Shorts. Und dann sag deiner analphabetischen Kellnerin, sie soll noch ein Bier bringen, jetzt lassen wir’s uns gut gehen. Und wenn wir schon dabei sind, sag ihr auch, sie soll die Oliven und zwei, drei Pinchos bringen, ich warte immer noch drauf. Kriegt man in der Schweiz keine Oliven zum Bier?«
Ich hätte sie beide umbringen können, um Dampf abzulassen.
Ich rannte davon. Ich stieg auf meinen Traktor, raste los und fuhr nach Hause, durchgerüttelt von den Spurrillen, eingelullt von dem Geräusch des Motors. Ich murmelte Wortfetzen vor mich hin, saß leicht nach vorn gebeugt, klammerte mich ans Lenkrad. Ich stand total neben mir.
Der vor Freude bellende Hund riss mich aus meinem Monolog. Ich war schon vor einer Weile auf dem Hof angekommen, der Motor war aus. Ich streichelte ihn flüchtig, weil er sich so freute, dass ich wieder da war, und rannte, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe zum Dachboden hinauf, zuerst Stein, dann Holz, nahm den Rest des Hauses überhaupt nicht wahr. Zwischen den Spinnweben gab es ein kleines Fenster, das auf das umliegende Land hinausging, hier war mein Aussichtspunkt. Schon als kleiner Junge hatte ich mich dorthin geflüchtet, wenn mein Vater mich wegen einer kindlichen Dummheit ausgeschimpft hatte. Ich hatte einen alten Schemel unter das kleine Viereck Himmel gestellt, und jetzt stand ich dort und rauchte, den Kopf in der Dachluke. Von dieser Warte aus überblickte ich meine gesamten galicischen Ländereien. Felder, so weit das Auge reichte, wie eine grüne weiche Dünung, die an das Meer erinnerte, so nah und doch nicht sichtbar. Die Eukalyptusbäume, die Blaugummibäume. Die zarte blaue Farbe der jungen, das dunkle Grün der älteren Blätter. Wenn der morgendliche Wind anhob und den Wald seufzen ließ, war es, als würden sie ineinanderfließen. Blau und Grün. Grün und Blau. Je nach Windstärke war es immer anders. Wenn die Brise die Blätter träge wogen ließ, waren sie wie ein großer Schwarm