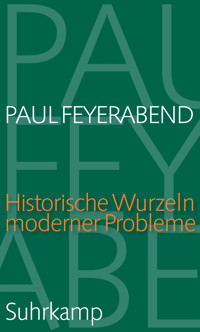
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Sommersemester 1985 hält Paul Feyerabend eine Vorlesung an der ETH Zürich, in der er die These vertritt, dass wir viele Probleme der modernen Welt besser verstehen, wenn wir sie auf historische Wurzeln in der Geisteswelt der griechischen Antike zurückführen. Das überwiegend naturwissenschaftliche Publikum wird nicht enttäuscht. In gezielt antiprofessoraler Performance, gespickt mit brillanten Provokationen und anekdotischen Abschweifungen, die sein profundes Wissen offenbaren, schärft das enfant terrible der Wissenschaftsphilosophie seine berühmte Kritik am abendländischen Rationalismus.
Besonders die Monopolstellung der wissenschaftlich-technischen Vernunft mit ihren Vorstellungen von Fortschritt, Wahrheit oder Objektivität nimmt er dabei ins Visier, als mitverantwortlich für die Schieflage der Welt. Dagegen empfiehlt Feyerabend einen erkenntnistheoretischen und politischen Pluralismus, um den »modernen Problemen« seiner Zeit beizukommen: der atomaren Bedrohung, der Zerstörung außereuropäischer Zivilisationen, den sozialen Verwerfungen und der sich anbahnenden ökologischen Katastrophe. Und heute? Eine furiose Reise in die 1980er Jahre, die unter anderem zeigt, dass nicht wenige Probleme von gestern noch immer auf der Agenda stehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 856
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
3Paul Feyerabend
Historische Wurzeln moderner Probleme
Vorlesung an der ETH Zürich 1985
Herausgegeben von Michael Hagner und Michael Hampe unter Mitarbeit von Hannah Kressig und Anna Morawietz
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2023.
Erste Auflage 2023Originalausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzungdes Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-77787-9
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Editorisches Vorwort
Vorlesungen
Vorlesung 1. (17. 4. 1985)
Vorlesung 2. (24. 4. 1985)
Vorlesung 3. (8. 5. 1985)
Vorlesung 4. (15. 5. 1985)
Vorlesung 5. (22. 5. 1985)
Vorlesung 6. (29. 5. 1985)
Vorlesung 7. (5. 6. 1985)
Vorlesung 8. (12. 6. 1985)
Vorlesung 9. (19. 6. 1985)
Vorlesung 10. (26. 6. 1985)
Vorlesung 11. (3. 7. 1985)
Vorlesung 12. (10. 7. 1985)
Siglenverzeichnis
Anmerkungen der Herausgeber
Vorlesung 1
Vorlesung 2
Vorlesung 3
Vorlesung 4
Vorlesung 5
Vorlesung 6
Vorlesung 7
Vorlesung 8
Vorlesung 9
Vorlesung 10
Vorlesung 11
Vorlesung 12
Feyerabends realistischer Relativismus
Nachwort von Michael Hagner und Michael Hampe
Namenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
511
512
513
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
7
Editorisches Vorwort
Im Sommersemester 1985 hielt Paul Feyerabend an der ETH Zürich die Vorlesung Historische Wurzeln moderner Probleme. Die Veranstaltung fand jeweils mittwochs von 13 bis 15 Uhr in einem 250 Plätze umfassenden Hörsaal (HIL E1) statt, der sich nicht im Zentrum der Stadt, sondern auf dem etwas außerhalb gelegenen zweiten Campus der Hochschule auf dem Hönggerberg befindet. Feyerabend lehrte seit 1980 auf einer halben Professur Philosophie der Wissenschaften an der ETH, wobei er das Sommersemester üblicherweise in Zürich, das Wintersemester in Berkeley verbrachte.
Die vorliegende Edition der Vorlesung basiert auf Tonbandmitschnitten, die von Feyerabends damaligem Assistenten Christian Thomas angefertigt worden sind. Diese Bänder befinden sich in der Paul-Feyerabend-Sammlung des Philosophischen Archivs der Universität Konstanz unter der Archivsignatur PAKN, PF 20. Zusätzlich zu den Tonaufnahmen haben wir ein ebenfalls im Nachlass befindliches, aus 261 Blättern bestehendes Typoskript (PAKN, PF 4-16) benutzt, das Feyerabend auf der ersten Seite mit Gegenwartsprobleme überschrieben hat. Das Konvolut enthält handschriftliche Notizen für die Vorlesung, daneben einige mit Schreibmaschine geschriebene Seiten, Zeitungsausschnitte, Fotokopien von gedruckten Texten und auch Briefentwürfe, die nichts mit der Vorlesung zu tun haben, deren unbeschriebene Rückseiten Feyerabend allerdings für Stichworte, Zitate und Literaturangaben benutzte.
Beim Abhören der in digitalisierter Form vorliegenden Dateien, die die zwölf Vorlesungen enthalten, wurde schnell deut8lich, dass Feyerabend an nicht wenigen Stellen schwer oder auch gar nicht zu verstehen ist. Für die Transkription, die von Frank Lachmann besorgt wurde, hat das erhebliche Schwierigkeiten zur Folge gehabt, wobei zwischen zwei Arten von Problemen zu unterscheiden ist. Erstens weisen die bald 40 Jahre alten Aufnahmen technische und akustische Probleme auf. So sind bei der Vorlesung vom 8. 5. 1985 die letzten 25 Minuten, bei der vom 12. 6. 1985 die letzte Viertelstunde wegen Korrumpierung der Audiodatei gänzlich unverständlich. Auch beim Wechsel der Kassetten sind einzelne Sätze verloren gegangen. Dass die medientechnische Situation damals das Geschehen nicht vollständig determiniert hat, zeigt sich daran, dass Feyerabend sich des Öfteren zu weit vom Mikrofon des Aufnahmegeräts entfernt hat, insbesondere wenn er auf Fragen aus dem Publikum geantwortet oder an die Tafel geschrieben hat. Er machte immer wieder eher schlecht zu verstehende Verweise auf die Tafel, die wir aber meist durch die Vorlesungsnotizen oder andere Publikationen von Feyerabend rekonstruieren konnten. Das bezieht sich vor allem auf das Tafelbild zur Ordnung der Vorlesung und auf einige an die Tafel gezeichnete Skizzen, die sich an Abbildungen aus seinem 1984 publizierten Buch Wissenschaft als Kunst orientierten. Die größten Verständnisprobleme stellten sich bei den Publikumsfragen, die mitunter kaum zu verstehen sind. Das ist umso bedauerlicher, als die Vorlesung interaktiv angelegt war: Diskussionen haben einen großen Raum eingenommen. Die beiden Veranstaltungen vom 19. 6. und 10. 7. 1985 bestehen sogar ausschließlich aus Diskussionen mit dem Auditorium, doch die Fragen, Anmerkungen und kritischen Einwände gegen Feyerabends Ausführungen finden sich in dieser Edition aus dem genannten Grund nur in unvollständiger Form wieder.
9Zweitens stellten die in freier Rede gehaltenen Vorlesungen uns immer wieder vor Verständnisprobleme. In seiner Autobiografie Zeitverschwendung erwähnt Feyerabend, dass er den Wiener Dialekt hasse und »ein neutrales Deutsch oder Bühnendeutsch mit preußischem Akzent« spreche.[1] Zumindest für die vorliegende Vorlesung trifft das nicht zu. Die Wiener Herkunft ist unverkennbar, was sowohl am Dialekt als auch an besonderen Redewendungen und Austriazismen deutlich wird. Man kann Feyerabend beim lauten Denken zuhören, hat aber mit dem akustischen Dokument bisweilen auch Schwierigkeiten, dem Gedanken zu folgen. Mal verschluckt er einzelne Wörter oder Satzteile, mal bricht er Sätze ab, um an einem neuen gedanklichen Punkt anzusetzen. Die Originalität freier Rede zehrt bekanntlich vom Verfertigen der Gedanken beim Reden, doch in diesem Fall kam nach Auskunft von Christian Thomas hinzu, dass Feyerabend aufgrund seiner schweren Kriegsverletzung immer wieder an heftigen Schmerzen litt, die er mit starken Schmerzmitteln bekämpfte, doch wegen deren sedierender Wirkung wurde er so müde, dass er sich gleichzeitig mit stimulierenden Medikamenten aufputschte. Im Hörsaal hat diese Beeinträchtigung offenbar kein Problem dargestellt, denn Feyerabends Vorlesungen lebten von seinem Charisma und seiner Unkonventionalität. Er unterhielt das Publikum mit Esprit, Wortwitz, Polemik, überraschenden Assoziationen und rhetorischen Zuspitzungen, die der gelernte Opernsänger virtuos abrufen konnte. Diese Atmosphäre konnten wir in die Edition nicht hinüberretten. Daher haben wir – mit einer einzigen Ausnahme – auch darauf verzichtet, die zahlreichen Stellen, an denen das Publikum mit Gelächter reagierte, zu markieren, zumal sich die Komik 10nicht selten auch aus seiner Gestik und Mimik ergab, die uns nicht überliefert sind.
Bei den sprachlichen Eigenheiten muss ein weiterer Aspekt berücksichtigt werden. Nach Jahrzehnten Leben und Arbeiten in England und in den USA redete, schrieb und dachte Feyerabend auf Englisch, wie er in Zeitverschwendung auch anmerkt.[2] Deutsch war für ihn gewiss keine Fremdsprache, aber die Reichhaltigkeit der Sprache und das Vokabular standen ihm unter besagten erschwerten medizinischen Bedingungen vielleicht nicht immer mit der zu erwartenden Selbstverständlichkeit zur Verfügung. So finden sich häufig unkonkrete Begriffe wie Sachen, Dinge und Leute, selbst wenn Feyerabend etwas ganz Konkretes meinte. Mag sein, dass diese mangelnde Spezifizierung zum Teil auch in seinem bewussten Verzicht auf Fachwörter begründet ist, doch allgemein gilt: die gesprochene Sprache, die für das Ohr verständlich und akzeptabel ist, ist es für das lesende Auge nicht.
Beim Transfer der gesprochenen Vorlesung in einen Text stellte sich angesichts dieser Hürden die Frage, welche Gestalt die Edition annehmen sollte. Es kam für uns von vornherein nicht in Betracht, eine historisch-kritische Ausgabe mit einem umfangreichen Apparat vorzulegen. Das hätte nicht nur unsere Kräfte überfordert, wir sind auch der Ansicht, dass für eine solche Edition das gedruckte Buch nicht mehr das richtige Medium darstellen würde. Unser Ziel bestand vielmehr darin, sowohl der Forschung als auch einem breiteren Publikum eine Leseausgabe zu präsentieren, die den Stil und den Sound der freien Rede beibehält, gleichzeitig jedoch einen lesbaren und lesenswerten Text hinzubekommen, der Feyerabends Gedankengängen ebenso Rechnung trägt wie seinen zahlreichen 11Aus- und Abschweifungen, Assoziationen und Witzen. Um dorthin zu gelangen, war es nicht zu vermeiden, an vielen Stellen Umstellungen, Kürzungen und Streichungen vorzunehmen, fehlende Wörter einzufügen und irrtümlich falsch verwendete Begriffe zu korrigieren. Bisweilen haben wir ganze Sätze, die nicht oder nur unvollständig zu verstehen waren, weggelassen oder in der Hoffnung umformuliert, dass sie im entsprechenden Kontext den von Feyerabend intendierten Sinn treffen. Für manche Ergänzungen waren die Vorlesungsnotizen da besonders hilfreich. Bei dieser zweifellos massiven, die sprachliche Konstruktion des gesprochenen Worts verändernden Praxis haben wir gleichwohl sorgfältig darauf geachtet, erstens den Inhalt nicht anzutasten und zweitens bei der Reformulierung der Sätze nur solche Wörter zu benutzen, die bei Feyerabend selbst vorkommen.
Offensichtliche Fehler haben wir, wie üblich, stillschweigend korrigiert, ebenso haben wir Füllwörter wie ja, natürlich, nicht wahr, und so weiter, die Feyerabend gerne und häufig benutzt hat, an vielen Stellen (wenn auch nicht immer) weggelassen. Darüber hinaus haben wir zwar die Streichung längerer Passagen mit einer Fußnote vermerkt, doch die angesprochenen Eingriffe in den Text nicht durch Anmerkungen, Auslassungspunkte in eckigen Klammern oder Ähnliches markiert. Hätten wir das konsequent getan, wäre jede einzelne Seite mit solchen Zeichen entstellt worden. Oder um es mit Feyerabends Worten selbst zu sagen: Wir hätten den Text »in einen Friedhof« verwandelt, und das galt es naturgemäß zu vermeiden.[3]
Die Streichungen ganzer Textteile betreffen vor allem diejenigen Passagen der Vorlesung, die entweder gar nicht oder nur so rudimentär zu verstehen sind, dass sie für uns keinen Sinn 12ergeben haben. Das bezieht sich vor allem auf die Fragen aus dem Publikum und Feyerabends Antworten in der Diskussion. Die Vorlesungen vom 19. 6. und die letzte vom 10. 7. 1985 waren, wie gesagt, ausschließlich der Diskussion vorbehalten. Gerade bei der letzten beteiligten sich so viele Zuhörer, und es gab so viel schnelle Rede und Gegenrede, dass wir uns für diese eine Vorlesung abweichend von den anderen entschieden haben, die Fragen alphabetisch durchzunummerieren, um eine gewisse Übersichtlichkeit herzustellen. Etliche Aussagen blieben aber auch hier unverständlich. So gesehen haben wir es bei dieser Edition mit einem Torso zu tun, der an verschiedenen Stellen von uns ergänzt oder modifiziert worden ist. Angesichts so weitreichender editorischer Eingriffe, die bisweilen eher einer Transformation als einem Transfer nahekommen, halten wir es für geboten, dass unsere Arbeit der Nachprüfbarkeit nicht entzogen wird. Daher sind auf der Webseite Paul Feyerabends die Vorlesungen im Originalton nachzuhören.[4] Es würde uns nicht überraschen, wenn interessierte Leserinnen und Leser beim Nachhören der Vorlesungen und gleichzeitiger Lektüre dieser Edition an der einen oder anderen Stelle etwas anderes verstehen als wir.
Ein weiterer editorischer Eingriff galt den Zitaten. Damit meinen wir nicht die für diese Vorlesung typische Form der direkten Rede und Gegenrede, bei der Feyerabend den von ihm behandelten Personen bestimmte Worte in den Mund legt und dann mit anderen, bisweilen imaginären Personen in einen fiktiven Dialog treten lässt. Diese theatrale Form hat Feyerabend wohl bewusst gewählt, um Johann Nestroy, Dada 13sowie der Sprache des Showbusiness und des Boulevards, die er als Bestandteil seines antiakademischen Habitus pflegte, seine Reverenz zu erweisen. Jedenfalls haben wir diese Sätze entweder in einfache Anführungszeichen gesetzt oder in indirekte Rede umgeschrieben. Bei den echten Zitaten, die in doppelten Anführungszeichen stehen, hat Feyerabend zumeist wörtlich zitiert, hin und wieder aber auch einzelne Sätze paraphrasiert, gekürzt oder weggelassen. In der Regel haben wir das unter Zuhilfenahme des Vorlesungsskripts oder der von Feyerabend benutzten Literatur korrigiert. Häufiger werden auch ganze Passagen aus den herangezogenen Texten zitiert, aber Feyerabend hat immer wieder kurze paraphrasierende oder kommentierende Einschübe vorgenommen. Um den Anmerkungsapparat nicht zu überlasten, haben wir die Anmerkung jeweils zum Schluss eines vollständig zitierten Abschnitts platziert und erst dann die nächste gesetzt, wenn ein neuer Absatz beginnt oder Feyerabend einen Sprung macht beziehungsweise einige Sätze aus der Quelle nicht vorliest.
Einen Spezialfall bilden die Übersetzungen aus dem Griechischen. In der Vorlesung vom 26. 6. 1985 kommt Feyerabend ausführlich auf das Problem der Übersetzungen zu sprechen. Er berichtet, in der Schule kein Griechisch gelernt, sich aber mit autodidaktischem Erlernen der Buchstaben, die ihm die Identifizierung der Wörter ermöglichte, sowie der Aneignung elementarer Grammatik und mit Spezialwörterbüchern für einzelne Autoren beholfen zu haben. Die von Feyerabend selbst übersetzten Passagen haben wir als solche vermerkt und, soweit möglich, mit existierenden Übersetzungen abgeglichen, allerdings auf Eingriffe verzichtet, sofern sie uns korrekt, wenn auch natürlich anders deutbar, erschienen. Auch wenn Feyerabends eigene Übersetzungen nur in seinen handschriftlichen Notizen existieren, haben wir sie in doppelte Anführungszei14chen gesetzt, um sie von seinen zahlreichen Paraphrasen abzusetzen, für die wir einfache Anführungszeichen verwendet haben. Wenn seine Übersetzungen oder Paraphrasen unklar waren oder inhaltlich stark vom Original abweichen, haben wir die wörtlichen Zitate aus anderen Ausgaben in den Fußnoten angegeben. Ansonsten haben wir die Zitate anhand der von Feyerabend benutzten Ausgaben nachgewiesen, dabei die üblichen Siglen verwendet und in einem auf die antiken Autoren beschränkten Siglenverzeichnis aufgeschlüsselt.
Schließlich hat Feyerabend in seine Vorlesung zahlreiche Literaturhinweise eingewoben, die er zumeist mit genauer Verlags-, Orts- und Jahresangabe versehen hat. Diese Angaben haben wir aus dem Fließtext in die Anmerkungen verfrachtet und dabei Irrtümer stillschweigend korrigiert sowie Ergänzungen (etwa Untertitel von Büchern) vorgenommen. Bei der angeführten Literatur halten wir uns an die nachweislich von Feyerabend benutzten Ausgaben und Übersetzungen, auch wenn diese inzwischen veraltet sind. In allen anderen Fällen haben wir die jeweils aktuellen und leicht erreichbaren Ausgaben herangezogen. Die Anmerkungen beschränken sich auf Nachweise offener und verdeckter Zitate sowie Quellen, sachliche Informationen zu Personen, Ereignissen, Werken und Kontextualisierungen, die zum Verständnis des Textes beitragen. Bei der Erstnennung von Personen haben wir konsequent den Vornamen hinzugefügt. An verschiedenen Stellen der Vorlesung hat Feyerabend Themen aufgegriffen, die er in ganz ähnlicher Form in seinen Publikationen verhandelt hat. Auch darauf haben wir, soweit es uns möglich war, in den Anmerkungen verwiesen.
*
15Eine Edition wie diese ist ohne die Unterstützung mehrerer Personen und Institutionen nicht möglich. Unser erster Dank gilt Grazia Borrini-Feyerabend, die diese Edition ermöglicht und stets mit Wohlwollen begleitet hat. Christian Thomas hat uns entscheidende Informationen zu den Umständen und zum Kontext der Vorlesung gegeben. Auch von Harald Atmanspacher haben wir wertvolle Hinweise erhalten. Besonders danken möchten wir Frank Lachmann für seine außerordentlich sorgfältige Transkription der Audiodateien. Sie stellt die unverzichtbare Grundlage unserer Arbeit dar. Weiterhin danken wir Daniel Wilhelm, dem Leiter der Archive der Universität Konstanz. Er hat uns kundig und unbürokratisch Zugang zu den relevanten Teilen des Nachlasses von Paul Feyerabend gewährt. Ohne die fabelhafte editorische Mitarbeit von Hannah Kressig und Anna Morawietz hätte dieses Buch sehr anders ausgesehen. Wir sind beiden zu Dank verpflichtet.
Im Herbstsemester 2022 haben wir unter dem Titel »Paul Feyerabends anarchistische Erkenntnistheorie« an der ETH Zürich gemeinsam ein Seminar durchgeführt, von dem wir sehr profitiert haben. Die Diskussionen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieses Seminars, die zum größeren Teil noch nicht geboren waren, als Feyerabend starb, haben uns darin bestärkt, dass es auch heute noch außerordentlich lohnenswert ist, seine Thesen zu diskutieren. Schließlich danken wir Eva Gilmer und ihrem Team im Suhrkamp Verlag für die vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit.
M. H./M. H., Zürich, im Juli 2023
17
Vorlesungen
19
Vorlesung 1
(17. 4. 1985)
Das Aufnahmegerät habe ich nicht bei mir, weil ich meine unsterblichen Worte für die Ewigkeit aufbewahrt haben möchte, sondern weil ich in Kalifornien eine Freundin namens Grazia habe, die ich jetzt fünf Monate lang nicht sehen werde. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, und da schicken wir uns Tonbänder. Sie schickt mir Tonbänder von den Veranstaltungen, an denen sie teilnimmt – das ist vor allem Bergklettern und so weiter –, und ich habe ihr versprochen, ein Tonband vom Anfang der Vorlesung zu schicken, damit sie etwas von der Atmosphäre mitkriegt. Deutsch versteht sie überhaupt nicht. Aber das macht nichts, denn ich wollte am Anfang das allgemeine Gemurmel und die Glocke haben, und dann habe ich entdeckt, dass ich in den Hörsaal E1 muss, und deshalb habe ich die Glocke versäumt.1
Ich habe Grazia auch noch aus einem zweiten Grund hier bei mir sitzen, weil ich ihr nämlich die Papers, die ich hier und da schreibe, zum Durchlesen gebe. Und die kommen immer mit einer langen Liste von Kritiken zurück. Gewöhnlich fängt es an mit ›Das ist ein wunderbares Paper‹, und dann kommt ein ›Aber‹, und es folgt eine lange Liste von Kritiken. Ihre umfassende Kritik ist ungefähr immer die, dass meine Aufsätze wie eine Minestrone sind. Da gibt es nicht Beginn, Mitte und Ende, sondern es ist so eine Suppe, in der alles drin ist. Im Italienischen hat man das Schlagwort anything goes ja mit tutto fa brodo übersetzt, und das trifft genau darauf zu. Ich habe mir das überlegt und gesagt, dass Minestrone ja gar nicht so schlecht ist. Das ist keine Kritik, sondern ein Lob, 20denn die ganze Welt, in der wir leben, ist eine Art von Minestrone. Es gibt kleine, eingeschränkte Bereiche, in denen es ordentlich zugeht, wie zum Beispiel die Universitäten – obwohl es in denen gerade auch nicht sehr ordentlich zugeht, wenn man sich das im Detail ansieht –, aber abgesehen davon herrscht ein großes Durcheinander. Wenn man sich in dieser Welt orientieren und ein wenig über die in ihr vorgehenden Dinge sagen will, ist es am besten, so zu schreiben, dass es dieser Welt ähnlich ist und nicht zu sehr verschieden von ihr. Denn wenn man mit dem Geschriebenen über die Welt hinausgeht, fällt man sofort auf die Nase. Eine alte Anekdote, die Platon über Thales erzählte, lautete: Da ging Thales die Sterne ansehend umher und fiel in einen Brunnen. Ein Bauernmädchen stand daneben, lachte und sagte: ›Na ja, die Sterne kennst du ja vielleicht, aber die Welt kennst du nicht.‹2 Und um die Welt kennenzulernen, so meine ich, braucht man eine Minestrone.
Eine solche Minestrone möchte ich Ihnen in dieser Vorlesungsreihe vorführen. Angelegt ist sie auf die nächsten drei Jahre.3 Im kommenden Jahr möchte ich etwas »ordentlicher« lesen. Da wird Galileo Galileis Dialog über die zwei hauptsächlichen Weltsysteme im Zentrum stehen. Ich werde dieses Buch Kapitel für Kapitel durchgehen, Bedeutung und Hintergrund erklären und natürlich auch auf den Prozess gegen Galilei eingehen, der durch die Publikation dieses Buches hervorgerufen worden ist. Im Jahr darauf werde ich meine einführende Vorlesung über Wissenschaftstheorie wiederholen. In diesem Semester wird die Vorlesung ungefähr wie folgt aussehen: Ich werde mich teils oberflächlich, teils sehr oberflächlich, teils etwas gründlicher, aber nie allzu gründlich mit einigen Problemen beschäftigen, die in der Gegenwart eine Rolle spielen. Ich werde eine Liste dieser Probleme an die Tafel schrei21ben und dann der Reihe nach von links nach rechts durchgehen.
Das ist also die Minestrone, denn all diese Probleme sind sehr verschiedenartig. Den roten Faden in der Vorlesung bildet meine Überzeugung, dass man abstrakte Probleme und politische Probleme, also etwa Probleme in den Wissenschaften, aber auch solche der Umweltverschmutzung, klären und vielleicht sogar lösen kann, wenn man auf den Ursprung der Probleme zurückgeht, dahin also, wo sie zum ersten Mal formuliert und die ersten Vorschläge zu ihrer Lösung unterbreitet worden sind. Ich beschränke mich hier auf den Westen, also auf das Geschehen im alten Griechenland, und beginne mit den Vorsokratikern und den Sophisten, den ersten bezahlten Professoren der Philosophie, und komme dann zu ihren Nachfolgern, den Schulgründern Platon und Aristoteles. Platon mochte die Sophisten gar nicht, weil sie sich bezahlen ließen, was er nicht getan hat – aber er war ja auch ein reicher Herr. Und dazwischen kam noch Isokrates, der mit Platon im Wettstreit stand und eine ganz andere Ansicht vom Aufbau der Gesellschaft hatte.
Wenn wir also irgendein Problem haben, fällt eine ganze Menge davon ab, wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen, etwa ins 18. Jahrhundert oder eben sogar in die Antike. Beispielsweise wusste man damals noch nichts über Industrialisierung und auch nichts über technische Termini, wie es sie heute in manchen Arten der Philosophie gibt. In der Hegel'schen Philosophie gibt es zum Beispiel eine sehr schwer zu erlernende Terminologie, die komplett wegfallen wird, wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen. In anderen Arten der Philosophie gibt es die Terminologie der mathematischen Logik. Sie ist auch nicht leicht zu erlernen, und auch sie wird allmählich wegfallen. Übrig bleibt dann plötzlich ein reines, von dieser 22Terminologie unbeschwertes Problem, und es ergibt sich für gewöhnlich, dass eine Menge von Leuten dieses Problem in der Antike diskutiert haben, dass sie verschiedene Lösungen vorgeschlagen haben und dass diese Lösungen oft sehr einfach waren. Gibt man zu einer solchen Lösung die durch die Gegenwart hineinkommenden Zusätze hinzu, sieht die Sache häufig viel besser aus als am Anfang. Jetzt übrigens werde ich das Band für Grazia ausschalten. Sie wird höchstwahrscheinlich schon eingeschlafen sein und kein Wort verstanden haben. Bye bye Grazia, now I'm putting you back into my bag.
Eine solche Idee wird heute nicht zum ersten Mal gefasst. Wenn Sie sich in Friedrich Nietzsches Gesammelten Werken die Vorlesungsnotizen ansehen, so hat er zum Beispiel – bei ihm ging das andersherum – Vorlesungen über die Vorsokratiker gehalten und sich von dort aus in die Philosophie seiner Zeit hinüberbewegt. In dieser Vorlesung hat er parallele Erscheinungen zwischen den Vorsokratikern und der damals modernen Physik herangezogen und diskutiert.4 Damit wollte er zeigen, dass viele sogenannte moderne Ideen in der Antike in einfacher Form schon vorweggenommen worden waren und dass man von der antiken Diskussion viel lernen kann. Nietzsche hat Ernst Mach sehr verehrt, der heute vielfach als Positivist verschrien ist, und ihm seine Werke geschickt. Mach hat darauf, soweit man weiß, nie geantwortet.5 Zumindest sind keine Briefe erhalten. So ist schon im späten 19. Jahrhundert ein Versuch gemacht worden, neue Errungenschaften mit alten zu verbinden, damit ihre Gegenüberstellung zu einer wechselseitigen Beleuchtung führt. Denn ein Kennzeichen der neuen Erkenntnis hat sich schon damals herauskristallisiert: Sie war zu kompliziert. Und um die Komplikationen wegzulassen und Grundprobleme hervorzuheben, ist Nietzsche in die Antike zurückgegangen.
23Ein zweites Beispiel ist die Abhandlung über die Krise in den Wissenschaften von Edmund Husserl. Husserl, der – ich weiß nicht, wie man das sagt – Lehrer von Martin Heidegger gewesen ist und selbst zahlreiche Schriften über die wissenschaftlichen Grundlagen der Weltanschauung der Wissenschaften verfasst hatte, schrieb in den dreißiger Jahren, als er schon alt und krank war, eine kurze Abhandlung über die Krise in den Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie.6 Das Buch ist sehr schön, denn da gibt es auf der einen Seite die Krise und auf der anderen die Lösung, nämlich seine eigene Philosophie. So gehen die Leute ja für gewöhnlich vor. Was er da beschreibt, ist das Folgende: Es gibt in den dreißiger Jahren eine Krise in den Wissenschaften. Und das war auch wirklich wahr. Langsam war in das Bewusstsein der breiteren Massen – die Philosophen eingeschlossen – und auch in das Bewusstsein von Fachwissenschaftlern, die sich nicht unmittelbar mit diesen Problemen beschäftigt haben, eingedrungen, dass eine gewisse Auffassung von der Natur der Welt nicht mehr stimmt: dass die Welt eine materielle Welt ist, die objektiver Natur ist und aus Atomen besteht, welche sich in einem dreidimensionalen Raum und in der Zeit bewegen und für die man Gleichungen aufstellen kann, nach denen sie sich bewegen. Im 19. Jahrhundert war die Biologie sehr oft atomistisch-materialistisch eingestellt. Emil Du Bois-Reymond war einer der hervorragendsten Biologen in diesem Zusammenhang. Auch die Psychologie war materialistisch. Das war also die Weltanschauung der meisten Wissenschaftler, von Ausnahmen wie Mach abgesehen.
Diese Weltanschauung ist durch zwei Entdeckungen, die Relativitätstheorie und die Quantentheorie, erschüttert, wenn nicht gar zerschlagen worden. Die erste Erschütterung war die Relativitätstheorie. In Deutschland ist sie sehr schnell ins Be24wusstsein eingedrungen, denn dort fand sie mit Max Planck einen guten Propagandisten, der die Einstein'schen Ideen unmittelbar aufgegriffen hat. In England und Frankreich hat es viel länger gedauert. Es ergab sich, dass objektive Beziehungen – nämlich Raumbeziehungen –, von denen man früher glaubte, sie sind da in der Welt, vom Bewegungszustand des Beobachters abhängen. Gewisse alte Sachen wurden also subjektiviert und alte Begriffe, zum Beispiel der eines festen Körpers, haben sich damals ganz aufgelöst.
Das war die erste Erschütterung. Die zweite war in gewisser Hinsicht noch schlimmer. Man hatte immer gesagt, Wissenschaft bestehe darin, Kausalzusammenhänge festzustellen, nämlich wie etwas etwas anderes hervorbringt. Die Wissenschaftler, die ein bisschen mehr nachgedacht haben, waren aber nicht damit zufrieden, dass sie Vorhersagen machen konnten – das wollten sie natürlich auch, denn das Eintreffen der Vorhersage war für sie ein Zeichen dafür, dass sie richtig gedacht hatten. Aber sie wollten dieses Eintreffen der Vorhersagen als ein Symptom dafür auffassen, dass sie etwas richtig erfasst haben, was es in der objektiven Welt gibt, nämlich eine kausale Beziehung zwischen einem gewissen Prozess und einem anderen, mit ihm zusammenhängenden Prozess. Mit einer bestimmten Interpretation der Quantentheorie schien es so, dass man die Idee einer allumfassenden Kausalität aufgeben muss, ebenso wie die Idee, dass es eine objektive Welt gibt, in der sich Dinge abspielen, die wir uns ansehen können – da greifen wir einmal dieses und einmal jenes heraus und machen unsere Wissenschaft, ohne die Welt allzu sehr dabei zu stören. Es ergab sich, dass die Wechselwirkung mit der Welt nicht nur einfach zu Störungen führt, die man eliminieren kann, wie zum Beispiel dann, wenn man etwa ein Thermometer in eine heiße Flüssigkeit taucht. Da dehnt sich zunächst einmal das Thermometergefäß aus, 25das heißt, der Thermometerfaden geht runter, und dann erst dehnt sich der Faden aus und steigt hoch. Das sind Störungen, die man eliminieren kann. Aber uneliminierbare Störungen sind so, dass man keine einheitliche Beschreibung mehr haben kann.
Da es die Leute zu der Zeit, als Husserl seine Schrift fertigstellte und vortrug, für einen dogmatischen Grundsatz hielten, dass Wissenschaft die objektiven Verhältnisse auf kausale Weise erklärt, schien es für sie, dass die ganze Wissenschaft jetzt explodiert ist. Nun kommt es aber noch ärger: Die abstrakteste, präziseste Wissenschaft von allen, nämlich die Mathematik, hat sich auch in einem Durcheinander befunden. Dieses Durcheinander begann um die Jahrhundertwende und hielt dann bis ungefähr 1933 an. Zunächst einmal fing man an, die Sache etwas mehr zu präzisieren: Es gab die Arithmetik, die Geometrie und die Analysis. Dann kam noch die Mengenlehre hinzu, eingeführt von Georg Cantor, sehr zum Missbehagen vieler Mathematiker, die das für einen metaphysischen Unsinn gehalten haben.7 Die traditionellen Sachen wurden jedenfalls ein bisschen mehr geklärt. Die euklidische Geometrie wurde zum Beispiel von David Hilbert besser axiomatisiert; Annahmen, die bei Euklid noch verborgen drinsteckten, hat er mit seinem, dem Hilbert'schen Axiomensystem der Geometrie explizit gemacht, und das war ein Triumph.8 Dann gab es auch für die Arithmetik ein Axiomensystem, nämlich das Peano'sche Axiomensystem. Nach dem Vorbild des Euklid hat man da alle Sätze auf einige Grundsätze zurückzuführen versucht. Nun kam es darauf an, zu beweisen, dass diese Grundsätze nicht im Widerspruch zueinander stehen. Die gewöhnliche Art des Beweises bestand darin, dass man ein Modell der Grundsätze in einem anderen Medium aufstellte, dessen Widerspruchsfreiheit man für selbstverständlich hielt. Für 26gewöhnlich waren das arithmetische Modelle, also Zahlenmodelle. Wenn sich zeigen ließ, dass es bestimmte Zahlenanordnungen gibt, die genau den euklidischen Axiomen genügen, dann war ein relativer Widerspruchsfreiheitsbeweis geliefert. Damit bewegte sich langsam alles zurück auf die Arithmetik, denn all diese Widerspruchsfreiheitsbeweise waren in terms von Modellen, die sich natürlicher Zahlen bedienten. Die Frage war nun: Wie beweist man die Widerspruchsfreiheit der Arithmetik?
Damals hat es zwei, eigentlich sogar drei, aber im Grunde zwei Vorschläge gegeben. Der eine war der von Gottlob Frege und Bertrand Russell,9 der seinen Triumph in Russells gemeinsam mit Alfred North Whitehead verfassten Principia Mathematica gefunden hat, in diesen monströsen Bänden mit der Formelschrift.10 Das war der Versuch, alle mathematischen Begriffe in logischen Begriffen zu definieren, das heißt in Begriffen wie »Klasse« – »etwas ist enthalten in einer Klasse, wenn«, »für jedes x dieser Art gilt« und so weiter –, und dann auch die Grundsätze der Arithmetik und später auch der Analysis auf einfache logische Grundsätze zurückzuführen beziehungsweise sie aus ihnen herzuleiten. Da man glaubte, die logischen Grundsätze seien so einfach, dass man einen in ihnen vorkommenden Widerspruch sofort entdecken würde, glaubte man, dadurch einen indirekten Widerspruchsfreiheitsbeweis für das gesamte Gebäude der Mathematik geliefert zu haben. Frege begann damit, und Russell hat es weiter ausgebaut. Es gab damals allerdings schon Schwierigkeiten, denn es zeigte sich, dass gewisse, sehr einfache Annahmen zu Widersprüchen, sogenannten Paradoxien, führen, aber das glaubte Russell beseitigt zu haben.
Die andere Vorgehensweise war die von Hilbert, der sich gesagt hat: Gehen wir doch einmal ganz naiv vor, als verstünden 27wir nicht, was arithmetische Sätze besagen. Er spricht da über Zahlen und sagt, das sind so abstrakte Dinge – kein Mensch weiß, was das ist. Aber ein Zahlzeichen auf dem Papier, da weiß man, das ist ein kleines Zeichen mit einer bestimmten Struktur. Und nun wollte er die ganze Arithmetik formalisieren, das heißt zunächst einmal, die Regeln des Schachs mit solchen Zahlzeichen angeben und dann zeigen, dass dieses Spiel widerspruchsfrei ist in dem Sinne, dass eine gewisse Konfiguration, nämlich die des Zahlzeichens 0 und des Zahlzeichens 0 und dazwischen diese zwei durchgestrichenen Striche, also interpretiert als »0 ≠ 0«, nie dabei herauskommt. Und da das Hantieren mit Zahlzeichen zu überblicken ist, während man bei einer Zahl nie genau weiß, was das überhaupt ist, so dachte Hilbert, es könnte auf diese Weise ein rein formaler Widerspruchsfreiheitsbeweis geliefert werden.
Nun ist in den dreißiger Jahren von Kurt Gödel – viele von Ihnen werden das ja wissen – ein Beweis gerade auf Basis dieser Voraussetzungen geliefert worden, der ungefähr Folgendes besagt: Wenn die Arithmetik widerspruchsfrei ist, dann ist es nicht möglich, diese Widerspruchsfreiheit mit Mitteln zu beweisen, die weniger reich sind als die Mittel der Arithmetik selbst.11 Das heißt, man kann nicht sagen, ich befasse mich einfach nur mit Zahlzeichen und dann muss ich sagen, dass das eine links davon ist und so weiter, das ist also etwas sehr Einfaches. Wenn ich die Widerspruchsfreiheit der Arithmetik beweisen will, muss ich mich bestimmter Gedankendinge bedienen, die komplizierter sind als die Gedankendinge der Arithmetik. Ich kann ihre Widerspruchsfreiheit nur beweisen, indem ich von der Arithmetik zu einer Art Überarithmetik übergehe. Na ja, und dann stellt sich die Frage nach der Widerspruchsfreiheit dieser Überarithmetik. Die kann auch nicht rein formal bewiesen werden. Das heißt, die Widerspruchsfrei28heit scheint auf einem Glauben zu beruhen: Man nimmt sie einfach an, aber man sieht, dass ein definitiver Widerspruchsfreiheitsbeweis für Systeme, die eine gewisse Komplikation haben – bei einfachen Prädikatenkalkülen kann man das machen –, sich nicht erbringen lässt. Das heißt, sogar die Mathematik, die exakteste aller Wissenschaften, schien in der Luft herumzuschweben.
Das waren also drei, wie soll man sagen, katastrophenartige Entwicklungen. Die dritte, Gödels Unvollständigkeitssatz, war Husserl noch nicht bekannt, als er seine Krisis-Schrift verfasste, aber die Schwierigkeiten der Mathematik und der Widerspruchsfreiheitsbeweise kannte er. Dazu kam zu dieser Zeit auch in den Geisteswissenschaften etwas, was noch heute diskutiert wird und was ich später sehr eingehend behandeln werde, nämlich der Relativismus. Der Relativismus war damals ein geisteswissenschaftlicher Luxus. In späteren Zeiten wurde er Teil einer humanitären Einstellung, als die Anthropologen nicht mehr so sehr wissenschaftszentriert waren, sondern als Menschen auf die Gebräuche anderer Menschen eingegangen sind. Denn da fiel es ihnen sehr schwer, diese Gebräuche zu verdammen und zu sagen, wie primitiv die doch seien. Sie sahen ein, dass dies eben auch eine Art zu leben ist, die viele Vorteile und viele Nachteile hat. Nachdem Edward Evans-Pritchard ein halbes Jahr bei den Azande gelebt hatte, sagte er: ›Auf die eine oder andere Weise ist es gehupft wie gesprungen.‹12 Das hat er natürlich nicht so gesagt, er hat auf Englisch geschrieben, aber gemeint. Wenn man lange Zeit mit einem Stamm wie den Azande zusammenlebt, ist das Leben ganz und gar anders. Man muss auf Luxus verzichten, gewinnt aber auch vieles, etwa an persönlichen Beziehungen. Und so scheint es nicht so leicht, zu sagen, die richtige Weise zu leben ist soundso. Der neuere Relativismus hat also in der humanitären 29Anthropologie einen Rückhalt. Der ältere war ein Luxus in den Geisteswissenschaften, indem man sagte: Es gibt viele Perioden der Geschichte, wie kann man die interpretieren? Und weil die Interpretationsmethoden verschiedener Schulen sehr verschieden voneinander waren, hat man schließlich im Zusammenhang mit dem Skeptizismus gesagt: Eine Wahrheit gibt es nicht, es kommt auf die Schule an.
Das war für Husserl eine Krise in den Geisteswissenschaften, und die hat er mit den damaligen politischen Krisen in Zusammenhang gebracht, denn in den dreißiger Jahren hat der Faschismus ja nicht nur in Deutschland eine Rolle gespielt. Wenn Sie Ernst Noltes Buch Der Faschismus in seiner Epoche lesen, stellen Sie fest, dass es Faschisten in Italien, aber auch in Frankreich, England und in Amerika gab.13 Die haben nicht nur Lärm gemacht, sondern auch Anhänger um sich geschart. Der Faschismus hat sich also verbreitet, und zwar teilweise als Resultat dieser relativistischen Einstellung: Weil es nicht auf die Wahrheit ankommt, kommt es eigentlich nur darauf an, wer der Stärkere ist. Das ist eine Theorie, die es schon im Altertum gegeben hat, bei Thrasymachos zum Beispiel.14
Das war also die Krise für Husserl. Nun hat er gefragt: Zeigt diese Krise, dass die Wissenschaft sich auflöst? Nein, das zeigt sie nicht, so seine Antwort. Wer sagt denn, dass die Wissenschaft immer stabil bleiben muss? Das heißt, Husserl hat damals, um 1930, ein Wissenschaftsbild gehabt, das man heute, sehr populär, mit Karl Popper verbindet und das besagt, dass die Wissenschaft ständig im Wandel ist. Exakte Wissenschaften hören nicht auf, exakt zu sein, weil plötzlich eine neue Ansicht auftaucht.15 Denn diese neue Ansicht, so glaubte Husserl, sei exakt begründbar, vielleicht auch mit der Mathematik. Aber der Umstand, dass die Leute an eine Krise glauben, zeige, 30dass sie das richtige Verständnis der Wissenschaften noch nicht gewonnen haben, weil sie noch nicht durchschaut haben, wie sich die Wissenschaften in die Umgebung des übrigen Lebens einfügen. Und sie haben das noch nicht durchschaut, weil die breite Öffentlichkeit und auch die Wissenschaftler selbst durch triumphale Entwicklungen zur Zeit des Galilei überrumpelt worden sind. Nachdem vom Altertum bis übers Mittelalter hinaus eine qualitative Naturauffassung gang und gäbe war, also eine nach Qualitäten – Aristoteles! –, hieß es plötzlich, dass Qualitäten sekundär sind. Man braucht sich gar nicht um sie zu kümmern, weil sie völlig uninteressant sind. Damit fiel die ganze Psychologie weg, die menschlichen Beziehungen, all das wurde unwichtig. Wirklichkeit wird, wie Galilei sagt, in Dreiecken und Kreisen beschrieben, also in quantitativer Weise.
Diese Wirklichkeitsbeschreibungen haben mit Isaac Newton zu einer fantastischen, nie dagewesenen Vorhersagefähigkeit geführt. Sie war so präzise, dass man über 200 Jahre hinweg alle scheinbaren Abweichungen vom Newton'schen System am Ende doch auf seiner Grundlage erklären konnte. Aufgrund dieses Erfolgs hat man sofort angenommen: Man arbeitet mathematisch, Qualitäten interessieren überhaupt nicht. Aber es hat sich niemand gefragt, wie denn diese Art des Wissens mit dem Alltagswissen zusammenhängt, in das der Wissenschaftler auch involviert ist und das ihn darüber informiert, was er mit seinem Wissen tun soll. Das heißt, die beiden Sachen haben sich voneinander abgespalten. Viele Leute sind Spezialisten geworden und haben so eine Spaltung inmitten ihres eigenen Lebens gehabt, zwischen dem Spezialistendenken und dem restlichen Denken, das sie dann unter die Herrschaft der Spezialisten bringen wollten, ohne genauer das Verhältnis zwischen beiden Denkweisen zu untersuchen. Wie schwierig die 31Lage war, sehen Sie daran, was nach Einführung dieser quantitativen Auffassung aus der Wahrnehmung geworden ist. Wahrnehmung ist ja durchaus qualitativ. Und wie überprüft man die Voraussagen physikalischer Theorien? Indem man eben gewisse Wahrnehmungen hat. Wie also die Wahrnehmung zu Quantitäten in Beziehung zu bringen ist, hat zu der Zeit von René Descartes alle möglichen Leute beschäftigt. Das ist das sogenannte Leib-Seele-Problem, das nie gelöst worden ist. Die ganze Wissenschaft beruhte also auf einem ungelösten Problem, das durchaus als gegeben hingenommen worden ist: Da ist irgendein Zusammenhang, wir wissen nicht, welcher, aber das macht nichts. Das heißt, die ganze Sache war unverstanden.
Die richtige Krise liegt für Husserl nicht darin, dass sich die Sachen ständig verändern. Das macht die Wissenschaft ja nicht weniger präzise. Die Krise liegt in dem Glauben, etwas zu verstehen, das im Grunde ganz unverständlich ist. Wie aber, so fragt sich Husserl, kann Verständnis herbeigeführt werden? Indem man an den Ursprung dieser Spaltung zurückgeht, und der lag für ihn bei Galilei. Denn zu dessen Zeit war das qualitative Denken noch etwas ganz Natürliches. Wie hat Galilei damals argumentiert? Was ist damals geschehen? Welche Fehlschritte sind gemacht worden? Was ist zu korrigieren? Denn wenn es korrigiert wird, kann man diese Korrektur in die Gegenwart bringen und damit die Wissenschaft besser verständlich machen. Das war die Idee von Husserl, und damit stimme ich ganz und gar überein. Nur meine ich, dass bei Galilei anzusetzen viel zu spät ist. Man muss zurückgehen bis zu den Vorsokratikern, denn genau die gleichen Schwierigkeiten – wie zum Beispiel die Mathematik zur umgebenden Welt steht, in die wir alle eingebettet sind – sind damals zum ersten Mal diskutiert worden. Dies mit zwei verschiedenen Ansich32ten: Platon sagt, dass es zusätzlich zu den materiellen Gegenständen, die wir mit unseren Augen sehen, handwerklich bearbeiten und mit groben Formeln beschreiben, noch andere, ideale Gegenstände gibt, etwa Linien und Kreise, die auf ganz andere Weise erfasst werden müssen. Die Welt ist sozusagen in zwei Welten gespalten, und das Problem für Platon war, wie sie zueinander in Beziehung gebracht werden sollen. Aufgrund der Annahme dieser Spaltung hat er auch gewisse Vorschläge für die Wissenschaften gemacht, die sich als sehr fruchtbar erwiesen haben. Zum Beispiel sollten die Astronomen aufhören, diesen Fleckenteppich, diese Plafondmalereien – Platon hat das wirklich so genannt: Plafondmalereien –, diese bunten Muster am Himmel immer nur zu beobachten.16 Macht mathematische Modelle! Und so hat die Astronomie mit den mathematischen Modellen, den Epizyklen, angefangen, die über lange Zeit sehr wirksam gewesen sind. Auf der anderen Seite war Aristoteles, der die Mathematik in seine eigenen Ideen eingebaut hat, indem er sagte, dass mathematische Gegenstände nicht separate Gegenstände sind, sondern unvollständige Weisen des Beschreibens physikalischer Gegenstände. Was existiert, ist rein physikalisch. Da fängt die Diskussion an.
Der rote Faden, an dem ich die ganze Sache aufziehen will, ist der, dass ich einige Probleme der Gegenwart besprechen und dann so weit wie möglich auf ihren Ursprung zurückführen möchte. Diese Diskussion wird die Sachen viel klarer machen, indem wir vor- und wieder zurückgehen und dann fragen: Wie stellt man sich eigentlich dazu? Jetzt möchte ich Ihnen einfach als Übersicht eine Reihe von Problemgruppen aufschreiben, damit Sie ungefähr wissen, was wir machen werden.17 Und dann gehe ich diese Probleme der Reihe nach durch.
33
Abb. 1a: Tafelbild (Original).
Auf der linken Seite haben wir, wie ich sie nenne, »unwirkliche Probleme« und auf der rechten Seite »wirkliche Probleme« (Abb. 1a und 1b). Ich gebe Ihnen dazu zunächst ein paar Literaturangaben. »Wirkliche Probleme« werden in dem Büchlein Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit von Konrad Lorenz behandelt.18 Er nennt es eine »Predigt«, die er 1970 im Rundfunk gehalten und später publiziert hat. Dazu gibt es einen umfassenderen Begleitband, der die Lösung bringen soll oder die Perspektive, von der aus man die Probleme angehen sollte, nämlich Der Abbau des Menschlichen.19 Lorenz glaubt, dass Geschehnisse in den vielleicht letzten zwei Jahrhunderten zu einem Abbau typisch menschlicher Qualitäten und einer Ersetzung durch etwas anderes geführt haben, was mit dem Menschsein nicht sehr gut zusammengeht. Ich lese Ihnen nun die Zusammenfassung der Kritiken von Lorenz vor, also die »wirklichen Probleme«, die ich später besprechen möchte.
»Es wurden acht von einander unterscheidbare, wenn auch in engem ursächlichem Zusammenhang miteinander stehende Vorgänge besprochen, die nicht nur unsere heutige Kultur, sondern die Menschheit als Spezies mit dem Untergang bedrohen. Diese Vorgänge sind:
(1) Die Übervölkerung der Erde, die jeden von uns durch das Überangebot an sozialen Kontakten dazu zwingt, sich dagegen in einer grundsätzlich ›un-menschlichen‹ Weise abzuschirmen« – auf dem Land heißt man den Besucher nicht willkommen, wie er sagt; in der Stadt schmeißt man ihn hinaus, schirmt sich ab –, »und die außerdem durch die Zusammenpferchung vieler Individuen auf engem Raum unmittelbar aggressionsauslösend wirkt.«20 Und das glaubt er nicht nur für den Menschen zeigen zu können, sondern auch bei Tieren: Wenn man sie eng zusammenbringt, werden sie nervös und aggressiver. Viele seiner Beobachtungen kann jeder Mensch ma36chen. Lorenz kombiniert sie dann aber auch mit ähnlichen Beobachtungsergebnissen aus dem Gebiet der Verhaltensforschung der Tiere, auf dem er ja wesentliche Dinge geleistet hat. Dadurch werden sie ein bisschen verallgemeinert und erhalten etwas Bedrohliches.
Abb. 1b: Tafelbild (Transkription).
»(2) Die Verwüstung des natürlichen Lebensraumes, die nicht nur die äußere Umwelt zerstört, in der wir leben, sondern auch im Menschen selbst alle Ehrfurcht vor der Schönheit und Größe einer über ihm stehenden Schöpfung.«21 Wie groß diese Zerstörung ist, kann man zum Beispiel an dem Bericht Global 2000 sehen, der aufgrund einer Direktive von Präsident Jimmy Carter erstellt worden ist.22 In diesem Bericht wird ein Überblick über Mineralien, Wälder und weitere Entwicklungstendenzen gegeben. Darunter werden auch fünf oder sechs verschiedene Projektionsmodelle bis zum Jahr 2000 diskutiert, die alle gewisse Fehler haben, aber alle sind sich darin einig, dass die Sache nicht sehr gut ausgeht: Ungefähr 20 Prozent aller Tier- und Pflanzenspezies werden im Jahr 2000 von der Erde verschwunden sein. Die Ausmerzung von Waldland führt dazu, dass jede Woche ungefähr eine Fläche von der Größe halb Kaliforniens von der Erdoberfläche verschwindet.
»(3) Der Wettlauf der Menschheit mit sich selbst, der die Entwicklung der Technologie zu unserem Verderben immer rascher vorantreibt, die Menschen blind für alle wahren Werte macht und ihnen die Zeit nimmt, der wahrhaft menschlichen Tätigkeit der Reflexion zu obliegen«23 – also Werte, mit denen man Sachen in Perspektive setzt, nicht allein die Machbarkeit erwägt.
»(4) Der Schwund aller starken Gefühle und Affekte durch Verweichlichung« – das ist eine besondere Geschichte. »Fortschreiten von Technologie und Pharmakologie fördert eine zunehmende Intoleranz gegen alles im geringsten Unlust Er37regende. Damit schwindet die Fähigkeit der Menschen, jene Freude zu erleben, die nur durch herbe Anstrengung« – er wandert halt gerne in den Bergen herum – »beim Überwinden von Hindernissen gewonnen werden kann. Der naturgewollte Wogengang der Kontraste von Leid und Freude verebbt in unmerklichen Oszillationen namenloser Langeweile.«24 So verhält es sich auch in den Verschiebungen des Wirklichkeitsbewusstseins. Früher stellte sich die Wirklichkeit einem entgegen, und davon hat man gelernt. Alle Spezies haben sich auf mehr oder weniger gute Weise an ihre Gegend der Welt angepasst, und angeborene Reaktionen haben diese Welt widergespiegelt. Solche Anpassungen sind heute anscheinend nicht mehr erforderlich, weil alles machbar wird. Die Perzeption wird verschwommen und man hat keine festen Grenzen mehr.
»(5) Der genetische Verfall. Innerhalb der modernen Zivilisation gibt es – außer den ›natürlichen Rechtsgefühlen‹ und manchen überlieferten Rechtstraditionen – keine Faktoren, die einen Selektionsdruck auf die Entwicklung und Aufrechterhaltung sozialer Verhaltensnormen ausüben, wiewohl diese mit dem Anwachsen der Sozietät immer nötiger werden.«25 Es gibt in der Rechtslehre zwei extreme Ansichten. Die eine besagt, dass jedes für lange Zeit irgendwo gültige Recht konventionell und willkürlich eingesetzt worden ist. Irgendwann haben einige Leute nach rein rationaler Überlegung bestimmt und willkürlich festgesetzt, was gut und was nicht gut ist und wie die Sache geregelt werden müsste. Demnach ist Recht aus der Konvention hervorgegangen und kann daher auch willkürlich verändert werden. Dann gibt es eine andere Gruppe von Leuten, wiederum auf der radikalen Rechten – also gerade keine Linken –, nach der alle Rechtssysteme, die von gewissen natürlichen Rechtsempfindungen des Menschen abweichen, früher oder später zum Scheitern verurteilt sind oder zu einer 38nationalen Revolution führen müssen. Lorenz glaubt, dass diese Naturrechtler, wie sie sich auch genannt haben, recht haben und dass die Grundlage des Naturrechts genetisch verankert ist. Genauso wie es bei den Tieren Verhaltensweisen gibt, die, wenn sie gezeigt werden, einen Kampf zum Stillstand bringen. Lorenz beschreibt das sehr schön bei Fischen oder Hunden. Der eine Hund macht ›Grrr‹ und der andere zeigt eine Unterwürfigkeitshaltung, so dass der erste sagt: ›Na ja, geh mir fort.‹ Zeigt der zweite Hund diese Haltung nicht, kommt es zu einem Kampf. Es gibt also gewisse natürliche, angeborene Verhaltensweisen, die einen Kampf in Gang oder zum Stillstand bringen. Er berichtet auch sehr schön, wie zwei Hunde, die durch ein Gitter voneinander getrennt waren, immer aufeinander losgegangen und auf und ab gerannt sind und ein fürchterliches Gebell angefangen haben. Eines Tages wurde das Gitter entfernt und plötzlich standen sie sich ohne Gitter gegenüber. Da sind beide sehr verlegen gewesen und sind sofort hinter das Gitter zurückgerannt und wieder auf und ab gerannt, ohne einander anzugreifen. Das heißt, es gibt eingebaute Mechanismen, die Aggression zum Stillstand bringen.
Lorenz glaubt nun, dass durch die Entwicklung der Menschheit diese eingebauten Reaktionen abgestumpft sind, vor allem auch deshalb, weil man gedacht hat, mit den Menschen alles machen zu können. Der Mensch ist zu allen Verhaltensweisen fähig, und daher besteht, wie er denkt, die Gefahr eines Krieges. Außerdem sind diese genetischen Mechanismen in einer Situation entstanden, die einem Atomkrieg überhaupt nicht entspricht, sondern einem Krieg, bei dem man mit der Waffe in der Hand dem Gegner gegenübersteht. Ein Atomkrieg ist eine Sache mit einem Schalter – etwas ganz Automatisches. Lorenz weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zur Aufrechterhaltung einer Spezies der Kampf mit 39anderen Arten aufrechterhalten werden muss. Kampf innerhalb einer Spezies führt zu einem riesig großen Gefieder bei bestimmten Pfauenarten, das den Pfauenherren bei der Paarung gegenüber anderen Pfauenherren einen Vorteil verschaffen kann. Aber dieses Gefieder ist beim Kampf gegen andere Spezies hinderlich. Und genau solche Dinge treten auch bei der Menschheit ein. Sie sehen, Lorenz führt zusammen mit seiner Diagnose immer auch theoretische Elemente ein, und warum auch nicht, er hat die Sache ja studiert. Nur ist die Frage: Lässt sich das auf den Menschen anwenden? Auf jeden Fall muss man darüber nachdenken.
»(6) Das Abreißen der Tradition. Es wird dadurch bewirkt, daß ein kritischer Punkt erreicht ist, an dem es der jüngeren Generation nicht mehr gelingt, sich mit der älteren kulturell zu verständigen, geschweige denn zu identifizieren.«26 Früher, als die Entwicklung langsamer war, war die Achtung vor und die Liebe zu den Vorfahren ein wesentlicher Bestandteil der Vermittlung von Traditionen. Jetzt gibt es einen schnellen Übergang, und Traditionsübermittlung geht nicht auf natürlich menschliche Weise von den Vorfahren aus, sondern über Schulen und Universitäten. Da wird oft keine Tradition bewahrt, sondern es herrschen die neuesten Moden. Wenn Sie in Frankfurt sind, dann müssen Sie sich Jürgen Habermas anhören und was da rundherum so vorgeht. Das ist keine Traditionsbewahrung, das ist die neueste Mode. Und in Oxford gibt es nur die Oxford-Philosophie. Das heißt, das Aneignen der Beziehung zur Umwelt und zur Tradition geht auf gebrochenem Wege vor sich. Das ist hier gemeint.
»(7) Die Zunahme der Indoktrinierbarkeit der Menschheit. Die Vermehrung der Zahl der in einer einzigen Kulturgruppe« – übrigens, das ist ein kleines Büchlein, schaffen Sie es sich an und lesen Sie es. Ich möchte einmal eine Diskussion dar40über haben, denn das hier ist ja nur eine Zusammenfassung. Zu jedem dieser Punkte gibt es dann einen Vortrag, der das Ganze im Detail behandelt.27 Wenn ich diese Überlegungen zur Indoktrinierbarkeit der Menschheit höre, frage ich mich, ob das eigentlich stimmt. Wenn ich mich umsehe, muss ich in gewisser Hinsicht zustimmen, weil ein Einzelner nur noch Fachmann auf einem einzigen Gebiet sein kann. Ein Fachmann zum Beispiel in der Hochenergiephysik muss sich auf den Fachmann in der Hochdruckphysik verlassen, wie zum Beispiel Percy Williams Bridgman einer war. Er muss übernehmen, was ihm gesagt wird, und kann es nicht selbst überprüfen, weil er weder Zeit noch Geld dafür hat. Indoktrinierbarkeit heißt also nicht nur, dass die Leute bloß passive Empfänger sind. Das müssen sie sogar sein, weil viel von dem Wissen, das sie anwenden müssen, um ihren eigenen Verein vorwärtszubringen, zu kompliziert und nicht mehr zugänglich ist. Lorenz fährt fort: »Die Vermehrung der Zahl der in einer einzigen Kulturgruppe vereinigten Menschen führt im Verein mit der Vervollkommnung technischer Mittel zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung zu einer Uniformierung der Anschauungen, wie sie zu keinem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte bestanden hat. Dazu kommt, daß die suggestive Wirkung einer fest geglaubten Doktrin mit der Zahl ihrer Anhänger wächst, vielleicht sogar in geometrischer Proportion« – der Glaube an Wissenschaft, der Glaube an eine gewisse Medizin. »Schon heute wird mancherorts ein Individuum, das sich der Wirkung der Massenmedien, z. B. des Fernsehens, bewußt entzieht, als pathologisch betrachtet.«28 Das ist nicht ganz wahr. Vielleicht ist es Lorenz passiert, aber zum Beispiel in einer Stadt in Neuengland haben alle Leute – ungefähr 7000 Leute – beschlossen, einen Monat lang kein Fernsehen zu schauen. Sie haben sich daran gehalten, und nach einem 41Monat sagten sie: ›Mein Gott, wir haben uns ja alle kennengelernt.‹ Sie haben selbst ein Theater aufgemacht und gesagt, na, das war doch ganz nett. Und dann haben sie wieder ferngesehen.
»(8) Die Aufrüstung der Menschheit mit Kernwaffen beschwört Gefahren für die Menschheit herauf, die leichter zu vermeiden sind als jene, die den vorher besprochenen sieben Vorgängen entspringen.«29 So, das war's. Ich fahre fort nach der Pause.
[Pause]
Mit den zu behandelnden Problemen werde ich auf der linken Seite anfangen und mich langsam nach rechts bewegen. Wie schnell ich mich bewege und wie ich vorgehe, hängt auch davon ab, wie sehr Sie mich unterbrechen. Wenn da etwas ist, über das ich reden kann und Sie das wollen, werde ich es tun, und wenn ich nicht reden kann, werde ich sagen, dass Sie reden sollen. Das werden wir dann sehen.
Ganz auf der rechten Seite habe ich wieder den Lorenz. Im Zusammenhang damit gibt es auch noch den Club of Rome und die Schrift seines Präsidenten Aurelio Peccei, Die Zukunft in unserer Hand, die auch auf einer Bestandsaufnahme der jetzigen Situation und auf einer Projektion in die Zukunft beruht.30 Es könnte also sein, dass die Situation jetzt miserabel ist, aber die Zukunft nicht so schlecht aussieht. Das heißt, man hat immer eine Bestandsaufnahme, kombiniert mit einer Projektion. Letztere bedient sich verschiedener Methoden, manche davon sind zweifelhaft, manche weniger. Jedenfalls werden sie stark debattiert. Und ein Buch, das einen Überblick über diese ganzen Methoden gibt und hinter dem auch nicht nur die Hauptbonzen stehen, ist Technological Forecasting in Perspective, von der OECD herausgegeben.31 Der Verfasser ist Erich Jantsch, von dem Sie vielleicht schon einmal 42gehört haben. Weiterhin hat Robert Jungk positive Vorschläge angesichts dieser Situation vorgelegt. Jungk – in England wird er »junk« ausgesprochen – schrieb die Bücher Heller als tausend Sonnen, eine Geschichte der Atomtheorie, und Der Jahrtausendmensch, ein Überblick über verschiedene Versuche, neue Formen der Erkenntnis und des Zusammenlebens und des Aufbaus von kleinen Gemeinschaften oder Städten herbeizuführen und die Kreativität anzuregen.32 Das sind sozusagen die guten Leute, die sagen, wie schlimm es jetzt aussieht und wie radikal man die Sachen ändern muss, um eine bessere Zukunft herbeizuführen.
Es hat sich aber neben diesen guten Leuten – »gut« steht hier natürlich nur in Anführungszeichen – eine Gegenströmung herausgebildet, die darauf hinweist, dass die von den guten Leuten verwendeten sogenannten Daten und ihre theoretischen Annahmen völlig unzuverlässig sind und die bereits gemachten Prognosen schon vielfach widerlegt worden sind. Ein ausgezeichnetes Buch in dieser Richtung ist The Apocalyptics von Edith Efron.33 Sie beschränkt sich auf den engeren Bereich der regierungsmäßigen Eingriffe in die Verbreitung krebserregender Stoffe in den USA und kritisiert die negativen Vorhersagen und die darauf gegründeten politischen Maßnahmen. Efron ist keine Akademikerin, sondern Journalistin. Sehr oft ziehe ich es vor, zu bestimmten Sachen Journalisten statt Akademiker zu lesen, denn sie lesen quer durch alle möglichen Fachgebiete, haben mehr Verbindungen, hören Gerüchte und haben auch viel mehr Zugang zu gewöhnlicher und ungewöhnlicher Literatur. Das Buch ist mir übrigens von Herrn Hans-Jürgen Eysenck empfohlen worden, der im letzten Jahr hier war und in diesem wiederum hier sein wird.34 Jeder, der sich mit dieser Sache beschäftigt, ob ein »guter« oder ein »nicht so guter« Mensch, sollte das lesen, weil man eine diffe43renzierte Vorstellung von der Sache bekommt. Aber das brauchen wir nicht unbedingt zu machen. Ich sage das nur für den Fall, dass Sie interessiert sind.
Global 2000, den von Präsident Carter im Jahr 1977 in Auftrag gegebenen Bericht, habe ich schon erwähnt. Das Interessante ist: Wenn man sich ansieht, was als gut und schlecht bewertet wird – zum Beispiel die Lage der sogenannten Dritten Welt –, so stellt man fest, dass nach dem Nationalprodukt oder nach Einfuhr oder Ausfuhr bewertet wird. Von der Qualität des Lebens ist überhaupt nicht die Rede. Es wird als selbstverständlich angenommen, dass arme Länder, in denen die Leute sehr wenig am Tag verdienen, ganz mies dran sind. Sie könnten aber sehr fröhliche Leute sein, und tatsächlich hat sich auch oft herausgestellt, dass es sich so verhält. Sehr oft hat die Einführung von Technologie ein Land mit fröhlichen, aber armen Leuten in ein Land mit nicht so fröhlichen, aber reicheren Leuten verwandelt. Dass die Qualität des Lebens auch in Betracht gezogen werden muss, ist erst in jüngerer Zeit berücksichtigt worden. Und das macht solche Diskussionen ungemein schwierig. Lorenz, der ein qualitativer Forscher ist, wettert in seinem Buch Der Abbau des Menschlichen gegen diejenigen, die Wissenschaft nur für Quantität halten.35 Er untersucht Menschen und Tiere mit Augen, Gesichtsausdrücken oder Bewegungsformen, und die kann man nicht auf eine quantitative Formel bringen. Lorenz ist eine der wenigen Ausnahmen. Die Frage ist, was zukünftig für ein Land getan werden muss: Wie soll das normale Leben eines Bürgers in diesem Land aussehen? Oder das eines Stammesangehörigen? In vielen Ländern gibt es Nomaden, die aufgrund flächendeckender Industrialisierung nicht mehr wissen, wo sie hinsollen – sie werden etwas reicher, aber nicht sehr glücklich. Das müsste auch mit einbezogen werden.
44Dazu gibt es ein kleines Büchlein, das mir viel Freude gemacht hat. Das ist ein eher persönliches Bekenntnis eines Herrn namens Peter Henningsen und heißt Werkzeuge der Erkenntnis.36





























