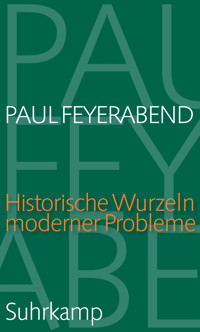19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Paul Feyerabend, Philosoph, Physiker und Anarchist, war einer der unkonventionellsten Wissenschaftler seiner Zeit. Im vorliegenden ersten Teil seiner auf drei Bände angelegten, unvollendet gebliebenen Naturphilosophie erschließt Feyerabend in gewohnt polemischer und äußerst belesener Weise die Vorgeschichte der modernen Wissenschaft von Homer bis Parmenides. »Die Fortschrittlichkeit des Steinzeitmenschen wird so recht deutlich, wenn man seine Ideen mit denen späterer Philosophen und Wissenschaftler vergleicht.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
3Paul Feyerabend
Naturphilosophie
Herausgegeben und mit einem Vorwort von Helmut Heit und Eric Oberheim
Suhrkamp
Inhalt
Paul Feyerabend als historischer NaturphilosophEinführung von Helmut Heit und Eric Oberheim
Paul Feyerabend: Naturphilosophie
Vorbemerkung
1.Die Voraussetzungen des Mythos und die Kenntnisse seiner Erfinder
1.1.Steinzeitliche Kunst und Naturerkenntnis
1.2.Megalithische Astronomie (Stonehenge)
1.3.Kritik primitivistischer Deutungen der Frühzeit
1.4.Das dynamische Weltbild des Steinzeitmenschen
2.Struktur und Funktion des Mythos
2.1.Theorien des Mythos
2.2.Die Theorie des Naturmythos und der Strukturalismus
3.Das Aggregatuniversum Homers
3.1.Die parataktische Welt der archaischen Kunst
3.2.Weltbild und Wissen in den Homerischen Epen
3.3.Grundsätzliches zu Wirklichkeitsauffassungen und Wissenschaftssprache
4.Übergang zur expliziten begrifflichen Erfassung der Natur
4.1.Die neue Welt der Philosophen: Vor- und Nachteile
4.2.Historische Umstände der Philosophieentstehung
4.3.Vorläufer in den Kosmogonien des Orients und Hesiods
5.Naturphilosophie bis Parmenides
5.1.Wechselnde Weltauffassungen: Hesiod und Anaximander
5.2.Religionskritik und Erkenntnistheorie: Xenophanes
5.3.Der Ursprung abendländischer Naturphilosophie: Parmenides
6.Abendländische Naturphilosophie von Aristoteles bis Bohr
6.1.Zum Forschungsprogramm des Aristoteles
6.2.Mathematische Behandlung der Natur: Descartes
6.3.Empirismus ohne Fundament: Galilei, Bacon, Agrippa
6.4.Bewegung der Begriffe: Hegel
6.5.Probleme des Mechanizismus: Newton, Leibniz, Mach
6.6.Vorzeichen des Neuen: Einstein, Bohr, Bohm
7.Zusammenfassung und Ausblick
Paul Feyerabend: Nachgelassene Dokumente
Brief an Jack J. C. Smart, Dezember 1963
Preparation (Antrag auf ein Forschungsjahr, 1977)
Report on 1980 Sabbatical (Bericht über ein Forschungsjahr)
Literaturverzeichnis
Editorische Notizen
7Paul Feyerabend als historischer Naturphilosoph
Einführung vonHelmut Heit und Eric Oberheim
»Eifriger und sehr interessierter Schüler, dessen Begabung weit über dem Durchschnitt ist. Manchmal läßt er sich zu vorlauten Bemerkungen hinreißen.« Dies trugen die Lehrer der Wiener Staatlichen Oberschule für Jungen im Schuljahr 1939/40 in Paul Feyerabends Zeugnis ein, und so mancher machte später ähnliche Erfahrungen mit ihm.[1] Feyerabend war sicher einer der bemerkenswertesten und kontroversesten Wissenschaftsphilosophen des 20. Jahrhunderts, der auch außerhalb der Universitäten Aufmerksamkeit erregte. Er war vielseitig interessiert und für viele interessant. Während seine überdurchschnittliche Begabung kaum je in Frage gestellt wurde, sind die Einschätzungen hinsichtlich seines Eifers mitunter etwas zurückhaltender. Feyerabend steht, nicht zuletzt durch eine lässige Selbstinszenierung und abfällige Bemerkungen über die gelehrte Belesenheit seiner Kollegen, in dem Ruf, kein übermäßig eifriger, fleißiger und gründlicher Forscher gewesen zu sein. Nicht wenige haben auch manchen Inhalt seiner Einlassungen, ähnlich wie schon seine Lehrer, als wenig erwünschte »vorlaute Bemerkungen« empfunden. Im Rahmen einer generellen Abrechnung mit den zum Relativismus und Skeptizismus tendierenden Entwicklungen in der Wissenschaftstheorie kürte man Feyer8abend in der Zeitschrift Nature zum »Salvador Dali of academic philosophy, and currently the worst enemy of science« (Theocharis/Psimopoulos 1987: 596). Aus der Sicht der Autoren sei er das jedoch mit nur geringem Vorsprung vor Karl Popper, Thomas Kuhn und Imre Lakatos, denn die philosophische Reflexion auf Wissenschaft befinde sich insgesamt in einer unguten Entwicklung. Insofern findet sich Feyerabend hier in der guten Gesellschaft der Klassiker post-positivistischer Wissenschaftsphilosophie. Von den genannten ›großen Vier‹ der Wissenschaftstheorie des zwanzigsten Jahrhunderts ist jedoch der Eindruck, ein Feind der Wissenschaft zu sein, vor allem an Feyerabend hängengeblieben, zunächst als mediengerechtes Label (Horgan 1993) und später, posthum, als ambivalenter Ehrentitel (Preston, Munévar et al. 2000).
Die vorliegende Naturphilosophie ist geeignet, auch hinsichtlich einer etwaigen Wissenschaftsfeindlichkeit Feyerabends neues Licht auf sein Werk und seine philosophische Entwicklung zu werfen. Im Folgenden möchten wir in drei Schritten in die Lektüre dieses Textes einführen. Nach einer kurzen Erinnerung an die philosophische Entwicklung von Feyerabend rekonstruieren wir die Geschichte dieses Buches und die Gründe, warum es erst mit gut dreißigjähriger Verzögerung veröffentlicht wird (1). In einem zweiten Schritt soll die besondere Bedeutung des Manuskripts sowohl für die Feyerabend-Forschung wie auch für ein Verständnis der Entwicklung unserer Naturauffassungen herausgestellt werden (2). Feyerabend zeigt sich in der Naturphilosophie als Interpret frühgriechischer Geisteswelt und als Genealoge des okzidentalen Rationalismus. So eröffnet dieser Text nicht nur eine faszinierende Perspektive auf die Geschichte der Naturphilosophie, sondern auch auf bislang wenig berücksichtigte Aspekte im Denken Feyerabends. Zugleich ist diese Arbeit aus den frühen siebziger Jahren eine entscheidende Ressource zum Verständnis der Gemeinsamkeiten und Dif9ferenzen zwischen dem frühen und dem späten Feyerabend. Sie ist das missing link, um die spätere Radikalisierung, ihre Rechtfertigung und ihr Ausmaß als Kontinuum im Denken Feyerabends zu verstehen. Der abschließende, dritte Teil der Einleitung gibt eine Übersicht über den Aufbau und den Inhalt von Feyerabends Naturphilosophie (3).
1. Zur Geschichte eines unabgeschlossenen Projektes
Feyerabends Philosophie stand stets in einem engen Zusammenhang mit den wissenschaftlichen und philosophischen Diskussionen seiner Zeit, und nicht selten war er an diesen Diskussionen auch durch persönliche Kontakte unmittelbar beteiligt. In den späten 1940er Jahren, als er in Wien bei Felix Ehrenhaft und Victor Kraft studierte, erhielt er direkte Einsichten in den logischen Positivismus des Wiener Kreises und seine Probleme, die für die weitere Entwicklung der internationalen Wissenschaftsphilosophie von so grundlegender Bedeutung waren. In dieser Zeit lernte er auch Ludwig Wittgenstein kennen, der ihm eine Stelle in Cambridge anbot. Da aus dieser Offerte durch den frühen Tod Wittgensteins nichts wurde, nahm Feyerabend für eine Weile das Angebot an, mit Karl Popper in London zu arbeiten. In den frühen fünfziger Jahren traf er sich mehrfach mit Niels Bohr und wurde einer der prominentesten philosophischen Kritiker der Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik. 1962 leitete er gemeinsam mit Thomas Kuhn, seinem damaligen Kollegen an der Universität Berkeley, die historische Wende in der Wissenschaftsphilosophie ein, die sich fortan verstärkt auch der Geschichte und Soziologie der Wissenschaften zuwandte, statt Wissenschaft allein als logisches System zu betrachten. Im Verlauf der 1970er Jahre wurde er zu einem entschiedenen Kritiker zunächst der Philosophie 10und der Schule Karl Poppers und später des Rationalismus in einem grundlegenderen Sinne. Das Schlagwort des ›anything goes‹ aus Wider den Methodenzwang (1975) sorgte innerhalb und außerhalb der akademischen Philosophie für Aufsehen. Die anschließenden Schriften, vor allem Erkenntnis für freie Menschen (1978), Wissenschaft als Kunst (1984) und Irrwege der Vernunft (1987), waren wichtige Elemente einer allgemeinen Diskussion um die Möglichkeiten und Grenzen der westlichen Wissenschaften, wie sie etwa in postkolonialen, postmodernistischen und ökologischen Strömungen im letzten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts geführt wurden. Die Potentiale und Grenzen einer wissenschaftlichen Weltauffassung sind auch das Thema seines letzten, posthum veröffentlichten Buches Die Vernichtung der Vielfalt (1999). Feyerabends Autobiographie, Zeitverschwendung (1994), gibt einen sehr lesenswerten Eindruck von diesem bewegten Leben im Zentrum zeitgenössischer Diskussionen. Die Naturphilosophie eröffnet nun den Blick auf einen bislang wenig bekannten Feyerabend: den historischen Naturphilosophen und Theoretiker der antiken Philosophieentstehung.
Parallel zu seinem Hauptwerk Wider den Methodenzwang, das 1975 in der ersten Buchfassung auf englisch erschien, arbeitete Paul Feyerabend in deutscher Sprache an einer umfassend konzipierten Naturphilosophie. Sie sollte ursprünglich drei Bände umfassen und die Geschichte des menschlichen Naturverständnisses von den frühesten Spuren steinzeitlicher Höhlenmalereien bis zu den zeitgenössischen Diskussionen in der Atomphysik rekonstruieren. Der Arbeitstitel lautete Einführung in die Naturphilosophie. Da es sich jedoch bei der Arbeit nicht um einen einführenden Einstieg in das Thema handelt, sondern um einen eigenständigen Forschungsbeitrag Feyerabends, der eher eine historische Rekonstruktion der aktuellen Situation darstellt als eine Einführung, haben wir für die Veröffentlichung auf diese irreführende Einschränkung 11verzichtet. Das Projekt wurde seinerzeit nicht abgeschlossen, es war schon in den späten siebziger Jahren unbekannt und ist offenbar auch bei Feyerabend selbst in Vergessenheit geraten. Eine Weile tauchte der Titel noch in frühen Literaturlisten auf, verschwindet dann aber wieder.[2] In seiner Autobiographie erwähnt Feyerabend die Naturphilosophie mit keinem Wort. Nur an vereinzelten Stellen fanden sich später noch Hinweise auf das Projekt. So erwähnt Feyerabend seine Arbeit an einer Einführung in die Naturphilosophie in einem Brief an Hans Albert (vgl. Baum 1997: 133). Aber der Herausgeber des Briefwechsels nimmt diesen Hinweis vor allem als Indiz für die notorische Unzuverlässigkeit der biographischen und bibliographischen Angaben Feyerabends: »Viele Projekte kamen nicht zustande; und auch wenn eine Arbeit als im Druck befindliche bezeichnet wird, heißt das nicht, daß sie tatsächlich auch erschienen ist. So ist zum Beispiel ein für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft geplantes Werk über Naturphilosophie nie erschienen« (Baum 1997: 8). Von der Existenz dieses Werkes, das allerdings seinerzeit nicht in Darmstadt, sondern bei Vieweg in Braunschweig erscheinen sollte, weiß Baum offenbar nichts.
Aus diesem Grund waren wir einigermaßen verblüfft, als das unvollendet gebliebene Ergebnis der Bemühungen Feyerabends bei einer Recherche im Philosophischen Archiv der 12Universität Konstanz auftauchte.[3] Daß es sich bei der 245 Seiten umfassenden Kopie eines Schreibmaschinentextes um eine wichtige Quelle für die Feyerabend-Forschung handelt, wurde schnell deutlich. Der Text behandelt in fünf Kapiteln die Entwicklung des menschlichen Verständnisses der natürlichen Welt von den frühesten Höhlenmalereien und Zeugnissen der Frühgeschichte über das homerische Aggregat-Universum bis zum Substanz-Universum der Vorsokratiker, insbesondere bei Parmenides. Damit lag erstmals eine ausführliche Erörterung des von Feyerabend wiederholt angesprochenen »Aufstiegs des Rationalismus« in der griechischen Antike vor. Eher zufällig stießen wir bald danach auf eine Referenz in einer Arbeit von Helmut Spinner, in der auf die unveröffentlichte Naturphilosophie Feyerabends verwiesen wird.[4] Wie sich herausstellte, sollte Spinner damals als Herausgeber der drei Bände fungieren und hatte bereits erhebliche Zeit und Arbeit in das Projekt investiert. Dankenswerterweise hat er uns sowohl diese Vorarbeiten wie auch eine zweite, ausführlichere Version des Typoskripts zur Verfügung gestellt, die insgesamt 305 Schreibmaschinenseiten umfaßte und insbesondere um ein sechstes Kapitel erweitert worden war. Dieses sechste Kapitel skizziert die Entwicklung der Naturphilosophie von Aristoteles bis Bohr. Die verschiedenen Kapitel sind unterschiedlich gründ13lich bearbeitet, aber sie stellen insgesamt eine kontinuierlich verlaufende und intern vernetzte Argumentation dar, die im Unterschied zu der nur fragmentarisch hinterlassenen Vernichtung der Vielfalt (1999) ein zusammenhängendes, wenn auch nicht abschließend redigiertes Buch bildet.
Die nun der Öffentlichkeit vorliegende Naturphilosophie eröffnet gerade durch ihren noch nicht ganz abgeschlossenen Zustand einen interessanten Blick in die Werkstatt dieses Philosophen. Insbesondere ist sie geeignet, das auch von Feyerabend selbst inszenierte Bild eines leichtfertigen Denkers zu korrigieren. Zwar bemüht sich Feyerabend um einen leichten Stil und läßt sich noch immer zu vorlauten, nicht in jedem Fall unabweisbar begründeten Behauptungen hinreißen. Aber er tut das ausgehend von einer umfangreichen Erörterung des einschlägigen zeitgenössischen Materials und einem hier besonders deutlich nachvollziehbaren »enormen Lesepensum« (Hoyningen-Huene 1997: 8). Feyerabend zeigt sich in diesem Buch nicht nur als Provokateur, sondern auch als ein Wissenschaftler, der hart gearbeitet und viel gelesen hat. In einem Brief an Imre Lakatos vom 5. Mai 1972 klagt er darüber.
Dear Imre, Damn the Naturphilosophie: I do not have your patience for hard work, nor do I have two secretaries, a whole mafia of assistants who bring me books, check passages, Xerox papers and so on. If anarchism loses, then this is the most important reason. The examples which I find, are in books which I have found in the stacks myself, which I have carried myself, which I have opened myself, and which I have returned myself. […] The very bloody version has been written by myself, never have I asked a secretary to do my dirty work (Lakatos/Feyerabend 1999: 274 f.).
Es bleibt zu spekulieren, ob nicht nur der Anarchismus, sondern auch die »verdammte Naturphilosophie« an einer zu hohen Arbeitsbelastung gescheitert ist. Jedenfalls hat sich Feyerabend im Laufe der späteren siebziger Jahre von diesem 14Projekt getrennt. Die Zusammenarbeit mit Helmut Spinner wurde im Frühjahr 1976 abgebrochen, als Feyerabend sich anscheinend zu einer grundlegenden Überarbeitung des bisherigen Manuskripts und der weiteren Vorgehensweisen entschließt. Hierzu könnten auch die umfangreichen Kommentare und Hinweise von Spinner beigetragen haben, die Feyerabend offenbar sehr schätzte und die ihn ermunterten, den Band insgesamt zu überarbeiten. Gleichzeitig scheint die Zusammenarbeit nicht unproblematisch gewesen zu sein, auch wenn die Vereinbarungen zwischen Feyerabend, Spinner und dem Vieweg-Verlag seinerzeit einvernehmlich aufgelöst worden sind. Recht bald danach öffentlich ausgetragene Differenzen sprechen hier für sich – so bemängelt Spinner Feyerabends »philosophischen Leerlauf« (Spinner 1977: 589), während dieser sich seinerseits über das »Analphabetentum« Spinners mokiert (Feyerabend 1978: 102). Dessenungeachtet erklärt Feyerabend jedoch 1977, er wolle sich »im Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte« mit verschiedenen Veröffentlichungen darum bemühen, »moralischen und intellektuellen Müll beiseite zu räumen, so daß neue Formen des Lebens zum Vorschein kommen können […]. Dazu zählt auch die Einführung in die Naturphilosophie, die 1976 erscheinen sollte, die ich aber zurückgezogen habe, um einige größere Überarbeitungen vorzunehmen« (Feyerabend 1977: 181). Daß es dazu nicht gekommen ist, hat sicher auch mit den Reaktionen auf sein anderes Buch aus dieser Zeit zu tun.
War Feyerabend bis Mitte der siebziger Jahre vor allem ein erfolgreicher, streitbarer und angesehener Wissenschaftsphilosoph, so geriet er durch sein Hauptwerk Against Method unversehens ins Zentrum der allgemeinen intellektuellen und kulturellen Diskussion. Der Effekt, den die vorwiegend negativen Reaktionen auf Wider den Methodenzwang bei Feyerabend hatten, dürfte für die Arbeit an der Naturphi15losophie durchaus ambivalent gewesen sein. So könnten dadurch seine Ansprüche an die Qualität und Eindeutigkeit des Textes gestiegen sein, um weiteren Mißverständnissen vorzubeugen. Denn Feyerabend mochte zwar über »Sonntagsleser, Analphabeten und Propagandisten« schimpfen (1978: 100 ff.), ganz frei von der Verantwortung für diese Fehldeutungen wird er sich doch nicht gefühlt haben. Darauf deuten auch die umfangreichen Überarbeitungen, die er immer wieder an dem Text vorgenommen hat. Against Method ist ursprünglich 1970 als längeres Essay in den Minnesota Studies in the Philosophy of Science veröffentlicht worden. 1975 erscheint die erste englische Buchfassung. Da Feyerabend jedoch in den folgenden Jahren die beiden Neuauflagen (1988, 1993) und auch die beiden deutschen Übersetzungen (1976, 1983) zum Anlaß umfassender Revisionen und Überarbeitungen nimmt, liegen heute zumindest sechs Fassungen von Wider den Methodenzwang vor, die in Inhalt, Umfang und Teilen der Argumentation mitunter erheblich voneinander abweichen. Noch in seiner Autobiographie schreibt er rückblickend: »WM ist kein Buch, sondern eine Collage« (1994: 189). Diese Collage hat zwar seinen internationalen Ruhm begründet, aber seiner Stimmung und seinem Selbstwertgefühl offenbar nicht unbedingt genützt. »Einige Zeit, nachdem sich der Entrüstungssturm erhoben hatte, verfiel ich in Depressionen, die über ein Jahr lang anhielten. […] Ich habe oft gewünscht, daß ich dieses idiotische Buch nie geschrieben hätte« (1994: 199 f.). Feyerabend war viele Jahre damit beschäftigt, Wider den Methodenzwang zu explizieren. Vielleicht wäre die Naturphilosophie eine bessere Antwort auf Kritiker gewesen, als es Erkenntnis für freie Menschen war.[5]16Wie dem auch sei, die Auseinandersetzungen um Wider den Methodenzwang und die damit verbundenen beruflichen und privaten Belastungen dürften jedenfalls eine wichtige Rolle für die Nicht-Veröffentlichung dieses immerhin fast vollständig abgeschlossenen Buches gespielt haben.
Dem nun vorliegenden Band sind einige zusätzliche Dokumente beigefügt, die über das weitere Schicksal der Naturphilosophie und über Feyerabends eigene Einschätzung seiner wissenschaftlichen Entwicklungen, Leistungen und Ziele Aufschluß geben können. Eine besonders interessante Quelle für die Vorgeschichte der Naturphilosophie stellt ein längerer und gehaltvoller Brief dar, den Feyerabend im Dezember 1963 an Jack Smart geschrieben hat. Feyerabend betont darin gegenüber seinem australischen Kollegen, er habe schon immer eine Arbeit über die Natur der Mythen schreiben wollen, um zu zeigen, daß sie vollentwickelte alternative Weltauffassungen seien. Dazu verbindet er verschiedene sprachphilosophische und kantische Überlegungen, wonach unsere Weltauffassung stets durch begriffliche Schemata mitkonstituiert werde, mit dem Gedanken, daß diese Schemata weder eingeboren noch historisch unveränderlich seien. Vielmehr belege die historische Forschung und der Kulturvergleich die Existenz alternativer Weltauffassungen, die ihrerseits voll entwickelt, eigenständig und funktional erfolgreich seien. Diese Überlegung illustriert Feyerabend am Beispiel der Lebendigkeit und Vollständigkeit des griechischen Mythos durch ein Zitat aus Nietzsches Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne. Dasselbe Zitat und denselben Gedanken greift er nicht nur in der Naturphilosophie (s. u., Kap. 3.3), sondern auch zwanzig Jahre später in Wissenschaft als Kunst (1984a: 51) wieder auf. Der Brief an Smart eröffnet zudem eine spezifische Perspektive auf Feyerabend, die in der später veröffentlichten Antwort an Kritiker: Bemerkungen zu Smart, Sellars und Putnam (1965) in der Fülle der behandelten Punkte leicht übersehen wird. 17Die grundlegende Tendenz Feyerabends, die wissenschaftliche Naturauffassung mit mythischen und ethnologischen Alternativen zu vergleichen, wurde bereits Anfang der sechziger Jahre gelegt, wenn auch mit zunächst weniger radikalen Konsequenzen. Dieser Umstand wird auch aus zwei autobiographisch und programmatisch sehr aufschlußreichen, bislang unveröffentlichten Texten ersichtlich.
In einem Antrag auf ein Forschungsjahr aus dem Jahre 1977 beschreibt Feyerabend die zunehmende Radikalisierung seiner Skepsis gegenüber der wissenschaftlichen Rationalität. Ausgehend von historischen Untersuchungen der tatsächlichen Wissenschaftspraxis habe er zunächst die beschränkte Geltung methodologischer Regeln erkannt, um dann zu einer grundsätzlichen Kritik von validen Abgrenzungskriterien zwischen Wissenschaft und Nicht-Wissenschaft zu kommen. Aber erst durch eine Untersuchung von Mythen und frühgriechischer Kunst habe er die These entwickelt, daß es voll entwickelte Alternativen zu einer wissenschaftlichen Weltauffassung geben kann, die sich zugleich nicht nach wissenschaftlichen Kriterien evaluieren lassen, sondern nur nach ihren jeweils eigenen. Schließlich habe er eingesehen, daß sich nicht einmal die mutmaßlichen Regeln der Vernunft zu einer essentiellen Diskriminierung zwischen Wissenschaft und Nicht-Wissenschaft eigneten. Daher wolle er im Rahmen eines langfristigen Projekts an einer neuartigen Theorie des Wissens arbeiten, die diese Situation in Rechnung stellt. Ein erster Schritt in diese Richtung, sein »short range plan«, ist die Überarbeitung und Vervollständigung seiner Naturphilosophie. Der hinterher, im Jahre 1985 verfaßte Bericht über ein Forschungsjahr erwähnt zwar noch das lang- und das kurzfristige Projekt, aber von der Naturphilosophie ist nicht mehr die Rede. Teile der angesprochenen Themen tauchen wieder auf, insbesondere zur antiken Mythologie und Weltauffassung, auch die in dem 18Arbeitsbericht aufgeführte Liste der Diskussionspartner ist aufschlußreich. Aber es wird doch deutlich, daß Feyerabend sein größeres und auch sein kleineres Projekt nicht verwirklicht hat. Dieser Ausgang ist jedoch nach Einschätzung der Herausgeber nicht so zu verstehen, daß Feyerabend – wie vielleicht im Rahmen von Anträgen auf Freisemester nicht völlig ausgeschlossen – ohnehin von vorneherein nicht ernsthaft an eine Umsetzung der Vorhaben gedacht hat. Vielmehr zeugt die nun vorliegende Naturphilosophie, aller anarchistischen Selbstinszenierung Feyerabends zum Trotz, von der Ernsthaftigkeit seiner Arbeit und seines Anliegens. Soweit dieser Text Aufschluß über die Motive und Fragen Feyerabends in den 1970er Jahren gibt, schließt er auch die Lücke zwischen einem etwaigen früheren, naturwissenschaftlich orientierten, seriösen Wissenschaftstheoretiker und einem späteren, allgemein kulturphilosophisch interessierten und gesellschaftskritischen enfant terrible.
2. Die Naturphilosophie im Kontext von Feyerabends philosophischer Entwicklung
Die besondere Bedeutung der Naturphilosophie für das Verhältnis von Kontinuität und Wandel im Denken Feyerabends ist nur vor dem Hintergrund seiner früheren Arbeiten verständlich. Auf den ersten Blick machen Feyerabends Arbeiten in den 1950er und 1960er Jahren einen höchst heterogenen Eindruck, ein gemeinsames, organisierendes Zentrum scheint es nicht zu geben. Man kommt leicht zu der Vorstellung einer Reihe unverbundener kritischer Essays, die zum Teil widerstreitende Ideen in unterschiedliche Richtungen entwickeln, ohne systematisch verbunden zu sein. Nicht wenige sehen darin keinen Grund zur Verwunderung, immerhin bezeichnete sich Feyerabend selbst als epistemischen Anarchisten. Dar19über hinaus hat Feyerabend oft zum Mittel der immanenten Kritik gegriffen und dazu bestimmte Überzeugungen anderer Autoren übernommen, um ihre internen Probleme herauszuarbeiten. Dadurch blieb sein eigener Standpunkt, sofern er einen vertrat, oftmals im verborgenen. Ein genauerer Blick auf Feyerabends frühere Arbeiten zeigt jedoch die erstaunlich konsistente Wiederkehr einer bestimmten Denkfigur, die aus zwei Elementen besteht: Die ansonsten unterschiedlichen Gegenstände seiner Kritik erscheinen alle als verschiedene Formen des begrifflichen Konservatismus, und Feyerabends Kritik daran beruht stets auf der Annahme bisher nicht beachteter inkommensurabler Alternativen zu den vorherrschenden Ideen. Schon in seiner Dissertation Zur Theorie der Basissätze verwendet Feyerabend den Gedanken der Inkommensurabilität, freilich nicht den Begriff, zur Kritik eines begrifflichen Konservatismus in Heisenbergs Konzept einer geschlossenen Theorie. Die konservative und exklusive Verwendung etablierter und erfolgreicher Begriffe und Theorien hält Feyerabend für problematisch, denn sie bevorzugt unzulässigerweise die bestehenden Theorien gegenüber potentiellen Verbesserungen und behindert so den wissenschaftlichen Fortschritt. Dieser Impuls zieht sich durch fast alle damaligen Texte. Feyerabends frühe Philosophie kann als eine Folge von unterschiedlichen Angriffen auf jegliche Form des begrifflichen Konservatismus verstanden werden.[6] Anstelle des begrifflichen Konservatismus plädiert er für Pluralismus und Theorienproliferation, besonders deutlich in seiner bereits erwähnten Antwort an Kritiker wie Smart oder Putnam:
Die Hauptkonsequenz ist das Prinzip des Pluralismus: Man erfinde und entwickle Theorien, die der gängigen Auffassung widersprechen, auch wenn diese sehr gut bestätigt und allgemein anerkannt 20ist. Die Theorien die man nach diesem Prinzip neben der gängigen Auffassung verwenden soll, nenne ich Alternativen dieser Auffassung (1965a: 128 f.).
An dieser Stelle sind verschiedene Punkte bemerkenswert, die über die philosophische Entwicklung Feyerabends und die Rolle der Naturphilosophie dabei Aufschluß geben können. Zunächst ist hervorzuheben, daß Feyerabend sogleich in einer Fußnote präzisiert, »wenn ich von Theorien spreche, so meine ich auch Mythen, politische Ideen, religiöse Systeme« (1965a: 128). Sein Begriff der Theorien und damit der diskussionswürdigen Alternativen beschränkt sich nicht auf wissenschaftliche Satzsysteme. Vielmehr geht es ihm um Gedankengebäude grundlegender Tragweite, um universale ›Theorien‹, die »mindestens auf einige Aspekte alles Daseienden anwendbar« sind. So schließt er Schöpfungserzählungen oder spekulative Metaphysiken explizit mit ein. Zweitens ist beachtlich, daß Feyerabend die Antwort an Kritiker (Reply to Critics) in seinem hier erstmals abgedruckten Antrag auf ein Forschungsjahr (1977) als Zusammenfassung der Überlegungen aus Explanation, Reduction, and Empiricism (1962), Problems of Empiricism (1965b) und Von der beschränkten Gültigkeit methodologischer Regel (1972) bezeichnet. Diese Texte sind seine wichtigsten philosophischen Arbeiten dieser Zeit, in denen er den Begriff der Inkommensurabilität in die wissenschaftstheoretische Debatte einführt (1962, zeitgleich mit Kuhn) und grundlegende Argumente für seine Kritik des Methodenzwangs vorbringt. Inwiefern ein Mythos als echte, gegebenenfalls inkommensurable Alternative einer wissenschaftlichen Theorie in Frage kommt, ist ein zentraler Gegenstand der Naturphilosophie. Während und durch die Arbeit an dieser Frage radikalisiert sich Feyerabends Einschätzung der Wissenschaften. War 1965 noch der wissenschaftliche Fortschritt das Ziel, dem der Theorienpluralismus dienen sollte, so zeigt sich der spätere Feyerabend 21weniger überzeugt davon, daß wissenschaftlicher Fortschritt in jedem Fall erstrebenswert ist. In einem rückblickenden Nachtrag zu seiner Antwort an Kritiker schreibt er 1980:
Ganz überrascht bin ich heute, wenn ich diese militant szientistische Abhandlung lese. Sie wendet sich zwar gegen gewisse Auffassungen von den Wissenschaften, wie einen extremen Empirismus und Monismus, aber eine pluralistisch geläuterte Wissenschaft gilt doch noch immer als die Grundlage unserer Einstellung zur Welt (1965a: 160).
Der Sinneswandel, den Feyerabend im Rückblick selbst deutlich wahrnimmt, ist gelegentlich als fundamentaler Bruch in seinem Denken und als Wende zum Irrationalismus verstanden worden.[7] Nicht zuletzt durch Feyerabend selbst ist zudem der Eindruck entstanden, dieser Schritt zu einer radikaleren Relativierung der westlich-wissenschaftlichen Weltauffassung sei vor allem die Konsequenz seiner sogenannten Berkeley-Erfahrung. Feyerabend verweist in seiner Autobiographie auf die Studentenrevolte und die Öffnung der Universitäten für Studierende mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, insbesondere für Afro-Amerikaner: »Sollte ich sie weiterhin mit intellektuellen Delikatessen füttern, die ein Teil der weißen Kultur waren?« (1994: 168)[8] So könnte der nachhaltige Zweifel an der wissenschaftlichen Weltauffassung als soziokulturell motivierte Idiosynkrasie Feyerabends erscheinen. Fügt man jedoch die Naturphilosophie dem Gesamtbild der Entwicklung Feyerabends hinzu, 22so wird deutlich, daß er nicht nur Gründe für seine Skepsis vorbringt, sondern auch daß diese Gründe als konsequente Erweiterung, als Radikalisierung seiner früheren Philosophie zu verstehen sind. Indem Feyerabend umsetzt, was er in dem Brief an Smart ankündigte, nämlich eine Arbeit über das Phänomen der Mythen als voll entwickelte Weltauffassungen, als universale Theorien im oben ausgeführten Sinne zu schreiben, bekommt er die wissenschaftliche Weltauffassung als Ganzes in den Blick und stellt ihr eine Alternative, die Welt Homers, gegenüber. Getreu seinem Prinzip des Pluralismus besteht nur im Vergleich mit solchen alternativen Auffassungen die Möglichkeit zu einem ernsthaften Test und einer fairen Evaluation der wissenschaftlichen Weltauffassung selbst. Der Schritt zur grundlegenden (und mitunter als Irrationalismus mißverstandenen) Wissenschaftskritik Feyerabends kann als Verbindung des Proliferationsprinzips und der Inkommensurabilitätsthese mit seinen Forschungen zur Antike verstanden werden. Diese allgemeine Radikalisierung läßt sich auch außerhalb der Naturphilosophie an seiner Deutung der Antike nachvollziehen.
Feyerabend war zeitlebens an Themen der griechischen Antike interessiert. Das gilt schon für seine auch naturphilosophisch interessante frühe Arbeit Physik und Ontologie, in der er bereits »das mythologische Stadium, das metaphysische Stadium und das naturwissenschaftliche Stadium« erklärender Weltbilder unterscheidet (1954: 464), bis hin zu seiner noch auf dem Sterbebett bearbeiteten Vernichtung der Vielfalt. Der Transformation des Denkens in der frühgriechischen Antike hat er ausgedehnte, wenn auch leider wenig beachtete Passagen seines Hauptwerkes gewidmet (1975: 303-356) und in vielen anderen Schriften antike Quellen erörtert. Das grundlegende Motiv dafür hat er einmal in Wissenschaft als Kunst wie folgt benannt: »Die Einführung abstrakter Begriffe im griechischen Abendland ist eines der merkwürdig23sten Kapitel in der Geschichte unserer Kultur« (1984a: 50). Die Transformation des Denkens in der griechischen Antike ist für Feyerabend vielleicht zunächst nur eine besonders faszinierende historische Fallstudie, aber darüber hinaus erscheint sie als Grundlegung einiger zentraler Elemente der abendländischen Naturauffassung. Aus diesem Grund widmet sich Feyerabend immer wieder der frühgriechischen Geisteswelt. Allerdings hat seine Auffassung vom Denken der Antike im Laufe der sechziger Jahre eine grundlegende Veränderung erfahren, die mit seiner allgemeinen Entwicklung korrespondiert und am ehesten als Radikalisierung zu verstehen ist. In seinen früheren Texten war Feyerabend hinsichtlich der vorsokratischen Philosophie offenbar stark von Karl Popper beeinflußt. In Knowledge without Foundations (1961) geht er noch davon aus, das wissenschaftliche Wissen sei durch einen Prozeß von Vermutungen und Widerlegungen entstanden: »by a process of rational criticism which relentlessly investigates every aspect of the theory and changes it in case it is found to be unsatisfactory. The attitude towards a generally accepted point of view such as a cosmological theory or a social system will therefore be an attitude of criticism« (1961: 48). Diese Auffassung reproduziert im wesentlichen Poppers Zurück zu den Vorsokratikern (1958). Im Zusammenhang mit seiner partiellen Abkehr von Popper ändert sich auch seine Einschätzung der Transformation des Denkens in der griechischen Antike. Nun erscheint der Schritt vom Mythos zum Logos nicht länger als Episode in einer allgemeinen Fortschrittsgeschichte, deren Motor die vernünftige Kritik früherer Positionen ist. In seiner Autobiographie macht er für diesen Sinneswandel insbesondere die Lektüre von Bruno Snell geltend.
Das lange Kapitel über Inkommensurabilität [in Wider den Methodenzwang] war das Ergebnis ausgedehnter Studien, die sich vor allem auf drei Bücher bezogen: Bruno Snells Die Entdeckung des 24Geistes, Heinrich Schäfers Von ägyptischer Kunst und Vasco Ronchis Optics. Ich erinnere mich noch an meine Aufregung, als ich bei Snell über den homerischen Begriff des Menschen las (1994: 190).
Bislang war diese Selbstbeschreibung Feyerabends insoweit nicht recht nachvollziehbar, als er seine Argumente gegen den begrifflichen Konservatismus und gegen die zwanghafte Anwendung einer fragwürdigen wissenschaftlichen Methode vor allem mit Beispielen aus der neuzeitlichen Wissenschaftsgeschichte erläutert hat. Dementsprechend wußte die Feyerabend-Forschung bislang wenig mit dieser Stelle anzufangen.[9] Vor dem Hintergrund unserer Edition läßt sich dieser Rückblick als Ergebnis seiner Arbeiten an der Naturphilosophie verstehen, die in rudimentärer und wenig beachteter Form auch Eingang in Wider den Methodenzwang (und spätere Werke) gefunden haben. Feyerabend legt sich in der Naturphilosophie die Frage nach den Anfängen der abendländisch-wissenschaftlichen Naturauffassung vor.[10] Und er ist bereits hier der Überzeugung, nicht Argumente, sondern die Geschichte habe die homerisch-mythische Weltauffassung widerlegt. Auf diese Weise erschließen sich auch andere Verweise auf die besondere Bedeutung der antiken Transformation des Denkens für Feyerabends Einstellung zur Wissenschaft. In der überarbeiteten deutschen Fassung von Erkenntnis für freie Menschen erläutert Feyerabend, er habe in Wider den Methodenzwang drei historische Beispiele erörtert, um die Schwierigkeiten wissenschaftstheoretischer Methodologien aufzuzeigen, wie sie etwa von Popper oder 25Lakatos vorgelegt worden waren. Neben Einsteins Ersetzung der klassischen Mechanik und Galileios Verteidigung des kopernikanischen Systems war »das dritte Beispiel […] der Übergang vom Aggregatuniversum Homers zum Substanzuniversum der Vorsokratiker« (1978: 30). Zwar gehöre dieses Beispiel nicht zur Geschichte der Wissenschaft, sondern vielmehr zu ihrem vorgeschichtlichen Anfang, aber »die Erklärung der Inkommensurabilität, die aus ihm hervorgeht, paßt genau« (1978: 30). Die grundlegenden Konzepte der Welt Homers und der Welt der Vorsokratiker seien inkommensurabel, denn »sie lassen sich nicht gleichzeitig verwenden, und man kann keine logischen oder wahrnehmungsmäßigen Verbindungen zwischen ihnen herstellen« (1975: 301).[11]
Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, daß Inkommensurabilität für Feyerabend nicht Unvergleichbarkeit bedeutet, sondern nur auf das Fehlen eines gemeinsamen Maßstabs verweist. Inkommensurable Theorien lassen sich nicht intern zueinander in Beziehung setzen, sondern nur von einem bestimmten Standpunkt aus vergleichen, der nicht automatisch als überlegen aufgefaßt werden darf, da dessen Vergleichs- und Bewertungsstandards ihrerseits immer Teil einer Weltauffassung sind. Um in diesem Sinne inkommensurabel zu sein, müssen die homerische und die vorsokratische Weltauffassung als vollständige und funktionale Begriffs- und Wahrnehmungswelten aufgefaßt werden können. So wird verständlich, warum Feyerabend in der Naturphilosophie eine Deutung der homerischen Epen und der archaischen Kunst und Religion im Sinne einer universalen und empirisch ge26haltvollen Theorie liefert. Der naturalistischen Metaphysik und der logozentrischen Beweisführung der Vorsokratiker stellt er die ganzheitliche und kontextsensitive Weltauffassung der homerischen Religion gegenüber. Besondere Bedeutung erwächst diesem historischen Fall auch dadurch, daß er gerade nicht zur Geschichte der Wissenschaften gehört, sondern einen wichtigen Anfang derselben markiert. Dadurch eröffnet er die Möglichkeit, der Wissenschaft selbst eine Alternative gegenüberzustellen. Gleichzeitig ist es unter dem Gesichtspunkt der Inkommensurabilität nicht legitim, nichtwissenschaftliche Theorien nach wissenschaftlichen Standards zu beurteilen. Die besondere Qualität der wissenschaftlichen Standards müßte auf anderem Wege gezeigt werden. Nur auf der Basis solcher Überlegungen kann der spätere Feyerabend den Glauben an Atome mit dem Glauben an Götter parallelisieren (cf. 1987a: 128 f.) und eine bislang ausgebliebene faire Evaluation der wissenschaftlichen Weltauffassung einfordern (cf. 1978: 113; 1999: 30).
All dies zeigt, daß die Naturphilosophie zentral für die philosophische Entwicklung Feyerabends war. Feyerabend forderte in den 1950er und 1960er Jahren durch die Entwicklung inkommensurabler Alternativen die unterschiedlichsten Formen des begrifflichen Konservatismus heraus. Basis und Ziel der Kritik war dabei die wissenschaftstheoretisch begründete Überzeugung, daß nur ein Pluralismus von Theorien den wissenschaftlichen Fortschritt nicht behindern würde. Bei der Auseinandersetzung mit der antiken Transformation vom Mythos zum Logos, die im Zentrum der Naturphilosophie steht, widmete er sich einem spezifischen Fall inkommensurabler Weltbilder. Dieser historische Fall ist insofern besonders beachtlich, weil er die Entstehung einiger allgemeiner Standards, Auffassungen und Werte der abendländisch-wissenschaftlichen Weltauffassung markiert. Namentlich die Präferenz für begrifflich-beweisende Metho27den, abstraktes und kontextunabhängiges Denken sowie eine naturalistische Metaphysik unterscheiden wissenschaftliche Theorien gemeinschaftlich von ihren nichtwissenschaftlichen Alternativen. Im Verlauf der Arbeit an der Naturphilosophie stellt sich Feyerabend die Frage nach Nutzen und Nachteil dieser Standards für ein glückliches Leben. Die Verbindung von Pluralismus und Fortschritt bleibt dabei tragend, aber wissenschaftlicher Fortschritt und kultureller und sozialer Fortschritt fallen für den späteren Feyerabend nicht mehr notwendig zusammen. Mit dem Ziel, zu einer fairen vergleichenden Bewertung der wissenschaftlichen Weltauffassung beizutragen, arbeitet er Mythos und Kunst als starke Alternativen zu dieser Auffassung heraus. Die spätere kritische Haltung gegenüber der abendländischen Wissenschaft erweist sich so als Ausweitung seiner Kritik des begrifflichen Konservatismus durch die Entwicklung inkommensurabler Alternativen; sie ist orientiert am Ideal menschlichen Fortschritts.
3. Übersicht über den Argumentationsgang der Naturphilosophie
Feyerabend zeigt sich in seiner Einführung in die Naturphilosophie als kritischer Historiker des abendländischen Naturdenkens, der für einen pragmatischen Gebrauch der menschlichen Vernunft plädiert. Er verstand seine Arbeit als ›Einführung‹ in dem Sinne, daß sie historisch auf die heutige Situation hinführt, sie ist eine Genealogie der modernen Naturauffassung vor dem Hintergrund vergangener und vielleicht auch zukünftiger Alternativen. Es gab funktional erfolgreiche Alternativen zu der modernen, wissenschaftlichen Lebensform, die geradeso wie unsere über eine Reihe von Vor- und Nachteilen verfügen. Mit dem Ziel, die Schwächen 28der abstrakt-wissenschaftlichen und die Stärken von alternativen Naturauffassungen herauszuarbeiten, erweitert er den üblichen Horizont historisch und interdisziplinär beträchtlich, indem er vor allem drei weitere Aspekte mit einbezieht: Das ist erstens die Ur- und Frühgeschichte, die in Forschungen zur Eiszeitkunst, zur Steinzeitwissenschaft, zu altägyptischer und babylonischer Kunst und Wissenschaft sowie zur Welt Homers ihren Ausdruck findet. Zweitens diskutiert er ethnographische und sozialanthropologische Studien zu indigenen Völkern, wobei er sich vor allem gegen die eurozentrische These vom anfänglichen und primitiven Denken wendet, um ein angemesseneres Bild mythischen Denkens zu entwickeln. Drittens bezieht er die klassische Kunstgeschichte in seine Naturphilosophie mit ein. Damit setzt sich Feyerabend trotz seiner umfassenden Lektüre der Gefahr gelegentlichen Dilettierens aus. Manche seiner Thesen, etwa über den fragmentarischen psychologischen Zustand des homerischen Menschen, werden heute unter Fachwissenschaftlern mehrheitlich in Frage gestellt.[12] Aber zugleich erweitert er auf überaus inspirierende Weise den klassischen Horizont historischer Untersuchungen. Darin ist durchaus ein Vorzug gegenüber anderen Einführungen in die Naturphilosophie zu sehen, die zumeist nicht hinter die vorsokratische Philosophie oder gar auf außereuropäische Kulturen zurückgreifen.[13]
Dieser umfassenden Programmatik entsprechend widmet sich Feyerabend in den ersten beiden Kapiteln den frühesten 29Zeugnissen menschlicher Naturforschung. Mit Hilfe archäologischer und kulturhistorischer Forschungen sowie durch sozialanthropologische Vergleiche bemüht er sich um eine Rekonstruktion der steinzeitlichen Naturauffassung. Bei den Thesen zu Stonehenge als frühem Astronomiezentrum und zu einer dynamischen Naturauffassung der Steinzeitkultur stützt sich Feyerabend insbesondere auf eine nicht-primitivistische Deutung der frühen Kulturen.[14] Der Steinzeitmensch verfüge schließlich über dieselben biologischen und kognitiven Fähigkeiten wie wir, er ist bereits der voll entwickelte homo sapiens. Es sei daher unwahrscheinlich, daß seine Mittel zum Verständnis und zur Beherrschung der Natur strukturell dysfunktional gewesen sein und auf völlig phantastischen Auffassungen beruht haben könnten. Die Betrachtung des historischen Materials vom vermeintlich folgerichtigen und überlegenen Standpunkt unserer Gegenwart weist Feyerabend als anachronistisch und selbstgerecht zurück. Vielmehr seien die Zeugnisse frühzeitlicher und antiker Kulturen ebenso theorieabhängige und zugleich partiell erfolgreiche Wirklichkeitsauffassungen wie die unsere, deren Qualität letztlich nur nach jeweils internen Kriterien evaluiert werden kann. Dementsprechend deutet er im zweiten Kapitel auch die griechischen Mythen im Rahmen einer Theorie des Naturmythos: Wie hilft der Mythos den Menschen bei ihrem Naturverständnis und ihrer Naturbeherrschung? Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der ausführliche Vergleich seiner eigenen Deutung des Mythos mit den Arbeiten von Lévi-Strauss.
Im dritten Kapitel liefert Feyerabend eine realistische Interpretation des archaischen Stils und der homerischen Epen. 30Die Darstellungsweisen der archaischen Kunst beruhen nicht auf dem strukturellen Unvermögen, besser zu malen, sondern sie bringen eine entsprechende Wahrnehmungswelt angemessen zum Ausdruck. Auch die Strukturmerkmale der homerischen Dichtungen seien als Konsequenz einer entsprechenden Weltauffassung zu verstehen. In ihnen zeige sich eine dynamische Weltsicht, die aus einzelnen Aggregaten parataktisch zusammengesetzt sei und flexibel auf veränderliche Kontexte reagiere. Eine offene Welt, die Feyerabend durchaus in einem sehr positiven Licht erscheinen läßt. Ähnlich wie Nietzsche oder Whorf geht er dabei davon aus, daß unsere begrifflichen Schemata einerseits unsere Wahrnehmungswelt entscheidend mitkonstituieren und daß sie andererseits historischen Veränderungen unterworfen sind. Wissenschaftssprache und Wirklichkeitsauffassungen hängen zusammen, beides kann sich wandeln.
Im Anschluß an diese Vergewisserungen über die Frühzeit entfaltet die Naturphilosophie eine beachtliche Perspektive auf die Transformation des Weltbildes in der griechischen Antike, die zugleich ein vertieftes Verständnis der abendländischen Naturauffassung ermöglichen soll. Die sprachliche und empirische Wirklichkeit der homerischen Welt löst sich auf und wird durch die Welt der Philosophen ersetzt, wie Feyerabend im vierten Kapitel darstellt. Dieser Übergang erweist sich als ein durchaus nicht vernünftig-regelgeleiteter Prozeß, der daher nur empirisch durch eine feinfühlige historische Analyse untersucht werden kann. Zu den historischen Umständen zählt Feyerabend zeremonielle und stilistische Elemente der religiösen Tradition sowie die Folgen von Krieg und Verwirrung, aber auch die Hoplitenphalanx, die den traditionellen heroischen Idealen die Basis entzieht. Besonders hebt er die Einflüsse der orientalischen Nachbarkulturen hervor. Außerdem werde die Kritik am Mythos schon im mythischen Gewande vorbereitet, wofür z. B. das Ringen des Achilles 31um einen neuen, substantiellen Begriff von Ehre steht.[15] Die Neuheiten des vorsokratischen Substanzuniversums illustriert Feyerabend im fünften Kapitel. Zu den hervorstechendsten Eigenschaften dieser Denker gehöre es, begrifflichen Erwägungen den Vorzug gegenüber sinnlichen Erfahrungen einzuräumen. Durch die metaphysischen Vorannahmen der frühgriechischen Philosophen, insbesondere durch die Trennung zwischen mutmaßlich einfacher und einheitlicher Realität und nur scheinbarer Vielfalt, werde die Wirklichkeit entnatürlicht und entmenschlicht zugunsten einer dogmatischen Welt der Theorie.[16] Dazu diskutiert er die Kosmologie von Anaximander, die Religions- und Erkenntniskritik des Xenophanes und insbesondere das Substanzuniversum des Parmenides. Besonders deutlich sind seine Argumente für eine alternative Interpretation der Mythenkritik des Xenophanes, die er wiederholt vorgetragen hat.[17] Vor allem die eleatische Seinsphilosophie bilde jedoch den Ausgangspunkt abendländischer Naturauffassungen, ihr Einfluß sei erheblich und nicht nur segensreich. »Im Gegenteil«, schreibt Feyerabend in der Naturphilosophie, »›infantil und traumhaft‹ erscheint uns nun ein Denken, wie das des Parmenides, das die Bewegung leugnet und damit das westliche Denken für Jahrhunderte auf Abwege führt.«
32Wie sich diese ›Abwege‹ entwickelten und auf welche Weise die abendländische Wissenschaft in der jüngeren Gegenwart seiner Auffassung nach ›zurück‹ zu ganzheitlicheren und dynamischeren Konzepten gelangt, skizziert Feyerabend im sechsten Kapitel. Dabei bemüht er sich oftmals darum, eine Gegenposition zur vorherrschenden Meinung zu entwickeln und auf diese Weise »das schwächere Argument stärker zu machen« (ton hetto de logon kreitto poiein – Protagoras, DK 80B6b). So stellt er die Vorzüge der Aristotelischen Wissenschaftsauffassung heraus, die im Unterschied zur mathematischen Behandlung der Natur bei Descartes einen konsistenten Zusammenhang zwischen den theoretischen und den praktischen Elementen der wissenschaftlichen Naturauffassung herstelle. Das hervorstechendste Merkmal der neuzeitlichen Wissenschaft sei das Fehlen eines wirklichen empirischen Fundaments bei gleichzeitiger empiristischer Rhetorik. In diesem Zusammenhang verteidigt er Bacon gegen den Vorwurf eines schlichten Empirismus, der sich so zwar in der naiven Sammelwut der Royal Society zeige, aber nicht in der letztlich theoriegeleiteten Naturbetrachtung bei Bacon oder Galilei. Verblüffend sind vielleicht die Bemerkungen zu den Wurzeln des Empirismus in den magischen Theorien von Agrippa oder in den heute bizarr anmutenden Experimenten zur Erkennung von Hexen. In einer ausführlichen Erörterung der Überlegungen Hegels deutet Feyerabend an, wie schließlich wieder eine Theorie der Bewegung der Begriffe Einzug in das abendländische Denken hält. Die Probleme, die sich aus der Betrachtung der Natur als einem bloßen Mechanismus für die Wissenschaftstheorie und die Naturwissenschaften ergeben, diskutiert er abschließend am Beispiel von Newton, Leibniz und Mach. In den physikalischen Theorien vor allem von David Bohm erblickt er den Beginn einer neuen, prozeduralen und wieder stärker philosophisch-mythologischen Wissenschaft. Langsam greife die 33Einsicht wieder um sich, es gebe »mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt« (Hamlet: I,5). Recht verstanden ist dies kein Plädoyer für Geisterseherei, sondern für einen flexiblen Gebrauch wissenschaftlicher Schulweisheit im Bewußtsein ihrer Möglichkeiten und Grenzen. Die Vorzüge eines solchen Naturbildes und der damit verbundenen offeneren Haltung gegenüber der Wissenschaft und ihrer Alternativen möchte Feyerabend durch seine Naturphilosophie herausstellen und befördern.
Zu den Abbildungen
Feyerabend hat die im Text verwendeten Abbildungen zum Teil aus Büchern kopiert, zum Teil abgezeichnet und zum Teil selbst entworfen. Alle kopierten Abbildungen wurden von uns durch druckfähige Scans ersetzt, nicht immer aus der Quelle, die Feyerabend verwendet hat. Feyerabends eigene Zeichnungen wurden von Simon Sharma auf kunstvolle Weise digital rekonstruiert.
Danksagung
Abschließend möchten wir uns bei verschiedenen Institutionen und Personen bedanken, ohne deren Unterstützung diese Arbeit wohl in den Kästen der Konstanzer Feyerabend-Sammlung verblieben wäre. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Humboldt-Universität zu Berlin haben diese Edition durch ihre finanzielle und institutionelle Förderung ermöglicht. Die Carl und Max Schneider Stiftung hat freundlicherweise zusätzliche Gelder für eine studentische Hilfskraft bewilligt. Simon Sharma hat bei der Transkription des Textes und der Bearbeitung der vielen Abbildungen Hervorragendes geleistet. Ohne seine vielfältige Unterstützung wäre die Edition kaum möglich gewesen, ihm gebührt unser besonderer Dank. In verschiedenen Seminaren haben wir Teile des Textes gelesen und mit Studierenden diskutiert, sie 34haben uns bei der Überprüfung der Quellen unterstützt und zum Verständnis der Überlegungen Feyerabends beigetragen. Herr Prof. Dr. Helmut Spinner hat uns großzügig seine Vorarbeiten zur Verfügung gestellt und über die Geschichte des Projekts bereitwillig Auskunft erteilt. Ein besonderer Dank gilt auch Frau Sabine Hassel von der Humboldt-Universität zu Berlin und Frau Dr. Brigitte Parakenings vom Philosophischen Archiv der Universität Konstanz. Herzlich bedanken möchten wir uns auch bei Grazia Borrini-Feyerabend, die sich mit uns freut, diese Arbeit Feyerabends schließlich doch der Öffentlichkeit zu übergeben.
Berlin im Oktober 2008,die Herausgeber
35Literatur
Baum, Wilhelm (Hg. 1997): Paul Feyerabend – Hans Albert. Briefwechsel, Frankfurt/M.
Esfeld, Michael (2004): Einführung in die Naturphilosophie, Darmstadt.
Feyerabend, Paul (1951): Per una theoria degli asserti di base (italienische Übersetzung von Feyerabends Dissertation: Zur Theorie der Basissätze), übers. und hg. v. Stefano Gattei u. Carlo Tonna, 2007.
–(1954): »Physik und Ontologie«, in: Wissenschaft und Weltbild. Zeitschrift für alle Gebiete der Forschung, Bd. 7; 11/12 (Nov.-Dez.), S. 464-476.
–(1961): Knowledge without Foundations. Two Lectures Delivered on the Nelli Heldt Lecture Fund, Oberlin.
–(1962): »Explanation, Reduction and Empiricism«, in: Ders. (Hg.): Realism, Rationalism and Scientific Method. Philosophical Papers, Vol. I, Cambridge, 1981, S. 44-96.
–(1965a): »Antworten an Kritiker. Bemerkungen zu Smart, Sellars und Putnam«, in: Ders. (Hg.): Probleme des Empirismus. Ausgwählte Schriften, Bd. II, Braunschweig, 1981, S. 126-159.
–(1965b): »Problems of Empiricism«, in: Robert G. Colodny (Hg.): Beyond the Edge of Certainty. Essays in Contemporary Science and Philosophy, Bd. II, Pittsburgh, S. 145-260.
–(1972): »Von der beschränkten Gültigkeit methodologischer Regeln«, in: Ders. (Hg.): Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften, Braunschweig, 1978, S. 205-248.
–(1975): Wider den Methodenzwang, übers. v. Hermann Vetter, Frankfurt/M., zweite, revidierte Ausgabe, 1983.
–(1977): »Unterwegs zu einer dadaistischen Erkenntnistheorie«, in: Hans Peter Duerr (Hg.): Unter dem Pflaster liegt der Strand (4), Berlin, S. 9-88.
–(1978): Erkenntnis für freie Menschen. Veränderte Ausgabe, Frankfurt/M., 1980.
–(1984a): Wissenschaft als Kunst, Frankfurt/M.
–(1984b): »Xenophanes: A Forerunner of Critical Rationalism?«, übers. v. John Krois, in: Gunnar Andersson (Hg.): Rationality in Science and Politics. Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol. 79, Dordrecht/Boston/Lancaster, S. 95-109.
–36(1986): »Eingebildete Vernunft. Die Kritik des Xenophanes an den Homerischen Göttern«, in: Kurt Lenk (Hg.): Zur Kritik der wissenschaftlichen Rationalität. Zum 65. Geburtstag von Kurt Hübner, Freiburg/München, S. 205-223.
–(1987a): Irrwege der Vernunft, übers. v. Jürgen Blasius, Frankfurt/M., 1990.
–(1987b): »Reason, Xenophanes and the Homeric Gods«, in: Ders. (Hg.): Farewell to Reason, London/New York, S. 90-102.
–(1993): Against Method, London, Third Edition.
–(1994): Zeitverschwendung, übers. v. Joachim Jung, Frankfurt/M., 1995.
–(1999): Die Vernichtung der Vielfalt. Ein Bericht, hg. v. Bert Terpstra, übers. v. Volker Böhnigk u. Rainer Noske, Wien, 2004.
Gill, Christopher (1996): Personality in Greek Epic, Tragedy, and Philosophy. The Self in Dialogue, Oxford.
Gloy, Karen (1995): Das Verständnis der Natur. Erster Band. Die Geschichte des wissenschaftlichen Denkens, München.
Heit, Helmut (2006): »Paul K. Feyerabend: Die Vernichtung der Vielfalt. Ein Bericht. Wien 2005«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 60/4, S. 615-619.
–(2007): Der Ursprungsmythos der Vernunft. Zur philosophiehistorischen Genealogie des griechischen Wunders, Würzburg.
Horgan, John (1993): »Profile Paul Karl Feyerabend: The Worst Enemy of Science«, in: Scientific American, Bd. May 1993, S. 36-37.
Hoyningen-Huene, Paul (1997): »Paul K. Feyerabend«, in: Journal for General Philosophy of Science, Bd. 28, S. 1-18.
Lakatos, Imre u. Paul Feyerabend (1999): For and Against Method. Including Lakatos’s Lectures on Scientific Method and the Lakatos-Feyerabend Correspondence, Chicago.
Mutschler, Hans-Dieter (2002): Naturphilosophie, Stuttgart.
Oberheim, Eric (2005): »On the Historical Origins of the Contemporary Notion of Incommensurability: Paul Feyerabend’s Assault on Conceptual Conservatism«, in: Studies in History and Philosophy of Science, Bd. 36, S. 363-390.
–(2006): Feyerabend’s Philosophy, Berlin/New York.
Popper, Karl R. (1958): »Zurück zu den Vorsokratikern«, in: Ders. (Hg.): Vermutungen und Widerlegungen – Das Wachstum der wissenschaftlichen Erkenntnis, Tübingen, S. 198-224.
37Preston, John (1997): Feyerabend. Philosophy, Science and Society, Cambridge.
Preston, John, Gonzales Munévar u. David Lamb (Hg. 2000): The Worst Enemy of Science? Essays in Memory of Paul Feyerabend, Oxford.
Rappe, Guido (1995): Archaische Leiberfahrung. Der Leib in der frühgriechischen Philosophie und in außereuropäischen Kulturen, Berlin.
Shakespeare, William (Hamlet): »Hamlet. Prinz von Dänemark«, in: Wolfgang Deninger (Hg.): Shakespeares Werke. Dramatische Werke in zehn Bänden. Nach der Übersetzung von August Wilhelm von Schlegel und Ludwig Tieck, Bd. 9, München, S. 79-192.
Snell, Bruno (1930): »Das Bewußtsein von eigenen Entscheidungen im frühen Griechentum«, in: Ders. (Hg.): Gesammelte Schriften. Mit einem Vorwort von Hartmut Erbse, Göttingen, S. 18-31.
–(1946): Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen, Hamburg.
Spinner, Helmut F. (1977): Begründung, Kritik und Rationalität. I. Die Entstehung des Erkenntnisproblems im griechischen Denken und seine klassische Rechtfertigungslösung aus dem Geiste des Rechts, Braunschweig.
Theocharis, T. u. M. Psimopoulos (1987): »Where Science Has Gone Wrong«, in: Nature, Bd. 329 (15 October), S. 595-598.
Williams, Bernard (2000): Scham, Schuld und Notwendigkeit. Eine Wiederbelebung antiker Begriffe der Moral, übers. v. Martin Hartmann, Berlin.
39Paul Feyerabend: Naturphilosophie
41Vorbemerkung
Dem Leser wird geraten, den Essay zunächst ohne die Abschnitte im Kleindruck in einem Zuge durchzulesen. Er erhält so einen Überblick über die zugrundeliegende Ideologie. Die kleingedruckten Bemerkungen bringen weiteres Material, zusätzliche Argumente, bibliographische Hinweise. Auch nehmen sie gelegentlich Seitenlinien auf und verfolgen sie weiter.[1]
Der Essay ist eine ›Einführung‹ in dem Sinn, daß er historisch auf die heutige Situation hinführt. Die drei Lebensformen, die besprochen werden – Mythos, Philosophie, Wissenschaft –, lassen sich weder scharf voneinander trennen, noch sind sie immer in dieser Reihenfolge anzutreffen. Der Mythos antizipiert die Wissenschaft, die Wissenschaft hat mythologische Züge, Philosophie, Wissenschaft und Mythos leben bald friedlich nebeneinander, bald bestreiten sie einander das Daseinsrecht, ›Aberglauben‹ und ›Vorurteil‹ findet man überall. Außerdem ist die Wissenschaft dem Mythos und der Philosophie gegenüber nicht immer im Vorteil. Von Interesse ist der Umstand, daß wir hier drei verschiedene Arten der Welterfassung vor uns haben, die vollständig sind in dem Sinn, daß sie sowohl Ziele und Methoden zur Erreichung der Ziele als auch Kriterien zur Feststellung von 42Erfolg und Mißerfolg besitzen. Die Übergänge zwischen den Stadien, die wir vorläufig einzig im Abendlande genau verfolgen können, bringen im Idealfall nicht nur neue Gedanken und Methoden, sie bringen auch neue Ziele und neue Wahrnehmungen, die sich zu neuen perzeptuellen Welten zusammenfügen.
Nur einer dieser Übergänge wird im folgenden genauer besprochen. Es ist der Übergang vom ›Aggregatuniversum‹ Homers zum ›Substanzuniversum‹ der griechischen Philosophie und Wissenschaft. Historische Gründe sind dafür verantwortlich, daß dieser Übergang relativ scharf und deutlich ist und im Detail verfolgt werden kann. Die Vielfalt der Einflüsse, die in dieser frühen Zeit einen Denker bewegen, macht es notwendig, über den Bereich der Philosophie hinaus auch die Kunst, die Dichtung, das religiöse Denken zu besprechen. Eine solche mehr umfassende Betrachtungsweise zeigt, daß ›Fortschritte‹ in einem Bereich fast immer von Rückschritten in anderen Bereichen begleitet sind. Insbesondere der Übergang zum ›rationalen‹ Universum der Philosophen führt zu Problemen, die auch heute noch der Lösung harren und die möglicherweise unlösbar sind: Eine Rückkehr zum Mythos mag wohl angezeigt sein.
Meine Aufgabe ist erfüllt, wenn der Leser einsieht, daß die Entscheidung für oder gegen den ›Mythos‹ oder für oder gegen eine bestimmte Methode in der Philosophie oder der Wissenschaft nicht leicht zu treffen ist, daß es immer Argumente für beide Seiten gibt, und wenn er einige der Umstände kennenlernt, die bei solchen Entscheidungen eine Rolle spielen. Der erkenntnistheoretische Standpunkt, der dieser Darstellung zugrunde liegt, ist weiter ausgeführt in meinem Essay Against Method (1975). Der vorliegende Text wurde 1971 geschrieben und 1976 aufgrund neuerer Literatur revidiert.
431. Die Voraussetzungen des Mythos und die Kenntnisse seiner Erfinder
[1] Auf dreifache Weise können wir den Wandel der Naturansichten in die Vergangenheit zurückverfolgen. Die Archäologie macht uns mit materiellen Produkten bekannt, die einen Rückschluß auf die Ideen und Kenntnisse der begleitenden Kulturen gestatten. Die Mythenforschung im weiteren Sinn, d. h. die Erforschung von Legenden, Märchen, Ritualen, Sprichwörtern, Geheimlehren, Gesängen, Epen, Träumen, gestattet die Identifikation und teilweise Entschlüsselung von Bruchstücken archaischen Wissens, die jene nur indirekt erschlossenen Ideen ergänzen. Die vergleichende Kulturanthropologie schließlich zeigt uns, wie schriftlose Kleingesellschaften der Gegenwart Ideen und Natur-›Tatsachen‹, soziale Umstände, Artefakte etc. verbinden, und legt eine analoge Ergänzung der von Archäologie und Mythenforschung entdeckten Elemente nahe.
Bei der Sammlung und Deutung des reichen und rätselhaften Materials bedürfen diese drei Grunddisziplinen der Hilfe aller übrigen Wissenschaften, also der Astronomie, der Biologie, Chemie, Physik, Geographie etc. Wir brauchen diese Wissenszweige für Datierung, Materialforschung (Herkunft und Behandlung des für Kunstwerke, Bauten, Schmuck etc. verwendeten Materials), wir brauchen sie noch viel mehr zur Deutung der so erhaltenen Information. Wie könnte man wohl den astronomischen Gehalt eines Mythos oder die astronomische Funktion eines Bauwerkes entdecken ohne genaue Kenntnis der Vorgänge am gestirnten Himmel? Noch genügt eine bloß rudimentäre Beherrschung der Hilfswissenschaften. Die Annahme, daß der Mensch der Steinzeit oder der Bronzezeit nur die primi44tivsten Naturkenntnisse besessen haben kann, schmeichelt zwar der Einbildung unserer eigenen Fortschrittlichkeit; sie ist aber wenig plausibel – der Mensch der Steinzeit ist bereits der voll entwickelte homo sapiens – und auch unvereinbar mit den Ergebnissen der neueren Forschung. Die Probleme, die Gesellschaft und Umwelt an den Frühmenschen stellten, waren unvergleichlich größer als die Anforderungen an den Wissenschaftler von heute, sie mußten mit den einfachsten Mitteln gelöst werden, oft ohne Arbeitsteilung und Spezialisierung, und die erreichten Lösungen deuten auf eine Intelligenz und Sensitivität, die der unseren sicher nicht unterlegen ist.
In der Anthropologie und in verwandten Gebieten sprach man für geraume Zeit von »Primitiven«, »Wilden« oder »Naturvölkern« im Gegensatz zu »zivilisierten«, »fortgeschrittenen« oder »Kulturvölkern«. Diese Terminologie hat ihren Ursprung in den ziemlich primitiven Entwicklungsgedanken des 19. Jahrhunderts, nach denen eine lineare Entwicklung im Tierreich (heute sehr fraglich) ihre Fortsetzung in einer linearen Entwicklung menschlicher Fähigkeiten und Kulturen findet. Evans-Pritchard macht den pseudo-empirischen Charakter evolutionistischer Theorien sehr klar. Man legte Entwicklungslinien fest und illustrierte dann diese aus der Fülle des keinesfalls vorurteilslos gesammelten Materials: »Trotz ihres Bestehens auf empirischer Methode im Studium sozialer Institutionen waren diese Anthropologen des 19. Jahrhunderts kaum weniger dialektisch in ihrem Vorgehen […] als die Moralphilosophen des vorhergehenden Jahrhunderts« (Evans-Pritchard 1964: 41). Die empirische Grundlage entschwindet in noch größere Ferne, wenn man bedenkt, daß die Missionare, die Frazer und Tylor mit Berichten versahen, oft begeisterte Anhänger der Entwicklungslehre waren – die Fragen, die sie stellten, die Fragebogen, die sie verfaßten, die Auswahl des gewonnenen Ma45terials war völlig durch die Entwicklungslehre bestimmt.[2] Zusätzlich wurde eine Stufe der Entwicklung angenommen, in der der Mensch noch ganz organisches Wesen ist und unberührt von den Segnungen der Kultur. Eine solche Stufe hat die Forschung nicht gefunden, und sie ist auch a priori sehr unwahrscheinlich. Rousseau, den man hier oft als Zeugen anführt, lehnt die Idee ausdrücklich ab. Er »richtet seine Energie nicht auf die Entdeckung eines kulturlosen Naturzustandes, sondern einer Kultur, die der wahren Natur des Menschen zum Lichte helfen würde« (Gay 1970: 95). Das zeigt auch Rousseaus Preisabhandlung über die Frage Hat der Wiederaufstieg der Wissenschaften und Künste zur Läuterung der Sitten beigetragen? aus dem Jahre 1750 sowie die Letzte Antwort an Bordes: »Alle barbarischen Völker, selbst jene, die keine Tugend besitzen, verehren dennoch die Tugend; die gebildeten, aufgeklärten Völker hingegen gelangen mit zunehmendem Fortschritt schließlich dahin, sie ins Lächerliche zu ziehen und zu verachten« (Rousseau 1752: 71). Soziale Verbände, soziale Zusammenarbeit, Entdeckungen, Verbreitung derselben, Ritualhandlungen finden wir bereits im Tierreich, zum Beispiel bei den von Jane Goodall beobachteten Schimpansen (Goodall 1971).[3] Der Unterschied zwischen Natur und Kultur (wild und zahm; roh und gekocht; ungeschmückt und geschmückt), über den selbst moderne Philosophen oft leicht hinweggleiten,[4] ist für viele »Wilde« ein Problem, das sie durch Mythen zu verstehen 46und durch Riten zu lösen versuchen.[5] Gelegentlich verfällt ein Stamm ins entgegengesetzte Extrem und verneint »natürliche« Funktionen mit allen Anzeichen des Ekels.[6]
Der Gegensatz zwischen Naturvölkern und Kulturvölkern beruht in nicht geringem Ausmaße auf einer Überschätzung der Schrift. Schrift ist zwar oft, doch nicht immer mit Fortschrittlichkeit (oder größerer Intelligenz) verbunden. Die Sprachen schriftloser Stämme übersteigen an Kompliziertheit oft die uns bekannten Kultursprachen. Gelegentlich sind sie darum für den erwachsenen westlichen Menschen ganz unerlernbar (Kinder hätten dazu vielleicht noch etwas Talent). Wir kennen schriftlose Kulturen, deren Errungenschaften den Vergleich mit den Errungenschaften zeitgenössischer Schriftträger aushalten, und wir wissen, daß unvergleichliche Kunstwerke, wie die Ilias und die Odyssee, von schriftlosen Sängern komponiert und überliefert wurden[7] und daß die Rabbinischen Traditionen, die Kommentare zur Torah bis zum 5. Jahrhundert nicht niedergeschrieben, sondern von professionellen Gedächtniskünstlern von einer Generation an die andere weitergegeben wurden. Die Griechen, sicher nicht das dümmste Volk der Erde, setzten sich der Einführung des Schriftlichen in der Literatur entgegen, und noch Plato wendet sich gegen eine rein schriftliche Entwicklung von Problemen.[8]
In dieser Situation ist eine neue Terminologie dringend erfordert. Im vorliegenden Essay spreche ich von Kultur47völkern und Verstandesvölkern, Industrievölkern und industrielosen Völkern, Schriftvölkern und schriftlosen Kleinstämmen, d. h., ich gründe Unterscheidungen nicht auf einen angenommenen Idealzustand (der dann »natürlich« im Westen verwirklicht ist), sondern auf relevante Unterschiede in der Struktur der beschriebenen Gesellschaften. Die Details werden jeweils aus dem Zusammenhang klar. Aber selbst eine ›objektive‹ Bestandsaufnahme mit Hilfe ›neutraler‹ Fragen ist unvollständig und irreführend. Sie erlaubt es dem Antwortgebenden nicht, scheinbar unsinnige Teile seines Mythos durch Argumente zu klären und zu verteidigen, und kommt damit zu einer falschen Einschätzung des Mythos und seiner Anhänger. Der argumentativen Kraft der Naturvölker kommt man so keinesfalls auf die Spur. Erst Forscher wie Evans-Pritchard, die die Mitglieder der von ihnen untersuchten Stämme wie normale Menschen behandelt haben und die also versuchten, die »Wilden« durch Argumente zu ihrer eigenen westlich-wissenschaftlichen Ideologie zu bekehren, mußten erkennen, daß eine solche »Bekehrung« keine leichte Sache ist. Die Mitglieder des Stammes haben zwar ursprünglich keine Vorstellung von der Struktur und der Funktion kritischer Argumente, aber sie lernen schnell, wenn auch ohne große Begeisterung, und kehren den Rationalismus bald gegen ihre Lehrer. Argumente stoßen auf kluge Gegenargumente, und es stellt sich heraus, daß auch die scheinbar absurdeste Lebensform einen starken rationalen Kern besitzt oder mit einem solchen Kern versehen werden kann, falls man daran Interesse hat: »Mir erschien ihre Art, sich das Leben einzurichten, genauso befriedigend wie jede andere Art, die ich kenne«, schreibt Evans-Pritchard über die Azande (1937: 270), die selbst die trivialsten Handlungen nicht ohne genaue Konsultation von Orakeln ausführen. Schließlich befanden sich viele untersuchte Stämme zur Zeit der Bestandsaufnahme 48im Progreß der Auflösung. Die ›primitiven‹ Züge, die man bei ihnen feststellte, waren das Ergebnis der katastrophalen Einwirkung westlicher Eindringlinge (vgl. Lévi-Strauss 1958a: Kap. VI). Wie würde wohl New York aussehen beim plötzlichen Aussetzen von Gas, Elektrizität, Benzin?[9]
1.1. Steinzeitliche Kunst und Naturerkenntnis
[2] In der Kunst führen den Beweis die erstaunlichen Felsenbilder der späten Altsteinzeit, in denen technisches Können, Beobachtungsgabe, Stilsicherheit, Drang nach neuen Ausdrucksformen und die Fähigkeit zur raschen Verwirklichung neuer Ideen sich auf einzigartige Weise zu einem Ganzen vereinen. Ökonomie der Darstellung, charmante Kleinarbeit, Beherrschung isolierter perspektivischer Phänomene findet man hier ebenso wie prunkvollen Farbenreichtum und impressionistische Züge. Die Idee, daß der Naturalismus eine 49Spätform ist, der in allen Fällen eine archaisch-infantile Stufe vorausgeht, ist mit einem Schlage widerlegt. Ganz im Gegenteil – die frühen Stufen sind lebendiger und folgen einander in schnellem Wechsel (Lascaux), während spätere Formen zwar besser gemalt, aber statisch und leblos sind (Altamira). Überhaupt scheinen Konventionalismus und Schematisierung späte Phänomene zu sein, denen Perioden größerer Schaffenskraft vorausgehen. Das gilt für die Kunst wie auch für die Wissenschaft (von Neumann).[10]
Abb. 1: Mammut. Font-de-Gaume Phase D (Teilbild)
Zeichnung von Feyerabend nach: Burkitt, Miles Crawford (1963): The Old Stone Age. A Study of Palaeolithic Times, New York, S. 204.
Die paläolithische Kunst hat ein lange vorherrschendes (vom Fortschrittsglauben an die allmähliche, geradlinige geistige Entwicklung des Menschen vom urdummen »Primitiven« – einschließlich des zeitgenössischen »Naturmenschen« als dessen unzeitgemäßem Relikt – zum hochzivilisierten »Kulturmenschen« geprägtes) Bild vom Eiszeitmenschen gleich zweimal revolutioniert.[11] Erstens durch ihre gegen das En50de des 19. Jahrhunderts voll einsetzende Entdeckung und die offizielle Anerkennung ihres authentischen Charakters durch die Fachwelt anfangs unseres Jahrhunderts (mit dem durch die Entdeckung von Les Combarelles – bei Les Eyzies in der Dordogne – im Herbst 1901 von Abbé Breuil erzielten Durchbruch, auf den dessen schärfster Gegner, Émile Cartailhac, mit seinem berühmten Widerruf reagierte).[12] Zweitens durch die nach dem zweiten Weltkrieg mit Hilfe neuen Materials und neuer Methoden vor allem von Leroi-Gourhans Werk ausgehende Revolution in der Deutung der sogenannten prähistorischen Kunst. Außer Leroi-Gourhan und Marshack sind im Zusammenhang mit dieser Revolution insbesondere noch Annette Laming-Emperaire und Marie E.P. König zu nennen.[13]
Abb. 2: Hirsch. Magdalen, Periode 5 (Art mobilier)
Zeichnung von Feyerabend nach: Burkitt, Miles Crawford (1963): The Old Stone Age. A Study of Palaeolithic Times, New York, Titelbild.
51[3] Von der Naturkenntnis dieser Künstler können wir durch Analogie mit schriftlosen Stämmen der Gegenwart eine angenäherte Vorstellung erhalten. Ein einziger Informant der Gabon in Äquatorialafrika gibt den besuchenden Forschern 8000 botanische Ausdrücke. Das botanische Vokabular der Hanoo übersteigt die 2000, die Klassifikationen sind gelegentlich genauer und systematischer als die der westlichen Wissenschaft, die Kennzeichnung von Arten, Unterarten, Variationen objektiv genug, um eine Identifikation in fast allen Fällen zu ermöglichen. Mißverständnisse und Fehlschläge westlicher Forscher, die sich der eingeborenen Klassifikation bedienen, gehen auf mangelnde Kenntnis der Klassifikationsprinzipien sowie auf Eigenschaften zurück, die dem anders geschulten Auge des westlichen Beobachters nicht zugänglich sind: »[Mein Lehrer] konnte einfach nicht begreifen, daß nicht die Worte, sondern die Pflanzen selbst mir Schwierigkeiten machten«, schreibt Eleonore Smith Bowen (1954: 19) über ihren Versuch, das botanische Vokabular eines afrikanischen Stammes zu erlernen. »Die Coahuila-Indianer, die mehrere Tausend zählten und eine Wüstenregion Südkaliforniens bewohnten, wo sich heute einige Familien von Weißen nur mit Mühe erhalten, konnten die natürlichen Reichtümer des Landes kaum ausschöpfen; sie lebten im Überfluß. Denn in diesem dem Anschein nach armen Lande kannten sie nicht weniger als 60 nahrhafte Pflanzen und 28 weitere mit narkotischen, stimulierenden oder heilenden Eigenschaften« 52(Lévi-Strauss 1968: 15).[14] Die Maisfelder der Indianer von Guatemala sind strenger nach Typus ausgewählt als die ihrer spanisch sprechenden Nachbarn.
Sie waren genauso typenrein wie die preisgekrönten amerikanischen Maisfelder während der Mais-Show-Ära, als die amerikanischen Farmer noch großes Gewicht auf solche züchterischen Showpunkte wie Gleichförmigkeit legten. Diese Tatsache überrascht, wenn man an die große Variabilität des guatemaltekischen Maises im ganzen denkt sowie den Umstand in Betracht zieht, daß Mais so leicht zu Kreuzungen führt. Schon eine geringe Menge von Pollen, von einem Feld zum anderen geblasen, führt genügend Keimplasma für die Mischung ein. Nur die peinlichst genaue Auswahl des Saatgutes sowie die Ausmerzung aller atypischen Exemplare kann unter diesen Bedingungen die Art rein erhalten. Für Mexiko, Guatemala und den amerikanischen Südwesten zeigt aber die Erfahrung klar: Wo die alten indianischen Kulturen am vollständigsten überlebt haben, da weist auch der Mais innerhalb der Artenmannigfaltigkeit die geringste Variation auf. […] Offensichtlich ist es nicht wahr, […] daß sich die größten Variationen von Abarten bei den primitivsten Stämmen finden. Ganz im Gegenteil. Der Eindruck, daß Primitive sorglose Pflanzenzüchter sind, kommt vielmehr von Stämmen, die von Reisenden am häufigsten gesehen werden, von Eingeborenen also, die in der Nähe moderner Autobahnen und großer Städte wohnen und deren alte Kulturen dem Verfall am stärksten ausgesetzt sind (Anderson 1952: 219).
Wie wissenschaftliche Gesellschaften diskutieren die Stammeskonzilien der Guarani in Argentinien und Paraguay die zu verwendenden Begriffe und entscheiden, welche Kombination vorhandener Wortstämme der Natur einer neugefundenen Spezies wohl am besten entspricht.
53