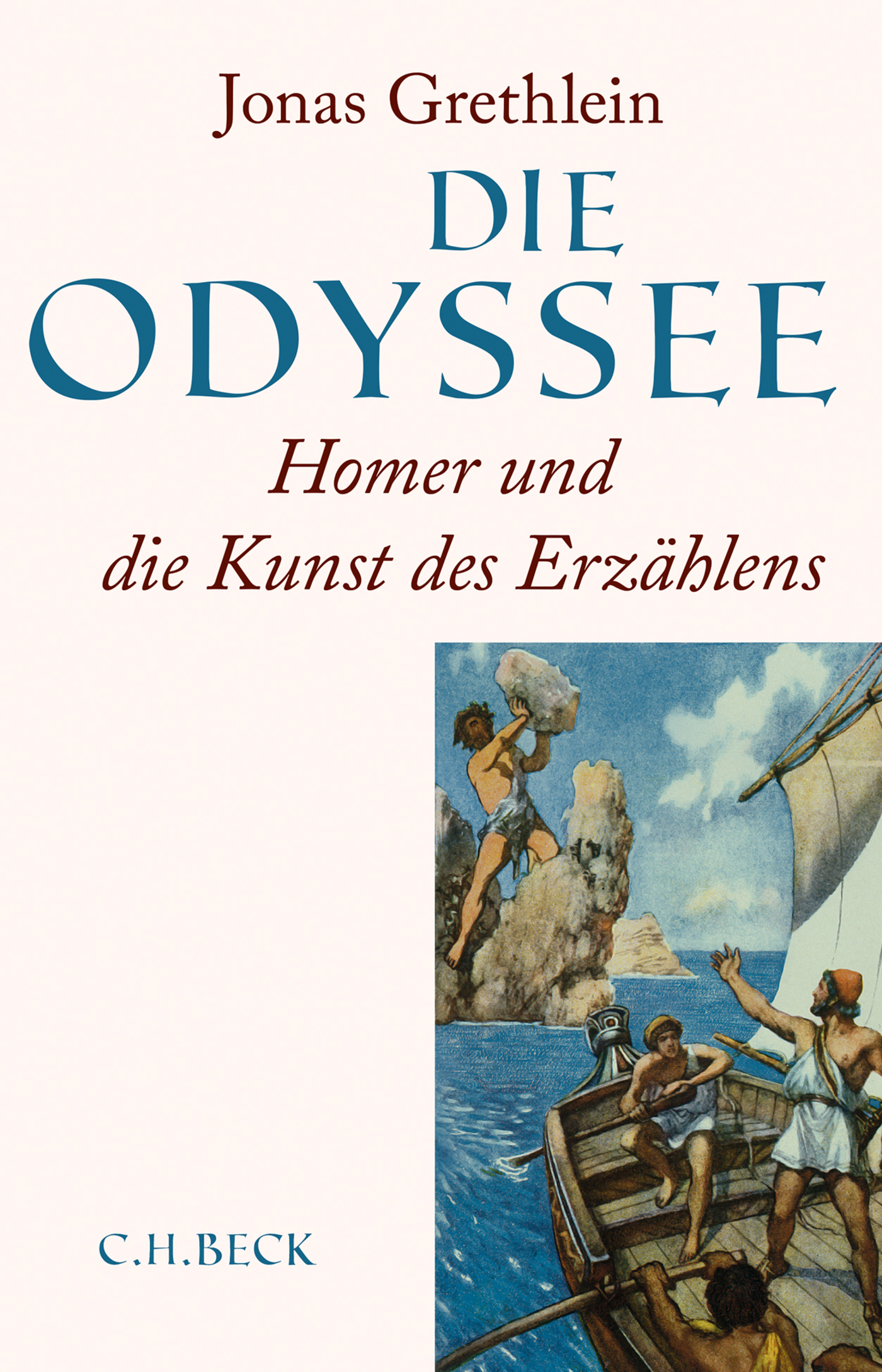21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die „Hoffnung“ ist ein Federding –/ Das in der Seele hockt –/ Und Lieder ohne Worte singt. Was die Dichterin Emily Dickinson in so anmutige Worte zu fassen verstand, berührt bis heute das Verhältnis eines jeden Menschen zu seinem eigenen Leben und zur Welt. Doch darf Hoffnung heute eigentlich noch als Quelle der Kraft gelten oder ist sie nicht vielmehr eine Flucht vor der Realität? Ist sie Tugend oder Torheit? Sollten wir die Hoffnung nicht besser sterben lassen und in unserer krisengeschüttelten Zeit endlich zu handeln beginnen? Ein Blick in 2500 Jahre Geschichte der Hoffnung erweist jedenfalls ihre überzeitliche Aktualität. Jonas Grethlein schreitet den Horizont der Hoffnung aus und lässt aus allen Epochen Philosophen und Religionsstifter, Märtyrerinnen und Literatinnen, Künstler, Opfer und Leidende zu Wort kommen, um den Menschen in seinem Bemühen verstehen zu lernen, eine ihm unverfügbare Zukunft zu bewältigen. So erhellt er das Wesen der Hoffnung, beschreibt, wie sie entstehen, worauf sie sich richten und worin sie gründen kann. Er legt ein menschenfreundliches Buch vor – geschrieben für all jene, die jeden Morgen aufstehen und in der stillen Annahme durchs Leben gehen, dass es sich irgendwie lohnen wird, weiter auf der Welt zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jonas Grethlein
Hoffnung
Eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
1: Hoffnung – ein Weltverhältnis
Quelle der Kraft oder Flucht vor der Realität?
Emotion, Tugend oder Haltung?
Weltverhältnis
Dimensionen des Hoffens
2: Die Büchse der Pandora: Von der frühgriechischen Dichtung zum römischen Kaiserkult
Das traurige Los der Gelehrten
Der Pandora-Mythos bei Hesiod
Frühgriechische Dichtung und attische Tragödie
Privatleben und Politik
Spes
: Hoffnung in Rom
3: Glaube, Hoffnung, Liebe: Die antiken Christen
Die Hoffnung der Märtyrer
Die Wurzeln des christlichen Hoffnungsbegriffs
Paulus: Die Hoffnung im Römerbrief
Augustinus: Von den
Selbstgesprächen
zum
Handbüchlein
Der Mond der Hoffnung
4: Endzeiterwartungen und irdisches Verlangen im Mittelalter
Hoffnung im Bild
Endzeiterwartungen
Thomas von Aquin: Hoffnung als Tugend und als Affekt
Nichteschatologische Hoffnung (I): Abaelards
Trostbrief für seinen Freund
Nichteschatologische Hoffnung (II): Minnesang
5: Aufklärerische Passionstheorien und Optimismus-Debatten
Aufklärungen
«Hoffnung auf bessere Zeiten» – Chiliasmus im Pietismus
Descartes’ Passionstheorie
Hobbes: Materialismus und Politische Theorie
Ein kritischer Reflex christlicher Hoffnung
Popes
Vom Menschen
Voltaires
Lissabon
-Gedicht und
Candide
6: Geschichte und Teleologie im 19. Jahrhundert
Säkularisierung der christlichen Hoffnung?
Die nationale Hoffnung
Das Reich der Freiheit
Kierkegaard: Hoffnung als «Widerschein des Ewigen in der Möglichkeit»
Schopenhauer und Nietzsche: Radikale Kritik der Hoffnung?
7: Im Schatten der Zivilisationsbrüche des 20. Jahrhunderts
Hoffnungslos am Kap der Guten Hoffnung
Absurdität und Negative Dialektik
Hoffnung im Konzentrationslager?
Die Bürgerrechtsbewegung in den
USA
Theologie der Hoffnung
8: Hoffen im Anthropozän?
Eine neue Epoche?
Gift oder Gegengift?
Christliche Spuren
Große Hoffnung – kleine Hoffnungen
Vogel und Ratte
Anmerkungen
1 | Hoffnung – ein Weltverhältnis
2 | Die Büchse der Pandora: Von der frühgriechischen Dichtung zum römischen Kaiserkult
3 | Glaube, Hoffnung, Liebe: Die antiken Christen
4 | Endzeiterwartungen und irdisches Verlangen im Mittelalter
5 | Aufklärerische Passionstheorien und Optimismus-Debatten
6 | Geschichte und Teleologie im 19. Jahrhundert
7 | Im Schatten der Zivilisationsbrüche des 20. Jahrhunderts
8 | Hoffen im Anthropozän?
Dank
Bibliographie
Bild- und Zitatnachweise
Namenregister
Register der geographischen Begriffe
Sachregister
Zum Buch
Vita
Impressum
Christian Grethlein zum 70. Geburtstag
1
Hoffnung – ein Weltverhältnis
Josephines Hand umklammert die Zwei-Euro-Münze, die sie gerade von ihrem Vater bekommen hat. Die Münze darf sie auf keinen Fall verlieren. Trotz des schönen Wetters nur eine kurze Schlange vor Carlos Eisdiele, sie wird nicht lange warten müssen. Soll sie Erdbeere oder Himbeere nehmen? Oder vielleicht doch lieber Schokolade? Auf jeden Fall in der Waffel, dann tropft das Eis zwar, aber das untere Ende der Waffel ist immer so herrlich knusprig. Beim letzten Mal war der alte Mann mit der Glatze und dem Schnauzbart da; er gab ihr eine besonders große Kugel, es waren schon fast zwei Kugeln. Ob er auch heute da ist und sie wieder eine so große Portion bekommt?
Zweihundert Meter weiter schiebt sich Christoph in einer farbenfrohen Menge durch die Fußgängerzone. Eigentlich müsste er jetzt im Proseminar sitzen und über Schillers Räuber diskutieren. Keine schlechte Lehrveranstaltung; Frau Dr. Baldung ist nett, sogar ziemlich witzig, und das «freie Leben» von Karl Moor spricht ihn auch persönlich an: «Der Wald ist unser Nachtquartier, bei Sturm und Wind hantieren wir, der Mond ist unsre Sonne …» Doch die Demonstration ist jetzt wichtiger, die Bilder der zerbombten Häuser in Charkiw haben ihn verstört. Die russischen Attacken müssen aufhören, so schnell wie möglich. Viel kann man nicht machen, aber es tut gut, gemeinsam mit anderen durch die Stadt zu marschieren und Schulter an Schulter gegen den Krieg zu demonstrieren.
Das Fußgetrappel, das Stimmengewirr und die vereinzelten Pfiffe dringen durch das hohe Fenster in das Zimmer von Ursula Schmidt. Was da wohl wieder los ist? Frau Schmidt versucht, den Kopf zu heben, aber auch das geht nicht mehr. Sie ist müde, zu müde, um die Schwester zu rufen und zu fragen. Morgen wird wieder der Priester Dolding kommen und ihr die Kommunion reichen. Bei seinem letzten Besuch las er ihr die Ostergeschichte aus dem Markusevangelium vor: «Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.» Bald wird alles vorüber sein, sie spürt es – wird sie dann ins Reich Gottes kommen?
Die drei Szenen sind erfunden, aber sie hätten sich so oder ähnlich im Sommer des letzten Jahres in Halle, Freiburg oder Göttingen zutragen können. Ein kleines Mädchen, vielleicht zum ersten Mal dabei, allein ein Eis zu kaufen – ein Student, der an einer Demonstration gegen den russischen Angriff auf die Ukraine teilnimmt – eine alte Frau an ihrem Lebensende, in einem Hospiz oder Krankenhaus: Die drei Figuren sind durch große Altersunterschiede voneinander getrennt, sie befinden sich in verschiedenen Lebenssituationen und werden von weit auseinanderliegenden Gedanken und Gefühlen bewegt. Und doch sind sie in einem vereint: Alle drei hoffen – Josephine auf eine besonders große Kugel Eis, Christoph auf Frieden in der Ukraine, Frau Schmidt auf das ewige Leben.
Abbildung 1 | Wappen von St. Andrews
Bereits in der Antike sah man im Hoffen etwas allgemein Menschliches. Gefragt, was die Menschen am stärksten verbinde, soll der griechische Philosoph Thales im 6. Jahrhundert v. Chr. geantwortet haben: «Die Hoffnung. Denn sie ist auch bei denen, die nichts anderes haben.»[1] Die Römer sagten: «Solange ich atme, hoffe ich.» Das Sprichwort, das heute dem US-amerikanischen Bundesstaat South Carolina als Motto dient und das Wappen der schottischen Stadt St. Andrews ziert, ist im lateinischen Original noch eindrücklicher: «dum spiro spero» – der Gleichklang lässt das Ohr die Liaison von Hoffen und Atmen hören. Goethe (1749–1832), eine unerschöpfliche Quelle von Lebensweisheiten, nennt die Hoffnung «das schönste Erbteil des Lebendigen, dessen sie sich nicht einmal, auch wenn sie wollte, entäußern könnten».[2] Ganz ähnlich konstatiert im 20. Jahrhundert der Philosoph Karl Jaspers (1883–1969): «Hoffnungslosigkeit ist wie der Tod des noch Lebendigen.»[3] In der Redewendung «guter Hoffnung sein» findet das Verwobensein der Hoffnung mit Leben einen alltagssprachlichen Ausdruck: Sie setzt Hoffnung nicht mit Leben in eins, sondern macht dieses zum Gegenstand des Hoffens, ohne es explizit nennen zu müssen.
Hoffnung scheint nicht nur «mit Leben verschwistert»,[4] sondern auch dem Menschen vorbehalten zu sein und – darum soll es in diesem Buch gehen – ihn in besonderer Weise zu charakterisieren. Lakonisch bemerkt Ludwig Wittgenstein (1889–1951): «Das Krokodil hofft nicht, der Mensch hofft.»[5] An anderer Stelle fragt er: «Man kann sich ein Tier zornig, furchtsam, traurig, freudig, erschrocken vorstellen. Aber hoffend? Und warum nicht?» Ein Hund wartet an der Tür auf seinen Herrn, «aber kann er auch glauben, sein Herr werde übermorgen kommen?»[6] Zu den vorsichtig tastenden Denkbewegungen in Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen ist kaum ein größerer Gegensatz denkbar als das messerscharfe Deduzieren des Scholastikers Thomas von Aquin (1225–1274), doch auch dieser stellt in der Summe der Theologie fest: «Es scheint, dass wilde Tiere keine Hoffnung haben.»[7]
Quelle der Kraft oder Flucht vor der Realität?
So tief Hoffnung im menschlichen Leben auch verankert ist, sie wird ganz verschieden bewertet. Hymnisch beginnt Gottfried August Bürger (1747–1794) sein Gedicht An die Hoffnung: «O beste holder Feen,/Mit liebevollem Sinn,/Vom Himmel ausersehen/Zur Menschentrösterin!»[8] Zum Trösten gesellt sich noch die Motivation als eine segensreiche Wirkung des Hoffens, wenn Goethe die «edle Treiberin, Trösterin Hoffnung»[9] anruft. Der Kraft, die Hoffnung zu geben vermag, kommt auch und gerade in den Krisen der Gegenwart ein großes Interesse zu. In seinem Essay Die Kraft der Hoffnung diagnostiziert der Jurist und Journalist Heribert Prantl, Populismus, Nationalismus und Terrorismus gefährdeten die Weltzuversicht vieler Menschen.[10] Umso wichtiger seien Hoffnungen, auch verrückte: «Es gibt Hoffnungen, die erscheinen verrückt; aber sie sind es nicht. Diese verrückten Hoffnungen sind nämlich oft gerade diejenigen Hoffnungen, die helfen, nicht verrückt zu werden.»[11] Der Philosoph Darrel Moellendorf preist das Hoffen als «ein Tonikum gegen Resignation und schwächende Angst» und empfiehlt, «eine hoffnungsvolle Politik» als «die beste Antwort auf die Probleme des Klimawandels».[12]
Abbildung 2 | George Frederic Watts, Hope, 1886 (Tate Britain)
Auch andere Philosophen und Politologen sehen in der Hoffnung eine wichtige Ressource im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe, doch nicht alle Umweltaktivisten teilen diese Sicht. Die Gruppe Extinction Rebellion stellt ihre Arbeit unter das Motto: «Die Hoffnung stirbt, das Handeln beginnt» («Hope dies – Action begins»).[13] Hoffnung, so der Vorwurf, hält von den Schritten ab, die notwendig sind, um die Menschheit zu retten. Diese Behauptung ist eng verbunden mit der Gleichsetzung von Hoffnungen mit Illusionen. Hoffnungen entsprängen einem Wunschdenken; wer sich ihnen hingebe, verschließe die Augen vor der Realität. Auf einem Bild von George Frederic Watts (1817–1904) sieht man die personifizierte Hoffnung, in sich gekrümmt, mit verbundenen Augen und in den Händen eine Leier mit nur noch einer Saite. Der griechische Dichter Pindar verurteilte im frühen 5. Jahrhundert v. Chr. den «unter den Menschen eitelsten Typ, der das Heimische verachtend Ausschau hält nach dem Fernen und mit unerfüllbaren Hoffnungen nach Vergeblichem jagt».[14] Der Hoffende ist in diesem Falle nicht blind, sondern blickt in weite Fernen, doch die Kritik ist die gleiche: Wer hofft, verweigert sich der Realität.
Die Zurückweisung von Hoffnungen als illusionär zieht sich von der Antike bis in die Gegenwart, sie ist ein wichtiger Strang der Religionskritik. Sigmund Freud (1856–1939) etwa schreibt über die Hoffnung des Menschen auf ein Leben nach dem Tod: «Was soll ihm die Vorspiegelung eines Großgrundbesitzes auf dem Mond, von dessen Ertrag noch nie jemand etwas gesehen hat? Als ehrlicher Kleinbauer auf dieser Erde wird er seine Scholle zu bearbeiten wissen, so dass sie ihn nährt. Dadurch, dass er seine Erwartungen vom Jenseits abzieht und alle freigewordenen Kräfte auf das irdische Leben konzentriert, wird er wahrscheinlich erreichen können, dass das Leben für alle erträglich wird und die Kultur keinen mehr unterdrückt.»[15]
Auch den antiken Stoikern war die Hoffnung suspekt. Sie sahen in ihr eine unnötige Erregung, die den Seelenfrieden gefährdet und dem Ideal der apatheia, der Freiheit von Leidenschaften, im Weg steht. Seneca (1–65 n. Chr.) führt in einem seiner Briefe an Lucilius aus, Hoffnung sei eng mit Furcht verbunden: «Der Hoffnung folgt Furcht. Und nicht wundere ich mich, dass das so geht: beides ist Eigenart einer schwankenden Seele, beides einer durch die Erwartung der Zukunft beunruhigten. Wichtigster Grund aber für beides ist, dass wir uns nicht mit der Gegenwart einrichten, sondern unsere Gedanken auf weit Entferntes vorausschicken.»[16] Statt sich im Hier und Jetzt auf das zu konzentrieren, was man selbst in der Hand hat, schweift der Hoffende mit seinen Gedanken in die ungewisse und nicht kontrollierbare Zukunft ab. Auch heute noch hat die stoische Position Anhänger. Wer auf Kreta in Heraklion zum Grab von Nikos Kazantzakis (1883–1957) pilgert, dem Autor von Alexis Sorbas, findet dort die Inschrift: «Ich hoffe nichts. Ich fürchte nichts. Ich bin frei.» Gibt es also doch ein Leben ohne Hoffnung? Ist es sogar so, dass wir erst frei und glücklich werden, wenn wir nicht mehr hoffen?
Emotion, Tugend oder Haltung?
Die Stoiker versuchten, sich das Hoffen auszutreiben, weil sie es als eine emotionale Regung auffassten. Besonders beliebt war das Verständnis von Hoffnung als Emotion in der Aufklärung: Descartes, Hobbes, Hume und Spinoza analysierten alle Hoffnung in ihren Passionstheorien. Auch in der Gegenwart gibt es vor allem Psychologen, die Hoffnung als eine Emotion betrachten, Maria Miceli und Cristiano Castelfranchi zum Beispiel als eine «antizipatorische Emotion»[17]. Nicht zuletzt Philosophen bestreiten hingegen, dass Hoffnung eine Emotion ist. Anders als Emotionen, wenden sie ein, erzeuge Hoffnung kein spezifisches Gefühl. Sie äußere sich auch nicht in einer bestimmten körperlichen Reaktion wie die Freude, die uns lachen, oder der Zorn, der unseren Puls steigen lässt.[18] Manche Hoffnungen mögen uns mit einem Gefühl erfüllen, aber, das zeigt die Kritik, als Emotion wäre Hoffnung unzureichend beschrieben. Während Josephines Hoffnung auf eine große Kugel Eis emotionalen Charakter hat, kann man die Hoffnung von Frau Schmidt auf ein Leben nach dem Tod nicht als Emotion beschreiben.
Eine alternative Klassifikation geht auf die Kirchenväter zurück und gewann große Bedeutung in der Scholastik: Hoffnung als Tugend. Thomas von Aquin zum Beispiel erörtert in seiner Summe der Theologie Hoffnung einmal als passio, als Emotion, und einmal als virtus, als Tugend. Zusammen mit Liebe und Glaube bildet Hoffnung die Trias der theologischen Tugenden; auf ihnen bauen dann die Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung auf. Auch wenn die christliche Tugendlehre heute außerhalb von Kirche und Theologie der Bedeutungslosigkeit anheimgefallen ist, preisen einzelne Autoren Hoffnung als eine «intellektuelle», «bürgerliche», «demokratische» oder «politische Tugend».[19] Ihre Analysen zeigen, welchen Beitrag Hoffnungen zum Funktionieren eines Gemeinwesens leisten können. Hoffnungen spornen Bürger an, sie helfen in Krisen und erzeugen ein Gemeinschaftsgefühl. Doch geht es hier um bestimmte Formen des Hoffens – wenn Christoph neben Germanistik auch Philosophie und Politologie studierte, sähe er seine Hoffnung auf Frieden vielleicht als eine politische Tugend. Das Beispiel destruktiver Hoffnungen weckt jedoch Zweifel daran, dass sich Hoffnung im Allgemeinen als Tugend klassifizieren lässt. Auch Terroristen hoffen, dass ihre Anschläge gelingen und viele Menschen in den Tod reißen …
Ist Hoffnung stattdessen eine Haltung?[20] Ist sie eine Disposition, die sich durch Übung erwerben lässt und dann unser Handeln prägt? Derartig bestimmt, wäre Hoffnung moralisch nicht so aufgeladen wie als Tugend. In der Tat kann man eine hoffnungsvolle Haltung kultivieren und sich darum bemühen, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken und weniger Gefahren als Möglichkeiten zu sehen. Aber auch damit würden wir das Phänomen des Hoffens auf eine seiner Erscheinungsformen verkürzen. Josephines Hoffen auf ein großes Eis dürfte nicht Ausdruck einer besonderen Haltung sein. Auch nicht erfasst wäre die Hoffnung, die plötzlich in der Not aufkeimt. Im Hoffnungsfunken und Hoffnungsschimmer ist sprachlich ausgedrückt, dass Hoffnung etwas anderes als ein Habitus sein kann. Emotion, Tugend und Haltung – so lassen sich einzelne Formen der Hoffnung, aber nicht die Hoffnung als Ganze beschreiben. Um die Bedeutung des Hoffens und seine vielfältigen Erscheinungsformen zu erfassen, müssen wir tiefer ansetzen: Hoffnung ist ein Weltverhältnis. Wer hofft, verhält sich zur Welt in einer bestimmten Weise – wie, das soll im Folgenden beschrieben werden.
Weltverhältnis
Denker wie Donna Haraway, Philippe Descola und Bruno Latour haben zuletzt die subjekttheoretischen Annahmen der westlichen Philosophie in Frage gestellt.[21] Menschen stehen nicht als Subjekte Objekten in der Welt gegenüber, sie sind vielmehr Teil der Welt und mit Dingen vielfältig verstrickt. Statt souverän über Dinge zu verfügen, sind Menschen selbst in hohem Maße durch ihren Umgang mit Dingen bestimmt. Anschaulich wird diese Feststellung, wenn man den Platz von Smartphones in unserem Leben betrachtet: Die Wetterapps bestimmen, was wir anziehen, die Algorithmen der Musikplattformen, welche Musik wir hören, und die der Datingapps, wen wir kennen- und vielleicht lieben lernen. Aber auch wenn man Menschen nicht mehr als Subjekte im herkömmlichen Sinne ansieht, lässt sich schwer leugnen, dass sie ein besonderes Verhältnis zur Welt haben – ein Verhältnis, das sich von dem von Tieren, Pflanzen und Dingen unterscheidet.
Der Mensch ist, so hat es Nietzsche (1844–1900) auf den Begriff gebracht, «das noch nicht festgestellte Tier»[22]. Was das bedeutet, buchstabiert zum Beispiel Helmuth Plessners (1892–1985) philosophische Anthropologie aus. Sie hat den Vorzug, dass sie den Menschen sowohl als eine Form des Lebens betrachtet als auch deren Besonderheit zu beschreiben versucht.[23] Nach Plessner ist «das Mensch genannte Ding» charakterisiert durch seine «exzentrische Positionalität»; es setzt sich von anderen Lebewesen dadurch ab, dass es in der Lage ist, «sich von sich zu distanzieren, zwischen sich und seine Erlebnisse eine Kluft zu setzen. Dann ist es diesseits und jenseits der Kluft, gebunden im Körper, gebunden in der Seele und zugleich nirgends, ortlos außer aller Bindung von Raum und Zeit und so ist es Mensch.»[24]
Plessner bemerkt auch, dass der Mensch anders als das Tier sich vorweg ist und sich in die Zukunft entwirft, aber die zeitliche Offenheit des Menschen hat in seiner Anthropologie keinen hohen Stellenwert.[25] Zentral ist die Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft hingegen in einem anderen Klassiker der Philosophiegeschichte, der nur ein Jahr vor Plessners Hauptwerk Die Stufen des Organischen erschien: Sein und Zeit (1927). Heidegger legt zwar ausdrücklich keine Anthropologie vor; sein Interesse gilt dem Sein, dem er sich über die Zeitlichkeit des Daseins nähert. Doch die anthropomorphen Begriffe, mit denen Heidegger das Dasein beschreibt, machen es schwer, in Sein und Zeit nicht auch eine Analyse der menschlichen Existenz zu sehen. Für den Meister des gefährlichen Denkens ist die Sorge die Grundstruktur des Daseins; als ein «Sich-vorweg-Sein»[26] ist sie die Ex-istenzialität, das «Aus-sich-Herausstehen» des Daseins. Dementsprechend privilegiert Heidegger auch die Zukunft als «das primäre Phänomen der ursprünglichen und eigentlichen Zeitlichkeit»[27]. Heideggers Existenz ist keineswegs Plessners exzentrische Positionalität, aber die Vorsilbe ex- markiert, dass sich das zeitliche Gewordensein als ein Ausdruck der menschlichen Distanz von sich selbst verstehen lässt.
Die Sorge in Sein und Zeit ist ein Kunstbegriff und nicht die Sorge, die uns im Alltag plagt.[28] Aber das «Sein zum Tode» als die «ursprünglichste Konkretion»[29] der Sorge verdeutlicht doch den düsteren Charakter, die tragische Dimension von Heideggers Existentialismus. Nur in der «Zeitlichkeit des Verfallens» locken die Möglichkeiten der Zukunft; «eigentlich» ist der Tod der Zielpunkt, den es «entschlossen» zu erfassen gilt. Hier setzt der Philosoph und Pädagoge Otto Friedrich Bollnow an und stellt die Hoffnung nicht nur neben die Sorge, sondern erklärt sie für «noch ursprünglicher als die Sorge»[30]. Die Entschlossenheit der Sorge sei erst im Horizont der Hoffnung möglich. Für Bollnow ist die Hoffnung «das tragende Verhältnis, das über die Gegenwart hinaus das Verhältnis zum Seinsgrund bestimmt», ja, sie ist «die Bedingung der Möglichkeit alles menschlichen Lebens»[31].
Um diese Behauptung zu unterfüttern, nimmt Bollnow eine Unterscheidung vor, die auch andere vor und nach ihm getroffen haben: zwischen einzelnen Hoffnungen, die ein klar definiertes Ziel haben, und einer inhaltlich unbestimmten Hoffnung, einer Erwartung, dass es weitergeht, dass die Zukunft etwas Gutes für uns bereithält, was auch immer es ist.[32] Da diese Grundhoffnung kein spezifisches Ziel hat, aber das Leben als Ganzes grundiert, bietet sich ein adverbialer Ausdruck für sie an: Man lebt hoffnungsvoll. Nun mag der hoffnungsvolle Blick in die Zukunft stärker oder schwächer sein, er kann auch durch Ängste und Sorgen getrübt werden, aber er begleitet uns doch durch das Leben. Dass wir morgens immer wieder aufs Neue aufstehen und uns in den Tag begeben und auch dass wir abends im Vertrauen darauf einschlafen, wieder aufzuwachen, ist der stillen Annahme geschuldet, dass es sich irgendwie lohnen wird, weiter auf der Welt zu sein. Nun gibt es in der Gegenwart wie in der Vergangenheit viele Menschen, die leiden und nur wenig oder gar keine Aussicht auf ein besseres Leben haben. Aber auch und gerade unter fürchterlichen Lebensbedingungen scheint den Menschen die Möglichkeit einer irgendwie guten Zukunft zu tragen. Diese Grundhoffnung ist das Fundament, auf dem spezifische Hoffnungen entstehen; umgekehrt gewinnt die allgemeine Erwartung einer guten Zukunft in den Hoffnungen auf bestimmte Dinge eine konkrete Gestalt.
Manchmal kommt aber auch die Grundhoffnung als solche zum Vorschein. Wichtige Anregungen für seine Theorie verdankt Bollnow dem Mediziner Herbert Plügge (1906–1972), der, philosophisch gebildet und anthropologisch interessiert, über seine Erfahrungen in der Klinik in einem geisteswissenschaftlichen Horizont reflektierte. Plügge beobachtete, dass auch unheilbar erkrankte Patienten von einer allgemeinen Hoffnung erfüllt waren, ja dass gerade der Verlust der Hoffnung auf Genesung bei ihnen eine «fundamentale Hoffnung» hervortreten ließ.[33] Bei Suizidanten wiederum konnte Plügge weniger konkrete Gründe als eine allgemeine Störung im Verhältnis zur Welt feststellen; diese Störung identifizierte er als Hoffnungslosigkeit.[34] In jüngeren Studien wird auch Depression mit Hoffnungslosigkeit verbunden und das erneute Schöpfen von Hoffnung zu einem Therapieziel erklärt.[35]
Eine bemerkenswerte Manifestation der Grundhoffnung hat der Philosoph Jonathan Lear aufgearbeitet.[36] Das Volk der Crow verlor im 19. Jahrhundert mit den Büffeln und Jagdgebieten nicht nur seinen traditionellen Lebensunterhalt, sondern auch die Grundlagen seiner Kultur. Die Einweisung der Crow ins Reservat, stellt Lear fest, bedeutete ihre «kulturelle Zerstörung». Doch ihrem letzten Häuptling, Plenty Coups, sei es gelungen, der Entwurzelung seines Volks mit «radikaler Hoffnung» zu begegnen. Nach dem Untergang der traditionellen Stammeskultur hätten Plenty Coups die Koordinaten gefehlt, um spezifische Erwartungen an die Zukunft zu richten, aber die zuversichtliche Erwartung, dass es irgendwie weitergehen werde, «eine Hoffnung auf Wiedererweckung»[37] habe ihm und seinem Volk Kraft gegeben. Die «fundamentale Hoffnung» der Todkranken, die «radikale Hoffnung» von Plenty Coups ist die Grundhoffnung, die bleibt, wenn sich keine bestimmten Hoffnungen mehr formulieren lassen.
Ob Hoffnung ursprünglicher als Sorge ist, sei dahingestellt. Aber wie diese ist sie ein in der zeitlichen Offenheit des Menschen begründetes Weltverhältnis. «Nicht-festgestellt» entwerfen wir uns in die Zukunft, den Blick ebenso auf Wünschenswertes wie Ängstigendes gerichtet: «Das Eigentliche ist im Menschen wie in der Welt ausstehend, wartend, steht in der Furcht, vereitelt zu werden, steht in der Hoffnung, zu gelingen.»[38] Die tiefe Verankerung der Hoffnung im menschlichen Leben ist auch in der Entwicklungspsychologie von Erik Erikson (1902–1994) greifbar. In seinem Modell der psychosozialen Entwicklung siedelt Erikson Hoffnung gleich auf der ersten Stufe an. Im ersten Lebensjahr erlebt das Baby die Krise des Vertrauens; es ist seiner Umwelt ausgeliefert und ganz von seiner Mutter abhängig. Nur wenn sich diese als verlässlich erweist, kann das Baby ein Urvertrauen entwickeln, das Fundament für Hoffnung, «sowohl die früheste wie die unentbehrlichste Tugend, die im Zustand des Lebendigseins inhärent ist».[39]
Dimensionen des Hoffens
Auf dem Grund des allgemeinen Vertrauens, dass es irgendwie gut weitergeht, entstehen konkrete Hoffnungen. Wie verschieden diese Hoffnungen sein können, haben wir bereits an Josephine, Christoph und Frau Schmidt gesehen. Vieles kann zum Gegenstand des Hoffens werden – das Bestehen einer Klausur morgen, schönes Wetter am Geburtstag, ein Abklingen der Zahnschmerzen, der Gewinn im Lotto, das baldige Ende eines Kriegs, eine gerechtere Gesellschaft, ein Leben nach dem Tod. Die Beispiele illustrieren auch, dass Hoffnungen verschieden weit reichen können – sie können sich auf unmittelbar Bevorstehendes, die nähere, aber auch die fernere Zukunft beziehen, ja sogar über das Leben hinaus aufs Jenseits zielen. Das Französische hat sogar zwei Wörter, um das weite Feld der Hoffnung abzudecken. Espoir ist in der Alltagssprache gebräuchlicher, das gehobene espérance bezeichnet vor allem auch spirituelle Hoffnungen. Wenn französische Theologen über die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten räsonieren, sprechen sie von espérance, nicht espoir. Wird Jonathan Lears Buch über Plenty Coups einmal ins Französische übersetzt, so wird wohl «espérance radicale» den Begriff «radical hope» wiedergeben.
An der Verankerung des Hoffens in unserer Offenheit zur Zukunft ändern auch Beispiele nichts, in denen die Hoffnung auf Vergangenes zu zielen scheint. Man kann zum Beispiel sagen: «Ich hoffe, sie ist gut angekommen», obgleich die Ankunft bereits in der Vergangenheit liegt. Aber auch in diesem Beispiel hat die Hoffnung ihren zukünftigen Charakter, denn für mich ist noch offen, ob mein Gast angekommen ist oder nicht.[40] Wenn ich am nächsten Morgen frage: «Ich hoffe, du hast gut geschlafen?», weiß ich noch nicht, ob mein Gast eine angenehme Nacht hatte, hoffe es aber gleich zu erfahren. Die Zukunftsorientierung der Hoffnung spiegelt sich im lateinischen Verb sperare, von dem neben dem französischen espérer auch das italienische sperare, das spanische esperar und das portugiesische esparar abgeleitet sind – sperare wird in der Regel mit einem Infinitiv Futur konstruiert. Auch die traditionellen Definitionen in der Antike und dem Mittelalter beschränken das Hoffen auf Zukünftiges.[41]
Nicht alles Zukünftige kann jedoch zum Gegenstand der Hoffnung werden. Das Erhoffte muss möglich sein, dadurch unterscheidet es sich vom Gewünschten. Wünschen kann man sich alles Mögliche, dass man einen Kopf größer ist, dass man in diesem Jahr den Friedensnobelpreis gewinnt, sogar dass das Deutsche Reich nicht den Zweiten Weltkrieg vom Zaun gebrochen hat, erhoffen aber nur das, was auch möglich ist. Nimmt man den Begriff der Utopie wörtlich, als einen Nicht-Ort, dann kann man sich eine Utopie nur wünschen. Verstanden als eine mögliche zukünftige Gesellschaftsordnung, kann eine Utopie jedoch auch zum Gegenstand des Hoffens werden.
Aber wenn man die Utopie selbst realisieren kann, braucht man nicht auf sie zu hoffen. Die Ziele der Hoffnung zeichnen sich nämlich durch ihre Unverfügbarkeit aus. Gerade weil wir etwas nicht aus eigener Kraft erreichen können, hoffen wir. Die Portionierung des Eis, um ein bescheideneres Beispiel zu nehmen, liegt ebenso wenig in Josephines Macht wie das Kriegsende in Christophs und die Auferstehung von den Toten in der von Frau Schmidt. Mit der Unverfügbarkeit verknüpft ist die Unsicherheit, die den Hoffenden vom Optimisten unterscheidet.[42] Der Optimist blickt voller Zuversicht in die Zukunft – es wird sich alles zum Guten wenden. Der Hoffende nimmt zwar auch zukünftiges Gutes in den Blick, doch dieses ist nur möglich, nicht notwendigerweise wahrscheinlich. Was nicht in der eigenen Hand liegt, ist ungewiss (wir werden in der christlichen Hoffnung einer interessanten Einschränkung dieser Feststellung begegnen). In Ernst Blochs (1885–1977) Worten: «Hoffnung hat eo ipso das Prekäre der Vereitlung in sich: sie ist keine Zuversicht.»[43]
Unverfügbarkeit ist wesentlich für das Erhoffte, sie kommt zum Tragen beispielsweise in der Kritik an der Lebenskunstphilosophie.[44] Mit dem Konzept der Lebenskunst haben Wilhelm Schmid und andere ein breites Publikum erreicht: Wir können – dies ist vereinfacht ihr Versprechen – unser Leben wie ein Kunstwerk gestalten, wir sind, wenn wir an uns arbeiten, die Autoren unseres Schicksals. Gegen diese Ästhetisierung der Existenz wendet die Philosophin Christiane Borchel ein, dass sie die Selbstmächtigkeit des Menschen über- und seine Abhängigkeiten unterschätzt. Als einen Kontrapunkt zur Lebenskunstphilosophie setzt Borchel die Hoffnung, sie lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das der Verfügbarkeit Entzogene und beleuchtet damit die Blindstelle der Lebenskunstphilosophie.
Wie bei der Zukünftigkeit ist auch hier die Perspektive des Hoffenden entscheidend. Es geht nicht um objektiv Mögliches und Unverfügbares, sondern um etwas, das dem Hoffenden möglich und unverfügbar erscheint. Hält man es für möglich, zum Mars zu fliegen, kann man darauf hoffen; wer es für ausgeschlossen hält, kann es sich nur wünschen. Dieser Subjektivität trägt bereits Aristoteles (384–322 v. Chr.) Rechnung, wenn er Junge und Betrunkene als Gruppen nennt, die leichter und schneller als andere hoffen.[45] Im Rausch wie in der Jugend erscheint manches möglich, das man nüchtern oder im fortgeschrittenen Alter nicht in Erwägung zu ziehen wagte. Mit der Einschätzung der Möglichkeit und Unverfügbarkeit stoßen wir auf die kognitive Dimension, die das Hoffen neben seiner affektiven Dimension hat. Wir verlangen nicht nur nach dem Erhofften und empfinden Freude beim Gedanken daran, sondern wir taxieren auch dessen Erlangbarkeit. Hoffnung gründet auf dem Urteil, dass uns etwas unverfügbar, aber möglich ist.
Die kognitive Dimension zeigt sich des Weiteren im «Gut», das wir erhoffen; auch dabei liegt der Hoffnung ein Urteil zugrunde. Wir erkennen etwas als gut und hoffen deswegen darauf. Für die Stoiker liegt darin der wesentliche Unterschied zum Fürchten: Wer sich fürchtet, antizipiert ein zukünftiges Übel, wer hofft, ein zukünftiges Gut. Zuletzt hat der Religionsphilosoph Ingolf Dalferth diesen Aspekt ins Zentrum seiner Hoffnungstheorie gerückt.[46] Für ihn ist Hoffnung unser «Sinn für die Gabe der Möglichkeit des Guten» und damit vor allem ethisch bestimmt. Aber auch das «Gut» ist subjektiv – wir können hoffen, dass das Finanzamt unsere Tricksereien nicht bemerkt, dass sich unsere Bekannte nicht mehr an das Buch erinnert, das sie uns geliehen hat, ja, dass sich unser Gegner verletzt. Neben ethisch fragwürdigen Hoffnungen gibt es auch solche ohne ethischen Gehalt, etwa die auf Sonnenschein oder darauf, dass der Eisverkäufer mir wieder eine besonders große Kugel gibt.
Auf manche Ziele hofft man auch, ohne dass sie gut für einen sind. Derartige Hoffnungen stellt die amerikanische Kulturtheoretikerin Lauren Berlant (1957–2021) ins Zentrum ihrer beißenden Kapitalismuskritik – Hoffnungen wie die auf sozialen Aufstieg führen keineswegs zur eigentlich gesuchten Erfüllung, sondern stützen letzten Endes ein menschenfeindliches System.[47] Keine Frage, man kann das erhoffte «Gut» ethisch aufladen und als objektiv Gutes verstehen. Das tun die modernen Tugendtheorien ebenso wie die christliche Hoffnungslehre. Dabei blendet man aber viele Formen der Hoffnung aus, Hoffnungen, die ethisch neutral oder problematisch oder sogar schädlich für den Hoffenden selbst sind. Man entwirft dann keine Phänomenologie des Hoffens, sondern reflektiert über Hoffnung im Rahmen einer Ethik.
Beim Kirchenvater Augustinus (354–430) finden wir eine scharfe Beobachtung: «Die Hoffnung aber gilt nur Gutem und nur Zukünftigem, und zwar nur solchen Gütern, die den angehen, der die Hoffnung auf sie hegt.»[48] Man hofft nur auf etwas, das einen auch selbst betrifft. Im Einklang mit Augustinus stellt Papst Benedikt XVI. (1927–2022) in seiner Enzyklika Auf Hoffnung hin gerettet fest: «Und sosehr zur großen Hoffnung das ‹Für alle› gehört, weil ich nicht gegen die anderen und nicht ohne sie glücklich werden kann, so ist umgekehrt eine Hoffnung, die mich selber nicht betrifft, auch keine wirkliche Hoffnung.»[49] Auch hier zeigt sich der subjektive Charakter des Hoffens – wie bei der Zukünftigkeit und der Einschätzung der Möglichkeit und Unverfügbarkeit ist die Perspektive des Hoffenden entscheidend. Deswegen definieren die Stoiker Hoffnung auch als eine zukunftsbezogene Freude – man freut sich, weil man etwas Gutes für sich selbst erwartet.
Philosophen schreiben dem Hoffen neben der affektiven und kognitiven oft auch noch eine «konative» Dimension, die Dimension des Versuchens, zu:[50] Wer hofft, strebt auch nach dem zukünftigen Gut, er wird selbst aktiv, um es zu erlangen. Dieser Aspekt des Hoffens steht im Mittelpunkt vieler psychologischer Theorien, die in Hoffnung einen menschlichen Adaptationsmechanismus sehen. Für Charles Richard Snyder setzt sich zum Beispiel Hoffnung aus zwei Komponenten zusammen, aus der Entschlossenheit, sich auf ein Ziel zuzubewegen («agency»), und der Erwartung, dass es Wege gibt, dieses Ziel zu erreichen («pathways»). Snyder entwickelte sogar eine Hoffnungsskala, mit der sich die Intensität von Hoffnungen messen lässt. Diese Skala liegt zahlreichen Studien zugrunde, viele von ihnen haben als Ergebnis, dass Hoffnungen die Erfolgsaussichten in Schule, Sport und anderen Feldern erhöhen.[51]
Aber so wie Freud die religiöse «Vorspiegelung eines Großgrundbesitzes auf dem Mond» anprangert, sehen auch andere Kritiker in Hoffnungen vor allem Vertröstungen. Wer hofft, beklagen sie, wird nicht selbst tätig, er wartet einfach darauf, dass sich das Gute irgendwann von selbst einstellt. Die Psychologen Maria Miceli und Cristiano Castelfranchi sprechen von einer passiven Hoffnung, einer Hoffnung, welche die Motivation beeinträchtigt.[52] Bereits der Volksmund weiß: «Hoffen und harren macht manchen zum Narren.» Nach Benjamin Franklin wird, wer sein Leben auf Hoffnung ausrichtet, sogar fastend sterben.[53] Hoffen kann offensichtlich auch pazifizierend sein, es kann Menschen stillstellen. Um die vertröstende ebenso wie die antreibende Wirkung der Hoffnung zu erfassen, spreche ich neutral von ihrer pragmatischen, ihrer handlungsbezogenen Dimension.
Wie facettenreich Hoffnung ist, zeigt sich nicht zuletzt in ihren Gegensätzen. Die Stoiker und viele nach ihnen betrachten die Furcht als das Gegenteil von Hoffnung.[54] Auch für den Unterschied, den Kierkegaard und Heidegger zwischen Furcht und Angst sehen, bietet Hoffnung eine Entsprechung. Der Furcht, die auf eine bestimmte Gefahr gerichtet ist, steht die konkrete Hoffnung, der Angst als allgemeiner Stimmung die Grundhoffnung gegenüber. Doch wird Hoffnung Angst und Furcht keineswegs immer entgegengesetzt. Hugo von Hofmannsthal zum Beispiel stellt fest: Die Furcht «zeigt nicht immer ihre magern Pantherarme. Sie nimmt eine Maske vor und verstellt ihre Stimme. Dann heißt sie Hoffnung.»[55] Wer in Hoffnung nicht eine Emotion, sondern eine Tugend sieht, nennt in der Regel die Verzweiflung als ihr Gegenteil.[56] Als Haltung betrachtet, ist Hoffnung auch der Vermessenheit entgegengestellt worden.[57] Ernst Bloch wiederum bemerkt, als «Richtungsakt kognitiver Art»[58] bilde sie ein Paar mit der Erinnerung: So wie die Erinnerung der Vergangenheit wendet sich die Hoffnung der Zukunft zu. Für Bollnow schließlich ist der Gegensatz zur Hoffnung die «Hoffnungslosigkeit im Sinne der stumpfen Teilnahmslosigkeit».[59]
Die kognitive Dimension des Hoffens wirft die Frage auf: Ist Hoffnung an Sprache gebunden? Dies ist Wittgensteins These. Auf die Frage, warum Tiere nicht hoffen können, folgt in den Philosophischen Untersuchungen die Überlegung: «Kann nur hoffen, wer sprechen kann? Nur der, der die Verwendung einer Sprache beherrscht. D. h., die Erscheinungen des Hoffens sind Modifikationen dieser komplizierten Lebensform.»[60] Sprache ist ein wichtiges Mittel, um sich vom Hier und Jetzt zu lösen, aber ist sie notwendig für Hoffnung? Nein, legt zumindest Emily Dickinsons (1830–1886) poetische Umschreibung der Hoffnung nahe: «Die ‹Hoffnung› ist ein Federding –/Das in der Seele hockt –/Und Lieder ohne Worte singt.»[61] In der Tat ist es fraglich, ob Hoffnung des sprachlichen Ausdrucks bedarf.[62] Bewegen uns nicht oft Hoffnungen, die, ohne dass wir sie benennen, manchmal vielleicht gar nicht benennen können, in unseren Gedanken umherschwirren und vage Gefühle auslösen? Ist nicht gerade die Grundhoffnung etwas, das sich in seiner Ziel- und Gegenstandslosigkeit dem sprachlichen Ausdruck im Alltag entzieht?
In diesem Buch wird Hoffnung als ein in der Zukunftsoffenheit des Menschen begründetes Weltverhältnis, aber nicht als anthropologische Konstante untersucht. Hoffnung hat in verschiedenen Kulturen und Epochen viele unterschiedliche Formen; diese sollen in den folgenden Kapiteln besichtigt, es soll eine Geschichte der Hoffnung als Weltverhältnis skizziert werden. Wenn das Panorama auf die westliche Geschichte beschränkt ist, dann keineswegs, weil nur in westlichen Kulturen gehofft wird. Bereits 1971 hat der Sinologe Wolfgang Bauer «die Hoffnung auf Glück» in der chinesischen Geschichte und Gegenwart nachgewiesen; zuletzt hat der Philosoph Xu Wang versucht, die Bedeutung des Hoffens im Konfuzianismus aufzuzeigen.[63] Jonathan Lear hat eindrücklich die «radikale Hoffnung» der Crow, der Ethnologe Hirokazu Miyazaki die «Methode der Hoffnung» auf den Fidschi-Inseln beschrieben.[64] Aber in der westlichen Welt gibt es eine eigene Tradition des Hoffens. Vor allem der christliche Hoffnungsbegriff mit seinen jüdischen Wurzeln, aber auch die Kritik an der Hoffnung als Illusion in der paganen Antike haben nicht nur das Mittelalter und die Frühe Neuzeit geprägt. Sie sind nach etlichen Metamorphosen und in verschiedenen Rekonfigurationen auch heute noch präsent. Allein diese Tradition nachzuzeichnen, mit ihren Linien und Brüchen, ist ein gewagtes Unterfangen, bereits bei dieser Beschränkung sind Unter- und Überbelichtungen ebenso wie Lücken unvermeidlich, aber vielleicht auch verzeihlich.
In den folgenden Kapiteln kommen neben theoretischen gleichberechtigt auch literarische Texte zur Sprache. So stehen Gedichte und Romane philosophischen, theologischen und psychologischen Abhandlungen in ihrer Reflexivität nicht notwendigerweise nach, sie wiegen die geringere begriffliche Schärfe oft mit genauer Beobachtung und formaler Verdichtung auf. Auch pragmatische Texte wie Reden und Pamphlete werden sich als aufschlussreiche Zeugnisse erweisen, durch sie können wir auch Eindrücke von der Bedeutung des Hoffens im Alltag der Menschen vergangener Epochen gewinnen. Zusammen mit dem Römerbrief, Joachim von Fiores Chiliasmus und Kants Frage «Was darf ich hoffen» werden unbekannte oder in diesem Kontext überraschende Texte erörtert werden, darunter Grabepigramme, Minnelieder und Parteiprogramme. Doch auch nichtsprachliche Manifestationen von und Reflexionen über Hoffnung haben ihren Platz auf den folgenden Seiten. Oft sind es Bilder, die uns Hoffnungen eindrücklich vor Augen führen, seien es Altar- oder Titelbilder von Zeitschriften.
Hoffnung hat in der Polykrise der Gegenwart Hochkonjunktur. Die nur oberflächlich gelöste Finanzkrise und das schwelende Risiko einer wirtschaftlichen Rezession, die Corona-Pandemie und die erheblichen Einschränkungen der Freiheitsrechte zu ihrer Bekämpfung, der Angriff Russlands auf die Ukraine und der Krieg in Europa, die Auseinandersetzungen im Nahen Osten, die Flüchtlingsströme und das Erstarken populistischer Parteien, sie verunsichern viele Menschen zutiefst. Vor allem aber hängt der Klimawandel wie eine dunkle Wolke über der Gegenwart. Sollen wir, können wir in dieser Situation hoffen? Geben Hoffnungen Kraft, oder sind sie eine Flucht vor der Realität? Ist es schon zu spät zum Hoffen? Und wenn wir es doch tun, worauf richten sich, worin sind unsere Hoffnungen begründet? Diese Fragen sollen im letzten Kapitel gestellt, davor soll die Geschichte der Hoffnung als ein Weltverhältnis erzählt werden. Der Blick in die Vergangenheit, so die Hoffnung dieses Buches, kann auch unser Verhältnis zur Zukunft erhellen.
2
Die Büchse der Pandora: Von der frühgriechischen Dichtung zum römischen Kaiserkult
Das traurige Los der Gelehrten
Auf einem Hügel residiert Reichtum. Man kann von unten die vergoldeten Säulen seines Palastes sehen, doch der Weg nach oben ist steil und schlüpfrig. Der Liebhaber des Reichtums nimmt den Aufstieg trotzdem auf sich und wird von einer Frau mit hübschem Gesicht und in buntem Kleid willkommen geheißen. Die Frau führt ihn, auf dem weiteren Weg begegnen sie anderen Frauen: dem Betrug, der Knechtschaft und der Plackerei. Nachdem Letztere ihn eine Weile traktiert hat – der Liebhaber des Reichtums ist schon krank und grau –, übergibt ihn seine Führerin dem Alter. Schließlich packt die Gewalt den Liebhaber des Reichtums und treibt ihn in die Arme der Verzweiflung. In diesem Augenblick fliegt seine Führerin davon, und er selbst wird durch einen versteckten Hinterausgang geworfen, jetzt «ein nackter, fettleibiger, blässlicher Greis, der mit der einen Hand seine Scham bedeckt, während er sich mit der Rechten selbst an die Gurgel geht. Bei seinem Abgang begegnet ihm Reue, ohne Nutzen weinend und den Armen noch mehr vernichtend.»[1]
Diese Geschichte ist eine Ekphrasis, eine Bildbeschreibung. Wir finden sie in einem Text des kaiserzeitlichen Schriftstellers Lukian (2. Jahrhundert n. Chr.). In Das traurige Los der Gelehrten erklärt der Sprecher einem Mann namens Timokles, warum er und andere griechische Gelehrte sich nicht als Hauslehrer bei wohlhabenden Römern verdingen sollten. Er beschreibt eindringlich das Schicksal, das ihnen dort drohe: Viel werde dort versprochen, materielle Sicherheit, ein gehobener Lebensstil und gesellschaftliches Ansehen – doch nichts davon gehe in Erfüllung. Sie würden dazu missbraucht, dem Hausherrn den Anschein von Bildung zu geben, und bei Unstimmigkeiten sofort in Ungnade entlassen werden. Die Beschreibung des allegorischen Bildes steht am Ende von Lukians Text, es veranschaulicht die Ausführungen des Sprechers und dient als Schlussplädoyer gegen die Sklavendienste des Gelehrten.
Zentral in der Allegorie ist die Frau, die den Liebhaber des Reichtums empfängt und zu den anderen Frauen führt, bevor sie, bei der Verzweiflung angekommen, verschwindet – Elpis, die Hoffnung. In ihr greifen wir einen wichtigen Strang der antiken Vorstellungen von Hoffnung, den wir in die Archaik zurückverfolgen können: Hoffnung als eine Zuversicht, die sich jedoch als Illusion entpuppt. Die Hoffnung in Lukians Ekphrasis ist verführerisch – sie empfängt den Wanderer freundlich mit ihrem schönen Gesicht und farbenfrohen Gewand –, aber statt zum erwünschten Reichtum führt sie ihn ins Elend. Auch in der Gegenwart gibt es kritische Stimmen zur Hoffnung, etwa die Warnung davor, sich Hoffnungen hinzugeben und deswegen nichts zu unternehmen, aber der Tenor ist positiv: Hoffnungen, so würden viele Menschen heute sagen, motivieren, sie helfen, schwere Zeiten durchzustehen, und tragen zur Lebenszufriedenheit bei. Kraft und Nutzen des Hoffens sind der paganen Antike keineswegs fremd; neben oder sogar vor ihnen stehen jedoch seine Gefahren.
Elpis, ins Lateinische mit spes übersetzt, bezeichnet Hoffnung, deckt sich aber nicht mit ihr. So können elpis und spes auch Erwartung bedeuten und sich sogar auf ungünstige Entwicklungen richten; dann fehlt ihnen das Begehrende des Hoffens. Nach einer Sonnenfinsternis schreibt der archaische Dichter Archilochos (7. Jahrhundert v. Chr.) etwa: «Nichts mehr von den Dingen ist unerwartet …»[2] «Unerwartet» übersetzt das griechische «aelpton», das denselben Stamm wie elpis hat und hier keine Hoffnung, sondern eher eine Furcht ausdrückt – wenn schon die Sonne verschwindet, was kann dann noch alles geschehen? In Aristoteles’ Schrift Über das Gedächtnis verhält sich elpis zur Zukunft wie die Erinnerung zur Vergangenheit und die Wahrnehmung zur Gegenwart – sie bezeichnet allgemein die Erwartung.[3]
An einigen Stellen beziehen sich elpis und stammverwandte Wörter auch nicht auf Zukünftiges und bezeichnen stattdessen Annahmen und Vermutungen über Vergangenes oder Gegenwärtiges. In der Ilias kämpfen die Griechen und Trojaner bereits um den Leichnam des Patroklos, doch Achill, zurückgeblieben bei den Schiffen, weiß noch nichts davon: «Das erwartete er niemals im Mute,/dass er tot sei.»[4] In diesem Falle können wir das mit elpis stammverwandte Verb elpesthai keineswegs mit «hoffen» übersetzen – Achill hofft nicht, dass sein Intimus tot ist. Aufs Ganze betrachtet, überwiegt die Bedeutung von Hoffnung aber in der antiken Literatur und setzt sich bei christlichen Autoren dann ganz durch.
Hoffnung findet sich auch, ohne dass das Wort elpis auftaucht. Bereits Homer lässt seine Helden hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, ohne diese Haltung immer ausdrücklich als elpis zu charakterisieren. Besonders eindrücklich ist Penelope in ihrer Hoffnung auf die Rückkehr des Odysseus. Sie hält die Freier, die sich an ihrem Hof eingenistet haben, über Jahre hin: Sobald sie das Leichentuch für ihren Schwiegervater Laertes fertiggewoben habe, werde sie sich mit einem von ihnen vermählen. Aber nachts trennt Penelope das, was sie tagsüber gewoben hat, wieder auf – bis sie von einer Dienerin verraten wird. Auch dann hört sie nicht auf zu hoffen, ihren Gatten wiederzusehen, ist aber schließlich so verzweifelt, daß sie die Freier zur Bogenprobe einlädt. Diese Gelegenheit nutzt Odysseus, der heimlich zurückgekehrt und von Athena in einen alten Bettler verwandelt worden ist, als Auftakt für seine Rache an den Freiern. Auch wenn Penelope ihren Gatten nicht sofort erkennt, geht ihre Hoffnung schließlich in Erfüllung.
Der Ausgangspunkt für unseren Streifzug durch die Antike ist aber nicht das homerische Epos, sondern ein berühmter Mythos bei Hesiod.[5] Bis heute gibt uns die Erzählung von Pandora Rätsel auf – die Rolle der Elpis, die im Fass der Pandora bleibt, wird höchst verschieden gedeutet.
Der Pandora-Mythos bei Hesiod
Gemeinsam mit Homer, so notiert Herodot, gab Hesiod «den Griechen die Entstehung der Götter und benannte die Götter, teilte ihre Vorrechte und Fertigkeiten auf und beschrieb ihr Aussehen»[6]. Hesiod lebte um 700 v. Chr. im boiotischen Askra, einem Ort am Fuß des Helikons, «im Winter schlecht, im Sommer furchtbar, niemals gut»[7]. Ihm verdanken wir die ersten Lehrgedichte; seine Hauptwerke sind die Theogonie und die Werke und Tage. Während die Theogonie die Abfolge der Göttergeschlechter von den Urwesen Chaos und Gaia bis zu den Olympiern erzählt, setzen sich die Werke und Tage mit dem Leben des Menschen auf der Erde auseinander.[8] Pandora taucht in beiden Werken als Teil des Prometheus-Mythos auf: In der Theogonie erwähnt Hesiod sie als die erste Frau, die Zeus schuf und dann Epimetheus «als ein Übel»[9] gab. Ausführlicher wird die Geschichte von Pandora in den Werken und Tagen geschildert.
Nach einer Musenanrufung korrigiert sich Hesiod in den Werken und Tagen selbst – hatte er in der Theogonie nur von einer Eris (Streit) gesprochen, führt er jetzt zwei Eriden ein. Neben der schlechten Eris, die Zwietracht säe und Krieg herbeiführe, gebe es die gute Eris. Sie sorge für Wettbewerb zwischen Menschen und bewirke, dass sie arbeiten und sich gut versorgen könnten. An dieser Stelle wendet sich Hesiod an seinen Bruder Perses und ermahnt ihn, sich von der schlechten Eris fernzuhalten. Die beiden sind in einen Rechtsstreit verwickelt: Perses – das behauptet Hesiod zumindest – hat die Richter bestochen und ihn um seinen Anteil am väterlichen Land gebracht. Statt sich derart zu bereichern, solle Perses seinen Lebensunterhalt mit ehrlicher Arbeit verdienen. Das sei nämlich das Los, das die Götter den Menschen zugewiesen hätten, indem sie die «Nahrung versteckt hielten».[10]
Hesiod bietet zwei Mythen an, um diesen Zustand – die Arbeit als Bedingung des Lebens – zu erklären: Prometheus und die Weltalter. Den Opferbetrug des Prometheus, den er in der Theogonie ausführlich erzählt, streift er hier nur als einen ersten Versuch des Prometheus, den Göttervater Zeus «zu täuschen»: Zeus darf zwischen zwei Haufen der Opfergaben wählen, aber Prometheus hat unter dem verführerischen Fett die Knochen versteckt und das essbare Fleisch in die unansehnliche Haut eingeschlagen. Um sich zu rächen, habe Zeus dann das Feuer «verborgen», aber Prometheus sei es gelungen, das Feuer zu «stehlen» und, in einem hohlen Riesenfenchel verborgen, den Menschen zu bringen. Daraufhin habe Zeus ein Übel angekündigt: «Und alle/werden es zärtlich umarmen, ihr Übel, das Herz voller Freude.»[11] Auf Anweisung des Zeus hätten die Götter ein Wesen geschaffen, «das Antlitz gleich den unsterblichen Göttinen» und von der «Gestalt eines reizenden Mädchens», aber zugleich mit einem «hündischen Sinn und diebischen Wesen»[12]. Sein Name sei Pandora, «weil alle Olympos-Bewohner/sie mit Gaben begabt, zum Leid den erwerbsamen Männern»[13]. Pan bedeutet «jedes, ganz», dôron ist das Geschenk – deswegen lässt sich Pandora als «die von allen Beschenkte» verstehen. Hermes habe Pandora zu Epimetheus gebracht; dieser habe sie angenommen, obwohl Prometheus ihn ausdrücklich vor einem Geschenk des Zeus gewarnt hatte.
Darauf folgt die Passage, die in der Neuzeit zahllose Autoren und Künstler angeregt, den Philologen aber viele Kopfschmerzen bereitet hat:
Früher nämlich lebten auf Erden die Stämme der Menschen weit von den Übeln entfernt und ohne drückende Plage, lästigen Krankheiten fern, die den Männern Tode bereiten. Aber die Frau entfernte den großen Deckel des Kruges, leerte ihn aus und sann den Menschen schmerzliche Leiden. Einzig die Hoffnung verblieb im unzerbrechlichen Hause, drinnen unter den Lippen des Kruges, und nicht aus der Öffnung flog sie heraus; sie hatte zuvor den Deckel des Kruges zugeworfen nach Willen des Zeus des Wolkenversammlers. Sonst aber zahllose Leiden entschwirrten unter die Menschen. Voll ist nämlich von Übeln die Erde und voll ist das Wasser, Krankheiten gehen bei Tag und Krankheiten gehen bei Nacht um unter den Menschen von selbst und bringen den Sterblichen Unheil, lautlos, da ihnen Zeus der Berater die Stimme herausnahm. Also ist es unmöglich, dem Sinn des Zeus zu entrinnen.[14]
Zuerst einmal ist zu bemerken, dass Pandora bei Hesiod keine Büchse mit sich führt; sie öffnet einen pithos, ein großes Vorratsfass, das offensichtlich bei Epimetheus steht – ob es dort schon vor ihrer Ankunft stand oder ihre Mitgift war, sagt Hesiod nicht. Lediglich im Italienischen spricht man vom vaso di Pandora, in anderen Sprachen hat sich wie im Deutschen die Vorstellung von einer Büchse durchgesetzt: Pandora’s box, boîte de Pandore, caja de Pandora, doos von Pandora … Das Bild der Büchse geht – das haben Dora und Erwin Panofsky gezeigt – wohl auf Erasmus von Rotterdam (1466?–1536) zurück.[15] In seiner Sammlung antiker Sprichwörter aus dem Jahr 1508 erklärt Erasmus auch die Wendung «Geschenke von Feinden sind keine Geschenke»: «so wie jene Büchse (pyxis) täuschend war, die dem Prometheus von Jupiter durch Pandora geschickt worden war». Der große Erfolg dieser Sprichwörtersammlung sorgte dafür, dass wir bis heute davon ausgehen, Pandora habe die Übel in einer Büchse mit sich gebracht – ohne dass davon etwas bei Hesiod steht.
Auf den ersten Blick scheint die Handlung klar zu sein: Pandora öffnet das Fass, die darin enthaltenen Übel entweichen und machen seitdem den Menschen zu schaffen; allein Elpis bleibt zurück im Fass. Aber schnell drängen sich Fragen auf: Ist Elpis auch ein Übel, oder handelt es sich um ein Gut, das zusammen mit den Übeln im Fass war? Was bedeutet der Verbleib von Elpis? Die Übel können die Menschen befallen, weil sie aus dem pithos geflogen sind – sind die Menschen vor der zurückgebliebenen Elpis geschützt? Aber kann das sein? Hoffnung gehört zum menschlichen Leben dazu – wechselt der pithos in der Geschichte plötzlich seine Funktion von einem Gefängnis zu einem Aufbewahrungsort?
Es gibt eine Deutung, die dem Text eng folgt und diese Fragen mehr oder weniger zufriedenstellend beantwortet.[16] Ihr zufolge steht Elpis im Einklang mit ihrer zweiten Erwähnung in den Werken und Tagen. Hesiod appelliert dort an den Leser, den Winter nicht untätig verstreichen zu lassen:
Oft hat der ohne Arbeit, in leerer Hoffnung (elpis) verharrend, weil er der Nahrung bedurfte, sein Herz zu Bösem beredet. Ungute Hoffnung (elpis) begleitet ja stets die bedürftigen Männer, die im Gemeinsaal sitzen, weil ihnen die Nahrung nicht ausreicht.[17]
Elpis erscheint in diesen Versen als eine illusionäre Hoffnung, sie hält Menschen vom Arbeiten ab und bewirkt, dass sie im Winter betteln müssen. Wenn wir Elpis so auch in der Pandora-Geschichte verstehen, ist ein Funktionswechsel des Behälters nicht notwendig: Die anderen Übel, namentlich die Krankheiten, fallen die Menschen «von selbst» an, sie nähern sich ihnen «lautlos», also ohne dass die Menschen es bemerken. Die Elpis hingegen haben die Menschen unter Kontrolle – sie können selbst bestimmen, ob sie sich Illusionen hingeben oder tätig werden. Diese Interpretation stützt sich nicht nur auf die in den Werken und Tagen belegte Bedeutung von elpis und eine schlüssige Deutung des Fasses, sie verstärkt auch den Bezug des Mythos zu seinem Rahmen, dem Appell an Perses, sich nicht auf Betrug, sondern ehrliche Arbeit zu verlassen. Hesiod richtet sich mit derselben Wendung an Perses, die er verwendet, wenn er über die Folgen des Untätigseins räsoniert: «ohne Arbeit» («aergon eonta»): «Leicht ja erwürbest du sonst an einem Tage durch Arbeit/Habe dir für ein Jahr, das ohne Arbeit dir hinging.»[18] Wenn Perses ein Mindestmaß an Arbeit erbrächte, könnte er es sich sogar leisten, übers Jahr hinweg müßig zu sein. Aber er tut gar nichts und ist ein Beispiel für die Folgen der illusionären Hoffnung. Die Geschichte von Pandora erklärt nicht nur die Notwendigkeit der Arbeit, die zurückgebliebene Hoffnung illustriert zudem die Gefahr, der Perses erlegen ist.
Aber diese Deutung konkurriert mit vielen anderen Interpretationen, die von nicht weniger Anwälten mit einer Vielzahl von Argumenten vertreten werden. So versteht eine Reihe von Philologen elpis nicht als Hoffnung, sondern als Erwartung der Übel.[19] Wäre diese auch noch nach draußen gelangt, so wäre das Leben der Menschen unerträglich geworden: Sie hätten sich nicht nur mit den Übeln, sondern auch mit dem Wissen um sie herumschlagen müssen. Nun kann elpis in der Tat die Erwartung bezeichnen, aber diese Bedeutung ist seltener und meist durch Attribute markiert – etwa «die Erwartung von Unheil»[20]. Für andere Interpreten ist Elpis im Pandora-Mythos kein Übel, sondern ein Gut – mit den Übeln, die den Menschen befallen, geht die Hoffnung einher und spendet Trost.[21] Der Zusammenhang zwischen Unglück und Hoffnung leuchtet unmittelbar ein, aber kann das Fass der Übel auch ein Gut enthalten, zumal Hesiod erst von der Elpis und dann den «anderen zahllosen Leiden» spricht?[22] Manche Philologen gehen noch einen Schritt weiter und behaupten, im Fass seien nur Güter gewesen, die nach der Öffnung die Erde geflohen hätten.[23] Diese Interpretation entspricht der Wiedergabe des Mythos beim kaiserzeitlichen Fabeldichter Babrios (2. Jahrhundert n. Chr.), aber es bedarf schon einiger Gewalt, um sie in Hesiods Text hineinzulesen: Das Umherschweifen der Übel nach dem Öffnen des Fasses legt nahe, dass sie aus diesem entwichen sind.
Die Bücher und Aufsätze über Pandora füllen ganze Regale, sie entwickeln die genannten Interpretationen mit verschiedenen Nuancen und auch noch eine Reihe anderer Ansätze.[24] Auch wenn fast alle Deutungen an der einen oder anderen Stelle hinken, spiegelt sich in ihrem Reichtum die Ambiguität der elpis wieder: Sie kann als Hoffnung ein Heilmittel gegen Unheil, aber auch eine neutrale Erwartung oder selbst ein Unheil sein, wenn der illusionsgeladene Blick auf die Zukunft von der Arbeit abhält. Bereits bei Hesiod zeigt sich der schillernde Charakter von Hoffnung in der Antike, sie konnte ebenso eine Form der Verblendung wie eine Quelle der Kraft sein.
Abbildung 3 | Rotfiguriger Volutenkrater, Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. (Ashmolean Museum, Beazley 275165)
Interpretieren wir Elpis als Illusion, dann lässt sie sich in Beziehung setzen zu dem Wesen, das sie im Fass lässt.[25] Schon der Name der Pandora ist mehrdeutig. Hesiod erklärt ihn damit, dass alle Götter zur Ausstattung von Pandora beitragen. Aber Pandora lässt sich auch verstehen als das Geschenk, das alles enthält. Pandora ist außerdem ein Beiname für Gaia, die Erde. Auf einer rotfigurigen Vase empfängt Epimetheus Pandora, die aus der Erde herauswächst. Hesiod beschreibt sie zwar als eine Schöpfung der Götter, aber auch bei ihm besteht sie aus Erde und Wasser. Vor allem hat Pandora ein «Antlitz gleich den unsterblichen Göttinnen» und die «Gestalt eines reizenden Mädchens», aber einen «hündischen Sinn und ein diebisches Wesen»[26]. Ist es zu kühn, in Pandora einen Spiegel der Elpis zu sehen? Hoffnungen sind auf den ersten Blick ähnlich attraktiv wie Pandora; sie richten den Blick auf Schönes in der Zukunft. Aber oft erweisen sich Hoffnungen als «leer»[27] – sie entpuppen sich, Pandora gleich, als «Lug und Trug und schmeichelnde Worte»[28]. Auch der pithos, in dem Elpis bleibt, ist charakterisiert durch die Spannung zwischen außen und innen – nach außen hin tönern, ein Gefäß, in dem man nahrhafte Vorräte vermutet, enthält er Übel.
Die Spannung zwischen außen und innen durchzieht auch die vorangehenden Teile des Prometheus-Mythos:[29] Im Opferbetrug, der in den Werken und Tagen nur erwähnt wird, schlägt Prometheus das essbare Fleisch in die unansehliche Haut ein und drapiert die nicht verzehrbaren Knochen in Fett, verführerisch mit Weihrauch auf dem Altar präsentiert. Daraufhin «verbirgt» Zeus das Feuer, doch Prometheus bringt es den Menschen. Wie bei Pandora täuscht im Schlagabtausch zwischen Zeus und Prometheus immer wieder die äußere Erscheinung über den Inhalt. Dabei spielt Hoffnung als Illusion eine gewichtige Rolle: Wenn Prometheus Zeus zwischen den beiden Opferhaufen wählen lässt, setzt er darauf, dass der Göttervater sich blenden lässt. Zeus durchschaut den Betrug, er lässt sich jedoch auf ihn ein, um die Menschen hart zu bestrafen. Mit dem Feuer raubt er den Menschen die Möglichkeit, das Opferfleisch zu braten, und zwingt sie auf die Stufe der Tiere, die Fleisch roh essen müssen. Nach dem Feuerdiebstahl nutzt er selbst die Empfänglichkeit der Menschen für Hoffnung. Betört von den äußeren Reizen der Pandora, vergisst Epimetheus die Warnung seines Bruders – und sieht sich schließlich konfrontiert mit einer Frau, die alle Übel auf die Menschheit loslässt.
So gelesen, ist der Pandora-Mythos nicht nur eine Geschichte, in der Hoffnung am Ende im Fass bleibt. Hoffnung ist zentral für den Mythos – sie treibt die Auseinandersetzung zwischen Prometheus und Zeus an, ist in Pandoras Ambivalenz gespiegelt und verdichtet sich am Höhepunkt in einer Personifikation. Der Mythos, der die Bedeutung der Hoffnung im menschlichen Leben erklärt, zeigt bereits ihr Wirken. Dabei wird Hoffnung sehr kritisch gesehen – als die Neigung, sich Illusionen über die Zukunft zu machen, mit fatalen Folgen. Ebenso wie das Opfer scheidet die Hoffnung die Menschen von den Göttern – während sich Zeus nicht von Prometheus täuschen lässt, gelingt es ihm, Epimetheus hinters Licht zu führen. Jedoch sind die Menschen der Hoffnung nicht ausgeliefert. Anders als Krankheiten und andere Leiden bleibt die Hoffnung im Fass; der Mensch kann über sie verfügen. Die Kontrolle über die Hoffnung ist von zentraler Bedeutung. Verliert der Mensch sie und gibt sich seinen Wunschvorstellungen hin, dann versäumt er es, die notwendige Arbeit zu verrichten, und verfehlt das Los, das Zeus ihm zugeteilt hat, als er den Lebensunterhalt «verbarg».
Frühgriechische Dichtung und attische Tragödie
Nur ein Teil der frühgriechischen Dichtung ist auf Papyri überliefert; der größere Teil unserer Fragmente stammt aus der indirekten Überlieferung – aus Zitaten bei späteren antiken Autoren, deren Werke in mittelalterlichen Handschriften vorliegen. Unsere Überlieferung ist also durch die Interessen und den Geschmack vor allem kaiserzeitlicher Schriftsteller geprägt. Ein Autor, dem wir eine nicht unbeträchtliche Zahl von Fragmenten verdanken, ist Stobaios. Er lebte im 5. Jahrhundert n. Chr. und stellte für seinen Sohn in vier Bänden Exzerpte aus ganz verschiedenen Feldern zusammen, aus der Ethik und Politik ebenso wie aus der Dialektik und der Naturphilosophie. Der vierte Band seiner Sammlung enthält Lebensweisheiten und ist für uns die Quelle vieler archaischer Betrachtungen über die Hoffnung sowie ein Zeugnis für das anhaltende Interesse an der Ambiguität von Hoffnung bis in die Spätantike.
In einem Kapitel mit dem Titel «Über das Leben, dass es kurz, wertlos und voller Sorgen ist» finden wir ein offensichtlich vollständig wiedergegebenes Gedicht des Semonides (7. Jahrhundert v. Chr.). Am Beginn stellt Semonides dem allgewaltigen Zeus die Menschen gegenüber:
… nur für einen Tag, so leben tierisch wir dahin und wissen nicht, zu welchem Ziel die Gottheit einen jeden führt. Nur Zuversicht und Hoffnung halten alle aufrecht beim eitlen Planen; einer wartet auf das Kommen bloß eines Tags, der andre auf den Gang von Jahren. Kein Mensch entgeht dem Wahn, im nächsten Jahre reich und eng befreundet mit Begüterten zu werden.[30]