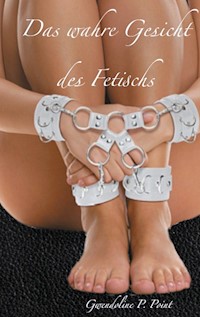Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OBW Offene Buchwelten
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Adriana wird von einem Tag zum anderen, aus dem Alltag gerissen: Operationen, künstliche Ernährung, ein Leben mit Stoma. Inmitten von Schmerz, Krankenhausfluren und Verzweiflung kämpft sie, für ihre Tochter, für sich selbst, für einen neuen Alltag. Diese autobiografische Erzählung zeigt eindrucksvoll, wie zerbrechlich das Leben ist und wie viel Kraft in einem Menschen stecken kann. Eine bewegende Geschichte über Krankheit, Hoffnung und die Kunst, trotz allem weiterzumachen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Moment, der alles veränderte
Ich dachte, es wird besser
Die erste Operation vergisst du nicht
Mein Körper gegen mich
Das Stoma
Nächte voller Chaos
Die ewige Geduld und das Leben danach
Tropfenweise Leben
Hallo Nonna
Wenn die Nacht dich verrät
Die Maske, die ich trage
Wurzeln im Asphalt, Blüten am See
Der Kampf ums Weitergehen
Die brutale Wahrheit der Krankheit
Wenn Hoffnung in Kinderaugen lebt
Leben mit dem Tod
Mädels-Urlaub in Jesolo
Jeannine
Der Tag, den ich nie vergessen werde
So kam ich zu TikTok
Tobi, der Therapiehund
Vorfreude auf meinen 50. Geburtstag
Chronische Krankheit und die Kunst, Licht zu finden
Meine tierischen Spiegel
Ein Tag für die Ewigkeit
Akzeptanz
Fünfzig Jahre ich
Nino – Mein kleiner Held mit großem Herz
Danke Grazie
Hinter den Kulissen – Mein persönlicher Dank
Vorwort
Manchmal stellt uns das Leben vor Herausforderungen, die wir uns nie hätten ausmalen können. Krankheit, Schmerz, Unsicherheit.
Sie erschüttern unser Innerstes und bringen uns an den Rand der Verzweiflung.
Und doch beginnt gerade in solchen dunklen Momenten oft ein neuer Weg: ein Weg zu uns selbst, zu neuer Kraft, zu einem tieferen Verständnis dessen, was wirklich zählt.
Dieses Buch ist kein Ratgeber und kein Heilversprechen. Es ist meine persönliche Reise. Ein Blick hinter die Kulissen meines Lebens mit einer chronischen Erkrankung, ein ehrliches Porträt von Schmerz und Hoffnung, von Verlust und Liebe.
Ich schreibe für alle, die sich im Kampf gegen das Unsichtbare nicht allein fühlen wollen. Für jene, die wissen, wie schwer es ist, Licht zu sehen, wenn alles dunkel erscheint. Hier findest du keine perfekten Antworten, aber vielleicht eine Hand, die dich hält, wenn du sie brauchst.
Eine Einladung, mit mir gemeinsam den Mut zu finden, das Leben anzunehmen, so wie es ist, mit all seinen Brüchen und seinen kleinen Wundern.
Ich lade dich ein, dieses Buch zu öffnen und mich zu begleiten, auf eine Reise durch Tiefen und Höhen, durch Verzweiflung und Zuversicht.
Möge es dir Mut machen, dir Kraft schenken und dich daran erinnern: Du bist nicht allein.
Lebe. Liebe. Lache. Und finde dein Licht.
Der Moment, der alles veränderte
Es begann mit einem Schmerz, den ich nicht kannte.
Nicht der übliche Schmerz nach einem langen Tag, nicht die Erschöpfung, die man mit einer Tasse Tee oder einer heißen Dusche vertreiben kann. Es war ein Schmerz, der alles veränderte. Ich wusste nicht, dass dieser Moment mein Leben in „Davor“ und „Danach“ teilen würde.
Ich war in Holland. Urlaub. Freunde. Markus.
Ein unbeschwerter Abend voller Lachen, Essen und Trinken, bis mein Körper mir einen Strich durch die Rechnung machte.
Während alle weiter feierten, saß ich auf der Toilette, unfähig, mich zu bewegen, während mein Körper gegen mich arbeitete.
Wie oft nehmen wir unser Leben als selbstverständlich hin?
Wir glauben, wir hätten die Kontrolle, wir planen, wir rennen, wir funktionieren, bis das Leben uns zeigt, dass es seinen eigenen Weg geht.
Ich dachte, ich sei unaufhaltbar. Ich dachte, wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich stark genug bin, könnte ich alles meistern.
Aber was, wenn dein eigener Körper plötzlich nicht mehr mitspielt?
Wenn sich das Leben, das du kanntest, Stück für Stück auflöst, nicht mit einem Knall, sondern in kleinen Momenten?
Ich saß da, mit Krämpfen, die mich lähmten, während die Stimmen meiner Freunde aus dem Esszimmer nach oben drangen: Lachen, Gespräche, Gläser, die aufeinandertreffen.
Und ich? Ich kämpfte. Mein Puls raste, der Schweiß lief mir über die Stirn und ich wusste, dass ich allein aus dieser Situation nicht mehr herauskommen würde. Also griff ich nach meinem Handy und rief Markus an. Ein riesiger Schritt für mich. Denn wer ruft schon gerne jemanden an, um ihm mitzuteilen, dass man gerade im Badezimmer kollabiert?
Doch er kam sofort. Und er blieb. Er hielt mich fest, redete mit mir, wich nicht von meiner Seite. Er konnte nichts tun, außer da sein. Und genau das war in diesem Moment das Wichtigste.
Zwei Stunden lang kämpfte ich gegen meinen eigenen Körper.
Währenddessen geschah unten im Esszimmer etwas, das heute fast surreal klingt.
Irgendwann, nachdem ich schon eine Ewigkeit im Badezimmer war, kamen meine Freunde auf eine großartige Idee: „Weißt du was? Wir gehen jetzt alle hoch!
Setzen uns ins Badezimmer und trinken da weiter!"
Heute lachen wir darüber, denn die Situation scheint im Nachhinein so absurd und surreal, dass Lachen das einzig Logische erscheint. Doch damals, in diesem Moment, auf dieser Toilette, war mir nicht nach Lachen zumute.
Dieser Urlaub war der letzte, den ich erleben durfte. Hätte ich gewusst, dass es mein Abschiedsgeschenk an mein bisheriges Leben sein würde, hätte ich die ganze Flasche Wein auf der Toilette geleert und mich so von meiner Freiheit verabschiedet.
Damals war ich noch Herrin über meine Kräfte, über meinen Körper, über mein Leben. Heute? Heute fühle ich mich wie eine Hülle. Eine Hülle, gefüllt mit Erinnerungen an eine starke, unabhängige Frau. Eine Frau, die einst Motorrad fuhr, Abenteuer erlebte, die sich selbst versorgte und für andere da war.
Heute kann ich nicht einmal mehr allein aus der Tür gehen.
Am nächsten Tag stand unser Rückflug an, ein simpler Plan, der jedoch durch meinen unfreiwilligen Aufenthalt in der luxuriösen Porzellan-Suite beinahe ins Wanken geriet. Während ich die Nacht auf kalten Fliesen verbrachte, hatten meine Freunde eine deutlich entspanntere Zeit. Sie feierten weiter, tranken bis spät in die Nacht und das hatte Folgen.
Denn plötzlich war die Zeit knapp. Viel zu knapp.
Hektik brach aus. Koffer wurden gegriffen, Jacken übergeworfen, wir stolperten förmlich aus der Tür.
Mein Zustand? Nicht kompatibel mit Stress. Doch in dem Chaos blieb keine Zeit für Rücksicht. Mein Körper schrie nach Ruhe, nach Stabilität, aber stattdessen hetzten wir zum Flughafen.
Das Check-in, die Platzsuche im Flieger, der Start, alles zog an mir vorbei wie in einem Film. Physisch war ich da, psychisch war ich woanders. Erschöpfung. Kraftlosigkeit. Ein dumpfes Unwohlsein, das sich wie ein dunkler Schatten um mich legte.
Es begleitete mich wie eine persönliche Stewardess, die nicht um meinen Komfort besorgt war, sondern mich mit einem seltsamen Gefühl der Fremdheit umfing.
Dann endlich: Landung. Zuhause. Erlösung.
Hier fühlte ich mich sicherer, wohler. Ich redete mir ein, dass es nichts Großes war. Vielleicht schlechtes Essen, vielleicht die Anstrengung des Rückflugs. Mein Körper würde sich schon wieder fangen. Doch das tat er nicht.
Und während ich versuchte, mein Leben wieder aufzunehmen, war da dieses leise, beharrliche Flüstern in mir. Kaum hörbar, aber unübersehbar. Etwas stimmte nicht. Ich ignorierte es.
Ich wollte es nicht hören. Aber mein Körper hatte längst angefangen zu schreien.
Ich dachte, es wird besser
Ich kam aus Holland nach Hause und dachte, es würde besser werden. Vielleicht war es einfach nur eine Magenverstimmung, zu viel Stress, zu viel Sonne, zu wenig Schlaf. Ich redete es klein. Ich verdrängte es. Weil die Alternative nicht greifbar war, nicht für meinen Kopf, nicht für mein Herz.
Aber mein Körper redete eine andere Sprache. Er schrie.
Nicht laut, sondern durch Schmerz, durch Erschöpfung, durch diese seltsame Mischung aus Druck und Leere. Ich spürte, dass etwas nicht stimmte. So tief und instinktiv, wie man spürt, dass ein Sturm kommt, noch bevor sich der Himmel verdunkelt.
Die Arzttermine reihten sich aneinander. Blutabnahmen, Ultraschall, CT, MRT, wieder Blut. Ich wurde ein Fall.
Ein ungelöstes Puzzle. Immer neue Fachbegriffe, immer neue Diagnosen im Konjunktiv: „Es könnte sein…",
„Wir vermuten…", „Wir müssen noch mal schauen." Ich wurde zum Objekt medizinischer Neugier – freundlich verpackt, mit Sätzen wie: „Das schauen wir uns jetzt ganz genau an."
Aber hinter jedem Lächeln lag Unsicherheit. Und hinter meiner Stirn wuchs die Angst.
Ich saß in diesem sterilen Untersuchungsraum, umgeben von kaltem Neonlicht, das jede Ecke der Wahrheit gnadenlos ausleuchtete. Der Geruch von Desinfektionsmittel war scharf und unbarmherzig. Ich hasste diesen Geruch. Ich hasste die weißen Wände, die metallischen Gerätschaften, das Piepen der Monitore – alles schrie mir entgegen: Hier verändert sich dein Leben. Und zwar nicht zum Guten.
Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Doch es von einem Arzt zu hören, war etwas ganz anderes.
Die Tür öffnete sich. Der Arzt trat ein, mit diesem professionellen Gesicht, das so sehr bemüht ist, Mitgefühl zu zeigen, ohne sich zu verlieren. „Wir haben die Untersuchungen ausgewertet", sagte er.
Blase, Vagina und Darm. Alles war nach unten gerutscht, an Orte, an die sie nicht gehören. Ein Prolaps in sämtlichen Dimensionen, als hätte mein Körper einfach aufgegeben.
Die Tage bis zur Operation verschwammen. Ich funktionierte.
Ging zu Terminen, hörte mir Erklärungen an, unterschrieb Formulare, ließ mich aufklären. Risiken, Komplikationen, mögliche Folgen – Worte wie aus einem Lehrbuch, die nichts mit meinem Gefühl zu tun hatten. Ich nickte schwach, zwang mich zu lächeln, wollte eine Fassade aus Kontrolle wahren.
Doch in meinem Inneren schrie alles. Es war ein leises, krächzendes, verzweifeltes Schreien. Nicht laut genug, um zu fliehen, aber zu laut, um zu überhören.
Markus war immer da. Er fuhr mich zu den Voruntersuchungen, wartete geduldig im Gang, reichte mir Wasser, legte mir eine Jacke über die Schultern, wenn ich fror.
Er sprach wenig. Aber er war da. Und das war alles, was ich brauchte. Seine stille Stärke, sein Schweigen, das kein Ausweichen war, sondern Präsenz. Ich wusste, dass er Angst hatte. Aber er trug sie allein, damit ich nicht noch mehr tragen musste.
Am Tag der OP war ich seltsam ruhig. Vielleicht war es Erschöpfung. Vielleicht Resignation. Vielleicht auch nur der Körper, der längst mehr verstand, als mein Geist. Ich legte mich auf die Trage, hörte das Rascheln von Papier, das Klacken von Geräten. Stimmen wurden leiser. Die Decke über mir war weiß, grell beleuchtet. Ich spürte die Nadel im Arm, die Kälte der Infusion. Und dann wurde alles still.
Ich erwachte in einem Nebel aus Schmerz und Benommenheit.
Alles war dumpf. Mein Körper lag schwer wie Blei. Ich spürte die Matratze unter mir, den festen Druck eines Verbandes um meinen Bauch. Etwas zog. Etwas brannte. Ich öffnete die Augen. Langsam. Es war hell, aber nicht unangenehm. Eine Krankenschwester beugte sich über mich. Sie sprach leise, beruhigend, nannte meinen Namen. Ich verstand kaum etwas, nur das eine Wort blieb hängen: „Geschafft."
Geschafft. Was hatte ich geschafft? Ich konnte es nicht einordnen. Alles war zu viel, zu fremd, zu durcheinander.
Markus kam wenig später ans Bett. Er nahm meine Hand.
Ich versuchte zu lächeln. Es gelang mir nicht.
Er sagte, die OP sei gut verlaufen. Dass der Arzt zufrieden gewesen sei. Dass alles nach Plan lief. Ich nickte. Aber in mir war keine Erleichterung. Nur Leere. Und ein stechender Schmerz, der sich langsam durch das Schmerzmittel kämpfte, das meine Sinne noch betäubte.
In den folgenden Tagen lag ich da wie ein angeschwemmtes Wrack. Ich war umgeben von Piepen, Maschinen, dem Geruch von Desinfektionsmitteln. Ich lernte, wie es sich anfühlt, hilflos zu sein. Wie es ist, jemanden zu brauchen, der dir hilft, dich aufzusetzen, dich zu waschen, dir das Tablett zurechtrückt, weil du die Kraft nicht hast.
Ich wurde entlassen, als ich gerade wieder laufen konnte.
Langsam, wackelig, tastend. Der Weg nach Hause war kurz und fühlte sich doch an wie eine Weltreise. Ich saß auf dem Beifahrersitz, zusammengesunken, den Blick leer auf die Straße gerichtet. Die Welt draußen war dieselbe und ich war jemand anders.
Zuhause roch es vertraut. Nach Tee. Nach frischer Wäsche.
Nach Leben. Aber es war, als würde ich eine Kulisse betreten, die für jemand anderen gebaut war. Ich gehörte nicht mehr hinein. Ich passte nicht mehr in dieses „vorher".
Ich schlich durch die Wohnung, hielt mich an Wänden fest.
Mein Bett, mein eigentlich sicherster Ort, wurde zur Herausforderung. Hinlegen war schwierig, Aufstehen eine Tortur. Ich schlief schlecht. Ich schwitzte. Ich zitterte.
Und immer wieder dachte ich: Es sollte, doch besser werden.
Warum fühlt es sich an wie ein Albtraum?
Markus richtete mir das Kissen zurecht, brachte mir Tee, wechselte wortlos den Verband. Seine Hände waren vorsichtig, sanft, aber ich spürte, wie schwer ihm jede Geste fiel. Nicht körperlich, emotional. Er tat alles, um mir die Scham zu nehmen. Aber sie war da. Tief. Hartnäckig. Wie ein zweiter Schatten.
Ich hasste es, mich nicht selbst waschen zu können. Ich hasste es, ihn um Hilfe bitten zu müssen, um aufzustehen, mich umzuziehen, zur Toilette zu gehen. Ich hasste es, dass mein Körper mich verriet. Nicht nur im Krankenhaus, sondern auch jetzt, in meinem eigenen Zuhause.
Die erste Nacht war schlimm. Ich lag im Bett, das mir vertraut war, das nach mir roch und doch war ich fremd darin. Die Schmerzen raubten mir den Atem.
Jeder Atemzug spannte die Naht, jeder Husten war eine Explosion. Ich starrte an die Decke, hörte Markus neben mir ruhig atmen und wünschte mir, in seinem Körper zu stecken.
Nur für einen Moment.
Nur um zu vergessen, wie es ist, in meinem zu leben.
Ich wollte ihm nicht zeigen, wie schlecht es mir ging. Ich wollte stark wirken, mutig, widerstandsfähig. Ich zwang mich zu lächeln, zu sagen „Es geht schon", wenn er mich fragte.
Doch nachts, wenn er schlief, weinte ich leise ins Kissen.
Tränen, die nicht nur aus Schmerz kamen, sondern aus Scham, Angst, Ohnmacht. Ich war nicht mehr die Frau, die ich einmal war. Ich wusste nicht mehr, wer ich jetzt war.
Am nächsten Morgen versuchte ich aufzustehen. Allein.
Ich wollte es schaffen Ich brauchte das Gefühl, wenigstens etwas kontrollieren zu können.
Aber kaum hatte ich mich zur Seite gedreht, explodierte ein stechender Schmerz durch meinen Bauch.
Ich keuchte, griff nach der Bettkante, rutschte zurück in die Kissen. Markus kam sofort. „Du musst mich rufen", sagte er. Ich nickte und log.
Er half mir ins Bad. Ich fühlte mich wie ein Schatten meiner selbst. Mein Gesicht war blass, eingefallen, meine Bewegungen langsam und mechanisch. Ich wusch mich, so gut es ging.
Jeder Handgriff war eine Prüfung. Ich kam zurück ins Schlafzimmer und ließ mich aufs Bett sinken. Ich wollte schlafen, doch der Schlaf kam nicht. Nur die Gedanken. Immer die Gedanken. Was, wenn das nur der Anfang war? Was, wenn mein Körper weiter zerfällt? Was, wenn ich in einem Jahr nicht mehr gehen kann? Was, wenn Markus irgendwann nicht mehr kann?
Diese Gedanken kamen nicht als Panik, sondern als dumpfe, kalte Gewissheit. Ich hatte das Gefühl, auf einer brüchigen Brücke zu stehen. Unter mir nur Nebel. Und ich wusste: Zurück gibt es nicht.
Ich versuchte, den Alltag zurückzuholen. Ein paar Schritte in den Garten. Sitzen am Frühstückstisch. Mich selbst anziehen.
Doch jeder Versuch fühlte sich an wie ein Test, den ich nur mit Ach und Krach bestand. Ich fiel durch. Jeden Tag ein bisschen mehr.
Markus versuchte, mir Mut zu machen. „Du brauchst Zeit", sagte er. Und ich wusste, er hatte recht. Aber ich wollte keine Zeit. Ich wollte mein Leben zurück. Ich wollte morgens aufstehen, ohne über jede Bewegung nachzudenken. Ich wollte wieder ich sein. Nicht diese fragile Version mit Narbe am Bauch und Tränen in den Augen.
Eines Morgens stand ich allein auf. Langsam. Zentimeter für Zentimeter. Ich zog mich an, atmete flach, hielt mich an der Kommode fest. Ich wollte in die Küche. Nur ein paar Schritte.
Doch auf halbem Weg gab mein Kreislauf nach. Schwarz vor den Augen. Ich sackte gegen die Wand, rutschte zu Boden.
Kalter Schweiß. Zittern. Ich weinte nicht. Ich schrie nicht.
Ich saß einfach da. Hilflos, leer.
Markus fand mich dort. Er kniete sich zu mir, hielt mich, sagte nichts. Und in seinem Schweigen lag alles.
Ich weiß nicht mehr, wie lange wir dasaßen. Markus auf dem Boden, ich in seinem Arm, mein Körper schwer und mein Herz so müde. Ich weiß nur, dass dieser Moment anders war.
Kein Arzt, keine Medikamente, kein Verband konnte mir das geben, was er in diesem Augenblick war: Halt.
Er trug mich zurück ins Bett. Und ich ließ es zu. Zum ersten Mal ohne Widerstand. Ohne diesen inneren Protest, der immer wieder rief: Du musst es allein schaffen. Ich musste gar nichts.
Manchmal ist Stärke nicht das, was man tut, sondern das, was man zulässt. In den Tagen danach veränderte sich etwas.
Nicht im Schmerz der war noch da. Nicht in der körperlichen Kraft, die war nach wie vor gering. Aber in meinem Blick auf alles.
Ich hörte auf, jeden Tag mit dem „Vorher" zu vergleichen.
Ich begann, im Jetzt zu leben. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil mir klar wurde, dass es keinen anderen Weg gab, ohne unterzugehen.
Ich nahm Hilfe an. Nicht weil ich schwach war, sondern weil ich menschlich bin. Ich ließ Markus beim Duschen helfen, ich ließ ihn mir Frühstück machen, ich ließ ihn meine Medikamente vorbereiten. Und irgendwann, an einem Tag, der genauso grau war wie jeder andere, fragte ich ihn: „Hast du Angst?"
Er sah mich an. Und sagte: „Ja. Aber ich bin trotzdem da."
Ich weinte. Diesmal laut. Und er hielt mich.
Es war nicht der Moment, in dem alles besser wurde.
Es war nicht die Hollywood-Szene mit Lichtstrahl und Happy End. Aber es war der Moment, in dem ich begriff: Ich bin nicht allein.
Ein paar Wochen später wagte ich meinen ersten Spaziergang.
Nur bis zur Ecke. Aber es war ein Sieg. Ich stützte mich auf Markus' Arm, atmete die kalte Luft ein, spürte den Asphalt unter meinen Füßen und fühlte mich, als hätte ich gerade einen Berg bestiegen.
In meinem Körper war noch viel kaputt. Ich wusste, es würde nicht schnell besser. Vielleicht würde es nie wieder so werden wie früher.
Aber ich lebte. Ich stand. Ich ging.
Und ich hatte Menschen, die an meiner Seite waren. Selbst dann, wenn ich selbst keine Hoffnung mehr hatte.
Ich dachte, es wird besser. Es wurde anders. Aber ich wurde stärker.