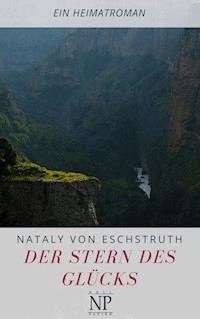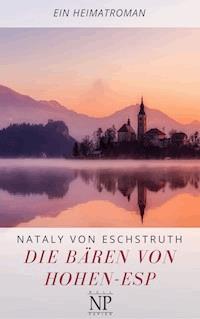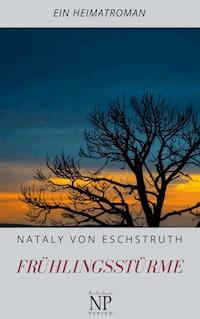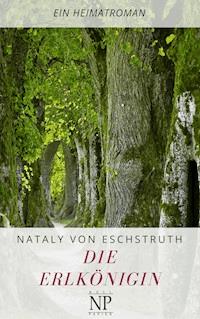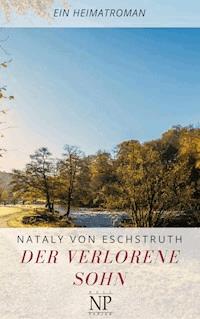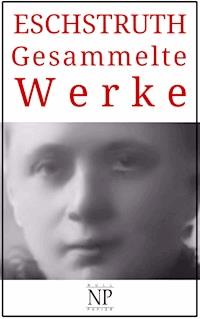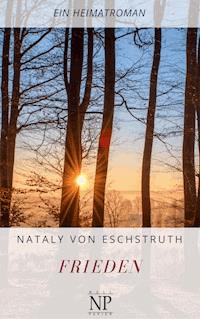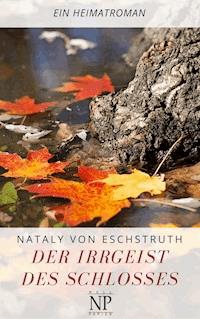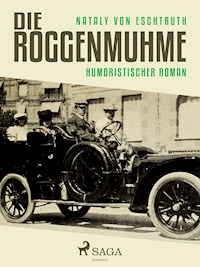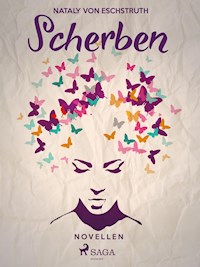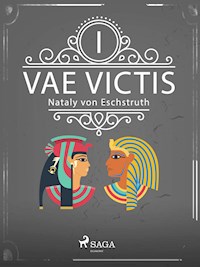Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Nataly von Eschstruth war eine deutsche Schriftstellerin und eine der populärsten und berühmtesten Erzählerinnen der Gründerzeit. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nataly von Eschstruth
Hofluft
Komplettausgabe beider Bände
Nataly von Eschstruth
Hofluft
Komplettausgabe beider Bände
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962810-89-4
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Band 1
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Band 2
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Sonne, Mond, Sterne, Himmelsglanz und Veilchenduft! So schrieb Jean Paul im ersten Entzücken über die Luft der Höfe.
Neumann-Strela.
Band 1
I.
Es war Frühling geworden. Lange Zeit hatte die Newa geduldig den Nacken unter das Joch des Winters gebeugt, hatte den eisglitzernden Panzer getragen, welcher ihre stolz wogende Flut schmal und starr zusammenpresste, und wie die Wagen der Triumphatoren ehemals über den Leib des besiegten Feindes stürmten, so rollten die Lastfuhren, klingelten die Schlitten und sausten die dreispännigen Chariots voll kecken Übermuts über die gefesselte Nixe, die Beherrscherin der alten Zarenstadt. Wohl hatte die klare Wintersonne am Himmel gestanden und mit blendend grellem Lichte Milliarden von bläulichen Funken aus den weiten Eis- und Schneeflächen geweckt, aber ihr Kuss war matt und kühl und verklärte nur die Ketten der gefangenen Freundin, ohne sie brechen zu können. – Als aber das bunte Getreibe der Petersburger immer herausfordernder wurde, und die gewaltige Kristallbrücke der Newa gar zu viel des rastlosen Lebens ertragen musste, da erglühte das Tagesgestirn voll Zorn hinter den Schneewolken, trieb sie auseinander wie Nebelgebilde und forderte mit goldnen Pfeilen den Winter zum Kampf. Und nicht lange währte es, da trieb eine imposante Wasserfläche ihre blauen Wogen zwischen den Steinwällen des Kais und den Granitwänden der Festung hindurch, an den Gärten des fürstlich Sobolefskoischen Palais vorüber.
Ein uralter, prächtig aufgeführter Bau, lag dasselbe etwas erhöht über dem terrassenartigen Park und gewährte aus seinen hohen, durch eine einzige Scheibe geschlossenen Fenstern einen köstlichen Ausblick über die Stadt. Durch das zarte Maigrün der Bäume sah man auf eine weite, platzartige Ebene hinab, auf die etwas entfernteren Straßen und Dächer, aus welchen in gedrängter Fülle Kuppeln und Kirchtürme mit goldblitzenden Pfeilen, kolossale, kasernenartige Gebäude und über denselben die finsteren Festungsmauern emporragten.
Die Balkontür zu einem der Mittelsalons stand geöffnet, und die Sonnenstrahlen, welche das Zimmer durch die fast bis zum Parkett reichenden Fenster wahrhaft überfluteten, verrieten jetzt erst völlig die pomphafte Pracht, welche der Winter solange hinter seinen Dämmerungsschleiern versteckt hatte. Wenn der alte Ausspruch: »von der Einrichtung eines Zimmers lässt sich auf den Charakter des Bewohners schließen«, sich stets bewahrheitet, so musste dieses Boudoir im Palais Sobolefskoi entschieden von der elegantesten, penibelst modernen, zartesten und anmutigsten Frau bewohnt werden. In geschmackvollster Weise waren die einzelnen Stücke des Ameublements zusammengestellt; mit Vorliebe schienen lichte Farben, himmelblau und abricot, verwandt zu sein, hier und da überhangen von duftigen Spitzen, durch zierliche Goldbronzen gestützt und umweht von süßem Blumenduft, welchen überreiche Jardinieren spendeten. Unzählige kleine Kostbarkeiten lagen auf Tischen und Konsolen ausgebreitet, rosa Schleier verhüllten die Lampen, weiche Atlaskissen bildeten trauliche Eckchen, und wo man auch hinblicken mochte, überall schien eine ideale, weiche und unendlich verwöhnte Frauenhand zu walten. Dennoch beherbergte das Palais Sobolefskoi keine Dame, und in dem entzückendsten aller Gemächer, vor dem unter zartesten Nippes fast zusammenbrechenden Schreibtisch saß die schlanke, etwas krankhaft hagere Gestalt eines Herrn, um dessen Schläfen sich das Haar, wenn auch mit peinlichster Sorgfalt jugendlich frisiert, so doch schon grau und spärlich lockte.
Fürst Gregor Sobolefskoi, der Kammerherr des Zaren.
An seiner wie durchsichtig weißen Hand sprüht ein Diamant von seltenster Schönheit, das Ehrengeschenk eines Großfürsten, welches derselbe dem erprobten Freund des Kaiserhauses bei seinem fünfzigjährigen Dienstjubiläum an den Finger gestreift hat.
Fünfzig Jahre im Dienst des Hofes! Fürst Sobolefskoi hatte als zehnjähriger Knabe ersten Pagendienst getan und als achtzehnjähriger Jüngling als Kammerherr seinen Dienst bei einem der kaiserlichen Prinzen offiziell angetreten, nachdem er seit seinen ersten Lebensjahren bereits ein ständiger Gast in der Kinderstube des Winterpalais und des Gatschinaer Schlosses gewesen. Fünfzig Jahre! Wie sich eine Pflanze mit tausend feinen und unlöslichen Wurzelfasern festsaugt und anklammert an den Boden, welcher ihr zur Heimat geworden ist, so ist auch Gregor Sobolefskoi mit dem höfischen Parkett verwachsen, so ist auch er mit unzähligen Banden an den Schlüssel gekettet, welcher für ihn jedes Sein und Existieren erschließt. Das Vermögen des Fürsten ist ungeheuer, er besitzt Ländergebiete, welche er nie in ihrer ganzen Ausdehnung geschaut, er hat Reichtümer bei in- und ausländischen Banken angehäuft, welche er kaum der Zahl nach anzugeben vermag, er könnte selbst einen Hofstaat halten und wie ein kleiner König sein Gebiet regieren, und dennoch beugt er voll fanatischen Eifers sein Haupt im Dienste des Zaren, dessen kleine Winke und Befehle für ihn zum Inbegriff des Lebens geworden sind. Fünfzig Jahre am Hof!
Alle Fäden der harmlosen und nicht harmlosen Intrigen, wie sie das tägliche Leben in Fürstenschlössern so selbstverständlich umspielen und seine Luft erfüllen, wie der gelbe Staub der Kätzchen einen blühenden Weidenbaum umwirbelt, waren entweder durch die Hände Sobolefskois gelaufen oder doch voll brennenden Interesses von ihm beobachtet worden, und ohne diesen kleinen Klatsch, welcher jedes Mal für ihn die Wichtigkeit einer »Krise« annahm, deuchte ihn das Leben unerträglich langweilig und so geschmacklos wie ungesäuertes Brot! Fürst Sobolefskoi kannte alle Elemente der Gesellschaft und war von allen gekannt, es gereichte zu seiner hohen Befriedigung, überall mit ein paar vertraulichen Worten die Hand zu schütteln und mit distinguierten Leuten intim zu sein und höchst wichtigen Gesichts mit irgendeinem Würdenträger zu tuscheln und zu flüstern, wenn ein Publikum dazu anwesend war.
Als Kammerherr ward ihm in späterer Zeit meistens das Ehrenamt, den Hof bei Feierlichkeiten in auswärtigen Residenzen zu vertreten, und alsdann sonnte er sich in dem Glanz der Fürstenkronen, welche ihm jedes Mal einen Strahl in Form eines Ordens gegen die kreuz- und sterngepanzerte Brust warfen. Der Jubel des Volkes, Ovationen und Kundgebungen, waren ihm äußerst sympathisch und berührten ihn, der so völlig mit dem Hofe verwachsen war, genau so angenehm, wie den hohen Herrn, dem sie gegolten.
Ja, er krankte wahrhaft an Sehnsucht, wenn er sie längere Zeit entbehren musste, und fühlte sich geradezu unglücklich, wenn ihn eine Erkältung an das Zimmer fesselte, und ihn hinderte, im Schlosse anwesend zu sein. Tage, an welchen er keine Hofluft atmen konnte, zählte er zu den verlorenen, und der Gedanke, sich durch irgendeine Unvorsichtigkeit die Huld des Zaren zu verscherzen und dadurch seiner Stellung verlustig zu gehen, hatte ihn fünfzig Jahre lang wie ein Gespenst verfolgt. Fünfzig Jahre lang! Und heute saß Gregor Sobolefskoi vor seinem Schreibtisch und wollte die kleine spitzige Feder am goldenen Halter zu scharfem Schwert machen, welches mit einem einzigen Schlag all die Bande, Fäden und Wurzeln zerschlagen sollte, welche den Fürst mit dem kaiserlichen Hof verbanden. Ein großer, weißer Bogen, zur Hälfte gebrochen, lag auf der goldeingelegten Ebenholzplatte, ein zweiter, das Konzept des Schreibens enthaltend, war gegen eine edelsteinbesetzte Stutzuhr aufgestellt, und während die Feder des alten Höflings voll nervöser Hast über das Papier tanzte, klirrten die Orden auf der Brust leise zusammen, als wollten sie die Stimmen wehklagend über solch unerhörtes Beginnen erheben.
Fürst Gregor Sobolefskoi erbat von dem Zaren die Gnade, ihn aus seinem langjährigen Dienst als Kammerherr zu entlassen.
Das Sonnenlicht flimmerte über das ergraute Haupt, und der Schreiber zog sein duftendes Taschentuch, um es mit all jener Grazie, welche ihm zur zweiten Natur geworden, über die hohe Stirn zu führen.
Dann entzündete er eine Wachskerze, kuvertierte das Schreiben und drückte mit umständlicher Genauigkeit das Siegel darauf. Einen Augenblick starrte er regungslos auf den inhaltsschweren Brief nieder, dann stieß er den zierlichen, mit bunten Blumenbuketts gestickten Atlassessel zurück und erhob sich tief aufatmend, um an die offene Balkontür zu treten. Eine jede Bewegung des alten Herrn war von seltener Elastizität und der wohlbemessenen Eleganz, welche zwischen dem Geckenhaften und Formvollen stets scharf die Grenze hält. Der Fürst wurde sehr oft für einen Franzosen gehalten, sowohl seinem Wesen wie seinem Äußeren nach, wozu der schwarz gefärbte, etwas aufgestutzte Bart im Kontrast zu dem weißgrauen Haupthaar eine wohlbegründete Berechtigung gab.
Das Antlitz war schmal und scharf geschnitten, die Augen in tiefdunkler Umrahmung so lebhaft und ausdrucksvoll, dass man die öfters in Anwendung gebrachte Lorgnette lediglich als ein Requisit aus der Rüstkammer der Höflingsmoden ansehen konnte.
Seine Kleidung war stets das Ergebnis peinlichster Sorgfalt, und obwohl über der ganzen Erscheinung Sobolefskois eine etwas weichliche, beinahe weibische Suavität lag, war der Fürst dennoch ein anerkannt geistvoller Mann, welcher nicht allein auf dem Parkett, sondern auch auf manchem Feld der Wissenschaft zu Hause war.
Es genügte ihm durchaus nicht, in leicht tändelnder Konversation von einer schönen Blume des Hofes zur anderen zu flattern, und in dem oberflächlichen Getriebe von Klatsch und Skandal, welche ihn allerdings der Gewohnheit gemäß hochgradig interessierten, fand er durchaus nicht volles Genüge. Der Kammerherr war überall dabei, und gerade dieses rastlose und vielseitige Lavieren in hoher Flut war sein Element.
Und nun wollte er alles aufgeben, was ihm von Kindesbeinen an zur Unentbehrlichkeit geworden war, alles, was bisher sein Leben ausgefüllt hatte, und alles, woran sein Herz und Verstand mit tausend Banden hingen! Sein Herz! nein, eben dieses Herz hing nicht mehr an jener purpurfarbenen Pracht, welche ihn voll starrer Unerbittlichkeit von seiner Liebe trennte.
Das Undenkbare, Unglaubliche, welches die Petersburger Chronique scandaleuse schon längere Zeit als schwebendes Gerücht erfüllte, war zur Tatsache geworden.
Fürst Gregor Sobolefskoi, der Lebemann und eingefleischte Junggeselle, welcher ein halbes Jahrhundert lang kaltblütig an der vornehmsten, lieblichsten, imposantesten und verführerischsten Frauenschönheit aller Herren Länder vorübergegangen war, Fürst Gregor hatte sich mit grauem Kopf noch verliebt – wahnwitzig und sinnlos, wie ein verblendeter Knabe. Und in wen? –
Am Hoftheater war eine neue Sängerin engagiert, die sang mit mäßig guter Stimme die Agathe und Norma und blickte dabei so schwärmerisch und sanft aus ihren braunen Taubenaugen in das Publikum und schüttelte die lichtblonde Lockenfülle so schmachtend in den Nacken, dass sich alle Mannerhände wie hypnotisiert zu stürmischem Applaus erhoben. Aber die dunklen Augen in dem zart ovalen Gesicht und die goldene Haarfülle bildeten auch die einzige Schönheit der Mademoiselle Eglantina Ruzzolane, deren Figur so sylphenhaft schlank war, dass es wie ein diskreter Liebesdienst von den langen Locken erschien, wenn sie gleich einem glänzenden Mantel über Hals und Schultern wallten.
Mademoiselle Eglantina war eine leidlich interessante Person, welche gut in ihre lyrischen Rollen passte, dass sie aber das versteinerte Herz des anspruchsvollsten aller Lebemänner in so ernste und heiße Flammen versetzen konnte, dass er alles aufgab um ihretwillen, das war und blieb der Petersburger Gesellschaft ein großes und unlösbares Rätsel.
Sobolefskoi war auf den Balkon hinausgetreten und starrte gedankenvoll auf das wogende Newawasser, auf die sonnenblitzenden Dächer und Kuppeln des nordischen Paris hinaus, Auch von dieser, so unendlich geliebten Heimat, an welche sich die glücklichsten Erinnerungen knüpfen, haben ihn die zierlichen Federzüge in dem Briefkuvert auf dem Schreibtisch drinnen getrennt, denn wenn Eglantina sein Weib wird, ist ihres Bleibens nicht länger in Petersburg. Und das ist gut.
Der Fürst ist eifersüchtig wie ein Türke, und der Gedanke, sein Weib soweit wie möglich aus hiesigen Verhältnissen zu entfernen, in tiefster Einsamkeit seiner Güter mit ihr allein und nur für sie allein zu leben, hat etwas Bezauberndes für ihn. Er wird wieder jung werden in solchem Maienglück idyllischster Flitterwochen, er wird voll Entzücken seine Freiheit genießen und aufatmen, wenn der lästige Zwang dieses Maschinenlebens voll Dienst und wieder Dienst endlich abgestreift ist!
Eglantinas dunkle Augen werden ihm in tausendmal wonnevollerem Glanz erstrahlen, als alle Fürstensäle der Welt, und die goldenen Locken werden ihn mit magischeren Banden umstricken, als all die Ordensbändlein und goldenen Tressen, welche ihn mit dem Hof verknüpfen! Ja, Fürst Sobolefskoi ist fest entschlossen, alles in die Wagschale zu werfen, um eine dafür zu gewinnen. Er verlacht die Mahnung treuer Freunde und sendet einen reitenden Boten nach dem alten, unendlich einsam gelegenen Schloss am Strand der Ostsee, damit sich dasselbe mit Blütengewinden und Fahnen schmücke, seine junge Herrin zu empfangen! Der Kammerherr beabsichtigt, sofort nach vollzogener Trauung mit seiner Gemahlin nach seinen kurländischen Besitzungen abzureisen.
Die Fluten der Newa blitzen im Sonnengold, süße Duftwogen steigen von den Teppichbeeten des Gartens empor und in Flieder und Goldregengebüschen zwitschert ein frühlingstrunken Vogelvölklein; Fürst Gregor aber schaut lächelnd über all die Lenzespracht hinaus, mitten in die Zukunft hinein, und reißt sich gewaltsam aus den Träumen, tritt auf den weichen Sohlen seiner roten Maroquinlederschuhe in das Boudoir zurück und schreibt mit den stürmenden Pulsschlägen eines Jünglings einen zweiten Brief.
Diesmal zeigt das rosige Papier ein prunkvolles Wappen unter der Fürstenkrone, und von ihm weht ein zartes Maherniaparfüm, und im Nebensalon wartet ein gigantisches Bukett aus Paris, aus lauter Orangeblüten und »brennender Liebe« zusammengestellt, das soll dem Billett die nötige Folie geben.
Fürst Gregor Sobolefskoi hielt in aller Form um die Hand der Demoiselle Eglantina Ruzzolane an.
Der Zar hatte einen kleinen Maiausflug nach Gatschina unternommen und beabsichtigte, etliche Tage in Begleitung seiner Familie in diesem so außerordentlich anmutig gelegenen Schlosse zu verleben.
Vor der breiten Fahrrampe der Fassade hatte die fürstlich Sobolefskoische Equipage gehalten und war dann langsam, an dem Denkmal Pauls I. vorüberfahrend, in eine der Parkalleen eingebogen.
Die beiden riesigen Tscherkessen, welche mit Dolch und Pistolen im Gürtel, in der Vorhalle die Wache hielten, hatten der schmächtigen Gestalt des Fürsten wie etwas sehr Alltäglichem nachgesehen, als derselbe in großer Kammerherrnuniform, leicht und etwas hüpfenden Schrittes die »goldene Treppe« emporstieg. Sonst hatte der alte Höfling unter dem Deckmäntelchen graziöser Pose die Hand meistens auf das prachtvolle, im Renaissancestil gehaltene und schwer vergoldete Gitter gestützt, weil er trotz der Läufer befürchtete, auf den glatten Marmorstufen auszugleiten, heut tänzelte er so frei und sicher die Stufen hinauf, als habe er vollständig vergessen, dass es schon über fünfzig Jahre her war, seit er zum ersten Mal als Knabe diesen Weg gegangen.
Der Kammerdiener des Zaren trat ihm entgegen, und an ihm vorüber schritt Sobolefskoi in das Vorzimmer, in welchem der Adjutant ihn stets mit verbindlichstem Gruß empfangen hatte.
Heut saß derselbe in einem Sessel am Fenster, blickte mit zwinkernden Augen von seinem französischen Journal auf, erhob sich mit kühl-formellem Gruß und wandte sich sehr ostentativ sofort wieder seiner Lektüre zu.
Einen Moment war der Kammerherr befremdet, dann zuckte ein etwas ironisches Lächeln um seine Lippen; schweigend nahm er Platz und wartete, bis er zu Seiner Majestät befohlen wurde.
Die Audienz dauerte nicht lange, aber die Stimme des Zaren klang laut und heftig, in jeder Silbe verständlich bis in das Vorgemach hinaus.
Der Adjutant hatte seine Zeitung langst auf den Tisch zurückgeworfen und war mit leisen Schritten in dem Gemach auf und nieder gewandelt.
»Graf Karnitcheff!«
Der Offizier wandte sich jählings zurück. Zwischen den Portieren stand die imposante Gestalt der verwitweten Palastdame Madame de Loux. Sie legte die schneeweiße, auffallend schöne Hand auf die schwarzen Spitzenschals, welche, von einem Goldkamm des Hinterhauptes herniederfallend, sich auf der Brust unter Brillantagraffen verschlangen, und atmete so schnell und heftig, wie jemand, der sehr eilig gegangen.
»Frau Baronin befehlen?« Karnitcheff glitt eifrig herzu und küsste die dargebotene Rechte galant über dem hohen schwarzen Handschuh.
»Wie steht’s mit Sobolefskoi? Gibt er nach?«
»Ich fürchte, nein!«
»Majestät sind erregt … ah … ich höre ihn deutlich reden. Karnitcheff! Ist denn der Fürst von allen guten Geistern verlassen, dass er noch zu widersprechen wagt? Wenn er sich jetzt nicht fügt, ist alles verloren!« Und Madame de Loux umspannte mit eisernem Griff den Arm des jungen Offiziers und trat in höchster Aufregung einen Schritt näher nach den golddurchwirkten Purpurdecken, welche die Tür zum Arbeitszimmer des Monarchen schlossen.
»Madame … ich beschwöre Sie … zurück!«
»Still, still, die Kaiserin will es wissen«, flüsterte die schöne Frau wie in leisem Zischen entgegen, neigte sich noch einen Moment lauschend vor und wandte sich dann, jah aufschreckend, mit schneller Bewegung zur Tür zurück. »Er entlässt ihn, muss ihn entlassen, der Rasende nimmt ja keine Vernunft an! Nun denn – wie man sich bettet, so liegt man – hier ist Fürst Sobolefskoi von Stund an unmöglich geworden!«
»Selbstredend unmöglich!« triumphierte Graf Karnitcheff und möchte abermals die Hand der reizenden Witwe küssen, sie winkt ihm jedoch hastig ab, lächelt ihm so gut zu, wie sie in diesem Augenblick zu lächeln vermag, und rauscht mit endloser Trauerschleppe über die Türschwelle in die Vorhalle zurück. Als Fürst Sobolefskoi mit hochgerötetem Antlitz in das Vorzimmer zurücktritt, steht der Adjutant am Fenster und scheint anfänglich das Eintreten des Kammerherrn zu überhören, erst als ihn der alte Herr, höflich wie immer, anredet: »Leben Sie wohl, Graf Karnitcheff, ich werde wohl nicht mehr die Freude haben, Sie noch einmal in diesen Räumen wiederzusehen!« wendet er sich kurz um, ignoriert die dargebotene Hand und verneigt sich kalt und stumm wie ein Pagode.
»Wetterfahne!« denkt Sobolefskoi und wendet sich zur Tür.
Als er die Halle durchschreitet, sieht er die beiden Komtessen Imanoff und Madame de Loux in eifrigstem Gespräch vor den Privatgemächern der Kaiserin stehen.
Madame de Loux war stets seine gute Freundin, welche ihn durch tausend kleine Liebenswürdigkeiten geradezu verwöhnt hat, auch die beiden Komtessen hatten ihm stets nur die schönsten Dinge gesagt. Er will seiner Gewohnheit gemäß mit ein paar heiteren Worten zu den Damen herantreten, bleibt aber ganz betroffen stehen, als sich die Köpfchen kaum halb zur Seite wenden, als ein undefinierbarer Blick ihn vom Scheitel bis zur Sohle misst und die drei Begleiterinnen der Zarewna mit kaum merklichem Gegengruß an ihm vorüberschreiten.
Fürst Sobolefskoi ist unmöglich geworden. Einen Moment trifft es den alten Herrn doch wie ein feiner Stich ins Herz, dann lächelt er abermals. Narr, der er ist, zu vergessen, dass Madame de Loux’ idealster Traum ein alter Gatte mit gutem Namen und großem Vermögen ist, der ihr bald zum zweiten Mal den Witwenschleier über das rotblonde Haupt breiten wird! Der Kammerherr bleibt zögernd stehen und lässt den Blick umherschweifen. Zum letztenmal steht er auf dem Marmorboden von Gatschina; wenn er die Schwelle überschreitet, fällt die Tür hinter ihm ins Schloss und schiebt auf ewige Zeiten ihren Riegel zwischen ihn und den Hof des Zaren. In hoher Ungnade hat ihn der Kaiser entlassen, hat ihn für immer aus seiner Umgebung ausgeschieden, und dass kein Bittgesuch jemals den Abgrund solcher Verbannung überbrücken kann, weiß Sobolefskoi.
Mit blitzendem Auge hat der hohe Herr vor ihm gestanden: »Sie sind ein Narr, Sobolefskoi, wenn Sie glauben, in der Liebe eines unebenbürtigen Weibes Ihr Glück zu finden! Ihr ganzes Dasein wurzelt in Ihrer Stellung, Sie werden verschmachten und ersticken wie der Fisch auf trockenem Lande, wenn Sie keine Hofluft mehr atmen!«
Sollte der Zar recht haben? Langsam strich Gregor über die Stirn und lächelte, aber er sog begierig den duftigen Hauch ein, welcher durch die Korridore wehte. Ja, das war Hofluft! Wer kannte sie besser denn er? Balsamisch und wundersam feierlich, süß und streng zugleich, ein Gemisch von »Sonne, Mond, Sterne, Himmelsglanz und Veilchenduft«, wie Jean Paul ehemals voll enthusiastischen Entzückens aus Türingen geschrieben.
Hofluft und Opium gleichen sich, wer einmal von dem berauschenden Gift genossen, kann nicht mehr davon lassen.
Lächerlich, die Liebe überwindet alles, Himmel und Erde, und der feine Hauch dieser geheimnisvollen Hofluft sollte sie gleich leerer Spreu über den Haufen blasen?
Fürst Sobolefskoi hob voll freudiger Zuversicht das Haupt, atmete noch ein paarmal tief aus, gleichsam, als wolle er sich zum letztenmal an heimatlicher Quelle für eine lange Pilgerfahrt satt trinken, und schritt hastig an den Lakaien und Türhütern vorüber, auf die Fahrrampe hinaus.
Eine kraftvolle Tscherkessenfaust fasste den schweren Bronzegriff und drückte hinter ihm wieder die Tür in das Schloss, ganz wie gewöhnlich, diesmal aber tönte das leise Geräusch des Aufklappens ganz wunderbar an das Ohr des verabschiedeten Kammerherrn, wie der Mahnruf einer Uhr, welche verkünden will, dass eine Frist abgelaufen.
II.
Die kurländische Besitzung des Fürsten Sobolefskoi dehnte sich in außerordentlichem Flächengebiet an dem Strande der Ostsee entlang. Auf dem höchsten Punkt einer kurzen Hügelkette ragte ein kolossaler, klosterartiger Schlossbau mit unzähligen Türmen und Türmchen gegen den blaugrauen Himmel empor, ein trutziger Markstein am Baltischen Meere, in dessen bemooste Quadern auch der Stift der Klio seine Runen gegraben.
Voll schwermütig erhabener Schönheit dehnte sich die bleifarbene Unermesslichkeit des Meeres zu seinen Füßen aus, lag weit und unumgrenzt das flache Land in seiner düsteren Waldeinsamkeit, und soweit auch der Blick schweifen mochte, er traf nur ein Bild des tiefsten, traumhaftesten Friedens, zu welchem die rollende See ihr majestätisch Psalmenlied der Ewigkeit sang.
Ja, es war einsam hier, viel einsamer als es sich Fürst Sobolefskoi und seine junge Gemahlin vorgestellt hatten, aber in der ersten Zeit seines jungen Eheglücks hatte der Kammerherr diese Abgeschiedenheit von aller Welt geradezu vergöttert, und Fürstin Eglantina tröstete sich in dem Gedanken, dass solch ein Exil ja nicht ewig dauern könne.
Das Glück ist eine schillernde, eilig dahinschwebende Kugel, und auch der süßeste Duft einer Rose verweht mit der Zeit.
Die Gewohnheit aber ist ein ruhig und sicher daherschreitendes Weib in grauem Nonnengewand, mit kalten, unendlich nüchtern blickenden Augen, das greift mit herber Hand jeglichen Flitterstaat nnd reißt ihn erbarmungslos herunter, das deckt unerbittlich alle Mängel und Fehler auf und zerschlägt die rosigen Brillen, welche der Optimismus dem schwärmerischen Menschenkinde vor die Augen geschoben.
Wenn Mademoiselle Eglantina bei günstiger Beleuchtung auf der Bühne stand und durch die Worte und Melodien, welche andere ersonnen, das Publikum entzückte, war es begreiflich, dass Fürst Sobolefskoi sich ein Leben an ihrer Seite so interessant nnd anregend wie nur möglich dachte, und wenn er sie nun im Schloss von Miskow stundenlang auf einem Diwan liegen sah, apathisch und gelangweilt, unlustig selbst, ein gutes Buch zu lesen, so war eine herbe Enttäuschung unausbleiblich. Die junge Fürstin war eine äußerst gutmütige Frau, welche sich trotz ihrer zweijährigen Bühnenlaufbahn überraschend viel Moral und gute Grundsätze bewahrt hatte, aber sie war ein unbeschriebenes Blatt, ohne Erziehung, ohne Kenntnisse und ohne den mindesten Trieb, sich dieselben anzueignen.
Eine gediegene oder etwas tiefer gehende Unterhaltung mit ihr zu fuhren, war eine Unmöglichkeit, und da sie ohne Bühne und entsprechendes Kostüm ungern sang, wurde das monotone Leben in dem Strandschloss auch selten durch ein paar Lieder unterbrochen.
Anfänglich hatte Eglantinas Geist noch von den Petersburger Erinnerungen und Eindrücken gezehrt, hatte durch die Fremdartigkeit der neuen Umgebung und durch den Reiz, »Fürstin zu spielen«, für kurze Zeit Nahrung erhalten, als aber ein halbes Jahr verstrichen war, und jegliche Anregung von außen mangelte, da wurde der Verkehr mit ihr immer nüchterner und langweiliger, und bald wusste und kannte die junge Frau nichts anderes, als gähnend in den seidenen Kissen zu liegen, Süßigkeiten zu naschen und voll Indolenz die goldenen Locken um die Finger zu rollen. Fürst Sobolefskoi aber mit seinen weitgehenden großen Interessen, verwöhnt durch geistreiche Konversationen und lebhaft berührt durch jegliche Tagesfragen, welche ihm die zahllosen Zeitungen und Journale wie ein Echo aus der großen Welt zuriefen, empfand es geradezu als Qual, nicht das mindeste Entgegenkommen auf seine Passionen bei Eglantina zu finden.
Anfänglich hatte er sich an dem Gedanken berauscht, ihr Lehrmeister zu werden und sie zu sich heranzubilden, doch wurde es ihm bei seiner nervösen, ungeduldigen Natur bald zur Unerträglichkeit, in die verständnislos aufgerissenen Augen seiner Gemahlin zu sehen, welche durch ihren geistlosen Ausdruck jeglichen Scharms verlustig gingen.
Er flüchtete in sein Zimmer zurück und schüttete sein Herz den kleinen Sängern in der Voliere aus, welche ihm wenigstens durch eifriges Zwitschern und Überschreien ihre Dankbarkeit für solche Unterhaltung ausbrückten. Schon stieg es wie ein graues, unheimliches Gespenst aus dem Paradies der Illusionen empor. Fürst Gregor ertappte sich oft bei einem schweren Seufzer und hatte die Zeitungen, welche interessante Hofnachrichten aus Petersburg brachten, schon mehr als einmal heftig zusammengeknäult in den Papierkorb geworfen. Da stieg noch einmal die Sonne am Horizont empor und verscheuchte die Nebel, welche alles Glück zu verschlingen drohten.
Fürstin Eglantina schenkte ihrem Gatten ein Söhnchen.
Eine unendliche, fast exaltierte Freude bemächtigte sich des alten Herrn, als er das auffallend zarte und schwächliche Kind, den Stammhalter seines Namens, auf den Armen wiegte.
All sein Interesse, seine Liebe und Sorgfalt konzentrierten sich auf das kleine Wesen, und wie zuvor die Wochen bleischwer und träge dahingeschlichen waren, so schwanden ihm jetzt die Monate wie im Traume.
Fürstin Eglantina aber ward noch stumpfsinniger als erst und bestürmte ihren Gemahl mit Tränen und Vorwürfen, sie nun endlich in die große Welt zurückzuführen.
Wohin aber sollte sich Fürst Sobolefskoi wenden? Er war überall bekannt, und die Kunde von seiner Mesalliance hatte die vornehme Welt Europas wie ein Lauffeuer durchflogen! Konnte er sich mit seiner so unendlich unbedeutenden Frau, deren Schönheit selbst argen Abbruch erlitten, seit sie bei all der Ruhe und guten Pflege sehr zum Starkwerden neigte, konnte er sich mit ihr zurück in die Gesellschaft wagen, ohne herbe Demütigungen, Spott und Zurückweisungen zu erleben? Nein, Fürst Sobolefsloi will in seinem selbstgewählten Exil geduldig ausharren, bis einst die Erziehung seines Sohnes einen Domizilwechsel notwendig macht.
Außerdem ist er noch immer eifersüchtig. Er hat beobachtet, dass Eglantina den jungen Maler, durch welchen er ihr Porträt hat anfertigen lassen, genau so mit den großen Taubenaugen angeschmachtet hat, wie ehemals ihn. Sie hat das nicht in böser Absicht getan, denn es ist nun einmal ihre Art und Weise, sich durch Blick und Mienen beliebt zu machen, weil sie es nicht mit Geist und Worten kann, aber Fürst Sobolefskoi will es nicht erleben, dass sich die Stutzer und Elegants solch ein Wesen anders deuten. Einer ehemaligen Sängerin gegenüber glaubt sich jeder etwas zu dreisterem Verkehr berechtigt. Eglantina aber behauptet, die Einsamkeit nicht mehr ertragen zu können, sie leidet in der Tat darunter und wird nervös und reizbar in ihrer Ungeduld; es kommt zu heftigen Szenen zwischen den beiden Gatten, welche das Band, das sehr gelockerte Band der Liebe völlig zu zerreißen drohen.
Der Rausch ist verflogen, eine entsetzliche Ernüchterung hat sich statt seiner breit gemacht, und der Kammerherr presst aufstöhnend die Hände vor das Antlitz und denkt an Petersburg zurück, wie an ein verlorenes Paradies.
Dazu kommt es, dass sein Söhnchen in keiner Weise den Hoffnungen des Vaters entspricht. Der kleine Daniel entwickelt sich sehr langsam, Sobolefskoi hat eine geraume Zeit die ernstesten Befürchtungen gehegt; mit größter Sorge und Mühe ist das schwache Kind überhaupt am Leben erhalten, und wo er jetzt sein zweites Lebensjahr erreicht hat, kann er sich kaum auf den Füßchen halten und ist so hässlich, dass bei seinem Anblick das Herz des Vaters blutet.
Kein Geistesfünkchen leuchtet aus den dunklen Augen, welche unnatürlich ernst, beinahe schwermütig ins Leere starren, kein Jubellaut klingt über die Lippen, kein lebensvolles Regen der Arme oder Beinchen, langsam und schwer ist jede Bewegung, und wenn nach langen Bemühungen, den Kleinen zu amüsieren, endlich ein müdes Lächeln über das welke Gesichtchen zuckt, so ist’s nur ein ganz flüchtiges Interesse, welches schon im nächsten Moment wieder dem stieren Vorsichhinbrüten weichen muss.
Noch einundeinhalbes Jahr erträgt Fürst Sobolefskoi die Misere seines Hauses. Seiner Gemahlin ist er fast völlig entfremdet, sie amüsiert sich damit, die kostbarsten Kostüme und Toiletten aus Paris kommen zu lassen, einen berühmten Gesanglehrer zu engagieren und all ihre ehemaligen Opernpartien mit Passion wieder einzustudieren.
Der Kammerherr sieht es gleichgültig mit an, bezahlt die Rechnungen, ohne ein Wort über ihre erstaunliche Höhe zu verlieren, und sitzt stundenlang in der Kinderstube bei seinem Knaben, welcher jetzt endlich zusammenhängende Sätze spricht. Der kleine Daniel ist ein ganz eigentümliches Kind. Er weint oder schreit nie, er hat weder Sympathien noch Antipathien, er blickt jedermann gleich ernsthaft aus dunklen Augen an und regt halbe Tage lang die mageren Fingerchen, um bunte Glaskugeln zu verschiedenen Figuren zusammenzusetzen. Seine Mutter kennt er kaum, sie kommt selten zu ihm, und wenn sie kommt, ist’s nur, um ihre Hand flüchtig über den unförmig großen Kopf gleiten zu lassen und bedauernd auszurufen: »Armer Daniel! Du bist doch gar zu hässlich!«
Fürst Sobolefskoi ist genötigt, eine Reise zu seinem Pariser Bankier anzutreten, und da der Herbstwind bereits die bunten Blätter von den Bäumen reißt und mit scharfem Sausen jene entsetzliche Zeit verkündet, da Miskow in unabsehbaren Schneefeldern begraben liegt, schlingt Eglantina zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Arme um den Hals des Gatten und fleht ihn unter heißen Tränen an, sie mitzunehmen. Ein finsterer Blick trifft sie: »Und wer soll bei Daniel bleiben?«
»Sein ganzer Hofstaat, mit welchem du ihn umgeben hast! Treue Dienstboten, ein vortrefflicher Arzt, fürsorgliche Wärterinnen und meine Gesellschaftsdame, der ich diesen zweiten verlorenen Winter, welchen sie hier in der Grabeseinsamkeit aushalten muss, mit Gold und Brillanten aufwiegen werde!«
Die Fürstin warf die blonden Locken ebenso graziös zurück wie ehemals, da sie noch auf den Brettern stand, und sah dem Kammerherrn mit unwiderstehlichem Blick in die Augen.
»Ich ertrage dieses Leben nicht länger, Gregor. Diese entsetzliche Einsamkeit, welche Herz und Geist verkümmern lässt, ist an all unserem Unglück schuld. Führe mich wieder in die Welt zurück, lass mich die Saison hindurch mein junges Leben genießen, lass mich den Karneval über den vollen Becher des Vergnügens leeren, und ich will ohne Murren den langen Sommer über in Miskow schmachten, ohne dich jemals durch Langeweile oder Launen zu plagen. Dein gehorsames und treues Weib will ich sein, wenn du das Leben redlich mit mir teilen willst! Du liebst die Einsamkeit, wohl, sie soll dir im Sommer werden, ich aber verlange nach Menschen, nach Licht, Leben und Walzerklängen, darum gib mir den Winter mit seiner bunten Lust, und wir beide werden glücklich sein!«
Es lag wieder ein Hauch der früheren Anmut und Lebhaftigkeit über der jungen Frau, welche in reizendster Morgentoilette so vorteilhaft wie seit langer Zeit nicht mehr aussah.
Eine jähe Bitterkeit überkam den Fürsten. Ihr junges Leben genießen! Tanzen und sich amüsieren, und den grauköpfigen Gatten zum Gespötte der Welt machen! Das eben war es, was er nicht dulden wollte, was ihn hinausgetrieben hatte, als Einsiedler hier sein Schicksal zu verfluchen! Er war elend genug, er lechzte am meisten nach Welt und Leben, er schmachtete nach jenem verlorenen Paradies, aus welchem er um ihretwillen entflohen, oder sollte er zurückkehren, so wollte er in der Sphäre leben, welche seine Heimat war, so wollte er Hofluft atmen oder Grabesluft; er konnte den Fuß auf kein anderes Parkett, als das des Hofes setzen, und weil dies unmöglich war, weil er sich selber seine Stellung auf der großen Weltbühne verscherzt hatte, so blieb er nun auch voll finsteren Trotzes hinter den Kulissen, um nicht als Hanswurst bei neuem Auftreten ausgepfiffen zu werden.
Da er aber glaubte, kein Recht zu haben, seiner Gemahlin eine Reise zu versagen, welche er selber unternahm, so zuckte er mit finsterem Blick die Achseln und entgegnete kurz: »Meine Reise ist noch nicht definitiv bestimmt, eine Depesche wird mir sagen, ob ich dieselbe unterlassen kann. Ist dies der Fall, wirst auch du auf einen Aufenthalt in Paris verzichten müssen.«
Mit blitzendem Auge trat Eglantina noch um einen Schritt näher, fiebrische Glut stieg in ihre Wangen, und die geballten, kleinen Hände bebten. »Nein, das werde ich nicht!« rief sie außer sich, »und du wirst mich aus diesem entsetzlichen Klima, dessen Schneeluft Gift für mich ist, entfernen, oder es erleben, dass ich den Zaren um Hilfe anrufe, mich vor der Eigenwilligkeit und Brutalität meines Gemahls zu schützen! Meine Gesundheit erfordert eine Reise nach dem Süden, und gewährst du sie nicht freiwillig, werde ich sie erzwingen!« Der Fürst war erbleicht. Ihre Drohung mit dem Zaren war lächerlich, aber Eglantinas Taktlosigkeit konnte es leicht zuwege bringen, die ganze Misere seiner Ehe nach Petersburg zu posaunen, um ein schallendes Triumphgelächter als Antwort zurückzuerhalten. In jähem Entschluss hob er das Haupt, »Geh, ich halte dich nicht. Lass deine Koffer packen und reise in das Ausland, wohin du willst; wenn auch die Bande, mit welchen der Segen der Kirche unsere Hände zusammengeschmiedet, niemals gelöst werden können, so vermögen wir dennoch eigene Wege zu gehen, und je weiter dieselben auseinanderführen, desto besser, Daniel wird dich nicht vermissen, hoffen wir, dass er seine Mutter wiedererkennt, wenn sie zurückkehrt!«
Einen Augenblick starrte die Fürstin den Sprecher aufs höchste überrascht an, diese Schicksalswendung hatte sie weder gewollt noch erwartet. Nicht aus leichtsinnigen Motiven hatte sie eine Reise erzwingen wollen, sondern lediglich weil ihrer oberflächlichen und genusssüchtigen Natur die Grabeseinsamkeit von Miskow und die stets wachsende Nervosität und Unliebenswürdigkeit Sobolefskois unerträglich wurden. Dass sie nicht im mindesten mit ihm harmonierte, wusste sie, und dass der Fürst sie als Urheberin seines Unglücks, ohne Hofleben existieren zu müssen, ansah, hatte sie empfunden, dass aber seine Liebe zu ihr so vollständig erloschen war, dass er sich von ihr trennte, ohne den mindesten Kampf mit seinem Herzen, das hatte sie nicht geahnt. Aufs tiefste verletzt und gereizt wandte sie ihm den Rücken und schritt nach ihren Gemächern zurück, voll zorniger Hast Befehle zu ihrer Abreise zu geben.
Eine kurze Zeit empfand sie noch Groll und Bitterkeit gegen ihren Gatten, dann siegte schnell ihre lebenslustige Natur, welche sich keinen Vorwurf daraus machte, kraft ihres Namens und Geldes ein wenig von der Welt zu sehen. Hatte sie nicht lange genug an Gregors Seite in dieser Verbannung ausgehalten? Hatte sie ihm nicht treu und geduldig die schönsten Jahre ihres Lebens geopfert? Nun will sie auch einen Lohn dafür haben, denn man heiratet doch schließlich keinen alten Mann, um ihm in eine Einöde zu folgen!
Es steckt eine dämonische Gewalt in dem bunten Flitterstaat und Komödiantenglast! Seit Eglantina wieder gesungen und Schminke auf dem Antlitz gefühlt hatte, erfasste sie eine leidenschaftliche Sehnsucht nach Freude und Genuss, denn auch die Luft, welche das Hoflager der Thalia und Euterpe umweht, hat etwas Zwingendes und lockt mit tausend Gewalten ihre fahnenflüchtigen Jünger zurück! Noch einmal stand Eglantina an dem Bettchen ihres Knaben, dessen gelblich hageres Gesichtchen wie das eines alten Mannes aus den seidenen Kissen schaute. Groß und melancholisch starrten sie die dunklen Augen an, kein Händchen hob sich der Mutter verlangend zu, nur ein leiser Seufzer klang über die Lippen, als die Fürstin etwas hastig und erregt den Kleinen emporhob, ihn zu küssen. Jedes harte Anfassen verursachte dem schwächlichen Körperchen Schmerzen, und so schloss Daniel wie ein Märtyrer stumm die Augen und sah nicht, wie seine Mutter für immer hinter der Tür verschwand.
Für immer! In der ersten Zeit schickte sie kurze Nachrichten und fragte nach dem Ergehen ihres Kindes, dann blieb wochenlang jede Kunde von ihr aus, bis endlich ein langer Brief aus Verona eintraf, jubelnd und glückberauscht. Eglantina schrieb ihrem Gemahl, dass sie im Theater gesessen habe, in der »Lukretia«, als die Sängerin dieser Rolle plötzlich an Vergiftungssymptomen erkrankt sei; kurz entschlossen – die Sache habe ihr einen kolossalen Spaß bereitet! – sei sie aus ihrer Loge auf die Bühne getreten und habe in ihrem schwarzen Spitzenschleppkleid und einem schnell übergeworfenen italienischen Schleier die Partie zu Ende gesungen. Das Publikum sei wie von Sinnen gewesen in seinem Enthusiasmus, nur durch eine kleine Seitenpforte flüchtend, habe sie sich vor den stürmischen Ovationen retten können, und heute sei ganz Verona in Aufregung über die geheimnisvolle Diva. Leider sei ihr Name schon bekannt geworden, und der Theaterdirektor bestürme sie auf den Knien, noch einmal in der ganzen Rolle aufzutreten. Die Lukretia sei stets eine Lieblingspartie von ihr gewesen, und sie könne ihm gar nicht mit Worten das wonnevolle Entzücken beschreiben, mit welchem sie seit so langer Entbehrung den Applaus der Menge vernommen! »Ja, die Euterpe sitzt auf gewaltigem Thron!« schloss der Brief voll Exaltation, »und das Zepter, welches sie schwingt, ist mit Lorbeeren und Rosen umwunden! Wo sie Hof hält, klingen die Zauberweisen der Unsterblichkeit, und wer einmal diese Luft voll Sang und Klang geatmet, diese Hofluft des gemalten Purpurs und der Papierkronen, der ist zu ihrem Sklaven geworden und hängt ihr an, im Leben oder Tod!«
Der Fürst zitterte vor Empörung und jagte eine Depesche nach Verona, welche seiner pflichtvergessenen Gemahlin aufs strengste untersagte, jemals wieder die Bretter zu betreten. Keine Antwort. Nach Wochen endlich ein eingeschriebener Brief aus Rom. Als Sobolefskoi ihn öffnete, fiel ihm ein amtliches Schriftstück entgegen, der Totenschein der Fürstin Eglantina Sobolefskoi; aber um denselben war ein Blatt Papier geschlagen, welches folgende, von der eigenen Hand seiner Gemahlin geschriebene Zeilen enthielt:
»Lieber Gregor!
Man soll nicht gegen die Möglichkeit streiten wollen! Du hast mir befohlen, nie wieder als Sängerin aufzutreten, und ich habe gegen Deinen Befehl gehandelt. Ich habe mit meiner Gesellschafterin die Rollen getauscht, sie spielte die Fürstin, und ich stand in ihrem Dienst, und ich sang allabendlich und feierte Triumphe. Du hast mir einstmals gesagt, Du verzehrtest Dich in Sehnsucht nach der Luft des Zarenhofes; wohl, auch ich verschmachte, wenn ich künftighin ohne die Luft leben soll, welche die Purpurmäntel der Könige des Thespiskarrens umweht.
Und so werfe ich alles hin, was ich besitze, die Fürstenkrone, Geld, Gatten und Kind und flüchte mich zurück in das Paradies, welches ich um Deinetwillen verlassen habe! Und ist’s mein Unglück und mein Tod, ich kann nicht anders! – Ein Zufall kam mir zu Hilfe. Meine arme Gesellschafterin, die Pseudo-Fürstin Sobolefskoi, ist in Neapel an dem Typhus erkrankt und vor wenig Tagen daselbst gestorben. Man fertigte auf mein Verlangen den Totenschein aus, und zwar auf den Namen, den sie geführt, wie dies ja selbstverständlich war. Anbei schicke ich Dir das kleine Stückchen Papier, welches unser beider Freiheit einschließt. Du bist, ebenso wie ich, aller Bande ledig. Fürstin Sobolefskoi ist tot, und ihre Gesellschaftsdame? Die wird nie und nimmer wieder Deine Wege kreuzen. Lebe wohl für ewig, Gregor, bring meinem Knaben den letzten Kuss der Mutter und sei für alles Gute, was Du ihr je getan, gesegnet von
Wera Czakaroff.«
Einen Augenblick griff der Fürst wie schwindelnd nach der Lehne seines Sessels, er ließ das Blatt zur Erde gleiten, schlug die beiden Hände vor das Antlitz und hob sie alsdann inbrünstig gefaltet zum Himmel. Ein einziges Wort zitterte wie ein Jubelschrei von seinen Lippen – »frei!«
III.
Fürst Sobolefskoi las den Brief seiner Gemahlin immer und immer wieder. Ja, es war ein wunderbares Spiel, welches das Schicksal mit ihnen trieb, und ein fast traumhaftes Glück, welches ihm plötzlich seine Freiheit zurückschenkte! Er kämpfte eine kurze Zeit mit seiner Rechtlichkeit und seinem Herzen, ob er von der eigentümlichen Lage der Dinge Gebrauch machen dürfe, doch kam er schnell zu der Einsicht, dass er ein Narr wäre, die Schlinge, welche der Zufall barmherzig gelockert, voll übertriebenen Ehrgefühls wieder um seinen Hals festzuziehen.
War es nicht das beste für Eglantina sowohl wie für ihn selbst, wenn sich eine Grabestiefe trennend zwischen sie riss, eine Tiefe, welche ja nichts weiter verschlang als den Namen eines Weibes und den Titel einer Fürstin Sobolefskoi? Eglantina selber lebte ja und war glücklich, und auch er konnte nun vielleicht zurückgewinnen, was er ehemals mutwillig verscherzt. Dieses kleine Stückchen Papier, welches das Ableben der Fürstin Sobolefskoi dokumentierte, gab zwei Menschenleben ihrer ureigentlichen Bestimmung zurück und erlöste beide von dem schiefen Pfad, auf welchen sie die Verblendung getrieben!
Und was riskiert Fürst Gregor, wenn er einer amtlichen Bescheinigung Glauben schenkt? Nicht er, sondern Eglantina hat ein betrügerisches Spiel getrieben, für welches sie nur allein zur Rechenschaft gezogen werden kann, sollte sie jemals wieder unter den Lebenden auftauchen, denn das Begleitschreiben, welches den Kammerherrn zum Mitwisser des falschen Spiels macht, wird in Asche zusammenfallen, und kein Mensch kann jemals beweisen, dass es in seine Hände gelangte. Und wollten dennoch Skrupel und Besorgnisse warnend ihre Stimme erheben, so wurden sie von den Seufzern fiebrischer Sehnsucht übertönt, welche den ehemaligen Höfling unwiderstehlich nach Petersburg zurückzog. Gleich wildem Heimweh erfasste ihn das Verlangen nach seiner früheren Stellung, und darum gab es kein Besinnen mehr, ob er in Fortunas dargereichte Hand einschlagen solle oder nicht.
Kurz entschlossen barg er die Zeilen Eglantinas in dem Geheimfach seines Schreibtisches, schellte dem Kammerdiener und befahl ihm, das gesamte Dienstpersonal in der Schlosskapelle zu versammeln.
Dort erhielten sie die Kunde von dem Ableben ihrer Gebieterin.
Von dem Frontturm auf Miskow wehte das umflorte Wappenbanner auf halbem Mast, aus den Fenstern hingen die schwarzen Trauerfahnen hernieder, und in düsteren Porphyrbecken brannten Tag und Nacht die gewaltigen Pechfeuer vor der Einfahrt. Das Bild der Fürstin war in der Kirche aufgestellt, umgeben von Palmen und Blütenpracht und beleuchtet von den hohen Wachskerzen, welche auf massiv goldnen Kandelabern zu beiden Seiten des Gemäldes postiert waren.
Nach acht Tagen aber wurden die Fahnen außer dem Halbmastbanner wieder entfernt, die Feuer verloschen, und das Bild Eglantinas ward an seinen alten Platz im Zimmer Sobolefskois zurückgetragen und durch eine schwarze, florüberwallte Wollportiere verhängt.
Die Zeitungen des In- und Auslandes brachten im breiten Trauerrahmen die Todesanzeige der so früh Verblichenen, und Privatanzeigen meldeten den ehemaligen Freunden Gregors die traurige Neuigkeit nach Petersburg.
Nur sehr vereinzelt kamen die formellen Kondolenzschreiben zurück, der Kammerherr aber drückte das Antlitz auf die schwarzgeränderten Bogen und atmete voll Exaltation den feinen Duft, welchen sie ausströmten. Ein Hauch von Hofluft! Direkt aus dem Schloss des Zaren zu ihm herübergeweht, echt und unverfälscht überkommen, zu ihm, dem Geächteten und Verbannten!
Ein Taumel der Wonne überkam den alten Herrn, welcher voll freudiger Hoffnung in neuen Zukunftsträumen schwelgte. Er wird abwarten, bis sich die durch Eglantinas Tod frisch geweckten Erinnerungen in Petersburg verwischt haben, bis der Sommer die Hofgesellschaft zerstreut hat und sie der Herbst mit neuen Interessen und Eindrücken wieder vereint, und dann wird er den großen Wurf wagen, wird sein Haupt in Reue und Demut vor dem Kaiser neigen und zurückkehren in die Welt, ohne welche er das Leben nicht mehr erträgt.
Der Zar hatte dermalen des Fürsten Verbindung mit der Madame de Loux gewünscht und ihm dieses Verlangen bei der letzten Audienz direkt ausgesprochen, und er, der Wahnwitzige, Verblendete, hatte der vorsorglichen Güte seines Gebieters ein schroffes Nein entgegengestellt, hatte voll unbegreiflichen Starrsinns an seiner Bitte um Entlassung aus dem Hofdienst festgehalten.
Den Kammerherrn fröstelt’s vor Entsetzen über sich selbst, wenn er an diese letzte Stunde denkt, aber er will alles sühnen, was er gefehlt, er will Madame de Loux’ kleinen Fuß, mag er sich noch so tyrannisch auf seinen Nacken setzen, demütig und gehorsam wie ein Sklave küssen, alles, alles will er tun, was man von ihm verlangt, wenn man ihn nur wieder auf dem Parkett duldet und ihn die Luft atmen lässt, ohne welche er hier verschmachtet.
Damit tröstet er sich.
Der Sommer vergeht schnell, weil der Fürst ihn zu einer Reise nach Paris benutzt, und als er wiederkehrt, treten ihm Tränen der Rührung in die Augen, als Daniel ihn erkennt und mit seinem resignierten Lächeln die kleine Hand entgegenreicht. Der Knabe hat sich körperlich entwickelt, aber sein stilles, apathisches Wesen ist unverändert dasselbe geblieben. Sein Gouverneur und der Arzt sprechen dem Fürsten die Überzeugung aus, dass keinerlei Besorgnisse für die geistigen Fähigkeiten des Kindes zu hegen sind. Er hat nicht die Art, seine Empfindungen durch Worte oder Zeichen zu äußern, aber es wohnt ein so tiefes und mächtiges Gefühl in dem schwachen Körperchen, wie man kaum für möglich halten sollte. Das beweist er am besten vor seinen Bilderbüchern. Welch ein wonnevolles Aufatmen, welch ein rührendes Lächeln des Mitgefühls, wenn es dem Helden seiner Geschichte und selbst den niedrigsten Kreaturen des Tierreichs gut ergeht, und welch ein stummes, schmerzgefoltertes Zucken der kleinen Glieder, wenn ihm ein Bild irgendwelches oft noch so unbedeutende Leid vor Augen führt.
Fürst Sobolefskoi freut sich solcher Wahrnehmungen auf das herzlichste, aber die Gegensätze zwischen Vater und Sohn sind zu groß, und wenn auch der so nervös erregte alte Herr sich zwingt, Daniel in sein Zimmer kommen zu lassen und eine Stunde lang die entsetzliche Ruhe und Indifferenz des Kindes in einem für beide Teile qualvollen Verkehr zu ertragen, so entfremdet er sich trotzdem immer mehr von ihm.
Dazu kommt es, dass Sobolefskoi bereits mit allen Gedanken in Petersburg lebt und in krankhafter Erregung kaum noch die Zeit erwarten kann, welche für sein Bittgesuch am geeignetsten erscheint.
Endlich dämmert auch jener Morgen, an welchem die Zeitung die Rückkehr der kaiserlichen Familie in die Residenz meldet. Das Schreiben liegt bereits bis auf das Datum vollendet bereit; mit zitternden Händen füllt der Fürst die leere Stelle aus, drückt das Siegel auf und sagt einen reitenden Boten mit dem Brief nach der nächsten Poststation.
Dann unternimmt er mit erregten Schritten eine kurze Promenade, läuft planlos auf der Seeterrasse auf und nieder, bis ihm das monotone Geräusch der Brandung unerträglich wird, und kehrt in sein Zimmer zurück, die Zeitungen weiter zu lesen.
Er überblickt die gedruckten Spalten flüchtig und gedankenlos, legt ein Blatt nach dem andern aus der Hand und greift schließlich nach einem französischen Journal, sich durch Reminiszenzen an Paris zu zerstreuen. Anfänglich langweilt er sich auch hier, plötzlich aber stutzt er und neigt sich frappiert näher. Die kleine Chronik bringt unter verschiedenen Hofnachrichten auch ein sensationelles Gerücht, welches zur Zeit die höchsten Gesellschaftskreise der alten Zarenstadt Petersburg alarmiert. Man spricht von der in kürzester Zeit stattfindenden Vermählung der berühmt schönen Palastdame der Kaiserin, Madame de Loux, mit einem der russischen Großfürsten. Frau Fama will ferner wissen, dass der Zar dieser Verbindung viele Schwierigkeiten in den Weg stellt, dass er dieselbe schon seit Jahren gefürchtet und darum den Wunsch gehegt habe, die schöne Witwe durch eine schnelle Heirat unschädlich zu machen. Die Umstände, welche dermals dieses Projekt, zu höchstem Zorn Sr. Majestät, vereitelten, haben durch ihre romanhaften Details genug von sich reden gemacht, und bringt man mit denselben die Namen eines fürstlichen Kammerherrn und einer Hofopernsängerin in Verbindung.
Die Zeitung schwankte in den Händen des ehemaligen Höflings; farblos wie das weiße Foulard, mit welchem er über die schweißbedeckte Stirn strich, ward sein Antlitz.
Wenn sich dieses Gerücht bestätigte, war alles verloren. Hatte Sobolefskoi in so verhängnisvoller Weise die Pläne seines gnädigsten Herrn gekreuzt, so war keine Hoffnung, den Zaren jemals wieder zu versöhnen, jemals wieder zu Gnaden von ihm aufgenommen zu werden. Und fand auch die Vermählung nicht statt, so war der Fürst dennoch die Veranlassung jahrelangen Ärgernisses für den Kaiser gewesen, denn dass der Großfürst die schöne Witwe schon damals auszeichnete, war Tatsache.
Wer aber hatte zu seiner Zeit geglaubt, dass aus solch einer Courmacherei Ernst werden könne, dass der Prinz aus anderen Motiven, als aus dem »pour passer le temps«, die Koketterien der Baronin mit Galanterie beantwortete?
Der Zar hatte schon damals besser Bescheid gewusst und darum die Starrköpfigkeit seines Kammerherrn so sehr ungnädig aufgenommen, er wusste, dass dem fürstlichen Krösus Sobolefskoi keine Dame der Hofgesellschaft ein Körbchen auf einen Heiratsantrag geschickt hätte! Und damals glaubte Madame de Loux selber noch nicht an ernste Absichten des Prinzen und hätte ihrerseits einer Verbindung mit dem Kammerherrn gewiss keine Hindernisse in den Weg gelegt. Späterhin war das wohl anders geworden, und die intrigante Frau hatte sicherlich Mittel und Wege gefunden, jeden Plan ihres kaiserlichen Herrn geschickt zu vereiteln. Wie oft mochte sich dessen Zorn noch gegen den undankbaren und verblendeten Höfling gerichtet haben!
Sobolefskoi fühlte es eiskalt durch alle Glieder rieseln, und dann wieder stieg die heiße Glut jäher Herzensangst in ihm empor und trieb ihm feuchte Tropfen auf die Stirn.
In maßloser Aufregung verbrachte er den Tag und die folgende Nacht, ruhelos umherirrend, verfolgt von dem Schreckgespenst des Gedankens: »Der Zar ist unversöhnlich!«
Der nächste Tag verging unter Folterqualen der Ungewissheit und Besorgnis, und wenn auch der darauffolgende Morgen eine höchst überraschende, sensationelle Nachricht brachte, so diente dieselbe durchaus nicht dazu, die Befürchtungen des alten Herrn zu vermindern. Die kleine Chronik teilte ihren Lesern die fast unglaubliche, aber doch wahrhafte Tatsache mit, dass am gestrigen Tag in aller Stille und vor nur wenigen Zeugen die Trauung der Madame de Loux und des Flügeladjutanten Sr. Majestät des Zaren, Grafen Karnitcheff in »Peter und Paul« vollzogen sei.
Sobolefskoi wusste, dass weder Madame de Loux noch Karnitcheff Vermögen besaßen, es hatte also den Kaiser sicherlich einen tiefen Eingriff in die Privatschatulle gekostet, diese Vermählung zu ermöglichen. Der Zar aber war allen großen Ausgaben, die hätten vermieden werden können, bitter feind, und darum mochte er nun wohl voll doppelten Grolls an die Renitenz seines ehemaligen Kammerherrn denken, welche ihn ein solch hohes Kapital kostete.
Als schwacher Trost blieb dem Fürsten der Gedanke, dass Zeitungen viele unverantwortliche Dinge melden, dass an dem ganzen Gerücht vielleicht keine Silbe wahr ist und Madame de Loux und Karnitcheff sich aus innigster Liebe, auf ein gutes Avancement des jungen Offiziers hin, geheiratet haben!
Dennoch wusste er, der eingefleischte Höfling, auch wieder allzugut, dass sich manch wunderlicher Roman hinter den Kulissen der Fürstensäle abspielt, und dass mancher Herrscher schon ein edelmütiges Opfer gebracht, seines Hauses (Stammbaum von wilden Schößlingen frei zu halten!
Tag um Tag verging, ohne Nachricht von Petersburg zu bringen.
Sobolefskoi verzehrte sich in fieberischer Aufregung, und je wahrscheinlicher der Gedanke »fortdauernder Allerhöchster Ungnade« wurde, desto krankhafter steigerte sich die Sehnsucht nach jener Welt, aus welcher er sich selber ausgestoßen hatte.
Wohl sagte er sich, dass ein jeder andere europäische Hof ihn zu Gnaden aufnehmen würde, dass er kraft seines Namens, Vermögens und seiner Freiheit imstande sei, daselbst noch eine bedeutende Rolle zu spielen, aber sein Herz und seine Seele hingen mit echter russischer Beharrlichkeit und Treue an seiner Heimat Petersburg, und je unbarmherziger dieselbe die Tore vor ihm schloss, desto gewaltsamer vernarrte der Fürst sich in die Idee, nur noch am Hofe der geliebten Zarenstadt existieren zu können.
Als nach Verlauf von vierzehn Tagen noch immer keine Antwort aus dem Kabinett des Kaisers eingetroffen war, stieg die Aufregung des Kammerherrn zu einem Grade, welcher den Arzt das Schlimmste befürchten ließ. Die Nerven waren zerrüttet, die physischen Kräfte durch Schlaflosigkeit und unregelmäßige, oft völlig ignorierte Mahlzeiten untergraben, einem Schatten gleich, bleich und verstört, wandelte er ruhelos durch die Säle Miskows. Wie ein Spuk huschte in der Nacht das Licht von einem Gemach zum andern, und das Dienstpersonal wich dem Gebieter scheu aus und flüsterte sich heimlich zu: »Es ist nicht mehr richtig in seinem Kopf! Mit dem Tode der Fürstin hat’s angefangen.«
Als Sobolefskoi die Ungewissheit nicht mehr ertragen konnte, schrieb er an seinen ehemals so vertrauten Freund, den Oberhofmarschall, und beschwor ihn, ihm beim Heil seiner Seele klaren und bündigen Bescheid, wie seine Chancen bei dem Zaren stünden, zu schicken, Dann wandte er sich wie ein Mondsüchtiger in das Zimmer seines Sekretärs und befahl ihm, in die Stadt zu fahren, um einen Notar zu holen, er beabsichtigte, sein Testament zu schreiben.
Der Wagen sauste den Schlossberg hinab, und der Fürst begab sich in sein Zimmer zurück, seinen Schreibtisch für jedwedes Auge einzurichten.
Er sortierte die verschiedenen Briefe, vernichtete, was überflüssig war, und schrieb hie und da kurze Bestimmungen oder Bemerkungen an den Rand. Oft hielt er die Hand vor die Stirn und starrte wie geistesabwesend vor sich nieder.
Die Brautbriefe Eglantinas noch einmal durchzusehen, behielt er sich bis zuletzt vor. Er legte jegliches Papier, welches von ihrer Hand beschrieben war, auf ein kleines Tischchen beiseite, und als er endlich danach griff und die Zeilen zerstreut noch einmal mit dem Blick überflogen hatte, warf er jeden einzelnen Brief in die Flammen des Kaminfeuers. Zwei Schriftstücke waren schließlich noch übriggeblieben, das Billett, in welchem Eglantina ihr Jawort gab, und dasjenige, welches sie ihrem Totenschein beigefügt hatte.
Sobolefskoi hielt das duftende Blatt, welches ihn vor fünf Jahren zum Glücklichsten der Sterblichen gemacht und welches ihm dennoch zum Fluch geworden war, einen Moment leicht zusammenzuckend in der Hand. Dann wandte er sich von dem Kamin ab, warf das Billett auf den Tisch zurück und stützte das gedankenschwere Haupt sinnend in die Hand. Nein, dieses Schreiben sollte nicht in den Flammen untergehen, diese liebesheißen, berauschenden Worte voll Innigkeit und Treue sollten einst seinem Sohne Daniel beweisen, dass er um eines solch verheißungsvollen Glückes willen wohl die Narrheit begehen konnte, dem Hof des Zaren den Rücken zu wenden. Dieser Brief Eglantinas musste des Fürsten rücksichtslose Kühnheit, »die Hand der Madame de Loux auszuschlagen«, rechtfertigen. Vielleicht konnte ihn Daniel noch einmal gebrauchen. Dieses Jawort sollte aufgehoben werden, aber der letzte verhängnisvolle Brief seiner Gemahlin, welcher den Tod der Fürstin Sobolefskoi zur Lüge machte, der musste in Rauch und Asche aufgehen, der musste für ewige Zeiten unschädlich gemacht werden.
In wirrer Hast griff der alte Herr nach den beiden Briefen, welche nebeneinander auf der schwarzen Ebenholzplatte lagen, und sah flüchtig darauf nieder.
Dieses waren die Liebesschwüle und jenes die kompromittierenden Eröffnungen – Sobolefskoi warf das eine der Schreiben in das durch feuerfeste Metalle doublierte Geheimfach seines Schreibtisches und schob dasselbe zerstreut in seine Fugen zurück. Kein Auge vermochte seine Existenz zu entdecken.
Dann wandte er sich mechanisch nach dem prasselnden Feuer zurück, zerriss das weiße Blatt, welches er noch in Händen hielt, in zwei Hälften, und ließ es in die Glut herniederwehen. Rote Flammen zuckten auf, und schneller, als es der Blick beobachten konnte, verschwanden die verkohlten Papierflocken zwischen den Eichklötzen der Feuerung.
Fürst Sobolefskoi stand mit verschränkten Armen und starrte finster in die tanzenden Funken, ahnungslos, dass dieselben nicht die letzten Zeilen Eglantinas, sondern ihr liebeheißes Gelöbnis der Treue unter der Asche begruben.
Die Eröffnungen Vera Czakaroffs lagen wohlgeborgen in dem Geheimfach, und über die Türme von Miskow strichen die Raben mit heiserem Unglücksgeschrei. Nach Verlauf einer Woche sprengte der Postkurier in den Schlosshof und überbrachte dem Fürsten die Briefschaften.
Eine unnatürliche, starre Ruhe lag über dem fahlen Antlitz Sobolefskois. Parfümiert und zierlich gekräuselt, wie seit Wochen nicht mehr, lag das graue Haar an den eingesunkenen Schläfen, und der Schnurrbart war schwarz gefärbt, wie in den glücklichen Zeiten am Hofe des Zaren.
Gregor nahm fester Hand ein großkuvertiertes Schreiben entgegen, sah auf die Schrift der Adresse und legte es tief aufatmend auf die Tischplatte nieder. Dann schritt er ernst und feierlich in sein Ankleidegemach, ließ sich die goldstrotzende Galauniform der Kaiserlichen Kammerherren mit allen Orden und Ehrenzeichen anlegen und betrat hierauf das Zimmer seines Söhnchens. Daniel schloss zwinkernd die Augen, als tue ihnen die funkelnde Pracht des Hofkleides weh, der Fürst aber hob ihn auf die Arme, küsste langsam Mund, Wangen und Stirn des Knaben, machte unmerklich das Zeichen des Kreuzes über ihm und legte sekundenlang die Hand auf sein Köpfchen.
Und stumm schritt er wieder durch die Tür in sein Arbeitszimmer zurück.
Gelassen nahm er den Brief, erbrach und las ihn. Seine Hand zitterte nicht, und sein Antlitz war leblos wie Stein.
Dann trat er zum Kamin und vernichtete auch dieses Schreiben.
Auf dem Büchertisch stand ein Kasten mit zwei prachtvollen, mit zwei Edelsteinen besetzten Pistolen, einem Ehrengeschenk des Zaren. Sobolefskoi nahm die eine derselben und spannte ihren Hahn. Wundersam, es war derselbe knackende Laut, wie damals in Gatschina, als die Tür hinter dem Fürsten ins Schloss fiel.
Noch einmal trat er vor das Bild seiner Gemahlin, schlug den schwarzen Vorhang zurück und sah mit gläsernem Blick in die dunklen Augen empor, dann zog er das seine Spitzentuch, welches seit seinem letzten Dienst in Gatschina unverändert in der Brusttasche verblieben war, hervor und presste das Antlitz tief atmend in seine duftigen Falten.
Hofluft! zum letztenmal streifte sie mit ihrem Hauch grüßend seine Stirn. Dann erzitterten die feinen Florstreifen vor Eglantinas Bild unter dem Einfluss einer schnellen Bewegung des ehemaligen Kammerherrn Seiner Majestät des Kaisers von Russland, ein dumpfer Knall … ein Aufschlagen und ein kurzes Röcheln, und dann eine tiefe, tiefe Stille.
IV.
Der Schuss im Zimmer des Fürsten hatte die Mittagsruhe von Miskow weithin durchhallt und eine außerordentliche Wirkung hervorgerufen. Von allen Ecken und Enden stürzte die Dienerschaft in wildem Schreck herzu, ein gellendes Angst- und Jammergeschrei, ein Flüchten und Zuhilfespringen, und zwischendurch klangen die Befehle des Arztes, welcher neben dem Sterbenden kniete und das blutüberströmte, entsetzlich entstellte Haupt auf ein Kissen bettete.
In der großen, planlosen Verwirrung hatte niemand auf den kleinen Daniel geachtet, welcher seinem davoneilenden Gouverneur durch die offenstehenden Türen gefolgt war.
In die düsteren Wollfalten des Vorhanges gedrückt, welcher vor seiner Mutter Bild herniederfiel, stand die schwächliche Kindergestalt und klammerte sich an das schwarze Tuch. Voll stieren Entsetzens richteten sich die weitaufgerissenen Augen auf das grauenvolle Bild, welches sich ihnen bot, die Zähne schlugen wie im Schüttelfrost zusammen und durch alle Fasern und Nerven kroch ein eisiges Grauen und legte sich wie Zentnerlast auf die kleine Brust.
Einen furchtbaren, unauslöschlichen Eindruck machte der Eindruck des schwerverwundeten Vaters auf Daniel, und gleichsam als habe sich die klaffende Wunde in sein eigen Haupt gerissen, litt des Kindes Seele selber jenes Todesweh, welches den erbleichenden Lippen des Sterbenden die letzten Seufzer auspresste.
Endlich bemerkte eine der helfenden Frauen den verwaisten Knaben. Sie sprang herzu, hob ihn erschrocken auf die Arme und eilte mit ihm aus dem Zimmer. Wie gebrochen sank das hässliche, unförmige Köpfchen auf ihre Schulter, kein Laut der Angst oder des Schreckens klang aus Daniels Mund, aber aus seinen Augen brachen Tränen, bittere, heiße Tränen, die ersten, welche er je geweint, wenn nicht ein eigener, körperlicher Schmerz ihm feuchte Perlen an die Wimpern getrieben.
Ja, er war ein eigenartiges Kind, »mein kleiner Schmerzensreich« hatte ihn seine Mutter oft genannt, wenn seine wehmutsvolle Geduld sie mit Rührung erfüllte.
Unter dem Bild seiner verewigten Gemahlin hatte man den Fürsten, der in einem Anfall von Geistesstörung Hand an sich gelegt, gefunden, und vor dem verhüllten Gemälde war er auch wenige Minuten nach seiner Verwundung verstorben.
Auf dem Schreibtisch lag ein offener Brief, welcher die einzige Anverwandte Sobolefskois, die Stiftsdame Gräfin Kathinka Arlowsk, zur Regelung seiner Angelegenheiten und Erziehung seines Sohnes nach Miskow berief; ferner ein versiegeltes Schreiben an des Zaren höchsteigene Person, sowie ein Verzeichnis der ausländischen Banken, welchen er zwei Tage zuvor bare Summen aus seiner Schatulle übersandt.
Die Leiche des Kammerherrn ward an derselben Stelle, wie ehemals das Bild seiner Gemahlin, in der Schlosskapelle aufgebahrt, und als der Reisewagen der Gräfin Arlowsk nach zehn Tagen durch das hohe Portal fuhr, lohten ihr die Pechbrände auf den Steinsäulen entgegen, rauschten über ihr die schwarzen Trauerflaggen im Herbstwind.
Gregor Sobolefskoi war in dem Erbbegräbnis beigesetzt. Sein Testament, in welchem sich der Totenschein der Fürstin vorfand, der auf Wunsch des Kammerherrn gerichtlich verwahrt werden sollte, wurde verlesen, die ausgeschriebenen Legate und Erbschaften gezahlt, die Vormundschaft ernannt und alle weiteren Wünsche und Befehle des Verstorbenen erfüllt.
Gräfin Arlowsk siedelte nach Miskow über, und alles nahm seinen gewohnten, unter den Augen der Stiftsdame streng geregelten Gang.
Mit energischen Händen und einem männlich klaren Verstand verwaltete sie das Eigentum ihres verwaisten Neffen, regierte den wie eine kleine Kolonie bevölkerten Schlossbesitz mit all jener imponierenden Übersicht, welche Sobolefskoi und Eglantina gemangelt hatten, und rodete voll rücksichtsloser Energie alles Unkraut, welches sich während der letzten, herrenlos wirren Zeit unter den Weizen geschlichen hatte.
Gräfin Arlowsk war eine hohe, markige Frauengestalt, welcher die langwallenden Trauergewänder ein geradezu majestätisches Ansehen verliehen. Ihre Haltung hatte etwas Selbstbewusstes und Unnahbares, ihr Wesen flößte viel Respekt, aber keinerlei Zuneigung ein. Kalt und durchdringend scharf blickten die blassblauen Augen, und die Lippen legten sich so farblos schmal auf die Zähne, dass es aussah, als würden sie stets voll herben Unwillens geschlossen. Unter dem Kreppschleier schmiegten sich glatte Haarscheitel, von Silberfäden durchzogen, an die Schläfen, und auf der Brust glänze die schwere Goldkette, welche das Stiftskreuz, ein aus Gold und Eisen gearbeitetes Kruzifix, trug.
Die Gräfin hatte den kleinen Daniel sofort nach ihrem Eintreffen in Miskow zu sehen gewünscht. Man antwortete ihr, dass der Knabe, welcher seit den letzten Tagen wiederholt Anfälle seines asthmatischen Leidens gehabt, schlafe. Sie nahm den hohen Silberleuchter, welcher auf ihrem Toilettentisch stehend brannte, und befahl der Kammerfrau, ihr den Weg zu dem Zimmer des Kindes zu zeigen. Vor seinem Bettchen stand sie, schlug die seidenen Gardinen zurück und beleuchtete den kleinen Schläfer. Eine kurze, scharfe Musterung, bei welcher ihre Züge so hart aussahen, als seien sie aus Stein gemeißelt.
»Wem gleicht er? Vater oder Mutter?«
Die Bonne knixte. »Das ist schwer zu sagen, gräfliche Gnaden; eigentlich ähnelt er beiden Eltern nicht. Durchlaucht die Fürstin war sehr schon und ihr Gemahl schien es in der Jugend ebenfalls gewesen zu sein. Der kleine Fürst ist wohl durch seine Kränklichkeit noch zu unentwickelt, um irgendwelche Spur von dem Erbteil dieser Schönheit aufweisen zu können, doch gibt es eine alte Regel, welche verheißt: ›Was als Raupe geboren wird, steigt als glänzender Schmetterling dereinst zum Himmel!‹ und das Fräulein lächelte dabei so höflich wie möglich und knixte abermals.«