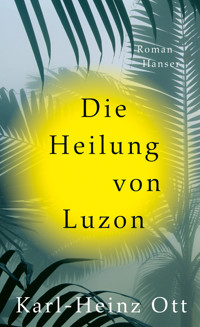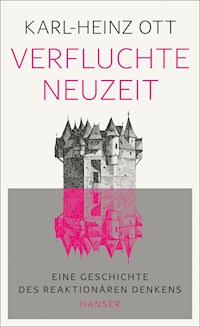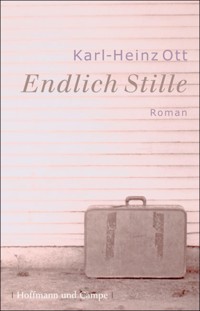Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Dichter zwischen Weltkrieg, Heidegger und Rotem Stern - Karl-Heinz Ott über die Hölderlin Manien des 20. Jahrhunderts Am Eingang des Tübinger Hölderlin-Turms stand jahrelang der Satz aufgesprüht: „Der Hölderlin isch et veruckt gwä!“ Ein Verrückter? Ein Revolutionär? Schwäbischer Idylliker? Oder der Vorreiter aller modernen Poesie? Friedrich Hölderlin, der Mann im Turm, ist umkämpft wie kein zweiter deutscher Dichter. Im 19. Jahrhundert fast vergessen, im 20. Jahrhundert vom George-Kreis wiederentdeckt, von den 68ern als Revolutionär gefeiert: In seinem so witzigen wie gelehrten Essay zeigt Karl-Heinz Ott Hölderlin als großen Spiegel Deutschlands. Tübingen ist der Rahmen; dort hat der Dichter den größten Teil seines Lebens zugebracht, dort geistert er bis heute faszinierend umher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Ein Dichter zwischen Weltkrieg, Heidegger und Rotem Stern — Karl-Heinz Ott über die Hölderlin Manien des 20. Jahrhunderts Am Eingang des Tübinger Hölderlin-Turms stand jahrelang der Satz aufgesprüht: »Der Hölderlin isch et veruckt gwä!« Ein Verrückter? Ein Revolutionär? Schwäbischer Idylliker? Oder der Vorreiter aller modernen Poesie? Friedrich Hölderlin, der Mann im Turm, ist umkämpft wie kein zweiter deutscher Dichter. Im 19. Jahrhundert fast vergessen, im 20. Jahrhundert vom George-Kreis wiederentdeckt, von den 68ern als Revolutionär gefeiert: In seinem so witzigen wie gelehrten Essay zeigt Karl-Heinz Ott Hölderlin als großen Spiegel Deutschlands. Tübingen ist der Rahmen; dort hat der Dichter den größten Teil seines Lebens zugebracht, dort geistert er bis heute faszinierend umher.
Karl-Heinz Ott
Hölderlins Geister
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Tübinger Visionen
Der bräunliche Hölderlin
Die Wahnsinnsmaske
Griechisches Licht
Forever Young
Für Peter Vorbach
Am Rand der Verzweiflung wiederholen sich die Mythen.
Peter Handke, Am Felsfenster morgens
Das Wesen eines Mythos besteht nicht darin, dass alle ihn kennen, sondern dass man glaubt, er sei allen bekannt und er sei würdig, es zu sein; deshalb kannte man ihn auch im Allgemeinen nicht.
Paul Veyne, Glaubten die Griechen an ihre Mythen?
We talked about how to get through a day without the old horizons of belief, and there was relief in that — in hearing another human being say how fucking hard it was, for her as well, just the simple act of living in the world without anything to blunt the edges.
Leslie Jamison, The Recovering
Tübinger Visionen
Alte Burse. Alle Viertelstunde schlagen die Glocken, Verkündigung aus naher Ferne, von was auch immer. Um elf schlagen sie dreiunddreißigmal hintereinander, von jedem Kirchturm anders, die einen voller und runder, die andern dürftiger und höher, die dritten klingen wie von weiter weg. Danach wirkt die nächtliche Stille noch stiller. Man klappt die Bücher zu, steckt die Notizhefte ein und die Stifte, stapft die knirschenden Stufen hinab, schließt die Alte Burse zu und geht hinüber in den Hölderlinturm, wenige Schritte nur. Dort gibt es noch Brot und Wein, schlicht wie beim Abendmahl, Speis und Trank der Götter, deren letzter Jesus ist, will man Hölderlin glauben. Nach Jesus kommt die Götternacht. Sie dauert Jahrtausende, bis heute. Das Christentum hat alles Schöne verscheucht, hat die Welt zum Jammertal gemacht. Doch sie kehren wieder, die Götter, Hölderlin ist davon überzeugt.
In Bielefeld oder Berlin hätte man nie das Gefühl, der Vergangenheit so nah zu sein. Hegel, Schelling, Hölderlin leben noch, in Tübingen am Neckar, man vernimmt ihre Schritte auf dem Kopfsteinpflaster, damals wie heute, bildet sich ein, dass sie die gleichen Glocken gehört haben. Nur heißt der Hölderlinturm damals noch nicht Hölderlinturm, und in der Alten Burse sind noch nicht die Philosophen untergebracht, es befindet sich dort die Authenrieth’sche Klinik, in der man Hölderlin behandelt hat, mit Methoden, über die man heute den Kopf schüttelt. Gleich nebenan das Stift, wo Hegel, Schelling und Hölderlin eine Neue Mythologie entworfen haben: »Die Poesie wird am Ende wieder, was sie am Anfang war — Lehrerin der Menschheit«, heißt es da.
Das Geistige allein ist das Wirkliche. Was hat man nicht schon gelacht über diesen Hegel-Satz! Als handle es sich um philosophischen Irrsinn, um reinstes Gaga, um Idealisten-Hypertrophie. Trotzdem ist es der wahrste Satz, den der Geist je hervorgebracht hat. Aus Geist wird Wirklichkeit, Ideen werden Realität: Das Stift, die Alte Burse, der Hölderlinturm — alles Stein gewordener Geist, Gebäude, in denen Gedanken zu Hause sind, als Wind, als Hauch, als Pneuma; die Wände voller Bücher, ganze Räume mit Regalen voller Hegel, Schelling, Hölderlin, der größte Teil Fußnoten, mit Blick auf die Platanenallee und den Neckar, den schwäbischen Isthmus. Auch die Garonne ist nicht weit, wo Hölderlin den sonnenverbrannten Gesichtern der alten Griechen begegnet, unweit von Smyrnas Ufern, an Ilions Gestaden, die bis Lauffen reichen und bis Nürtingen und bis zu Meister Zimmers Haus, wo heutzutage Stocherkähne liegen.
Die Zeit steht hier noch still, nicht nur bei Nacht. Hört man auf den Gassen Schritte durchs Dunkel hallen, hört man immer auch anderes: die Geister der Vergangenheit, die heimlichen Gesprächslenker.
Hölderlins Aber. Immer wieder das Wörtchen Aber. Jedes Mal horcht man auf, wie Kinder. Jedes Aber lässt an die Bibel denken, man sieht einen Zeigefinger: »Ich aber sage euch …« Jesus gegen die Pharisäer, Jesus gegen die Schriftgelehrten, Jesus gegen den Gesetzesglauben. Hölderlins Aber dagegen besteht aus Bejahung: »Im Hofe aber wächset ein Feigenbaum.« Hölderlins Aber macht diesen Feigenbaum erst bedeutsam, nicht nur ihn, den ganzen Hof. Und mit ihm die ganze Welt. Als sehe man zum ersten Mal einen Feigenbaum, als blicke man überhaupt zum ersten Mal hin, auf alles. Der Feigenbaum wird zum Inbild, wofür auch immer.
Eine neue Mythologie. Den drei Stiftsfreunden Hegel, Schelling und Hölderlin haben es Kants Schriften angetan, wie vielen damals. Kant zertrümmert eine zweitausendjährige Metaphysik, er steckt die Grenzen der Philosophie neu ab. Die Aufklärung verbietet den Rückfall in ein bodenloses Spekulieren, das mit Begriffen wie Gott und Ewigkeit um sich wirft. Allerdings merken die drei schon bald, dass damit auch jeder höhere Sinn schwindet. Kants Vernunft, die alle Denkbereiche ordentlich trennt, zerschlägt jeden Gesamtzusammenhang. Die Wissenschaften haben fortan nichts mehr mit Ethik zu tun, die Ethik nichts mehr mit Ästhetik, alles steht bloß noch für sich. Aufklärung entpuppt sich als nüchternes Geschäft.
Was das Nachdenken übers große Ganze angeht, verlangt Kant radikale Abstinenz. Alles, was mit Gott und dem Unendlichen zusammenhängt, verbannt er ins Reich der Phantasie. Philosophen sollen sich nicht mehr mit den Letzten Dingen beschäftigen, schließlich gibt es darauf keine einzige Antwort, die sich beweisen lässt. Jahrtausendelang hat ein Wirrwarr an widersprüchlichen Thesen und Lehren Kopfgeburt auf Kopfgeburt gehäuft, damit soll nun Schluss sein. Zwar besitzt auch die Phantasie ihre Berechtigung, sie muss sich aber auf das Reich der Kunst beschränken. Sie darf unser Verlangen nach Bildern bewirtschaften und nach Geschichten, die dem Vorstellungsvermögen keine Grenzen setzen, philosophische Relevanz besitzt sie nicht mehr.
Jeder Versuch, die auseinanderfallenden Lebensbereiche wieder zusammenzudenken, führt für Kant in ein Schwadronieren, wie man es viel zu lange kultiviert hat, in sinnloser Hülle und Fülle. Allerdings lassen sich die Fragen nach dem Wohin und Woher nicht per Dekret zum Schweigen bringen. Eine Vernunft, die so viel ausgrenzt, muss in den Augen der drei Stiftler wieder entgrenzt werden. Weder wollen die drei hinter die Aufklärung zurück, noch wollen sie bei Kant verharren. Religionskritik ist gut und recht, nur hinterlässt sie fatale Leerstellen. Die Aufklärung muss ihre eigenen Grenzen erkennen und wieder dem Bedürfnis nach Sinnstiftung nachkommen. Wo Kant auf Trennungen beharrt, sehnen Hegel, Schelling und Hölderlin sich nach neuer Ganzheitlichkeit. Sie wollen die Vernunft aus jenen Ketten befreien, die sie sich selbst angelegt hat.
Schiller geht in seinen Briefen »Über die ästhetische Erziehung des Menschen« bereits einen Schritt in diese Richtung. Mit dem Argument, dass in Kunstwerken eine freischweifende Phantasie und ein methodischer Konstruktionswille ineinandergreifen, sieht er Kants Trennungen überwunden. Wendet man die Kunst aufs Leben an, lassen sich auch dort die Gegensätze überwinden. In Hölderlins Augen genügt das allerdings nicht. Im Oktober 1794 schreibt er an Neuffer, Schiller habe einen Schritt zu wenig über die »Kantische Grenzlinie« gewagt. Während es bei Schiller Sache des Einzelnen bleibt, die Trennungen aufzuheben, drängt es Hölderlin nach einer Harmonie, die alles umfasst.
1917 entdeckt der Philosoph Franz Rosenzweig ein zweiseitiges Manuskript, dessen Urheberschaft bis heute nicht einwandfrei feststeht. Vielleicht stammt es von Hegel, vielleicht von Schelling, vielleicht von Hegel, Schelling und Hölderlin zusammen, vielleicht handelt es sich aber auch um die Abschrift eines fremden Textes. Das Manuskript besitzt keinen Titel, es beginnt mitten im Satz. Unter der Bezeichnung »Ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus« macht es seither die Runde. Seit den 1970er Jahren steht es im Mittelpunkt so gut wie aller philosophischer Debatten, die den intellektuellen Werdegang der drei Stiftler umkreisen oder das Aufkommen romantischer Poetologien in den Blick rücken.
Im Zentrum des »Systemprogramms« steht die Kritik an einer Welt, die immer mehr nach mechanischen Gesetzen funktioniert und es an einem organischen Ganzen fehlen lässt. Man kann das als frühe Kapitalismuskritik deuten und darin den Ruf nach einer Gemeinschaft erkennen, die sich wieder als communio begreifen soll. Allerdings bildet im »Systemprogramm« nicht die Idee der Gerechtigkeit den Mittelpunkt, sondern die der Schönheit. Zwar ist von der angestrebten »Gleichheit der Geister« die Rede, diese Gleichheitsvorstellung orientiert sich jedoch an ästhetischen Idealen, nicht an egalitären. Es geht nicht in erster Linie um Politik, es geht um viel mehr, nämlich um den Wiedergewinn eines allumfassenden Sinns. Das schließt Politik keineswegs aus, doch sie spielt eine untergeordnete Rolle.
Das letzte, größte Werk der Menschheit. Im »Systemprogramm« begegnen wir einer Zeitkritik, die in den gebildeten Kreisen immer lauter wird. In Schillers »Briefen« heißt es: »Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus, ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens, und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft.«
Diese Kritik kehrt in Hölderlins »Hyperion« wieder, wo es heißt: »Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen — ist das nicht wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergoßne Lebensblut im Sande zerrinnt?« Novalis behauptet in seiner Schrift »Die Christenheit in Europa«, der neuzeitliche Religionshass habe »die unendliche schöpferische Musik des Weltalls zum einförmigen Klappern einer ungeheuren Mühle« gemacht, »vom Strom des Zufalls getrieben …, ohne Baumeister und Müller«. Schon Jahre zuvor prägt Rousseau einen Ausdruck, der durch Marx prominent wird: aliénation — Entfremdung.
Rousseau begreift darunter allerdings Umfassenderes als Marx. Für ihn beginnt die Entfremdung schon in dem Moment, wo der Mensch die Nabelschnur zur Natur durchtrennt und die Symbiose mit dem kosmischen Ganzen zerstört. Ginge es bloß um sozialpolitische Fragen, müssten weder Rousseau noch Schiller so grundsätzlich werden, und auch nicht die Verfasser des »Systemprogramms«, in deren Augen sich die Übel der Zeit nur durch eine Neue Mythologie überwinden lassen. Es soll sich um eine Mythologie der Vernunft handeln, bei der Sinn und Sinnlichkeit wieder zusammenfinden und Verstand und Phantasie keine Gegensätze mehr bilden. »Ehe wir die Ideen ästhetisch, d.h. mythologisch machen, haben sie für das Volk kein Interesse; und umgekehrt, ehe die Mythologie vernünftig ist, muß sich der Philosoph ihrer schämen«, heißt es dort. »So müssen endlich Aufgeklärte und Unaufgeklärte sich die Hand reichen, die Mythologie muß philosophisch werden und das Volk vernünftig, und die Philosophie muß mythologisch werden, um die Philosophen sinnlich zu machen. Dann herrscht ewige Einheit unter uns.«
In einer fragmentarischen Abhandlung, die in einigen Ausgaben den Titel »Über Religion« trägt, erklärt Hölderlin, Religion sorge für einen Zusammenhalt, der über alles bloß Mechanische des menschlichen Getriebes und damit über alle wirtschaftlichen, rechtlichen und moralischen Verhältnisse hinausreiche und allem einen höheren Sinn verleihe. Hölderlin verwendet die Begriffe Religion und Mythologie synonym, was aus kulturgeschichtlicher Sicht Fragen aufwirft. Schließlich haben die antiken Göttervorstellungen nichts mit Glaubensbekenntnissen zu tun und nichts mit Dogmen, wie man sie von monotheistischen Religionen kennt. Es gibt dort keine reine Lehre, über die Würdenträger und Institutionen wachen. Mythologien bestehen nicht aus theologischen Gedankengebäuden, sie leben von Götter- und Heldengeschichten, die nichts Bekenntnishaftes besitzen.
Hölderlin kürt die griechische Mythologie zum Vorbild für eine zukünftige, schönere Welt. Das Christentum ist schuld, dass es diese Welt nicht mehr gibt. Mit ihm ist alles auseinandergefallen: Glaube und Wissen, Mensch und Natur, Leib und Geist, Diesseits und Jenseits. Das Christentum hat die Mythologie als Aberglauben bekämpft und an die Stelle bunter Göttergeschichten die nüchterne Wahrheit von Geboten und Verboten gesetzt. Schöner geworden ist die Welt dadurch nicht. Mit dem Ruf nach der Rückkehr des Mythischen drängt Hölderlin auf eine Umwertung der Werte. Schließlich soll der Mensch sich fortan nicht mehr nach einem Leben verzehren, das jenseits des Todes liegt. Er soll seine »Liebe zur Erde« wiederfinden, wie es später bei Nietzsche heißt. Mit den alten Göttern soll jene Natur wiederauferstehen, die vom Christentum entwertet wird. Hinter dem Wogen des Meeres soll sich wieder Poseidon verbergen, den Sonnenwagen wieder Helios lenken, das Donnergrollen wieder von Zeus kommen.
Den alten Griechen ist der Begriff Religion unbekannt. So wenig es für sie eine absolute Wahrheit gibt, so wenig gibt es für sie Häresie. Die Griechen halten die Götter anderer Völker nicht für falsch, sie entdecken in ihnen Abarten der eigenen. Alexander der Große anerkennt auf seinen Feldzügen die Götter der unterworfenen Länder unverzüglich an und weiht ihnen Opfergaben. Das macht nicht nur die Unterwerfung leichter, er vergibt sich dabei auch nichts. Zwischen den verschiedenen Mythologien herrscht Austausch. Dionysos ist ursprünglich nicht in Griechenland daheim, er kommt aus Indien: Import, Export. Bevor die Griechen den ersten Schluck Wein trinken, vergießen sie einen Spritzer für die Götter. Sie kippen damit das Öl weg, das ihn haltbar macht. In der Mythologie ist alles halb so wild wie bei den Religionen.
Den Verfassern des »Systemprogramms« schwebt die große Gleichheit der Geister vor, allerdings eine Gleichheit in Freiheit. Monotheismus und Polytheismus sollen sich nicht nur vertragen, sie sollen eins sein. »Ein höherer Geist, vom Himmel gesandt, muss diese neue Religion unter uns stiften, sie wird das letzte, größte Werk der Menschheit sein«, lautet der abschließende Satz.
Der Große Pan ist tot. Um 100 n. Chr. erzählt Plutarch die Geschichte von Seereisenden, die abends beim Wein sitzen und bei Windstille von fernher eine Stimme vernehmen. Diese Stimme trägt dem ägyptischen Steuermann auf, noch vor der Ankunft im nächsten Hafen aufs Land hinüber zu rufen: Der Große Pan ist tot! Voller Verwunderung fragt der Steuermann sich, ob er dieser Aufforderung nachkommen soll oder nicht. Er beschließt, bei günstigem Wind weiterzusegeln, bei erneuter Meeresstille der Aufforderung nachzukommen. Als vor der nächsten Küste wieder der Wind ausbleibt, ruft er: Der Große Pan ist tot! Worauf vom Land her Klagen zu vernehmen sind und Geschrei und Geheul.
Da an Bord zahlreiche Passagiere sind, verbreitet sich die Geschichte geschwind. Auch Kaiser Tiberius hört davon. Nicht das erste Mal in seiner Regierungszeit sieht er sich vor ein Rätsel gestellt. Pontius Pilatus ist sein Statthalter in Judäa, wo sich ebenfalls mysteriöse Dinge zutragen. Ein junger Mann hat sich dort als Gottes Sohn ausgegeben, deshalb hat man ihn gekreuzigt. Nach drei Tagen sei er jedoch wiederauferstanden, behaupten seine Anhänger. Und nun auch noch das. Tiberius lässt Nachforschungen anstellen.
Plutarch kommentiert die Geschichte vom Tod des Großen Pan nicht, er erzählt sie lediglich nach, ohne jeden Deutungsversuch. In seiner Abhandlung »Vom Verschwinden der Orakel« heißt es allerdings, die Flüsse seien einst voll strömenden Wassers gewesen, nun habe das Land die prophetische Dürre heimgesucht. Man kann darin ein weiteres Zeichen für die Götterdämmerung erblicken. Pan steht für eine Welt, in der es noch kein Christentum gibt. Er versinnbildlicht eine kosmische Natur, die aus Trieb und Drang besteht, in ihrer Animalität jedoch etwas Göttliches besitzt.
Tiberius kommt mit seinen Nachforschungen nicht weit. Vielleicht hat Pan selbst seinen Tod ausgerufen und den Steuermann aufgefordert, diese Nachricht in die Welt hinauszutragen, so wie Jesus auf andere Weise seine Jünger aufgefordert hat: Geht hinaus in die Welt und verkündet die Frohe Botschaft! Der eine gibt seinen Untergang bekannt, der andere verheißt einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo alle Menschen gleich sind, zumindest vor Gott. Plötzlich steht der Mensch ganz anders da, als wenn er bloß Sklave ist oder Ruderknecht von Odysseus. Es bedeutet auch, dass die Erde vor allem für den Menschen gemacht ist, für die Krone der Schöpfung. Er kann sie sich nun untertan machen. All das ist für mich da, kann der Mensch sich jetzt sagen: die Tiere, die Bäume, die Flüsse, die Luft. Ich kann damit tun, was ich will.
Und er sagt es sich so lange, bis sichtbar wird, welche Folgen das hat. Er befolgt dieses Gebot, bis die Klage aufkommt, dass er durch seine Wissenschaft und seinen Fleiß immer barbarischer in die Natur eingreift und sich dadurch selbst immer mehr in einen Barbaren verwandelt, der seiner Gier keine Grenzen setzt. So jedenfalls liest es sich bei Rousseau. Und auch bei Hölderlin. Indem der Mensch sich die Natur gefügig macht, entfremdet er sich von ihr, und damit von sich selbst, schließlich ist er ihr Teil. Diese Klage hallt nicht nur in Marx’ Frühschriften nach, sie ist gegenwärtig bis heute und wird immer lauter. Schon um 1800 führt sie dazu, dass man Volkslieder sammelt und Märchen, wie die Brüder Grimm und wie Tieck und Brentano. Man will von der früheren Welt wenigstens ihre Geschichten retten und ihre Gesänge. Man besingt mit ihnen Bäche, Wälder und Wipfel, in denen sich die Sprache der Natur kundtut. Oder auch den antiken Kosmos, in den der Mensch noch eingebettet war, ganz anders als in eine Welt, die aus christlicher Sicht voll Sünde ist und als Jammertal zu gelten hat.
Ästhetische Ideen. Solange Ideen nicht ästhetisch würden, finde das Volk kein Interesse an ihnen, heißt es im »Systemprogramm«. Ideen dürfen keine bloßen Ideen bleiben, sie müssen sinnlich erfahrbar werden. Allerdings nicht dadurch, dass man ihnen ein schönes Mäntelchen umhängt, sie müssen von innen heraus leuchten. In seinem 1800 erschienenen »System des transzendentalen Idealismus« charakterisiert Schelling das Zusammenspiel aus Phantasie und Philosophie als intellektuelle Anschauung. Bei Hölderlin taucht dieser Begriff bereits in einem Brief vom 24. Februar 1796 auf. Er spricht dort von seiner Suche nach einem Prinzip, das die Trennungen erklärt, »in denen wir denken und existieren, … , das aber auch vermögend ist, den Widerstreit verschwinden zu machen, den Widerstreit zwischen dem Subjekt und dem Objekt, zwischen unserem Selbst und der Welt, ja auch zwischen Vernunft und Offenbarung, … in intellektualer Anschauung«. Er fügt hinzu: »Wir bedürfen dafür ästhetischen Sinn, und ich werde meine philosophischen Briefe ›Neue Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen‹ nennen. Auch werde ich darin von der Philosophie auf Poësie und Religion kommen.«
Mit Philosophie allein ist so etwas nicht zu leisten, sie lebt von einer Reflexion, die Distanz erzeugt: Distanz zur Welt, Distanz zur Wirklichkeit, Distanz zu uns selbst. Was sie zu bieten hat, ist trockene Terminologie, der jede Sinnlichkeit fehlt. Sie verharrt in der Sphäre der Argumentation, der Logik, der Begriffshuberei. Was Hölderlin an ihr zurückstößt, bildet für Hegel allerdings bald schon ihr schönstes Lebenselement. Die Wege der beiden trennen sich früh, allerdings halten beide an der Idee fest, dass man alles Getrennte wieder zusammendenken muss. In Hegels Augen eignet sich dafür am besten die Philosophie, da allein sie die Welt in ihrer Komplexität begreifen kann. Hegel lässt die Tübinger Träume von einer Mythologie der Vernunft nach kurzer Zeit Träume sein, Hölderlin dagegen bleibt dem »Systemprogramm« aus ihrer gemeinsamen Stiftszeit treu. Philosophie spielt für ihn zeitlebens eine untergeordnete Rolle, über allem steht die Dichtung. Hölderlin ist überzeugt, dass einzig sie die Welt verändern kann. In seinem »Hyperion« heißt es von den Athenern, sie wären »ohne Dichtung nie ein philosophisch Volk gewesen«. Auf die Frage: »Was hat die kalte Erhabenheit dieser Wissenschaft mit Dichtung zu tun?«, gibt Hyperion zur Antwort: »Die Dichtung … ist der Anfang und das Ende dieser Wissenschaft. Wie Minerva aus Jupiters Haupt entspringt sie aus der Dichtung eines unendlichen göttlichen Seins. Und so läuft am End’ auch wieder in ihr das Unvereinbare in der geheimnisvollen Quelle der Dichtung zusammen.«
In einem Brief vom November 1798 bezeichnet er die Philosophie als ein Hospital, in das man flüchten kann, wenn es mit der Dichtung nichts wird. Hölderlin weiß, dass man von Dichtung schlecht leben kann, doch es geht ja nicht um sein Leben allein, es geht ums Ganze.
Die gute alte Zeit. Hölderlin glaubt nicht als Einziger, dass die schöneren Zeiten in der Vergangenheit liegen. Allerdings blicken nicht alle wie er in eine Antike zurück, die weniger aus historisch belegbaren Daten und Fakten besteht als aus Visionen. Anders als Hölderlin schwärmt Novalis in seiner um 1800 entstandenen Schrift »Die Christenheit oder Europa« vom guten alten Mittelalter. »Es waren schöne glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches Land war«, heißt es bei ihm, »wo Eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Weltteil bewohnte; Ein großes gemeinschaftliches Interesse verband die entlegensten Provinzen dieses weiten geistlichen Reichs. — … Wie heiter konnte jedermann sein irdisches Tagewerk vollbringen.« Zu Novalis’ Bedauern tauchten eines Tages Protestanten auf, die diese Einheit zerstörten. Sie »trennten das Untrennbare, teilten die unteilbare Kirche und rissen sich frevelnd aus dem allgemeinen christlichen Verein, durch welchen und in welchem allein die echte, dauernde Wiedergeburt möglich war«. Sie haben das »kosmopolitische Interesse« der katholischen Kirche untergraben und Unfrieden in die Welt gebracht und Krieg.
Man entdeckt damals auch die Gotik neu. Seit der Renaissance galt sie als Kunst von Barbaren, wie nur Goten sie hervorbringen konnten. Nun blickt man mit frischem Blick auf sie zurück und behauptet, nie habe es Größeres gegeben. Walter Scott lässt in seinen Romanen das englische Mittelalter wiederaufleben, Victor Hugo verherrlicht im »Glöckner von Notre Dame« das mittelalterliche Paris, Wilhelm Hauff träumt sich in »Lichtenstein« in ein schwäbisches Mittelalter hinein, das man nach Erscheinen seines Romans sogar ein Stück weit wiederzubeleben versucht durch die Errichtung eines Schlosses überm Albaufstieg bei Reutlingen.
Auch für Eichendorff steht fest, dass die heutige Welt alles Übel der Reformation verdankt. Davor war der Mensch noch in eine geistlich-weltliche Ordnung eingebettet, die das Leben mit Sinn erfüllt hat. Sogar der späte Friedrich Schlegel flüchtet in den Schoß der katholischen Kirche, nachdem er in jungen Jahren die freie Liebe gepredigt und die Ironie zum Kernelement aller Kunst erkoren hat.
So unterschiedlich die Sehnsucht nach den alten Zeiten im einzelnen ausfällt, so sehr lebt sie von der Überzeugung, die Moderne mache das Leben weniger lebenswert. Niemals würde Hölderlin das Mittelalter als Hort des Guten und Schönen verherrlichen, es spielt bei ihm nicht die geringste Rolle. Was ihn jedoch mit Novalis und den anderen verbindet, ist der Glaube, einst sei alles besser gewesen, früher habe es keine Vereinzelung gegeben und keinen Mangel an Sinn. Zwar will er die neuzeitliche Freiheit nicht missen, bodenlos soll man sich aber auf keinen Fall fühlen.
Kampf der Entzauberung. Von der Entzauberung der Welt ist erst bei Max Weber die Rede, dass die Aufklärung der Welt jedoch ihren Zauber nimmt, steht schon länger fest. »Wo jetzt nur … / Seelenlos ein Feuerball sich dreht, / Lenkte damals seinen goldnen Wagen / Helios in stiller Majestät«, heißt es in Schillers Elegie »Die Götter Griechenlands«. Auch Goethe lässt seine Iphigenie »das Land der Griechen mit der Seele suchen«. Sofern die Moderne überhaupt an etwas glaubt, glaubt sie vor allem an Technik, Fortschritt, Wissenschaft. Religion dagegen ist zur Privatangelegenheit degradiert. Weil jetzt jeder glauben kann, was er will, muss sich auch jeder seinen eigenen Sinn suchen, einen allgemeinen gibt es nicht mehr.
Und deshalb muss eine neue Mythologie her. Eine neue Mythologie, die nicht hinter die Aufklärung zurückfallen darf, die Welt aber wieder mit Sinn beglückt. Ein sakral glühender Säkularismus soll vollbringen, was ans Unmögliche grenzt: die Quadratur des Kreises. Die Freiheit des Denkens soll gewahrt bleiben, zugleich aber ein wunderbarer Irrationalismus die Menschheit beseelen. Schon Rousseau plädiert in seinem »Contrat social« für eine Zivilreligion, die in religionslosen Zeiten den Zusammenhalt der Bürger gewährleisten soll. Mit Berufung auf Rousseau proklamiert Robespierre den Kult des Höchsten Wesens; er ordnet öffentliche Feste an und Feiern, die die kirchliche Liturgie ersetzen. Ohne Glaube und ohne Mythos geht es offenbar nicht.
Für Hölderlin kommt das Christentum nicht mehr in Betracht, es hält schon viel zu lange an und ist verantwortlich für das Ersterben der griechischen Welt. Mit seiner Jenseitsorientierung verdunkelt es die Welt, woran auch die Reformation nichts geändert hat, im Gegenteil. Für Luther ist die Welt ein Scheißhaus, in dem man sich gegen tausend Teufel bewähren muss. Fragen nach dem kosmischen Ganzen verweist Luther ins Reich leerer Spekulation. In seinen »Reden über die Religion« erklärt der protestantische Theologe Schleiermacher, wer Lehren über den Sinn des Weltganzen zusammenspinne, verlasse den Gedankenkreis des Christentums und sinke in leere Mythologie zurück.
Frühe Auseinanderdrift. Das »Systemprogramm« spiegelt die gemeinsamen Überzeugungen aus der Stiftszeit. Hegel und Hölderlin sind damals um die zwanzig, Schelling erst um die fünfzehn. Wie man den Widerspruch zwischen Freiheitsverlangen und dem Bedürfnis nach allumfassender Sinnstiftung lösen kann, diese Frage beschäftigt alle drei, das ganze Leben lang. Doch früh schon trennen sich ihre Wege, nicht nur geistig.
Schelling bleibt dem Thema Mythologie zeitlebens verhaftet, an ihre Wiederherstellung glaubt er allerdings bald nicht mehr. Hegel sieht in Kunst, Religion und Mythologie geistige Ausdrucksformen am Werk, die ihre einstige geschichtliche Bedeutung verloren haben, zumindest fürs unmittelbare Zusammenleben der Menschen. »Mögen wir die griechischen Götterbilder noch so vortrefflich finden und Gottvater, Christus, Maria noch so würdig und vollendet dargestellt sehen — es hilft nichts, unser Knie beugen wir doch nicht mehr«, heißt es in seinen Ästhetikvorlesungen. Ein Staat lässt sich damit jedenfalls nicht mehr machen, außer er setzt mit Gewalt ein bestimmtes Weltbild durch, was dem neuzeitlichen Freiheitsverständnis zuwider steht. Unser cartesianisches Ideal verlangt, dass wir alles mit der Vernunft prüfen, bevor wir etwas glauben und akzeptieren.
Als einziger der drei Stiftler hält Hölderlin an der Überzeugung fest, nur eine Neue Mythologie könne die Wunden der Moderne heilen. Mit seiner Dichtung will er ihr den Weg bereiten.
Was bleibet aber, stiften die Dichter. Dieser berühmte Hölderlin-Vers besitzt eine gänzlich andere Bedeutung als jener Vers von Horaz, mit dem er sich ewigen Ruhm voraussagt: »Exegi monumentum aere perennius / regalique situ pyramidum altius« — ich habe ein Denkmal errichtet, dauerhafter als Erz und höher als die Pyramiden. Horaz verherrlicht seine eigene Dichtung, Hölderlin geht es um die Menschheit.
Mythos bedeutet Erzählung, nicht weniger, nicht mehr. Erzählungen gibt es viele: die homerischen, die biblischen, Gilgamesch, die Upanishaden, die Edda. Unser abendländisches Denken wird von der griechischen Antike unterströmt und von der Bibel. So gut wie jeder hier kennt die Namen Kain und Abel, David und Goliath, Antigone und Kreon, Jesus und Maria, Orpheus, Prometheus, Odysseus, Ödipus.
Handelt es sich dabei um Dichtung? Gläubige Christen und Juden würden das bei der Bibel bestreiten, und zwar vehement. Haben die Griechen an Zeus geglaubt? Fest steht, dass er in ihrem Leben eine Rolle gespielt hat, so wie bei uns der Nikolaus. Ob wir tatsächlich glauben, dass es ihn gegeben hat, spielt keine allzu große Rolle. Dichtung und Wahrheit werden zuweilen ununterscheidbar. Wir fragen uns in diesem Fall nicht, was daran stimmt und was nicht. Solche Geschichten gehören zu unserer Geschichte, jenseits dessen, ob Zeus oder der Nikolaus wirklich existiert haben.
Was aber will Hölderlin stiften? Glaubt er ernsthaft, man könne sich an den Schreibtisch setzen, eine neue Mythologie entwerfen und damit nochmals ein gemeinsames geistiges Dach über die Welt spannen?
O meine Lust / Pindarisieren, heißt es in Martin Opitz’ 1624 erschienenem »Buch von der Deutschen Poeterey«. Es sollte noch über hundert Jahre dauern, bis mit Klopstock tatsächlich ein deutscher Dichter zu pindarisieren beginnt. Zu diesem Pindarisieren gehört ein hoher Ton und es gehören dazu Verse, die nicht reimselig klappern, sondern sich in kühnen Wendungen zu erhabenen Gesängen emporschwingen. »Harfenbeherrschende Hymnen, / welchen Gott, welchen Heros, welchen Mann sollen wir besingen?«, setzt Pindars zweite Olympische Ode ein. Vor lauter Göttern, Helden und Titanen weiß Pindar gar nicht, wo anfangen. Überall wartet Großes, Gewaltiges, Grandioses.
Seit Goethe dem jungen Hölderlin geraten hat, sich an kleinere Gegenstände zu halten und nicht immer gleich zu Übergroßem zu greifen, löst bei ihm der Name Goethe Krämpfe aus, zeitlebens. Dabei hat Goethe in seiner Sturm-und-Drang-Zeit selbst pindarisiert, viel ungestümer als Klopstock und Hölderlin. Goethe trumpft mit einem Pathos auf, das reichlich theatralisch klingt. Seine Verse sind für Histrionen gemacht, für die Rampe, fürs Gefuchtel, fürs Augenrollen. Was Pindarisieren bedeutet, erklärt Goethe Herder in einem Brief. Es sei, schreibt er ihm, wie »wenn du kühn im Wagen stehst und vier neue Pferde wild, unordentlich sich an deinen Zügeln bäumen, du ihre Kraft lenkst, den austretenden herbei, den aufbäumenden hinabpeitschest und jagst und lenkst und wendest, peitschest, hältst und wieder ausjagst, bis alle sechzehn Füße in einem Takt ans Ziel tragen«.
Goethes Pindarisieren bleibt eine Jugendsünde, wie er später behauptet. Ganz anders ist es bei Hölderlin, der den hohen Ton zu seinem Markenzeichen macht. Zu Hölderlins Pindarisieren gehören häufige Wendungen wie »aber«, »doch«, »nämlich«, »zwar«. In ihnen allen steckt ein Hört und Horcht! »Aber weh! es wandelt in Nacht, es wohnt, wie im Orkus, / Ohne Göttliches unser Geschlecht« — »Aber die Sonne des Geists, die schönere Welt ist hinunter« — »Vom Abgrund nämlich haben / Wir angefangen« — »Zwar leben die Götter, / Aber über dem Haupt droben in anderer Welt.«
Zuweilen verbindet sich ein solches »Aber« auch mit einem Merksatz: »Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch«. Ebenso begegnet man Wortballungen wie »göttlichschön«, »gewittertrunken«, »gedankenvoll«, »tatenarm«, »ewigbang«. Oder Oxymora wie »heilignüchtern« und paradoxen Formulierungen wie: »Nah ist / Und schwer zu fassen der Gott«.
Ein Hang zum Vieldeutigen und Schwerverständlichen zeichnet Hölderlins Verse aus, es ist viel die Rede von den Himmlischen, vom Göttlichen, von Vater Äther. Bescheiden geht es selten zu, stets strebt die Sprache zum Erhabenen, zu »Pindars Flug«, zu »Klopstocksgröße«, wie er selbst formuliert.
Hölderlins hymnischer Ton ist allerdings elegisch getränkt, schließlich besingt er eine Welt, die es nicht mehr gibt. Doch er glaubt an ihre Wiederkehr. Alabanda lässt er seinem Schüler Hyperion erklären: »Die Helden haben ihren Ruhm, die Weisen ihre Lehrlinge verloren. Große Taten, wenn sie nicht ein edel Volk vernimmt, sind mehr nicht als ein gewaltiger Schlag vor eine dumpfe Stirne und hohe Worte, wenn sie nicht in hohen Herzen widertönen, sind wie ein sterbend Blatt, das in den Kot herunterrauscht.« In dem Hymnen-Entwurf »Die Titanen« heißt es: »Viele sind gestorben / Feldherrn in alter Zeit / Und schöne Frauen und Dichter / Und in neuer / Der Männer viel / Ich aber bin allein.« Das soll sich ändern.
Forgotten Songs and Unsung Heroes. »O Bellarmin!«, schwärmt Hyperion, »wo ein Volk das Schöne liebt, wo es den Genius in seinen Künstlern ehrt, da weht wie Lebensluft ein allgemeiner Geist … und fromm und groß sind alle Herzen, und Helden gebiert die Begeisterung.« »Am Tage der Freundschaftsfeier« setzt mit dem Vers ein: »Ihr Freunde! mein Wunsch ist Helden zu singen.« Im »Lied der Freundschaft« heißt es: »Helden der Vergangenheit! / Kommt in unsern Kreis hernieder«; und in dem Gedicht »Der Tod fürs Vaterland«: »Wie oft im Lichte dürstet’ ich euch zu seh’n, / Ihr Helden und ihr Dichter aus alter Zeit!« In »Buonaparte«: »Heilige Gefäße sind die Dichter, / Worin des Lebens Wein, der Geist / Der Helden sich aufbewahrt«. Seinem Freund Bellarmin verkündet Hyperion: »Es gibt große Stunden im Leben. Wir schauen an ihnen hinauf wie an den kolossalischen Gestalten der Zukunft und des Altertums, wir kämpfen einen herrlichen Kampf mit ihnen, und bestehn wir vor ihnen, so werden sie wie Schwestern und verlassen uns nicht.«
In »Heimkunft« heißt es allerdings auch: »Schweigen müssen wir oft; es fehlen heilige Namen«. Wo die Namen fehlen, gibt es auch die Götter nicht mehr. Nur durch Anrufung lassen sie sich wieder zum Leben erwecken. Indem man sie besingt, holt man sie zurück.
»Da rief’ ich den Namen der Helden / In des hohlen Felsen finstres Geklüft, / Und siehe! der Helden Namen / Rief ernster mir zurück«, heißt es in »Am Tage der Freundschaftsfeier«. Im »Archipelagus« macht der Sänger sich auf zu Kastaliens Quelle, um der Schlafenden und Toten zu gedenken: »Dort im schweigenden Tal, an Tempes hangenden Felsen, / Will ich wohnen mit euch, dort oft, ihr herrlichen Namen! / Her euch rufen bei Nacht.« In »Ermunterung« prophezeit der Dichter: »Es kommt die Zeit, / Dass aus der Menschen Munde sich die / Seele, die göttliche, neuverkündet / … // Und er, der sprachlos waltet, und unbekannt / Zukünftiges bereitet, der Gott, der Geist / Im Menschenwort, am schönen Tage / Wieder mit Namen, wie einst, sich nennet.« Und in »Germanien«: »O nenne Tochter du der heiligen Erd’ / Einmal die Mutter. Es rauschen die Wasser am Fels / Und Wetter im Wald und bei dem Namen derselben / Tönt auf aus alter Zeit Vergangengöttliches wieder.«
Die Anrufung von Helden und Göttern gerät zum magischen Akt. Indem er ihre Namen nennt, haucht der Dichter ihnen Leben ein. Aus Wort wird Fleisch, wie es am Anfang des Johannesevangeliums heißt. Dichtung bildet nicht die Wirklichkeit ab, sie erzeugt Wirklichkeit. Im 20. Jahrhundert sieht Heidegger sich durch Hölderlin in dem Glauben bestärkt, Verborgenes ließe sich nur durch dichterisches Benennen wieder entbergen. Für Heidegger ist das Unverborgene gleichbedeutend mit Wahrheit. Es geht dabei nicht um richtig oder falsch, es geht um Anwesenheit. Heidegger drängt es mit Hölderlin in die heidnische Welt zurück, in eine Welt, in der es noch keinen Sokrates gibt und noch keine zersetzende Rationalität.
Indem Dichtung die logo-technische Sprache der Metaphysik untergräbt, verändert sie das Denken. Das jedenfalls erhofft sich Heidegger, mit Hölderlins Hilfe. Mit seinen Versen soll man sich in ein anderes Fühlen, in ein anderes Sehen, ein anderes Denken hineinwiegen. Dadurch lebt man dann auch anders. Mit dem Wandel der Sprache wandelt sich das Sein. In seinen »Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung« erklärt Heidegger, der Dichter müsse »das Heilige darstellen, damit durch sein Sagen die Götter sich selbst fühlen und so sich zum Erscheinen bringen in der Wohnstatt der Menschen auf dieser Erde«. Welche Dimensionen das annehmen soll, lässt Heideggers Satz erahnen: »Dieses Gesetz des Dichtertums der künftigen Dichter ist das Grundgesetz der durch sie zu gründenden Geschichte.«
Wie hat man sich das vorzustellen? Muss man sich Hölderlins Versmusik nur lange genug aussetzen, um sich von ihr nach einer Weile so vollkommen durchflutet zu fühlen, dass man in der Natur wieder Götter am Werk sieht? Damit alles in anderem Licht erscheint? Im englischen spell treffen drei Bedeutungen aufeinander: buchstabieren, bannen, bezaubern. Dichtung wird zum Gottesdienst, zum Zauberwerk, zum Mysterium. Allerdings nicht im christlichen Sinn, zumindest nicht bei Heidegger und Hölderlin.
Herkules-Helden. Wer bei Hölderlin vor allem an Zartes denkt und an Zerbrechliches, blendet seine vielen Heldenanrufungen aus. Wer sich an Pindar orientiert, muss Kämpfe besingen und Siege. Pindar verherrlicht die Sieger der Olympischen Spiele und stimmt Preislieder auf Tyrannen an, die bei Wagenrennen gewinnen. Die Mächtigen geben bei ihm Oden in Auftrag und sie entlohnen ihn fürstlich. Pindars Lieblingsheld ist Herkules. Wer seinen Namen nicht rühme, erklärt er, sei stumpfen, dumpfen Sinns.
»Ihr Freunde! mein Wunsch ist Helden zu singen«, beginnt auch Hölderlins »Am Tage der Freundschaftsfeier«. Auch für ihn geht nichts über Herkules, über Ajax und Achill. »Von ihren Taten nähren die Söhne der Sonne sich; sie leben vom Sieg; mit eignem Geist ermuntern sie sich, und ihre Kraft ist ihre Freude«, heißt es im »Hyperion«. Achill hat Hektors Leiche geschändet, Ajax ist für seinen Zorn berühmt, Herkules ist der schlimmste Rabauke, den die Antike kennt.
Nirgends taucht bei Hölderlin eine Alkmene auf, eine Alkestis, eine Ariadne. Trotz der Symbiosesehnsüchte, von denen seine Dichtungen künden, trifft man nirgends auf einen Sappho-Ton. Lediglich die idealisch entrückte Diotima übernimmt in seinem Kosmos die Funktion eines strahlenden Spiegelbilds, in dem der bedürftige Möchtegernheld sich vervollkommnet sieht. Warum ausgerechnet Pindar zu Hölderlins Vorbildern gehört und nicht Sappho, erklärt sich aus einem Brief, den er im Dezember 1803 an den Verleger Friedrich Wilmans schreibt. »Übrigens sind Liebeslieder immer müder Flug«, heißt es da, »ein anders ist das hohe und reine Frohlocken vaterländischer Gesänge.«