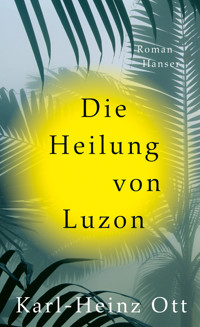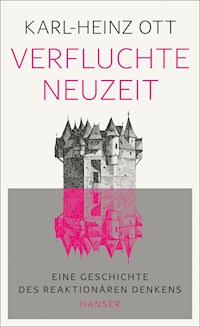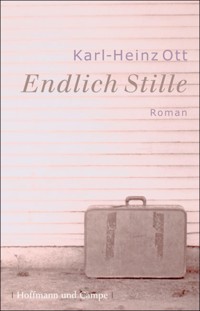9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kastraten und Diven prägen seine Welt, aber auch Philosophen, die über der Frage, ob man die Oper verbieten soll, zu Erzfeinden werden. Dieses mitreißende Buch über Georg Friedrich Händel erzählt, wie ein aus Sachsen stammender Protestant in Italien zu einem furiosen Komponisten der Gegenreformation wird. Dabei wird deutlich, dass Musik nie nur Musik ist, sondern sich ganze Weltbilder in ihr spiegeln. Dieser groß angelegte Essay widmet sich einem Musiker, dessen Opern lange vergessen waren und der heute neu entdeckt wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Karl-Heinz Ott
Tumult und Grazie
Über Georg Friedrich Händel
Hoffmann und Campe Verlag
Für Albrecht Puhlmann
Heute morgen eine Art von Glück,
das (sehr schöne, sehr schwerelose) Wetter,
die Musik (Händel), Amphetamin, Kaffee,
die Zigarre, eine gute Feder, Küchengeräusche.
Roland Barthes, Tagebuch von Urt,18. Juli 1977
Die stinklangweilige Barockmusik
Auf einmal ist alles anders. Man hört wieder hin, staunt und fragt sich, aus welcher Art von Geigen, Pfeifen und Harfen solche Kratz- und Klirrgeräusche kommen, weiß aber oft nicht einmal, wie diese Instrumente überhaupt heißen. Mit Bildern vor Augen wie von alten flämischen Malern, auf denen dickbäuchige Lauten mit langen Hälsen die Hauptrolle spielen und knollennasige Musikanten in Wirtshäusern aufspielen, begegnen wir inzwischen auch in unseren Konzertsälen Klängen, die ein wenig fremd und manchmal beinahe folkloristisch zugleich anmuten, ohne dass wir im Einzelnen wüssten, was eine Theorbe, Erzlaute oder ein Chitarrone ist, jedoch sofort wahrnehmen, wie warm, weich und dunkel Blockflöten im Unterschied zu ihren jüngeren Schwestern, den schrillen Querflöten, tönen. Vor dreißig, vierzig Jahren war das alles noch anders, zumindest im Großen und Ganzen. Wer sich damals aufmachte, auf alten Gamben zu spielen, hatte als Student bei seinem Lehrer alles andere als gute Karten und konnte zuweilen bloß hoffen, nicht gleich hinausgeworfen zu werden. Wer sich auf Barockmusik spezialisieren und sie auch noch anders als gewohnt spielen wollte, musste befürchten, als Versager dazustehen, der ein Schlupfloch sucht, um sein Mittelmaß mit Kuriositäten zu kompensieren. Schließlich dienten Bachs Brandenburgische oder Händels Concerti grossi bei Konzerten vor allem zum Aufwärmen, um erst danach richtig loszulegen. Sieht man einmal von Dirigenten wie Karl Münchinger oder Karl Richter ab, die schon nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Schwerpunkt auf die Zeit zwischen 1700 und 1750 legten, so galt Barockmusik ansonsten als die Vorläuferin einer Klassik, die in Beethoven gipfelt und von dort aus in eine Romantik übergeht, in welcher der symphonische Sound nicht dicht und dick genug klingen und die Orchester nie groß genug sein konnten, um die Abgründe und Aufschwünge der Seele zum Sprechen zu bringen.
Barockmusik dagegen bestand aus solcher Perspektive vor allem aus Nähmaschinengeratter, schematischen Affekt-Arien, Cembalogezirpe und jenem monotonen Rezitativgesinge, wie man es in den endlos sich hinziehenden Passionsmusiken erleben musste, deren pure Länge einem tatsächlich etwas von Christi Leiden zu vermitteln schien. Zwar gehörte für einen Konzertpianisten das Wohltemperierte Clavier allein deshalb zum Pflichtprogramm, weil er beweisen musste, wie behende sich seine Finger auch beim Fugenspiel krümmen lassen, obwohl er vielleicht viel lieber den virtuosen Irrwisch gegeben und mit Rachmaninoffs Getöse brilliert hätte. Die Hochachtung vor der Komplexität der Kontrapunktik musste man aber eben auch zur Schau stellen, selbst wenn sie unterkühlt war und oft reichlich wenig mit Lust und Liebe zu tun hatte.
Für jemanden wie Adorno beginnt die neuzeitliche Musikgeschichte im Grunde eh erst mit Beethoven, aus dessen Symphonien man ganze französische Revolutionen, napoleonische Kriege und tausend subjektive Zerrissenheiten heraushören kann, lauter soziale und seelische Dramen, aus denen sich eine regelrechte Geschichtsphilosophie schmieden lässt. Weil Bach und Händel sich für derlei schwerlich eignen, handelt Adorno fast alles, was vor 1750 komponiert wurde, in Nebensätzen ab, die nicht selten etwas Wegwerfendes besitzen, und sei es, dass er Telemann als eine musikalische Manufaktur abkanzelt oder Heinrich Schütz als einen hölzernen, kontrapunktisch unbedarften Vorgänger von Bach abstempelt. 1955 veröffentlicht er zwar einen Essay mit dem Titel Bach gegen seine Liebhaber verteidigt, in dem er dem Thomaskantor durchaus seine Bedeutung bestätigt, in Wirklichkeit jedoch seinen Anhängern vorhält, jenen Jazzfans zu gleichen, denen es vor allem darum gehe, sich einer eingeschworenen Kennergemeinde zugehörig fühlen und sich von der Masse absetzen zu können. Im Übrigen, so Adornos Diagnose, verberge sich bei den Barock-Verehrern die alte Sehnsucht nach einer Autorität, der man sich mit dem Gefühl, sie frei gewählt zu haben, in einer als haltlos empfundenen Welt unterordnen könne. Auch wenn Adorno dabei ein paar sektiererisch wirkende Zeitgenossen vor Augen gehabt haben mag, wird man den Verdacht nicht los, er ziele im Grunde weniger auf Bachs falsche Liebhaber als diese gesamte Musikrichtung.
Bedeutende Abhandlungen, wie wir sie von ihm in Bezug auf Beethoven, Wagner und Mahler kennen, hat er, was barocke Werke anbelangt, nie vorgelegt. Bedeutsam wird für ihn Musik erst dort, wo man auf das sogenannte bürgerliche Subjekt trifft, was ganz schlicht heißt, dass dabei ein Leiden zum Ausdruck kommen muss, das von der Heillosigkeit einer Welt kündet, die sich am allerwenigsten mit einer religiös inspirierten Musik auffangen lässt. Adornos Kosmos bevölkern jene Verlorenen, metaphysisch Unbehausten, zutiefst Verwundeten, wie wir ihnen angefangen beim romantischen Lied bis hin zu Beckett begegnen, von dem nicht zufällig eines seiner nahezu sprachlosen Zehn-Minuten-Stücke Nacht und Träume lautet. Zwei Männer sitzen dabei somnambul auf einer fast dunklen Bühne, während zwei weitere durch den Raum geistern und wir eine Stimme die letzten sieben Takte von Schuberts titelgebendem Lied singen hören. Eine Kunst, in der das Preisen und Rühmen auch seinen Platz hat, kommt Adorno von vornherein suspekt vor. Schließlich ignorierte er auch Olivier Messiaen, und sei es, weil für ihn ein zeitgenössischer Komponist, der sich als Christ fühlt, als contradictio in adjecto gelten musste.
Ob die Behauptung, dass erst nach der Barockzeit musikalische Subjektivität aufkommt, tatsächlich so evident ist, wie unsere gängigen Geschichtsvorstellungen suggerieren, darf man bezweifeln. Schließlich begegnen wir gerade bei Händel immer wieder einer Musik, die ins Schema einer barocken Affektmaschinerie nicht im Geringsten passt. Selbst wenn die ihnen unterlegten Verse jener Psychologie entraten, deren Zentrum unauflösbare Ambivalenzen bilden, drücken sich in vielen seiner Arien weit schillerndere Seelenzustände aus, als wir sie in den schlicht gestrickten Klage-, Jubel-, Wut- und Liebesgesängen der damaligen opera seria finden. Deutlich wird das bereits daran, dass Händel das übliche da-capo-Schema immer wieder aufbricht und man manchmal kaum ahnt, ob es sich noch um ein Rezitativ oder bereits eine Arie oder beides zusammen handelt, das ineinanderfließt, womit er weit ins 19. Jahrhundert vorausweist. Vor allem in Händels Oper Teseo lassen sich solche Tendenzen erkennen, so etwa in Medeas zwischen innigem Frieden und Verzweiflung schwankendem »Dolce riposo«, das wie eine große Arie beginnt, jedoch nach wenigen Takten seinen rezitativischen Charakter verrät, um dann sofort wieder in einen dramatischen Gesang überzugehen, wobei diese gesamte Szene mit zwei Arien, die sie hintereinander singt, und einem aufgewühlten Streit-Duett, das sich dem auch noch anfügt, nahezu das Ausmaß eines ganzen halben Aktes annimmt.
Andererseits muss man jemandem wie Adorno zugutehalten, dass es zu seiner Zeit kaum Gelegenheiten gab, Barockmusik anders als von Orchestern zu hören, die einen satten, durch die Romantik geprägten symphonischen Sound pflegten, was bei Händel und Bach gerade dann, wenn er strahlen sollte, oft ungemein dick, schwerfällig, breit und sogar breiig klang, ganz zu schweigen von solchen Sängern, die auch noch gravitätisch auf die Tube drückten und filigrane Gesangsgirlanden in Wagnersche Heldengesänge zu verwandeln suchten. Allerdings gehörte Adorno auch zu denen, die es für einen Rückfall in schiere Barbarei hielten, wenn diese Musik ernsthaft wieder auf alten Instrumenten gespielt werden sollte. Im Übrigen war er der Meinung, man brauche Händel, wenn es ums Polyphone gehe, erst gar nicht zu erwähnen, da Händel seine Fugen in einem pastosen Stil ertränke, der – wie er formuliert – keine Durchartikulation des Gewebes dulde. Mit solchen Bemerkungen offenbart er nicht nur eine erstaunliche Unkenntnis, sie sagen vor allem auch etwas darüber aus, wie zähflüssig und klebrig eine solche Musik damals gespielt wurde. Selbst die Aufnahmen eines Karl Münchinger und Karl Richter, die bis weit in die siebziger Jahre hinein als vorbildliche Interpretationen galten, wirken von heute aus gesehen derart tranig und träge, dass man meinen könnte, die sogenannte Alte Musik wolle uns vor allem trübsinnig machen. Bei der damaligen Vorliebe für sämige Streicherkantilenen schienen die Musiker gar nicht genug in ihrem schwerblütigen Sostenuto schwelgen zu können, womit sie allerdings dafür sorgten, dass Heerscharen von Jugendlichen, die bei ihren Eltern an müden Sonntagmorgen solche Erbaulichkeiten über sich ergehen lassen mussten, nie wieder etwas von Klassik wissen wollten.
Umso erstaunlicher, dass Die vier Jahreszeiten inzwischen nicht mehr wiederzuerkennen sind und die Geigen seit jüngstem wie im Eis knirschende, mit Metall beschlagene Fuhrwerksräder klingen und überhaupt kein einziges Instrument sich mehr so anhört, wie wir es bislang von ihm kannten. Auf einmal scheinen wir von einem unentwegten Zirpen, Knarren, Sirren und Scharren, von Windgeheul, Taubengeturtel, Kettengerassel und Hufgeklapper umgeben zu sein, als erstehe wie nie zuvor eine ganze Welt um uns herum, die man tatsächlich mit Augen zu sehen meint, eine Welt zwischen Breughelscher Winterstimmung und venezianischem Karneval, mit lauter Lautmalereien, angesichts derer man sich wundert, wie sie solchen sonst so rein klingenden Instrumenten wie einer Flöte und Laute überhaupt entlockt werden können. Nicht anders ist es bei Telemanns Hamburger Ebb & Fluth, wenn die Elemente zu toben beginnen, und zwar mit einer Lust und einer Wucht, als könne man von jenen wilden Stürmen gar nicht genug bekommen, die musikalisch auszuleiern beginnen, wenn die Winde ins Land hinein ziehen. Nur muss eine solche Musik eben federnd leicht und furios zugleich gespielt werden. Wen einst bei Händels Wassermusik eine lähmende Müdigkeit überkam, der kann auch sie längst neu entdecken, so etwa in der Einspielung von Harnoncourts Contentus Musicus, die so eckig und energisch, vital und kantig klingt, dass manche sie bei ihrem Erscheinen Ende der siebziger Jahre sogar für eine Parodie hielten. Dabei spricht allein das äußerst innig gespielte Andante in d-Moll, aber auch alles andere gegen jede satirische Absicht, ganz abgesehen davon, dass es inzwischen weit kühnere Zugriffe auf dieses Werk gibt. Was jedoch Harnoncourt und mit ihm alle, die im Namen einer historischen Aufführungspraxis frischen Wind ins Musikleben brachten, anstrebten, war die Wiederbelebung einer Klangrede, die mit jenem auf Hochglanz getrimmten Schönheitsideal aufräumt, wie wir es vor allem mit dem Namen Karajan verbinden, unter dem Harnoncourt als junger Cellist im Orchester gespielt hat.
Karajan steht dabei symptomatisch für eine Entwicklung, die mit der feldherrnartigen Beherrschung riesiger Orchestermassen im 19. Jahrhundert einsetzt, und zwar bereits zu einer Zeit, als der italienische Komponist und Dirigent Gaspare Spontini sich in Berlin anno 1819 den Titel eines Generalmusikdirektors zulegt, wie er an unseren Opernhäusern immer noch in Gebrauch ist. Wenn heutige Barockensembles auch die Symphonien von Beethoven und Schubert in kleineren Orchesterformationen spielen, lassen sich dabei musikalische und gruppendynamische Motive kaum auseinanderdividieren, zumal es zu den wesentlichen Anliegen einer historischen Aufführungspraxis gehört, an einem so durchsichtigen Klang zu arbeiten, dass nicht die Melodie das einzig Wichtige ist und alle restlichen Instrumente die Rolle einer Gitarre übernehmen. Wenn Debussy bemerkt, noch niemand habe Bachs Musik nachpfeifen können, hat er damit zwar nicht grundsätzlich recht, trifft aber einen richtigen Punkt. Schließlich verdankt sich die Anziehungskraft der wiederentdeckten Barockmusik ja unter anderem dem Umstand, dass auf einmal wieder allerlei Seitenlinien zum Vorschein kommen, Seitenlinien, die einen wie selten zuvor aufhorchen und merken lassen, wie polyphon eine Partitur selbst dort klingen kann, wo es sich nicht einmal um etwas Kontrapunktisches handelt. Statt mit einem Klangteppich haben wir es auf einmal mit einem Stimmengeflecht zu tun, angesichts dessen man zuweilen nur staunen kann, was sich dabei in den Zwischenlagen alles abspielt.
Ganz anders dagegen jener symphonische Grandiositätsgestus, bei dem eine ganze Infanterie aus Geigern, Paukern und Bläsern ein vollkommen homogenes Klanggewoge hervorzaubern soll, das wie jene blitzblank polierten Posaunen zu glänzen hat, die in den hinteren, höheren Reihen das streichende Fußvolk überragen. Damit ein solcher Strahleklang immer strahlender klinge, wird die Instrumentenstimmung seit langem ständig höhergetrieben, was inzwischen dazu geführt hat, dass der Kammerton bei manchen Orchestern beinahe schon die Grenze von 450 Hertz erreicht, während er zu Barockzeiten noch unter 400 lag. Auch hier steuert die Barockbewegung entschieden zurück, zumal ihr an nichts weniger als an einer Brillanz liegt, die sich selbst genügt. Als Karajan in einem Radiointerview einmal gefragt wurde, wie er die Musik von Alban Berg einstudiere, antwortete er: »Ich übe mit den Musikern so lange, bis sie schön klingt.« Ob es der Sinn von Alban Bergs Werken ist, vor allem schön zu klingen, darf allerdings genauso wie im Falle der Vier Jahreszeiten bezweifelt werden.
Jene »respektvolle Langeweile«, die – wie Adorno meint – manchen Leuten beim Hören von Barockmusik ein »masochistisches Entzücken« bereite, verdankte sich weit weniger der Musik selbst als denjenigen, die sie zu Gehör brachten. Ganz abgesehen davon war in musikalischer Hinsicht die Barockzeit eh weitgehend unentdeckt, sieht man einmal von jenen akademischen Nischen ab, in denen man sich mit ihr schon lange intensiver beschäftigt. Doch außer Bach, Vivaldi, Händel und ein bisschen Scarlatti standen bei Kammermusiken allenfalls noch gelegentlich Namen wie Albinoni, Corelli und Couperin auf dem Programm, wenn es um die Zeit vor Haydn und Mozart ging. Wer, außer einigen wenigen, kannte schließlich schon Emilio de’ Cavalieri, Alessandro Grandi, Giacomo Carissimi, Andrea Gabrieli, Giulio Caccini oder Stefano Landi, ganz zu schweigen von Komponisten, die geschichtlich noch weiter zurückliegen? Inzwischen hat sich jedoch eine Welt eröffnet, in der wir bei der Alten Musik unentwegt Neues entdecken, was keineswegs aus rein historischem Interesse geschieht, sondern vor allem deshalb, weil man gar nicht mehr begreifen will, dass wir uns so lange mit dem klassisch-romantischen Repertoire zufriedengeben konnten.
Dabei war der Aufstand groß, als sich immer mehr Musiker dazu entschlossen, ihre neuen gegen alte Instrumente einzutauschen und die Dinge anders, als man es gewohnt war, zu spielen. Schließlich fanden nicht nur solche Publikumslieblinge wie Yehudi Menuhin, dass Darmsaiten glanzlos klingen und sich Originalinstrumente nur stumpf und dumpf anhören. Dass jemand das Bedürfnis haben kann, wieder auf stählern, blechern, schnarrend und knarrend klingenden Hammerklavieren Haydn zu spielen oder Saiten auf seine Geige zu spannen, die unablässig nachgestimmt werden müssen, war in ihren Augen absurd. Bach, so hieß es, würde heutzutage auch auf nichts anderem als einem Steinway seine Kunst der Fuge zum Klingen bringen wollen und wäre dankbar dafür, dass es einen solchen technischen Fortschritt gibt. Während die historisch Orientierten an ihren alten Instrumenten die ungeahnte Klangpalette rühmten, klang in den Ohren ihrer Kritiker das, was ein Harnoncourt oder Hogwood hervorbrachten, nur wie eine einzige Sägerei und ein ungeschlachtes Geschrubbel, dem jeder Glanz und jede Eleganz abgehen. Rau, grob, ungeschliffen sei es und nichts anderes, hieß es entsetzt, als seien manche Zeitgenossen aus unerfindlichen Gründen in einen Rückschritt vernarrt, den man für immer überwunden glaubte.
Dass es reine Absicht sein kann, keinen Hochglanz zu erzeugen, sondern kratzig, harsch und bizarr zu klingen, belegen allein Rameaus höchst lautmalerische Cembalostücke, die Titel wie La Poule (das Huhn), La Follette (die Verrückte), La Boiteuse (die Hinkende), Le Rappel des Oiseaux (der Wachruf der Vögel) oder Les Sauvages (die Wilden) tragen. Wer es vermag, entlockt dabei dem eh schon spitz und scharf klingenden Cembalo allerlei Geräusche, die sich nach Scharren und Knarren, Zwitschern und Zirpen, Gerassel und Geklapper, Seufzern und dem Getrommel von Tambourinspielern anhören, durchmischt mit orientalischen Anklängen und Fanfarengelärm. Was Rameau alles an Naturgewalten zum Klingen bringen will, erleben wir wie nirgends sonst in seinem lautmalerisch kaum zu überbietenden Opéra-Ballet Les Indes Galantes, das unserem Gehör über Stunden hinweg ein berauschendes Schauspiel bietet, vom aufgepeitschten Meer und dem orkanartigen Wüten der Winde über ganze Erdbeben bis zum friedlichen Säuseln des Zephyrs. Wie sehr Rameau es um eine überbordende Affekt- und Bildersprache zu tun ist, belegen auch Spielanweisungen, wie sie sich etwa über einem Satz aus der Suite Hippolyte et Aricie finden, über dem nicht etwa Musette, sondern bruit de musettes geschrieben steht, was man mit Musette-Geräusch bzw. Musetten-Krach übersetzen könnte.
Natürlich ging auch damals dieses Imitatorische und Expressive manchen zu weit, wie etwa dem Philosophen Rousseau, der sich nebenbei als Komponist betätigte und für Diderots Enzyklopädie die Musik-Artikel verfasste. In seinen Augen muss Musik eingängig und sanglich sein, was heißt, dass der Komponist die Rolle des Orchesters möglichst klein zu halten hat und es auf keinen Fall zum überschäumenden Klangkörper aufblähen darf. Zwischen ihm und Rameau entstand deshalb eine Debatte, die nicht nur zwischen Gluck und Piccini, sondern auch im 19. Jahrhundert zwischen Belcanto-Anhängern und solchen wiederaufflackerte, die von der Oper mehr als nur eine Art Liederabend erwarten. Es ist ein Streit, der im Grunde bis heute anhält und auch fortdauern wird, zumal es dabei um die Frage geht, ob eher das Melodiöse oder Expressive, das Schöne oder Drastische im Vordergrund zu stehen hat. Dass das eine das andere keineswegs ausschließen muss, beweist wiederum Händels Musik, in der das Kantable und Kraftvolle, Gesangliche und Gewaltsame, Lyrische und Dramatische – oder man könnte auch sagen: Italienische und Rameausche – ganz selbstverständlich zusammengehören.
Die Fähigkeit, aus einer Partitur auch und gerade dann ein Ereignis zu machen, wenn der Notentext, wie es nicht nur bei Händel üblich ist, zuweilen reichlich spärlich aussieht, setzt eine viel freiere musikalische Phantasie voraus, als man sie bis vor kurzem noch für erlaubt hielt. Dabei sollte sich die Vitalität, mit der Barockensembles anfangs tatsächlich nur Werke aus Händels und Bachs Zeit aufführten, so ansteckend auswirken, dass längst auch Haydn und Mozart, Beethoven und Schubert merklich frischer und farbenreicher als noch bis vor wenigen Jahrzehnten klingen. Und wenn John Eliot Gardiner sich mit seinem Orchestre révolutionnaire et romantique an Berlioz’ Symphonie Fantastique macht, gerät selbst hier, wo wir ein wildes Toben gewohnt sind, auf einmal alles glasklar, als ließe jedes Instrument sich jederzeit von allen andern unterscheiden, ohne dass dem Ganzen deshalb etwas an Erregung abhandenkäme, nur dass alles Auffahrende und Aufgepeitschte auf einmal weniger lärmend, sondern zuweilen sogar richtiggehend tänzerisch und auf wahrlich musikantische Weise schmissiger klingt. Interessant an dieser Entwicklung ist, dass nicht nur Barockspezialisten wie Harnoncourt oder Minkowski längst bis ins tiefe 19. Jahrhundert vorstoßen, sondern ebenso Dirigenten, die sich nicht der historischen Spielweise verpflichtet fühlen, Impulse von ihr aufnehmen. Als Claudio Abbado beispielsweise vor einigen Jahren Beethovens Symphonien neu einstudierte, arbeitete er mehr denn je jene vielen Stimmen heraus, die dem Wuchtigen dieser Werke auf einmal ein lichtes Gepräge geben können.
Vollkommen anders, als es ihnen prophezeit wurde, sollten ein Hogwood oder Harnoncourt keine Einzelfälle bleiben, sondern zum Motor einer musikalischen Bewegung werden, die mit so gut wie allem aufräumt, was im Klassikbetrieb vor einem halben Jahrhundert noch als hoch und heilig galt. Das betrifft nicht nur unsere gewandelten Klangvorstellungen, sondern auch das Selbstbild von Musikern, die es sich nicht mehr vorstellen können, einem Chef untertan zu sein, der das Orchester piesackt. Karl Böhms legendäre Widerwärtigkeiten und Karajans ikonenhafte Selbstinszenierungen, all das mag es in Ansätzen zwar immer noch und immer wieder geben, doch nicht zufällig sind die beiden in Zusammenhängen groß geworden, die man sich vor allem politisch nie mehr zurückwünscht. Von heute aus gesehen wirken ihre autokratischen Attitüden und Allüren reichlich lächerlich, doch sie haben nahezu ein Jahrhundert lang eine Atmosphäre geprägt, die von Gigantomanie und Subordination geprägt war.
In so manchen Barockensembles, die sich vor zwanzig, dreißig Jahren gegründet haben, wurde zuerst einmal monatelang über alle Arten von Phrasierungsmöglichkeiten und Tempovorstellungen geredet, bevor man ein Konzert gab. Bei jedem Ton sollte geklärt werden, warum man ihn so und nicht anders spielt, jeder Übergang wollte gemeinsam überlegt sein, und überhaupt gab es rein gar nichts mehr, was von vornherein als selbstverständlich galt, vor allem keinen Chef, der sagt, wo es langgeht. Auch die erste Geige wechselte zuweilen bei so gut wie jedem Konzert, und zwar schon deshalb, damit jeder die gleiche Verantwortung übernimmt und eine andere Kultur des Zusammenspiels eingeübt wird. Dass inzwischen auch hier der Alltag Einkehr gehalten hat und es längst wieder herkömmliche Aufgabenzuweisungen gibt, scheint schon deshalb unvermeidlich zu sein, weil das Habermassche Ideal vom herrschaftsfreien Dialog voraussetzt, dass Ergebnisse erst dann zustande kommen dürfen, wenn immer alle mit allem einverstanden sind. Wer nach einem solchen Prinzip zu arbeiten versucht, darf keinerlei Zeitdruck unterliegen und sollte möglichst frei von dem Zwang sein, auch Geld verdienen zu müssen. Wer aber je ein Barockensemble auf der Bühne agieren sah, weiß, dass es in aller Regel einen weit lebendigeren Eindruck als jene Orchester macht, in denen der Einzelne nichts anderes als ein kleiner Teil des Ganzen ist und in einem Repertoirebetrieb funktionieren muss, der keine langen Diskussionen darüber erlaubt, ob die Mehrheit der Musiker sich lieber auf Wagner oder Mahler, Verdi oder Strauss, das 18. oder 20. Jahrhundert kaprizieren möchte. In ein Barockensemble dagegen drängen vermutlich in erster Linie Musiker, die viel genauer wissen, was sie wollen, und die in aller Regel noch weit häufiger als die meisten Orchestermusiker in kleineren Formationen auftreten, ohne dabei nur auf Gigs aus zu sein. Auch wenn man sich mit Idealisierungen zurückhalten muss und der inzwischen allgegenwärtig gewordene Barockbetrieb ebenfalls etwas Routinemäßiges besitzt, meint man nach wie vor zu sehen, wie anders diese Musiker in das, was ihren Alltag ausmacht, involviert sind.
Als Reinhard Goebel mit der Musica Antiqua Köln im Jahre 1986 Bachs Brandenburgische Konzerte herausbrachte, standen die Leute Kopf, und zwar sowohl die Begeisterten als auch die Entsetzten. Das sechste Konzert in B-Dur etwa spielt dieses Ensemble bei höchster Präzision derart rasant, dass man es auf Anhieb kaum wiedererkennt. So wild und trotzdem unerhört transparent, wie es klingt, entdeckt man auf einmal einen Bach, der einen im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr ruhig auf dem Stuhl sitzen lässt. Wie die einzelnen Stimmen sich dabei verhaken und wieder voneinander lösen, bringen diese Musiker Linien zum Vorschein, die früher nur als Füllsel galten und gar nicht als solche wahrgenommen wurden. Derart kühn und frech, wie hier mit furioser Spielfreude ein Feuerwerk entfacht wird, fragt man sich aber auch, wie es möglich sein konnte, dass Heerscharen von Musikern das Potential einer solchen Musik über eine so unendlich lange Zeit hinweg nicht erkannten. So unerhört neu, wie Alte Musik hier klingt, will es einem zuweilen sogar scheinen, als könne man alles, was nach ihr kam, zuerst einmal vergessen, vor allem jenes 19. Jahrhundert, in dem man nicht selten den Eindruck gewinnt, es handle sich um ein reichlich forciertes Klanggewoge, das mitunter umso öder wirkt, je mehr man zu merken glaubt, wie ergriffen es einen machen will.
Die historische Spielweise zeichnet sich zunächst einmal dadurch aus, dass man die Myriaden von willkürlich hinzugefügten Artikulationsangaben vergessen muss, die den barocken Partituren erst später hinzugefügt wurden. Schließlich findet sich in ihnen von der Romantik an kein einziger Takt mehr, der nicht mit Phrasierungsbögen, Pedalvorschriften, Staccatotupfern, Crescendo- und Decrescendo-Pfeilen, Forte- und Pianozeichen und sonst noch allerlei Humbug übersät worden ist. Dass Bach mit Franz Liszt nichts zu tun hat, schien man nicht nur nicht wahrhaben, sondern widerlegen zu wollen. Und obwohl beispielsweise Busoni in seinem 1916 erschienenen Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst das romantische Wallen und Schwallen weit hinter sich zu lassen gedenkt, erdrückt er Bachs Cembalowerke mit endlosen Anweisungen wie »Molto tranquillo e gravemente, serioso, sostenuto e sempre sottovoce«, gefolgt von ständig wechselnden Vorschriften wie »mormorando«, »dolcissimo sospiro« und »più cantabile«. Die Bässe verdoppelt er eh so gut wie immer, und auch im Diskant werden fast alle Akkorde verfettet, sodass seine Bach-Arrangements so aussehen, als handle es sich um Sonaten von Brahms.
Während bereits Beethoven, aber vor allem Komponisten wie Schumann und Mahler ihre Werke mit einer Unzahl von Vortragsanweisungen ausstaffieren, sehen Partituren aus der Barockzeit in dieser Hinsicht vollkommen karg und kahl aus. Der Ruf »Zurück zum Original!« kann deshalb nur heißen, dass man sich an den Handschriften orientiert und spätere Ausgaben ignoriert. Dass wir, wie etwa im Falle Händels, oftmals keine Autographe mehr besitzen, macht die Sache zwar nicht einfacher, doch auch nicht so kompliziert, dass man wie vor dem Nichts stünde, zumal bereits viel gewonnen ist, wenn man den ganzen Wust an später hinzugefügten Vortragsanweisungen einfach ausblendet. Weil wir über unsere klassisch-romantische Tradition allerdings nicht per Dekret hinwegsehen können, bleibt einem nur die Möglichkeit, deren Klangideale auf den Prüfstand zu stellen, was zuerst einmal heißt, dass wir sie nicht auf die Barockzeit anwenden. Wie sehr bis heute der Drang vorhanden ist, selbst Werke aus dem frühen 17. Jahrhundert in Wagnersche Klangwogen zu verwandeln, belegt Henzes Bearbeitung von Monteverdis Il ritorno d’Ulisse in patria. Vom Ungewohnten, Sperrigen, Andersartigen der Monteverdischen Musik bleibt dabei nichts mehr übrig, ganz zu schweigen davon, dass von Transparenz keine Rede sein kann und die Sänger wahrlich walkürenhaft drauflosdröhnen müssen. Dass das Bedürfnis, den Klang zu verdichten und ihn gleichzeitig geschmeidiger zu machen, schon bei Mozart aufkam, zeigen seine Bearbeitungen des Messias und anderer Werke von Händel, die im Auftrag des Barons van Swieten zustande kamen. Dabei ist gegen Stimmverdoppelungen, das Hinzufügen weiterer Instrumente, Transpositionen und auch Streichungen und Straffungen, wie Mozart sie vornahm, nicht grundsätzlich etwas zu sagen, zumal Händel mit seinen eigenen Werken und denen anderer nicht anders verfuhr. Im Übrigen wurde in der Barockzeit auch die Wahl der Instrumente weit freier als zu späteren Zeiten gehandhabt, was schlichtweg daran lag, dass es beim Generalbassspiel keine allzu große Rolle spielte, ob dabei ein Cembalo oder eine Laute oder beide zusammen zum Einsatz kamen, zumal man in aller Regel einfach zu denjenigen Instrumenten griff, die gerade zur Verfügung standen.
Während Händel und Bach ihren eigenen Schöpfungen gegenüber ein reichlich pragmatisches Verhältnis besaßen, kommt mit dem romantischen Geniegedanken auch die Vorstellung auf, dass ein Werk etwas in sich Geschlossenes und damit Unantastbares ist. Was allerdings nicht heißen kann, dass es völlig beliebig ist, wie wir mit barocken Werken umgehen. Immerhin erfahren wir erst wieder durch die kleineren Besetzungen mit Originalinstrumenten etwas über die eklatanten Unterschiede nicht nur zwischen einem Bach- und Beethoven-Orchester, sondern bereits zwischen einem solchen, wie Haydn es am Hofe Esterhazys zur Verfügung stand, und jenem Londoner, für das er seine viel großzügiger und prächtiger angelegten späten Symphonien komponierte. Weil das eine dünner und das andere bombastischer klingt, gehen wir jedoch davon aus, dass Komponisten ihre Werke immer schon viel lieber für modernere Instrumente und riesigere Orchesterapparate geschrieben hätten und Bach lieber heute als morgen das Cembalo gegen einen Konzertflügel eingetauscht haben würde. Wer allein in solchen Fortschrittskategorien denkt, muss es natürlich vollkommen absurd finden, wenn heutzutage Musiker auf jene antiquierten Flöten, Oboen, Hörner und Gamben zurückgreifen, die bloß als Vorstufen unserer viel perfekteren Exemplare gelten dürfen.
Da Bach seine Suiten aber nun einmal für ältere Instrumente und Haydn seine ersten fünf Dutzend Symphonien für Kammerorchester konzipierte, hatten sie andere Klangvorstellungen im Kopf, als wenn sie für einen Steinway oder Londons üppige Orchesterbesetzung gedacht gewesen wären. Nur der geschichtsphilosophische Glaube, das Spätere sei auch das Bessere, konnte dazu führen, dass Klangkörper, die an Beethoven und Brahms geschult sind, sich auch für Händels Feuerwerksmusik zuständig fühlten. In solchen aufgeblähten Bach- und Händel-Bearbeitungen, wie sie etwa von Stokowski stammen, kippt der orchestrale Gigantismus fast schon wieder unfreiwillig ins Parodistische um, wobei man diesem Monumentalklangfanatiker im Grunde sogar dankbar dafür sein muss, dass er diese Tendenzen bis zum Exzess getrieben und damit vorgeführt hat, wie die Gier nach Fülle das Gegenteil dessen, was sie anstrebt, hervorbringen kann. Wer allerdings eine Händel-Oper je mit einem heutigen Barockensemble erlebt hat, mag von da an im Graben kein auf Verdi und Wagner getrimmtes Orchester mehr sitzen sehen, wenn es um Werke geht, die vor 1750 entstanden sind. Zwar können die meisten Opernhäuser es sich kaum leisten, dafür eigens Spezialisten zu engagieren, doch es kommt durchaus vor, dass in Straßburg Les Arts Florissants, in Basel das Freiburger Barockorchester, an der Lindenoper die Akademie für Alte Musik Berlin oder das Balthasar-Neumann-Ensemble im Pariser Palais Garnier an Stelle der fest angestellten Musiker aufspielen. Ein kleineres Opernhaus wie in Lille wiederum, das kein eigenes Orchester besitzt, hat sich inzwischen dafür entschieden, regelmäßig mit dem von Emmanuelle Haïm gegründeten und geleiteten Le Concert d’Astrée zusammenzuarbeiten, was heißt, dass dort in jeder Saison Werke auf dem Programm stehen, die von einem der führenden Barockensembles aufgeführt werden. Wer als Geiger ständig mit Beethoven, Brahms und Mahler beschäftigt ist, wird im Unterschied zu diesen Spezialisten schwerlich in der Lage sein, von heute auf morgen eine Musik zum Klingen zu bringen, bei der das Vibrato keine Rolle spielt und die von viel schärferen Akzenten und einer Verzierungstechnik lebt, wie sie später überhaupt nicht mehr existiert, ganz zu schweigen davon, dass bei einem Händel oder Caldara bei weitem nicht all das, was diese Musik erfordert, bereits in den Noten zu finden ist. Doch damit sich allmählich die Einsicht durchsetzen konnte, dass nicht erst zwischen Bach und Beethoven, sondern bereits zwischen Händel und Haydn Welten liegen, hat es im Allround-Klassikbetrieb des 20. Jahrhunderts lange gebraucht.
Was aber als historisch korrekt zu gelten hat und was nicht, darüber lässt sich endlos streiten. Gustav Leonhardt, einer der Pioniere barocker Spielpraxis, legte stets Wert auf die Feststellung, es handle sich bei dem, was er macht, um keine Interpretationen, sondern um das, wie es vom Komponisten gedacht sei. Doch selbst dann, wenn man Leonhardts Einspielungen für das Nonplusultra halten mag, heißt das noch lange nicht, dass er damit keine Interpretation, sondern die Sache selbst, so wie sie zu sein hat, vorgelegt hat. Wer sich über jede Hermeneutik erhaben glaubt, offenbart damit nur seine Unbedarftheit, was jene vielfältigen geschichtlichen, kulturellen und biographischen Vermittlungsprozesse anbelangt, die wir keineswegs im Griff haben und überschauen können. Schließlich bringen wir bei jedem Blick in einen Notentext bereits tausend Voraussetzungen mit, und zwar zum größten Teil solche, die uns gar nicht bewusst sind. Der Glaube an die Unschuld eines handwerklich richtigen Verstehens, mit dem sich alles falsch Dazwischengeschaltete scheinbar fernhalten lässt, besitzt etwas erstaunlich Naives. Dass handwerkliches Wissen und Können als Voraussetzungen einer jeden Aufführungspraxis zu gelten haben, ist selbstverständlich, doch allein damit lässt sich keineswegs hinreichend erklären, warum William Christies Tempi andere als diejenigen von Trevor Pinnock sind und warum bei dem einen das gleiche Andante weit heiterer als beim anderen klingt. Der Notentext selbst gibt vor allem Auskunft darüber, was nicht in ihm steht, was ja schon sehr viel ist, nur dass dieses Nicht-Vorhandene in der barocken Spielpraxis etwas ganz anderes als in jenen späteren Zeiten bedeutet, in denen die freie verzierende Ausgestaltung als selbstherrlicher Eingriff in die innere Struktur eines Werks gegolten hätte, während sie im Barock unbedingt gefordert war.
Zwar erfahren wir über damalige Spielweisen sehr vieles aus musiktheoretischen Abhandlungen, wie sie etwa Händels Hamburger Weggefährte Johann Mattheson in seiner Grossen General-Baß-Schule oder der Schrift Der vollkommene Kapellmeister verfasst hat. Andererseits darf man solche Abhandlungen nicht nur als Bestandsaufnahmen lesen, sondern muss auch sehen, dass der Verfasser mit ihnen normativ eingreifen wollte. Im Übrigen können einem diese Schriften bei aller Detailliertheit trotzdem nicht erklären, wie temperamentvoll oder unaufgeregt man ein Werk anzugehen hat. Die inständige Beteuerung, von eigenen Auslegungsbedürfnissen und geschichtlichen Einflüssen radikal absehen zu wollen, mag zwar ernst gemeint sein, blendet jedoch aus, dass wir schon deshalb nicht souverän über unsere Deutungsprozesse gebieten können, weil alles, was wir tun, auch eine Reaktion auf etwas bereits Vorhandenes ist, ob es uns bewusst ist oder nicht. Ein Karl Richter hätte schließlich mit dem gleichen Recht von seinen Bach-Aufführungen behauptet, dass sie authentisch sind, wie es Gustav Leonhardt für sich beansprucht. Doch beide bringen Voraussetzungen mit, über die sie nicht frei verfügen, und sei es, dass der eine von diesem, der andere von jenem Lehrer geprägt ist oder dass er es absichtlich anders machen will, als es bis dahin üblich war. Allein die Frage, wie viel wir aus einem Notentext heraus- und wie viel wir in ihn hineinlesen, lässt sich kaum eindeutig beantworten. Dass eine da-capo-Arie anderen Regeln gehorcht als ein Wagnerscher Gesang, sieht beim Blick in die Partitur selbst ein Blinder. Was das allerdings im Einzelnen fürs barocke Phrasieren bedeutet, ist damit noch lange nicht gesagt. Während ein Gustav Leonhardt an authentische Lesarten glaubt, gilt in der Philosophie des 20. Jahrhunderts als weitgehend ausgemacht, dass nichts illusionärer ist als der Glaube an das Ursprüngliche und Echte. Wo das Uneigentliche endet und das Eigentliche beginnt, lässt sich schon deshalb schwer sagen, weil diese Unterscheidungen selbst ja bereits auf begrifflichen Entgegensetzungen beruhen und damit Voraussetzungen mit sich bringen, die alles andere als naturwüchsig und kulturell unschuldig sind.
Ungeachtet solcher Grundsatzfragen hängen wir mit dem Ruf nach dem Echten auch deshalb in der Luft, weil trotz noch so vieler historischer Studien keiner von uns wissen kann, wie Barockmusik damals tatsächlich geklungen hat. Schließlich wissen wir nicht, wie rasant Bach selbst seine Presti genommen hat oder ob Händel die Fanfarenstöße seiner Feuerwerksmusik eher gravitätisch oder leicht gespielt haben wollte. In den USA sind immerhin schon Platten erschienen, auf denen stand: Authentic Edition – The famous Kanon as Pachelbel heard it (»Authentische Ausgabe – Der berühmte Kanon, wie Pachelbel selbst ihn hörte«). Abgesehen davon muss ein Komponist nicht einmal der überzeugendste Interpret seines eigenen Werkes sein. Auch an Beckett hat sich gezeigt, dass er alles andere als ein inspirierter Regisseur war, wenn er seine Stücke inszenierte. Weil aber das, was wir mit dem Begriff Authentizität meinen, nichts Überprüfbares ist, stellt sich am Ende vor allem die Frage, ob uns eine Aufführung bannen kann oder nicht, ob sie uns mitreißt oder kaltlässt, aufrüttelt oder in den Schlaf befördert. Alles andere bleibt zu weiten Teilen der Spekulation überlassen, woran auch ein Gustav Leonhardt nichts ändern kann, wenn er meint, durch genaues Notenstudium zur einzig möglichen Wahrheit einer Komposition vordringen zu können und dadurch zum Sachwalter der Sache selbst zu werden.
Trotzdem kann man daraus nicht schließen, alles sei beliebig, zumal jemand, der eine Blockflöte von vornherein durch eine heutige Querflöte ersetzt, nie erfahren wird, wie sehr einen beispielsweise die Wärme der beiden Flöten in Bachs Actus tragicus berühren kann. Allerdings gibt es auch ganz schlichte Gründe, zu Originalinstrumenten zu greifen, so etwa im Falle von Bachs Goldberg-Variationen, die auf dem Klavier an manchen Stellen schon deshalb Schwierigkeiten bereiten, weil sich dabei die beiden Hände gelegentlich entschieden in die Quere kommen und zuweilen sogar die gleichen Töne anschlagen müssen, weshalb sich auf ein zweites Manual kaum verzichten lässt. Dass eine solche Musik, auf einem Konzertflügel gespielt, trotzdem nichts vom gewohnten Interpretationstrott besitzen muss und einem auch schon vor der Entdeckung der historischen Aufführungspraxis die Ohren geöffnet werden konnten, zeigen allerdings nicht nur die Aufnahmen von Glenn Gould, der alles andere als ein Verfechter des Originalklangs war. Auch wenn er geradezu penetrant seine unverwechselbaren Manierismen kultivierte, gelang es ihm immer wieder, aus dem Klavier Klänge herauszulocken, die sich gar nicht mehr nach einem Klavier, sondern eher nach einer Laute oder sonst einem Zupfinstrument anhörten. Es ist, als drücke er dabei überhaupt nicht auf Tasten, sondern reiße äußerst vorsichtig an Saiten, so wie es etwa Streicher bei einem leisen Pizzicato-Spiel tun. Zuweilen hat man aber auch das Gefühl, er zerre damit manche Stücke ins Parodistische, so wenn er gelegentlich einem Suitensatz einen reichlich mechanischen Charakter verleiht, womit er vielleicht auf ganz andere Weise, als es den Apologeten des Authentischen vorschwebt, den Klang von Hammerklavieren nachzuahmen versucht. Nicht so sehr bei Bach und Händel, jedoch bei Mozart, den Glenn Gould nicht sonderlich schätzte, kippt dieses Mechanische sogar ins Komische um, so wenn er etwa das Alla turca derart automatenhaft abspielt, als handle es sich um eine Spieluhr. Was Glenn Gould allerdings mit den Vertretern der historischen Aufführungspraxis verbindet, ist sein ungewöhnliches Non-Legato-Spiel. Ohne es könnte er überhaupt nicht in so gut wie jedem Takt drei verschiedene Akzente setzen und jeden Pralltriller zu einem Ereignis werden lassen, was bei ihm auf jene durch und durch kristalline Weise geschieht, wie sie heutigen Barockspezialisten als Klangideal gilt.
Ein paar Werke von Bach und Händel hat Glenn Gould auch auf dem Cembalo eingespielt, was sich bei ihm wiederum zuweilen nach einem frühen Klavier anhört, als suche er jedem Instrument ausgerechnet das zu entlocken, was nicht nach ihm klingt. Wie frei er dabei zum Teil verfährt, zeigt allein das Präludium von Händels erster Cembalo-Suite in A-Dur. Im Notentext haben wir es dabei vor allem mit liegenden Akkorden zu tun, die durch auf und ab gleitende Tonleitergirlanden miteinander verbunden werden. Glenn Gould verlebendigt diese akkordischen Pfundnoten nicht nur durch unentwegtes Arpeggieren, vielmehr löst er sie vollkommen auf und fängt an zu extemporieren, sodass das Stück sich wie eine virtuose Gitarrenimprovisation ausnimmt. Er verwandelt Händels Präludium schlichtweg in sein eigenes Stück, womit er sich allerdings keine maßlosen Freiheiten herausnimmt, sondern nur das macht, was während der Barockzeit Usus war. So erzählt Charles Burney, dem wir einen Großteil unserer Kenntnisse über die Musik des 18. Jahrhunderts verdanken, in seiner General History of Music, jener berühmte Kastrat Senesino, der einen Großteil von Händels Hauptrollen sang, habe auf der Bühne eine Arie des Komponisten Ariosti mit allem nur erdenklichen Gezottel, Gezappel und geckenhaften Verrücktheiten in ein ganz eigenes Stück verwandelt (»an exhibition of all the furbelows, flounces and vocal fopperies«).
Der um 1653 in der Nähe von Rimini geborene Pier Francesco Tosi, selbst ein berühmter Kastrat, veröffentlichte 1723 eine Schrift mit dem Titel Opinioni de’ cantori antichi e moderni – »Meinungen alter und moderner Sänger« –, die der Direktor der königlichen Kapelle Friedrichs des Großen, Johann Friedrich Agricola, ins Deutsche übersetzte. Tosi schreibt darin, dass sein erster Lehrer – vermutlich sein Vater – ihm erzählt habe, wie die Sänger zunehmend die Marotte entwickelt hätten, in jede Arie endlose Kadenzen einzufügen, sodass die Opernabende kaum noch ein Ende finden wollten. Giulio Caccini wiederum erteilt im Vorwort zu seiner 1602 erschienenen Madrigal- und Ariensammlung Le nuove Musiche genaue Gesangsanweisungen, auf dass seinen Stücken nicht das passiere, was Graf Bardi, der Gründer der berühmten Florentiner Camerata, in einer ihm gewidmeten Abhandlung über die ältere und neuere Gesangsart zu beklagen hatte. Schließlich ist dort von Sängern die Rede, die derart wahllos eigene Passagen in Arien einfügten, dass der Komponist sein eigenes Werk nicht wiedererkennen könne. Um solche Exzesse einzudämmen, wurden damals Anleitungen für den angemessenen Gebrauch solcher Freiheiten ausgegeben, so etwa von Lullys Schüler Georg Muffat, der bezüglich des ornamentalisierenden Improvisierens ein paar grundsätzliche Regeln aufzustellen versuchte, und sei es nur, dass man nicht gleich den ersten Ton mit einem Triller ausschmückt. Immerhin findet es Johann Joachim Quantz, der Hauskomponist und Flötenlehrer Friedrichs des Großen, anlässlich eines Opernbesuchs in London der ausdrücklichen Erwähnung wert, dass Senesino in Händels Admeto nicht allzu viel improvisiert hat. Wie sehr dieses Ausschmücken nicht nur bei Sängern, sondern auch bei Musikern beliebt war, davon handelt eine Geschichte, die erzählt, wie der schottische Tenor Alexander Gordon sich während einer Probe bei der einzigen Arie, die er als nichtitalienischer Sänger in der Oper Flavio hatte, dermaßen über den am Cembalo sitzenden Händel aufregte, dass er zu singen aufhörte und schrie: »Falls Sie nicht endlich mit Ihrem endlosen Improvisieren aufhören, springe ich in den Orchestergraben!«, was Händel mit einem »Davon hätte das Publikum mehr als von Ihrem Gesang!« quittiert haben soll. Bei Charles Burney wiederum findet sich eine Anekdote, derzufolge der irische Geiger Matthew Dubourg, der im Jahre 1742 die Dubliner Uraufführung des Messias leitete, sich bei einer von Händel dirigierten Opernaufführung so sehr in einem labyrinthischen ad-libitum-Solo verloren habe, dass ihm längst die Grundtonart abhanden gekommen sei. Als er schließlich seine uferlose Kadenz doch noch mit einem signifikanten Triller zu Ende zu bringen gedachte, habe ihm Händel zugerufen: »You are welcome home, Mr. Dubourg!«, und dafür tobenden Applaus bekommen.
Dass es letztlich doch auf so etwas wie Stilempfinden ankommt, darauf spielt auch Couperin im Vorwort zum ersten Band seiner 1713 veröffentlichten Pièces de Clavecin an, wenn er gesteht, das, was ihn berühre, viel lieber zu mögen als das, was ihn nur erstaune (»j’avoueray de bonne foy, que j’ayme beaucoup mieux ce qui me touche, qu ce qui me surprend.«). Dass in einem vorgegebenen Rahmen Ausschmückungen jedoch nicht nur erlaubt, sondern unabdingbar sind, belegt allein schon die Aussetzung jenes sogenannten Generalbasses, der lediglich aus einer ausgeschriebenen Basslinie besteht, die mit Ziffern versehen ist, durch die deutlich wird, um welche Akkorde und deren Umkehrungen es sich dabei handelt. Vivaldi weigerte sich sogar, den kargen Bassverlauf mit Ziffern zu versehen, zumal er der Meinung war, dass Musiker, die das brauchen, Idioten sind. In welcher Weise der Cembalo-, Lauten- oder Harfenspieler diese Linie ergänzt, muss sich aus dem Charakter des jeweiligen Stücks ergeben, wobei – wie bereits gesagt – zum Teil auch die Wahl der Instrumente offenstand und man schlichtweg auf das, was eben gerade zur Hand war, zurückgriff. Was wiederum Glenn Goulds frei gestaltetes Präludium aus Händels A-Dur-Suite anbelangt, so hat er es in eine Art Bachsche Toccata verwandelt, wobei bemerkenswert ist, dass Bach seine Toccaten vollkommen ausschrieb und dadurch so gut wie keinen Raum mehr für eine freie Gestaltung ließ, was ihm auch vorgehalten wurde. Dass Händels Präludium geradezu nach Improvisation ruft, lässt sich freilich gleich beim ersten Blick in die Noten erkennen, und zwar schon deshalb, weil es sterbenslangweilig wäre, würde man sie nur brav vom Blatt spielen.
Selbstverständlich hat das barocke Ausschmücken und Variieren nichts mit jenen Bearbeitungen zu tun, wie wir sie im Falle Bachs von Busoni oder im Falle Monteverdis von Henze kennen. Immerhin schüttelte der Musikwissenschaftler Max Schneider bereits in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts, als Händels Opern wiederentdeckt wurden, den Kopf über eine Aufführungspraxis, die auf die schönen Melodien fixiert ist und all das, was den zeitgenössischen Ohren nicht passt, weglässt oder umschreibt und dabei dem Orchester die Rolle eines wohlgefälligen Begleiters zuweist, der ein bisschen romantische Soße über das Ganze zu gießen hat. Gemeint waren damit unter anderem die Bearbeitungen von Oskar Hagen, der Händels Werken auch noch zu Titeln und Gattungsbezeichnungen ganz nach seinem Geschmack verhalf, so etwa wenn er die Oper Serse in »Xerxes oder Der Verliebte König – Heitere Oper in drei Akten« umtaufte. Was aber die tragischen Opern anbelangt, so bedarf es ebenfalls keiner großen Phantasie, um sich vorzustellen, was sich damals auf der Bühne tat und dabei aus dem Orchestergraben hochgeschwappt kam, wenn sein Regisseur Hans Niedecken erklärt: »Der Expressionismus hat uns die Kraft gegeben, wieder ein echtes, erfülltes Pathos zu haben; in einem neuen Barock entladen sich die aus der Musik Händels erwachsenen Kräfte in breitausladender Geste, in den in mächtigen Schwüngen gestalteten Linien bewegter Massen.«
Inzwischen sind jene Stimmen rarer geworden, die Darmsaiten und Holzflöten für armselige Vorgänger unserer brillanteren Gegenwartsinstrumente halten. Die lautmalerische Ausdrucksbreite, der wir seit einiger Zeit begegnen, überzeugt auch solche, die den Kult ums Authentische für Ideologie halten. Dass wir inzwischen etwas weniger in Kategorien des musikalischen Fortschritts denken, sondern die immensen Unterschiede zwischen einer barocken, klassischen und romantischen Musiksprache wahrnehmen, verdankt sich vor allem der historischen Aufführungspraxis. Die Frage, ob es sich dabei um etwas Originales handelt oder nicht, rückt dabei allein deshalb in den Hintergrund, weil sich die Verve und Vitalität, mit der die meisten Barockensembles zu Werke gehen, unmittelbar auf ihre Hörer überträgt. Dass viele Dirigenten es heute nicht mehr wagen, ein Konzert mit einem Bach- oder Händelhäppchen zu beginnen, deutet darauf hin, dass sie ihre Grenzen besser einschätzen können. Doch nach wie vor fragt man sich, wie Generationen von Musikern in der Lage sein konnten, einen Bach und Händel abzuliefern, der an Langeweile nicht zu überbieten war.
Namen wie Harnoncourt, Trevor Pinnock, Christopher Hogwood, John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, René Jacobs, Reinhard Goebel, William Christie, Frans Brüggen, Ton Koopman, Sigiswald Kuijken, Marc Minkowski, Emmanuelle Haïm und manch andere sind inzwischen aus unserem Musikleben nicht mehr wegzudenken. Doch man darf nicht vergessen, dass es nicht so sehr ein Harnoncourt oder ein Christopher Hogwood waren, die andere Spielweisen erfunden haben, schließlich gründete Anfang der dreißiger Jahre der Schweizer Dirigent, Mäzen und Eigentümer von Hoffman-LaRoche, Paul Sacher, jene Schola Cantorum Basiliensis, die längst der Basler Musikakademie angegliedert ist und als eine der wichtigsten Ausbildungs- und Forschungsstätten für barocke Aufführungspraxis gilt. Dass die Paul-Sacher-Stiftung zugleich die weltweit größte Sammlung von Werken des 20. Jahrhunderts besitzt, ist ebenso bemerkenswert wie die Tatsache, dass das Freiburger Barockorchester sich mit dem auf zeitgenössische Musik spezialisierten »ensemble recherche« ein gemeinsames Dach als Proben- und Begegnungsort gesucht hat. Beides mag darauf hindeuten, wie eng die Neuentdeckung des Alten und die Gegenwart zusammengehören, und zwar weniger in einem vordergründigen kompositionstechnischen Sinne, sondern in Bezug auf das, was wir Hörgewohnheiten nennen. Dass zeitgenössische Komponisten unser Gehör herausfordern, ist hinlänglich bekannt, nur dass es die Spezialisten für Alte Musik nicht weniger, wenn auch auf andere Weise tun. So macht uns etwa ein René Jacobs eine scheinbar längst vertraute Musik meist gänzlich neu erfahrbar, und zwar zuweilen so sehr, dass man meinen könnte, sie überhaupt nicht wiederzuerkennen. Wer einmal gehört hat, welches Gekreische er die Countertenor-Hexen in Purcells Dido und Aeneas anstimmen lässt, weiß spätestens von da an, welche Kluft sich zwischen den herkömmlichen Aufführungsgewohnheiten und einem bislang in dieser Weise unbekannten, höchst affektiven und lautmalerischen Ausdrucksdrang auftut. Nicht anders ist es, wenn er eine Händel-Oper wie Rinaldo entstaubt und sie mit dem Freiburger Barockorchester in ein wahrlich furioses Ereignis verwandelt, bei dem – wie in der Uraufführung – Vögel zu singen beginnen und die Continuo-Begleitung einen ganzen Kosmos an Klangfarben hervorzaubert, und zwar von Anfang bis Ende.