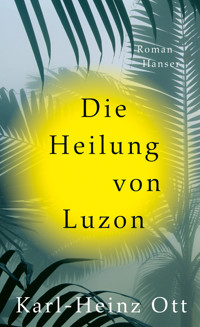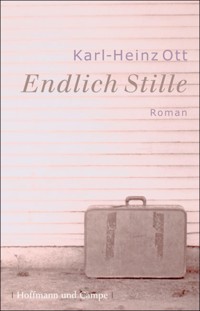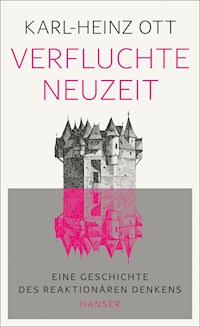
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Misstrauen in die Demokratie, Radikalisierung, autoritäre Staatsmodelle – Karl-Heinz Ott fragt: Hat die Aufklärung ihren Zweck verfehlt? Querdenker stürmen den Reichstag. Ein Schamane triumphiert im Kapitol. Noch vor wenigen Jahren schienen Bilder wie diese unvorstellbar. Doch die Rebellion gegen die Aufklärung hat eine lange Geschichte. Und sie findet keineswegs nur auf der Straße statt. Ihre Glaubenslehren behaupten, nicht der Mensch selbst, sondern höhere Mächte bestimmten sein Schicksal. Auch der westliche Individualismus sei eine Irrlehre, verantwortlich für alles Unheil in der Welt. Karl-Heinz Ott legt in seinem so gedankenreichen wie anregenden Essay die geistigen Fundamente dieser Bewegungen frei. Er zeigt: Die Antimoderne ist so alt wie die Moderne. Die Vernunft kann nur die Oberhand behalten, wenn sie ihre Gegner kennt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Misstrauen in die Demokratie, Radikalisierung, autoritäre Staatsmodelle — Karl-Heinz Ott fragt: Hat die Aufklärung ihren Zweck verfehlt?Querdenker stürmen den Reichstag. Ein Schamane triumphiert im Kapitol. Noch vor wenigen Jahren schienen Bilder wie diese unvorstellbar. Doch die Rebellion gegen die Aufklärung hat eine lange Geschichte. Und sie findet keineswegs nur auf der Straße statt. Ihre Glaubenslehren behaupten, nicht der Mensch selbst, sondern höhere Mächte bestimmten sein Schicksal. Auch der westliche Individualismus sei eine Irrlehre, verantwortlich für alles Unheil in der Welt. Karl-Heinz Ott legt in seinem so gedankenreichen wie anregenden Essay die geistigen Fundamente dieser Bewegungen frei. Er zeigt: Die Antimoderne ist so alt wie die Moderne. Die Vernunft kann nur die Oberhand behalten, wenn sie ihre Gegner kennt.
KARL-HEINZ OTT
VERFLUCHTE NEUZEIT
Eine Geschichte des reaktionären Denkens
Hanser
Schließlich war der Unterschied zwischen der Überzeugung, dass etwas ewig Bestand hat, und der Erwartung, dass im Gegenteil nichts von Dauer ist, gar nicht groß. Man musste in beiden Fällen einfach nur daran glauben.
JAMES GORDON FARRELL, TROUBLES
PROLOGE
Kann man eine ganze Epoche verdammen?
Kann man die Neuzeit verdammen? Die Neuzeit als ganze? Man kann das Barock verabscheuen mit seiner Überladenheit oder die Romantik mit ihrem Gefühlskult oder die Postmoderne mit ihrer Beliebigkeit. Auch gibt es eine Menge Schriften mit dem Titel »Die Feinde der Aufklärung« oder »Die Feinde der Moderne«. Von Feinden der Neuzeit ist dagegen nie die Rede. Trotzdem gibt es sie. Es sind nicht wenige. Sie werden wieder lauter.
Wo beginnt die Neuzeit? Wo endet sie? Was soll nach ihr kommen? Neuer als neu kann schließlich nichts sein. Zum Bild der Neuzeit gehört ein Gefühl des Höhepunkts, zum Höhepunkt ein Gefühl des nahenden Endes. Schon seit Jahrhunderten fordern besorgte Stimmen, man müsse wieder zurück: zu den Griechen, zur Religion, zu was auch immer. Neuzeit bedeutet Freiheit, Freiheit bedeutet Bodenlosigkeit — zumindest in den Augen ihrer Kritiker. Seit der Katholizismus seine mittelalterliche Macht eingebüßt und Luther das Gewissen eines jeden Einzelnen ins Zentrum gerückt hat, zersplittern nicht nur Institutionen, die sich als göttliche Hüter der Wahrheit aufspielen — die Wahrheit selbst wird subjektiv verwässert. Jeder macht sich sein eigenes Bild von der Welt, jeder seine eigene Vorstellung vom Leben. Der eine große Sinn verflüchtigt sich in Tausende von Sinnmöglichkeiten. Das Motto der Postmoderne lautet: Anything goes. Sein Keim wird bereits vor einem halben Jahrtausend gelegt, am Beginn der Neuzeit. Die einen geben daran Luther die Schuld, die andern Descartes, wieder andere der grassierenden Gottlosigkeit und dem aufziehenden Kapitalismus, der nur noch ein einziges Heiligtum kennt: Geld und Erfolg.
Nie hat eine Epoche maßloser an Utopien geglaubt, nie intensiver die Apokalypse beschworen. Ständig ist von Zerstörung die Rede, ständig drohen Katastrophen. Jene Freiheit, auf die wir so viel Wert legen, tut uns offenbar nicht gut. Seit einiger Zeit verwandeln wir uns in reuige Sünder, die ihre Selbstherrlichkeit verdammen. An Mahnungen hat es nie gefehlt, nicht nur von ökologischer Seite. Konservative Stimmen warnen seit langem vor der Bodenlosigkeit der Neuzeit; an der Fortschrittsfront schüttelt man darüber schon ebenso lange den Kopf.
Inzwischen sind wir mit politischen Entwicklungen konfrontiert, die man in der westlichen Welt kaum mehr für möglich gehalten hätte nach den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts. Wir glaubten aus ihnen gelernt zu haben, für immer. Die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts erscheint im Nachhinein als glückliche Zeit, zumindest in unseren Breiten. Die Demokratie galt als selbstverständliche Lebensform, an der niemand mehr gezweifelt hat, sieht man von den üblichen Rändern ab. Wenige Jahre nach 1989 wurde sogar schon das Ende der Geschichte ausgerufen, womit gemeint war, dass selbst die östliche Hemisphäre nunmehr kapiert hat, dass es zur Demokratie keine Alternative gibt, jedenfalls keine bessere. Das westliche Modell hatte gesiegt, mit allem, was dazugehört: Aufklärung, Universalismus, Menschenrechte. Die Freiheit schien Voraussetzung für Fortschritt und Wohlstand.
Nicht nur China führt mittlerweile vor, dass solche Dinge auch ohne Freiheit zu haben sind. Selbst in der westlichen Welt hat der Wind schneller gedreht, als man sich in schlimmsten Alpträumen hätte ausmalen können. Inzwischen fragen wir uns, was die vielen Aufgebrachten umtreibt, denen unsere Art von Demokratie keinen Pfennig mehr wert scheint. Wir forschen nach Ursachen, Gründen, Zusammenhängen. Die Antwort lautet: Es sind die Globalisierung, die Migration, die Deindustrialisierung. Vom Verlust aller Sicherheiten ist die Rede und von einer Überforderung, die jeden Lebensbereich erfaßt, nicht bloß den materiellen. Es werden weltanschauliche Schlachten geschlagen wie selten zuvor, stets geht es ums Ganze. Was darf man noch sagen, wie muss man denken, wo liegen die ständig sich verschiebenden Grenzen, lauten die allgegenwärtigen Fragen. Ebenso ist von der Schere die Rede, die ständig weiter auseinandergeht zwischen denen, die immer mehr, und denen, die immer weniger verdienen. Zwischen den polyglotten Globalisierungsgewinnlern und den Abgehängten ist eine Kluft entstanden, die man lange nicht wahrnehmen wollte. Den einen gefällt, dass die Welt kaum noch Grenzen kennt, die andern wollen wieder Mauern errichten. Die Lust am Autoritären wächst. Inzwischen erscheint die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wie eine trügerische Friedenszeit.
Allerdings drängt es nicht nur die Abgehängten, Tabula rasa zu machen. Auch in Schichten, die keine ökonomischen Sorgen kennen, breitet sich Rabatzstimmung aus. Nicht wenige ziehen über Eliten her, deren Teil sie sind. Weder leiden sie unter einem Mangel an Aufmerksamkeit noch unter Sprechverboten. Trotzdem glauben sie, die gegenwärtige Demokratie revidieren zu müssen. Sie rufen nach der Nation, nach traditionellen Werten, nach geistig-sittlicher Orientierung. Wirtschaftliche Ursachenforschung hilft dabei kaum weiter. Es geht ihnen um die Rettung des Abendlands, wie schon Oswald Spengler, der kaum noch an Rettung geglaubt hat.
Zu den Folgen von 1989 gehört nicht nur der Kollaps der Sowjetunion, auch der Westen hat Risse bekommen. Seit das eine, große, klare Feindbild fehlt, in dessen Licht die hiesigen Lebensverhältnisse immer rosig erschienen, richtet sich der Blick umso gnadenloser auf unsere eigenen, inwendigen Konflikte. Während die allseitige globale Abhängigkeit schon aus ökonomischen Gründen überall nach Öffnung ruft, wächst das Bedürfnis nach Abgrenzung und identitärer Einzigartigkeit. Ebenso stellt sich wieder vermehrt die Frage, ob der freie Markt und das kapitalistische Wirtschaften den einzig verbliebenen Sinn auf der Welt ergeben. An allen Ecken und Enden regt sich Unmut, Zorn und Widerstand, auf völlig diverse, gegensätzliche Weise. Die einen gieren nach Ordnung und Übersichtlichkeit, die andern wollen jenes Projekt der Moderne vollenden, das auf größtmögliche Grenzenlosigkeit zielt.
Zur Moderne gehört seit je die Kritik an der Moderne, auf rechter Seite wie auf linker. Paradoxerweise lebt diese Kritik just von jener Freiheit, die sie für bedenklich hält. Dabei steht nicht nur die Aufklärung unter Beschuss, deren Beginn wir aufs 18. Jahrhundert datieren, es geht um die Neuzeit insgesamt. Nicht Voltaire und Rousseau gelten als hauptsächliche Übeltäter, es sind Luther und Descartes. Diese beiden werden für den Zerfall einer Ordnung verantwortlich gemacht, in der noch nicht der Einzelne im Mittelpunkt stand und noch nicht die Meinung von Krethi und Plethi gefragt war. Seit ein jeder sich aufgerufen fühlt, selbst zu denken und selbst zu urteilen, zerbröselt der Glaube an eherne Wahrheiten. Alles wird relativ, nichts steht mehr fest, alles Absolute muss abdanken. Nietzsche charakterisiert diesen Zustand als Nihilismus. Die einen kommen damit zurecht, andere nicht. Was die einen als Freiheit rühmen, verdammen die andern als Sinnlosigkeit.
Descartes fordert dazu auf, alle Arten von Wissen und Wahrheit in Frage zu stellen, damit wir sie nicht mit bloßer Überlieferung verwechseln. Der neuzeitliche Mensch kann auf nichts mehr bauen, außer auf sich selbst. Diesem Zustand wünschen nicht nur Leo Strauss, Carl Schmitt und Heidegger ein baldiges Ende, auch Foucault wünscht die Neuzeit zum Teufel.
Von denen, die bei Pegida mitmarschieren oder das Kapitol gestürmt haben, denkt vermutlich kein einziger an Descartes und Luther. Was sollten diese beiden schon damit zu tun haben? Dennoch muss man nicht lange suchen, um rechtsintellektuelle Stimmen auszumachen, die dort das Ursprungsübel erkennen. Weder grölen ihre Vertreter auf der Straße herum, noch stellen sie griffige Parolen zur Verfügung. Meist handelt es sich um wohlbestallte Professoren, die als Politikberater Maulwurfsarbeit leisten.
Lange war man sicher, der Geist stehe automatisch links. An solche 68er-Selbstherrlichkeiten glaubt inzwischen kaum noch jemand. Es gibt nicht nur linksliberale Eliten, es gibt auch rechtskonservative; und sie sind weit älter als die Frankfurter Schule. Seit ein paar Jahren drängen sie wieder an die Rampe, vergleichbar den McCarthy-Zeiten. Ihre Vertreter agieren nicht nur an Universitäten und in Thinktanks mit potenten Geldgebern, zuweilen sitzen sie sogar auf Ministerposten, von Washington bis Warschau. Ihre Agenda reicht nie nur bis zur nächsten Wahl, sie rütteln an den Grundlagen der Neuzeit. Das mag maßlos klingen und furchtbar übertrieben, trifft aber den Punkt — man muss nur ihre Schriften zur Hand nehmen. Deren Sprache klingt ganz anders als die der Straße: feinsinnig und gebildet. Es ist dort viel von Platon die Rede und anderen Denkern, von Aufruhr keine Spur. Von Marx stammt der Satz: »Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen.«1 Marx bezieht ihn aufs Denken, Barrikaden sind allenfalls dessen Folge. Radikalität zeichnet nicht allein das linke Denken aus, sondern ebenso das rechte.
Zuweilen ergeben sich dabei Vernetzungen, die so kurios nicht sind, wie sie scheinen. Am Ende hängen Heidegger, Foucault, Don Quijote und Descartes aufs Engste zusammen.
Neuzeit, Moderne, Postmoderne
Wo fängt die Neuzeit an? Wo die Moderne? Wo die Postmoderne? Handelt es sich mehr oder weniger um das Gleiche, nur im Sinn einer Steigerung? Oder um jeweils Neues, Anderes? Ist die Neuzeit identisch mit der Moderne, oder fängt die Moderne erst später an? Wo beginnt die Postmoderne? Kündet sie vom Ende der Neuzeit oder treibt sie lediglich auf die Spitze, was seit ihren Anfängen im Gang ist? Begrifflichkeiten über Begrifflichkeiten, Epochen, Unterepochen, Abschiedsepochen: Renaissance, Barock, Aufklärung, Romantik, Moderne, Avantgarde, Post-Histoire. Nur eines scheint klar: Der Moderne kann es nie schnell genug gehen mit immer neuen Modernitätsschüben. Sie lebt von einem manischen Voraus-Drang. Allerdings fragt sich: wohin?
Grenzen zieht man nicht ohne Willkür. Wer vom Ende der Geschichte redet, spricht von ihrer Krönung und nicht wirklich vom Ende. Es bedeutet: Mehr geht nicht, besser kann es nicht werden, zumindest nicht im Prinzip. Alles Bisherige war Vorlauf, die Neuzeit bildet den Abschluss. Was keineswegs bedeutet, dass fortan nichts mehr geschieht und nichts sich mehr ändert; es bedeutet, dass die Demokratie die höchste Stufe der Menschheitsentwicklung darstellt und alles andere auf einen Rückfall hinausliefe. So sehen es die meisten in der westlichen Welt, selbst solche, die diese Entwicklung kritisch beäugen. Wirklich zurück möchte vermutlich niemand, selbst wenn er vom Mittelalter schwärmt oder von den alten Griechen oder vom rousseauistischen Naturzustand. Wir können uns solche Träume leisten, sie kosten nichts; es handelt sich um Phantasien, mit denen wir vor dem Hier und Jetzt in künstliche Paradiese fliehen. Dennoch scheint die Lust an der Demokratie im Schwinden. Herrschte 1989 noch allgemeine Aufbruchsstimmung, fing keine zehn Jahr später die Welt an zu wackeln, an allen Ecken und Enden. Das Ende der Geschichte ist wieder ferner gerückt.
Die Neuzeit hat das Mittelalter abgelöst, darin sind sich alle einig. Der mittelalterliche Mensch wusste allerdings nicht, dass er im Mittelalter lebt; das wissen erst wir. Laut Kant findet in der Neuzeit etwas statt, das er als den Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit charakterisiert — darin besteht seine Definition der Aufklärung. In Kants Schriften tauchen selten vorneuzeitliche Philosophen auf. Er bedarf ihrer nicht, sie haben ihm nichts mehr zu sagen. Sie verharren für ihn in einem metaphysischen Schlummer, der sie Gedankensysteme ersinnen ließ, die sie mit der Welt und der Wirklichkeit verwechselt haben. Statt nach den Konstruktionsmechanismen unseres geistigen Legobaukastens zu fragen, haben sie Theorien aufeinandergetürmt, die unter dem kritischen Blick der neuzeitlichen Vernunft zusammenkrachen. Sie haben so getan, als würden sie die innerste Ordnung der Welt erkennen, ohne sich die Frage zu stellen, ob wir das überhaupt können. Herausgekommen sind nichts als dogmatische Gedankengebäude, wie Kant behauptet. Diese Entwicklung setzt ein mit Platon und gipfelt in den theologischen Begriffskathedralen des Mittelalters.
Auch wenn uns das Mittelalter seit einiger Zeit wieder ein bisschen bunter erscheint, halten wir es unterm Strich immer noch für finster. Zwar lassen wir uns gern in Dubys bildersatte »Zeit der Kathedralen« entführen und in Victor Hugos Paris des Quasimodo, leben möchten wir dort aber auf keinen Fall — außer in Filmen und Videospielen. Dabei glaubte schon so mancher Romantiker, im Mittelalter all das zu finden, was die Aufklärung zerstört hat; man muss nur Novalis lesen oder Eichendorff. Trotzdem sind wir im Grunde allesamt Kantianer, die an den Fortschritt der Neuzeit glauben, sowohl technisch wie gedanklich. Wir schauen aufs Früher herab, bei aller Bewunderung für gotische Kirchen und Dantes »Göttliche Komödie«. Als Kulturgüter möchten wir diese Dinge nicht missen, an unserem Überlegenheitsgefühl ändert das wenig.
Wo aber fängt die Neuzeit an? Was wir im Deutschen Neuzeit nennen, nennt sich im Englischen modern times, im Französischen les temps modernes. Im Deutschen setzt die Moderne für viele erst im 19. Jahrhundert ein, für manche sogar erst im 20., je nachdem, ob wir in erster Linie an die Kunst oder an die Anfänge der Demokratie oder an die Industrialisierung denken. Was den Beginn der Neuzeit betrifft, legen ihn manche auf die Entdeckung Amerikas im Jahr 1492 fest, andere auf das Jahr 1517, in dem Luther seine Thesen anschlägt. Luther hat nicht nur die kirchliche Welt zum Beben gebracht, sondern das ganze Abendland, mit weltweiten Folgen, bis heute.
Die Staatstheorie von Hobbes verdankt sich den Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges, der 1648 endet, drei Jahre bevor sein »Leviathan« erscheint. Nachdem Europa im Namen der Religion in ein Schlachtfeld verwandelt worden ist, muss der moderne Staat laut Hobbes dafür sorgen, dass der Glaube Privatsache bleibt. Die staatlichen Gesetze stehen fortan über jeder Religion, ihnen allein muss man sich fügen. Mit dem IS vor Augen und dem Iran wissen auch wir Heutigen, wovon Hobbes spricht. Wer in vermeintlich Heiligen Schriften die absolute Wahrheit zu erkennen meint, kann sich nicht Gesetzen beugen, die allein von Menschen stammen, am allerwenigsten, wenn es sich um Ungläubige handelt. Nicht bloß islamische Hardcore-Strömungen, auch christliche Fundamentalisten wollen mancherorts rückgängig machen, was nicht in ihr Weltbild passt. In Ungarn und Polen sind Regierungen an der Macht, denen ein traditionalistischer Katholizismus, wie man ihn nicht einmal mehr im Vatikan pflegt, mehr bedeutet als der neuzeitliche Liberalismus. In den USA gewinnen Evangelikale an Boden, die an Schulen nicht nur Darwin verbieten wollen, sondern alles, was dem Glauben widerspricht, Gott habe in sieben Tagen die Welt erschaffen, im wörtlichen Sinn.
Obwohl Novalis, Eichendorff und Carl Schmitt wenig miteinander gemein haben, machen sie alle den Protestantismus für die Übel der Neuzeit verantwortlich. Religiöse Argumente spielen dabei eine zweitrangige Rolle. Ihre Klage lautet, die Reformation habe die Einheit des Abendlands zerstört. Was seither fehlt, ist eine höchste Sinninstanz — und damit jegliches Fundament und jegliches Firmament. Das Leben besitzt keine geistige Ordnung mehr und keine Orientierung. Jeder muss sich nun seinen eigenen Sinn zusammensuchen, einen gemeinsamen gibt es nicht mehr. Der Plural von Sinn lautet Sinne, womit alles gesagt ist. Indem Luther das Gewissen höher wertet als die Lehre der Kirche, verlegt er den Gottesbezug ins Innere eines jeden Einzelnen, womit er ihm auch die Verantwortung für sein Handeln und Denken überträgt. Was fortan regiert, ist ein Individualismus, der zu einem Durcheinander divergierender Meinungen führt. Jeder entscheidet nun selbst, woran er glauben will und woran nicht. Nichts fügt sich mehr, es fehlt jeder Kitt. Was bleibt, ist eine Welt, die pluralistisch zerfällt. Das Einzige, was allgemein zählt, sind Produktion und Konsum, alles andere macht jeder mit sich allein aus. Im Supermarkt der Sinnangebote kann jeder frei wählen, nach Lust und Laune. An Weltbildern, Glaubensartikeln, Wertvorstellungen herrscht kein Mangel.
Carl Schmitt ist überzeugt, dass die protestantische Wende sich von Anfang an auf einen Anarchismus zubewegt, der nur zu bändigen ist durch einen starken Staat. An dessen Spitze muss eine Autorität stehen, die — gleich Gott — absolutistisch bestimmt, was zu gelten hat. Nichts anderes meint Schmitt mit seiner Rede von der politischen Theologie. Ohne einen höchsten Souverän zerfällt alles, er allein kann das Chaos verhindern. Wo tausend Stimmen durcheinanderquasseln, regiert der reinste Wirrwarr. Wehret den Anfängen, lautet Schmitts Credo. Ordnung ist alles, egal, mit welchen Mitteln man sie verwirklicht und aufrechterhält. Andernfalls führt der neuzeitliche Subjektivismus mit seiner Gesinnungsethik und seinem Tanz ums Individuum zum Kampf aller gegen alle. Ein jeder erhebt dann seine eigene Moral und seine eigenen Vorstellungen von Wahrheit und Gerechtigkeit zum Absoluten. Würde Schmitt heute noch leben, wäre für ihn mit der politischen Correctness der letzte Beweis dafür erbracht.
Allerdings stoßen der Relativismus, Individualismus und Pluralismus auch an der linken Front auf wenig Gegenliebe. Wo ein kapitalistischer Darwinismus herrscht, verschleiert die Rede von Freiheit und Toleranz das Recht des Stärkeren. Was nach Pluralismus klingt, verdeckt lediglich, dass die meisten sich durch eine Welt schlagen müssen, die den Erfolgreichen, Durchsetzungsfähigen, Raffgierigen gehört. Gleich zum Auftakt konstatieren Marx und Engels in ihrem »Kommunistischen Manifest«, dass die neuzeitliche Freiheit darin besteht, sich auf dem Markt als Arbeitskraft zu verkaufen. Bei Adorno heißt es: Wir leben im offenen System der Platzangst.1 Während Adorno jedoch vor autoritären Lösungen warnt, verkündet der orthodoxe Marxist Lukács noch 1969 im ungarischen Rundfunk: Wahrheit gibt es nur in der Einzahl, nicht in der Mehrzahl!2
In dem Roman »Der Zauberberg« taucht Lukács in Gestalt eines Jesuiten namens Naphta auf. Was Thomas Mann bereits dadurch zum Ausdruck bringt, dass er Naphta bei einem gewissen Lukaçek zur Miete wohnen lässt. Naphta wünscht den gottlosen Kehricht der Neuzeit zum Teufel und will die Diktatur des Proletariats errichten. Was ihm zuwider ist, sind humanistische Phrasen, die das himmelschreiende Unrecht unserer Welt als etwas Erstrebenswertes ausgeben. Weil er einen mittelalterlichen Gottesstaat errichten will, dessen Name Kommunismus lautet, charakterisiert sein liberaler Gegenspieler Settembrini ihn als »Princeps scholasticorum«: als Fürsten der Scholastiker.3
Warum die Neuzeit in philosophischer Hinsicht mit Descartes einsetzt, zeigt gleich der erste Satz seiner »Meditationen über die Erste Philosophie«. Er lautet: »Nicht erst heute wird mir bewusst, wie viele falsche Meinungen ich seit meiner Kindheit für wahr gehalten habe, und dass mehr als zweifelhaft ist und ungewiss, was auf so ungesicherten Grundsätzen beruhte; und deshalb beschloss ich, mich einmal ernsthaft in meinem Leben aller Meinungen zu entledigen, die ich voller Treu und Glauben übernommen hatte, um ganz von neuem bei den Fundamenten anzufangen.«4 Gleich zu Beginn seines »Discours de la Méthode« lesen wir, er habe vieles gelernt und studiert, allerdings lauter Dinge, die voller Widersprüche seien und aus bloßen Spekulationen beständen, obwohl man sie als Wahrheiten verkauft. Nicht nur die Theologie, auch die bisherige Philosophie habe »mit einem Anschein von Wahrheit über alles geredet und sich von Leuten bewundern lassen, die weniger gebildet sind.«5 Und deshalb muss ab sofort alles auf den Prüfstand des selbständigen Denkens. Mit seinem Cogito rückt Descartes das Ich ins Zentrum und mit ihm den Vorsatz, den eigenen Verstand über alles andere zu stellen. Nicht mehr Gott bildet den Ausgangspunkt allen Seins und auch nicht die Welt, es ist das Subjekt. Paul Valéry behauptet, Descartes habe mit seinem »Discours« den ersten modernen Roman geschrieben, und fügt voller Bedauern hinzu: »Erstaunlicherweise hat die nachfolgende Philosophie den autobiographischen Anteil wieder zurückgedrängt. Doch daran sollte man wieder anknüpfen und das Leben von Theorien auf die gleiche Weise schildern, wie man das der Leidenschaften schildert.«6
Auch Hobbes räumt mit allem auf, was an Lehrmeinungen noch aus dem Mittelalter herüberschwappt oder was nur als wahr gilt, weil es in antiken Schriften steht.7 Auf den ersten hundert Seiten seines »Leviathan« rennt er nicht bloß gegen das »Kauderwelsch der Scholastiker« an, nicht minder schüttelt er den Kopf über Leute, die sich mit gewichtiger Miene auf Aristoteles berufen.8 Während Descartes die Philosophie weiterhin für relevant hält, veranschlagt Hobbes ihren Nutzen auf nahezu null. In seinen Augen handelt es sich um ein Begriffsgefuchtel, das an Irrsinn grenzt. Wer sich auf die Narreteien einer solchen »Buchstabengelehrtheit« einlässt, gibt seine Urteilskraft an der Garderobe ab.9 Scholastische Abstraktionen sind für ihn keinen Deut besser als die Weissagungen des Nostradamus.10 Hobbes strebt eine radikale Reform der Universitäten an: All dieser Gallimathias muss aus ihnen verbannt werden, und es muss eine verständliche Sprache einkehren, ohne jeden Begriffsnebel.11
Die Aufklärung setzt nicht erst mit dem 18. Jahrhundert ein, sie beginnt mit Descartes und Hobbes, zu denen sich als dritter Spinoza gesellt, der die Religion in seinem »Theologisch-politischen Traktat« als Angelegenheit für geistig Bedürftige abkanzelt. Die Scholastik hat ausgespielt, die Kirche ihre Vorherrschaft eingebüßt. Im Gefolge von Descartes wurde ganze Arbeit geleistet.
Warum aber wird Descartes so angefeindet, vor allem von Leuten, die alle Freiheiten des neuzeitlichen Denkens genießen, ihn jedoch für den Urschuldigen einer Moderne halten, der sie am liebsten den Garaus machen würden? Wenige Jahre nach der Französischen Revolution setzt eine Bewegung ein, die den Namen Romantik erhält und sich dadurch auszeichnet, dass sie vom Lichtzwang der Vernunft erst einmal genug hat. Sie setzt sich bis heute fort, und zwar gerade dort, wo man sie auf den ersten Blick gar nicht vermutet. In seinem 1961 erschienenen Werk »Wahnsinn und Gesellschaft« zeigt Foucault die neuzeitliche Vernunft einer Gewalt, der niemand entkommt, außer auf die Gefahr hin, ausgestoßen oder eingesperrt zu werden. Wer sich ihr nicht fügt, wird als wahnsinnig, abartig, unnormal stigmatisiert. Für Foucault ist Don Quijote das erste Opfer dieses neuzeitlichen Rationalitätswahns. Weil er in einer ritterlichen Vergangenheit lebt, über die man inzwischen den Kopf schüttelt, wird er als Irrer abgestempelt. Man erhebt sich über ihn, im Namen einer Vernunft, die nichts von dem, was ihren Horizont überschreitet, mehr begreift.
Auch wenn der Ritter von der traurigen Gestalt wenige Jahre älter ist als der Apologet des Cogito, kann man sagen: Don Quijote ist das Opfer von Descartes. Vernunftkritik bedeutet Descartes-Kritik, von Heidegger bis Foucault, der in seinem letzten Interview erklärt: »Mein ganzes philosophisches Werden ist durch Heidegger bestimmt worden«, für ihn sei er »immer der wesentliche Philosoph gewesen«.12 Beide wollen einen Humanismus überwinden, der nur ein anderer Begriff ist für radikale Subjektherrschaft. Humanismus bedeutet, dass der Mensch sich in den Mittelpunkt des Universums rückt und nichts mehr über ihm stehen darf, weder ein Gott noch die Natur, noch sonst etwas. Sofern das neuzeitliche Subjekt noch von Gott spricht oder etwas Höherem, wird es nicht müde zu betonen, dass niemand wissen kann, ob es dieses Höhere gibt. Fest steht lediglich, dass es sich bei all dem um Ideen handelt, die von uns selbst stammen und geschichtlichem Wandel unterworfen sind. Die Welt ist, was sich in unseren Köpfen, unserer Sprache, unseren Phantasien abspielt. Der Begriff Projektion hält Einzug: Wir selbst sind der Projektor, der Rest des Universums bildet eine immense Leinwand, auf der sich unsere Wünsche, Vorstellungen, Absichten spiegeln. Alles gerät zum Projekt unseres Denkens, Handelns, Veränderns.
Das alles fängt an mit dem cartesianischen Ego, dessen Blick nun alles prägt und bestimmt. Descartes zerstört die Grundfesten der Metaphysik, indem er an die Stelle des Seins das Subjekt rückt. Bereits vor Descartes zerstört Luther die Grundfesten jeder Dogmatik, indem er das Gewissen zur zentralen Instanz kürt, was bedeutet, dass er den Glauben an jeden Einzelnen relegiert und ihn zur Sache eines persönlichen Gottesbezugs macht. Dass ein solcher Glaube voller Unsicherheit bleiben muss und ganz schnell zu Pascalshorror vacui führt, ist evident. Nicht zufällig heißt es in seinen »Pensées«, die Natur weise überall auf einen verlorenen Gott hin, sowohl im Innern des Menschen wie außerhalb von ihm.13
Die Postmoderne vollendet lediglich, was seit Anfang der Neuzeit im Schwange ist. Sofern Deleuze voller Euphorie feststellt, es gebe nicht nur keine privilegierten Gesichtspunkte mehr, sondern nicht einmal einen gemeinsamen Gegenstand, auf den wir uns beziehen — wie einst auf Platons Idee des Guten oder den Gott der Religionen —, begrüßt er eine Entwicklung, die nicht erst in den letzten ein-, zweihundert Jahren einsetzt, sondern mit dem Ende des Mittelalters. Was Deleuze als neue Vielheit feiert, liefert der Gegenseite den Beweis, dass jedes sinnstiftende Denken verloren gegangen ist und mit ihm jede sinnstiftende Ordnung.14 Wir sind mit tausenderlei Überzeugungen und Weltbildern konfrontiert, es fehlt jeder verbindliche Rahmen und jeder richtungsweisende Horizont. Alles zersplittert, unaufhaltsam, immer weiter.
In den Augen fundamentaler Neuzeit-Kritiker wie Leo Strauss, Eric Voegelin, Martin Heidegger und Carl Schmitt steuern wir seit fünfhundert Jahren auf einen Nihilismus zu, der bloß noch die Beliebigkeit sozialer Stimmungen, windiger Meinungen und wechselnder Sprachregelungen kennt. Foucault behauptet, die moderne Literatur zerstöre sich selbst, und zwar dadurch, dass sie zunehmend lauter, betäubender, grenzenloser um eine Leere kreist, die am Ende nur noch aus Selbstverweisen besteht, hinter denen sich nichts als ihr eigenes Gemurmel verbirgt.15 Bei Derrida heißt es: »Auf eine bestimmte Weise bedeutet ›das Denken‹ nichts«. Es lebe, behauptet er, vom »weißen Zwischenraum im Text«.16
Dass man inzwischen sogar die Existenz biologischer Geschlechter bestreitet, liefert notorischen Bedenkenträgern den endgültigen Beweis, dass es keinerlei Bremsen und Halten mehr gibt. Das neue Babylon liegt nicht vor uns, wir leben mittendrin. Man hat uns gewarnt.
PRÄLUDIEN
Ein katholischer Pole
Als Mitglied der Partei für Recht und Gerechtigkeit war Ryszard Legutko polnischer Bildungsminister, inzwischen steht er der PiS-Fraktion im Europaparlament vor und ist stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Europäische Konservative und Reformisten. Als Philosoph lehrt er an der Universität Krakau, seine Habilitation trägt den Titel »Platons Kritik der Demokratie«. 2016 erscheint von ihm die Schrift »Der Dämon der Demokratie. Totalitäre Strömungen in liberalen Gesellschaften«. Der erste Satz lautet: »Dieses Buch handelt von den Ähnlichkeiten zwischen Kommunismus und liberaler Demokratie.«1
Geht es um den Kampf gegen die nihilistische Zerstörung christlicher Werte und das nationale Selbstbestimmungsrecht der Völker, stößt man schnell auf Legutkos Namen. Der Kommunismus lebt für ihn in einem Multinationalismus fort, der den Staaten die Freiheit raubt, ihre Angelegenheiten nach eigenem Gusto zu regeln. Was einst Moskau war, ist heute Brüssel. Dort hat das feindliche Hauptquartier seinen Sitz, dort regieren die linken Zwangs-Säkularisierer, dort wird die Masseneinwanderung von Moslems organisiert, mit dem Ziel, die letzten Reste des Abendlands zu vernichten. Gegen diesen postkommunistischen Despotismus führt Legutko einen Kreuzzug. Er will Europa in einen Zustand zurückführen, wo nicht mehr Minderheiten die Mehrheit terrorisieren. Weder will er sich zwingen lassen, muslimische Communities zu akzeptieren, noch will er Homosexualität und sonstige Perversionen als etwas Normales anerkennen müssen.
Zu den fatalen Ausflüssen des Liberalismus gehört in seinen Augen ein Relativismus, der zu einem prinzipienlosen Pluralismus führt und zu einem liederlichen Toleranzgetue. Mit einer totalitären Pädagogik versucht der heutige Westen die Menschen ihrer angestammten Sitten zu berauben und sie radikal umzuerziehen. »Sowohl der Kommunismus als auch die liberale Demokratie sind Herrschaftsformen, deren Absicht es ist, die Realität zum Besseren zu verändern«, erklärt er. »Beide leben von der Überzeugung, dass die Welt, wie sie ist, nicht tragbar ist und dass man sie verändern muss: das Alte soll durch das Neue ersetzt werden. Beide Systeme greifen … unerbittlich ein ins soziale Gefüge, beide rechtfertigen ihr Eingreifen mit dem Argument, es diene der Verbesserung.«2 Tyrannische Sozialtechnologen bestimmen unser Leben; sie dulden nichts, was ihren Heilsvorstellungen widerspricht.
In seiner Argumentation folgt Legutko rechtsintellektuellen Vordenkern, die sich an Leo Strauss orientieren, für den wiederum Hobbes der geistige Urheber aller neuzeitlichen Fehlentwicklungen ist. Legutko teilt mit Strauss die Überzeugung, dass die Moderne keinerlei Wahrheit mehr kennt, weder eine philosophische noch eine sonstige. Der Mensch bedarf jedoch geistiger Orientierung, anders findet er nicht nur keinen Sinn in der Welt, anders ist auch keine Ordnung möglich. Was wir überwinden müssen, ist unser neuzeitlicher Stolz auf eine Freiheit, die uns haltlos macht. Menschen bedürfen einer starken Hand, eines festen Glaubens, eines klaren Wegweisers, alles andere führt in Abgründe.
Die Grundlagen für diese Haltlosigkeit wurden von Descartes gelegt, der jede Wahrheit in Frage stellt, die sich bloßer Tradition verdankt oder großen Namen aus der Philosophie- und Theologiegeschichte. Descartes’ politisches Pendant findet sich bei Hobbes, der ein Staatsmodell entwirft, das Religion nur so weit zulässt, wie sie den öffentlichen Frieden nicht stört. Hobbes kriminalisiert jeglichen Wahrheitsanspruch, der sich über den Staat stellt. Zwar glaubt er, dass seine Staatsvorstellung christlichen Prinzipien entspricht, hinterrücks öffnet er atheistischen Umtrieben jedoch Tür und Tor. Weil seine Art von Staat ein tolerantes Zusammenleben anstrebt, darf dort die Frage nach einer absoluten Wahrheit keinen wirklichen Platz mehr besitzen. Hobbes lässt die Religion verdorren und mit ihr alles, was über das bloße Funktionieren des Lebens hinausweist. An die Stelle überzeitlicher Wahrheiten tritt der politische Glaube, dass wir unsere irdischen Dinge auch ohne etwas Absolutes regeln können. Wir müssen uns lediglich für eine Gesellschaft engagieren, deren einzige Wahrheit darin besteht, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Womit der Mensch sich selbst zu Gott macht. Zu einem Gott, der den Relativismus zur höchsten Gottheit erklärt.
Hinter Legutkos polterndem Zorn gegen alles Linke und Liberale — wozu auch alles moderat Konservative gehört — verbirgt sich eine Argumentationsstruktur, wie man sie seit langem in rechten amerikanischen Thinktanks findet. Stets lautet der Grundtenor, dass im Liberalismus ein Totalitarismus steckt, der alles zum Feind erklärt, was nicht einstimmt in seinen bodenlosen Relativismus und nicht an das Ideal einer multikulturellen Weltgemeinschaft glaubt. Da diese Utopie über jedem anderen Glauben zu stehen hat, ist der Liberalismus keinen Deut besser als der Kommunismus. Beide wollen die Menschheit umerziehen, beide alles unterdrücken, was ihren Zielen widerstrebt.
Laut Legutko unterstützt die postkommunistische Internationale der Linksliberalen weltweit Organisationen, die alle nationalen Eigenheiten systematisch unterminieren und die sittliche Selbstbestimmung der Völker hintertreiben. »Beide reden gern vom ›Volk‹ und von großen sozialen Bewegungen, während sie gleichzeitig — ganz wie die Philosophen der Aufklärung — keinerlei Skrupel kennen, wenn es darum geht, die soziale Spontaneität schonungslos zu unterbinden, um den gesellschaftlichen Umbau voranzutreiben«, heißt es in Legutkos »Dämon der Demokratie«.3 Soziale Spontaneität bedeutet in diesem Fall: Anti-Schwulen-Demonstrationen, Pegida-Aufmärsche, Anti-Abtreibungs-Proteste.
Laut Legutko erleben wir schon bei Hobbes, wie »Befreiung und Zwang sich vermischen«.4 Bereits Hobbes wird nicht müde, den Menschen einzureden, dass sie von allem scholastischen Irrsinn lassen müssen und nicht mehr die Kirche als höchste Autorität anerkennen dürfen. »Hobbes erklärte ihnen, was Hölle und Himmel im Licht der Vernunft noch bedeuten können und welche Teile der christlichen Lehre vertretbar sind und welche nicht.«5 Was daraus im Lauf der Jahrhunderte geworden ist, erleben wir heute in erschreckender Deutlichkeit, schließlich haben solche Lehren es geschafft, »alle nicht-liberalen Ansichten über die politische Ordnung zum Schweigen zu bringen und an den Rand zu drängen. Der Liberalismus hat die Köpfe der Menschen so sehr monopolisiert, dass die Theoretiker des Sozialismus in den kommunistischen Ländern vor Neid erblassen müssten.«6 Was der Liberalismus als Offenheit anpreist, entpuppt sich als doktrinäre Weltanschauung, die einzig akzeptiert, was seinem eigenen Bild von Offenheit entspricht.
Der Liberalismus ist nicht liberal, er betreibt eine Gehirnwäsche, wie man sie vom Kommunismus kennt, nur mit flexibleren Mitteln. Beiden bescheinigt Legutko eine Brutalität, wie es sie nie zuvor gegeben hat. Im März 2020 veröffentlicht er in der rechtskatholischen amerikanischen Zeitschrift »First Things« einen Artikel mit dem Titel »Warum ich nicht liberal bin«. Er beklagt dort, dass nicht mehr die Kirche bestimmt, was man zu glauben hat, sondern der Staat. Der Staat indoktriniert das Volk mit einem Bildungsprogramm, das den Einfluss der Eltern schon früh an den Rand drängt: »Besonderes Augenmerk wird auf die Sprache gelegt …, aber auch darauf, dass die Kinder nur geeignete Bücher lesen, nur korrekte Filme sehen, nur passende Spiele spielen. Alles soll das Gefühl einer ›Offenheit‹ vermitteln, von der die liberale Übertheorie zutiefst glaubt, dass sie zu einer neuen und freieren Gesellschaft führt. … Eine von großen Unternehmen unterstützte Propagandamaschine programmiert die Köpfe der Menschen, was anfängt bei den Kindern im Kindergarten und sogar noch früher. … Die wenigen Ausnahmen, welche wagen, ›Nein‹ zu sagen, verlieren häufig ihre Arbeit und werden zur Zielscheibe verbaler und sogar körperlicher Gewalt.« Was wir unter Freiheit verstehen, läuft laut Legutko auf einen verbissenen Anti-Katholizismus hinaus, wie man ihn von Voltaire kennt und von Hobbes.
Aus all diesen Gründen muss man das liberale Establishment bekämpfen, allem voran sein »strenges Regiment politischer Korrektheit«. Man muss wieder den Mut aufbringen, »auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen« und nicht mitzusingen im totalitären Chor linker Sittenwächter. Man darf keine Angst haben, als Frömmler, Reaktionär, Faschist abgekanzelt zu werden.7 Man muss wagen, den vielen Voltaires entgegenzutreten und das Monopol einer Ideologie zu zertrümmern, die sich einen Pluralismus auf die Fahnen schreibt, der aus nichts als Konformitätsdruck besteht und Zensur.
Rotzlöffel und Banditen
2009 reichen Krakauer Gymnasiasten bei ihrer Schulleitung eine Petition ein, die das Entfernen religiöser Symbole aus Klassenzimmern verlangt. Sie berufen sich auf die Religionsfreiheit und eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Die Petition wird abgelehnt, die Kreuze bleiben hängen, die Schüler wehren sich nicht weiter dagegen. Als Legutko Wind von dieser Aktion bekommt, beschimpft er die Unterzeichner als »Hündchen«, »Rotzlöffel« und »ungezogene, von ihren Eltern verwöhnte Gören«. Worauf die Schüler ihn anzeigen. Als Schadensersatz verlangen sie 5000 Zloty — circa 1000 Euro —, die einem sozialen Zweck zugutekommen sollen, samt einer Entschuldigung, die in zwei Zeitungen erscheinen muss.
Legutko ist überzeugt, dass man jemanden wie ihn überhaupt nicht verklagen kann, er beruft sich auf seine Immunität als Europaabgeordneter. Das Gericht widerspricht. Es kann in seinen Äußerungen keinen Zusammenhang mit seiner Tätigkeit in Straßburg erkennen.1 Er verliert den Prozess. Was ihm wieder einmal beweist, wie weit es gekommen ist mit dem Abendland.
Als Ungarn und Polen sich Ende 2020 weigern, die Ergebnisse eines lange verhandelten EU-Haushaltsgipfels zu unterzeichnen, der Milliardenbeträge gegen Corona zur Verfügung stellt, verkündet Legutko im polnischen Staatssender TVP, den Westeuropäern sei das Foul-Spiel zur zweiten Natur geworden. Weil Brüssel die Vergabe von Geldern künftig an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeitsprinzipien knüpfen will, behauptet er, Brüssel erpresse Polen mit einer »räuberischen Verordnung«; das Europaparlament werde von einer tyrannischen Linken kontrolliert, es handle sich um hellen Wahnsinn, nirgends ein Funke von gesundem Menschenverstand, man müsse sich die Gesichter und die Rhetorik dieser Leute nur anschauen.2
Zum Beispiel Garaudy
1913 Geburt in Marseille. 1933 Eintritt in die Kommunistische Partei. Über die Besatzungszeit sind mehrere Versionen im Umlauf. Eine lautet, er habe zwei Jahre in einem Konzentrationslager verbracht, aus dem ihm die Flucht gelang. Danach steckt ihn das Vichy-Regime in ein algerisches Internierungslager. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird er als Abgeordneter der KPF Mitglied der Verfassungsgebenden Versammlung. Bis 1951 Abgeordneter der Nationalversammlung. 1951—1955 Aufenthalt in der UdSSR, Moskau-Korrespondent der Parteizeitung »L’Humanité«. 1953 marxistisch-orthodoxe Doktorarbeit an der Sorbonne über »Die materialistische Erkenntnistheorie«. 1956 zweite Doktorarbeit an der Russischen Akademie der Wissenschaften über »Die Freiheit als philosophische und historische Kategorie«. Nach dem XX. Parteitag der KPdSU, auf dem Chruschtschow die Entstalinisierung zur neuen Parteilinie erklärt, Kehrtwende zum Reformkommunisten. 1956—1958 ist er als Abgeordneter der KPF Vizepräsident der Nationalversammlung. 1961—1970 Mitglied des Politbüros der KPF. 1965—1972 Professor für Philosophie und Kunstgeschichte an der Universität Poitiers, Direktor des »Centre d’Études de Recherches Marxistes«.
In seiner 1966 veröffentlichten Schrift »Marxismus im 20. Jahrhundert« engagiert er sich für den christlich-marxistischen Dialog. Während Daniel Cohn-Bendit im Pariser Mai 68 die Studentenrevolte anführt, erklärt Garaudy: »Diese Massenbewegung erkennt sich nicht in uns, und wir erkennen uns nicht in ihr.« 1970 Ausschluss aus der KPF wegen revisionistischer Umtriebe. 1975 erscheint »Parole d’homme« — Menschenwort —, wo es heißt: »Je mehr ich arbeite, desto mehr ist Gott der Schöpfer. Der Sozialismus, gegründet auf einen permanenten Dialog des Menschen mit dem Gott-Poeten, der in ihm wohnt, ist ein Sozialismus, dessen höchste Berufung darin besteht, ökonomische, politische und geistige Grundlagen zu schaffen, die den poetischen Menschen entstehen lassen.« Platon und Descartes sind für Garaudy verantwortlich für die Übel der abendländischen Welt. Der letzte Satz des Buches lautet: »Ich bin Christ.« Davor heißt es: »In diesem ganzen Buch wie in meinem ganzen Leben geht es mir um nichts als Liebe. Ich möchte, dass dies das letzte Wort ist.«1 Garaudy konvertiert vom Katholizismus zum Protestantismus.
1979 erscheint »Appel aux vivants« — Aufruf an die Lebenden —, in dem Ajatollah Khomeini und Muammar al-Gaddafi als leuchtende Humanisten verherrlicht werden. 1981 erscheint »Pour l’avènement de la femme«, dessen deutscher Titel lautet: »Das schwache Geschlecht ist unsere Stärke — Für die Feminisierung der Gesellschaft«. Garaudy sieht sich an der Spitze der feministischen Bewegung und lässt sich als Präsidentschaftskandidat der französischen Alternativen und Grünen aufstellen, bringt aber nicht die erforderlichen fünfhundert Unterschriften zusammen. Es erscheinen »L’Islam Habite Notre Avenir« — Dem Islam gehört unsere Zukunft — und »Promesse d’Islam« — Verheißung Islam —, wo es zum Auftakt heißt: »Der Okzident ist ein Zufall. Seine Kultur eine Anomalie.« Das Abendland, erklärt er, beruhe auf einer Lüge, solange es sich immerzu auf seine antiken und jüdisch-christlichen Quellen berufe und nicht auf seine islamischen. 1982 Konversion zum Islam in Genf, wo er feierlich erklärt: »Gott allein ist Gott, und Mohammed ist sein Prophet.«
Er heiratet die Palästinenserin Salma Al-Farouki. Anfang der 1990er Jahre ziehen die beiden nach Córdoba, um in Andalusien die islamische Kultur wiederzubeleben.
Zusammen mit zwei Priestern gibt Garaudy am 17. Juni 1982 in »Le Monde« eine Anzeige auf mit dem Text »L’Affair Israël«. Einer der Priester, Michel Lelong, hält 2007 die Grabrede auf Maurice Papon, der unter Pétain für die Deportation der Juden in Marseille verantwortlich war und dafür 1998 zu zehn Jahren Haft verurteilt worden ist, von denen er drei abbüßt. 1961 war er als Polizeipräfekt von Paris für das Massaker an über zweihundert Algeriern verantwortlich. In seiner Grabrede vergleicht Lelong Papon mit Christus: »Wir alle wissen, wie ungerecht Männer und Frauen über Jahrhunderte hinweg behandelt worden sind. Monsieur Papon ist einer von ihnen. Er hat ein Vorbild und ein Licht gefunden in Christus, der ebenfalls zu Unrecht verurteilt wurde.«2
Circa 1983 kommen mir auf der Tübinger Neckarbrücke an einem sommerlichen Abend Erhard Eppler, Roger Garaudy und eine weitgehend verschleierte Frau entgegen. Tiefer Ernst in allen drei Gesichtern. Sie scheinen die ganze Bürde des Weltgeists mit sich zu schleppen.
1984 erhält Garaudy den saudischen König-Faisal-Preis für seine Verdienste um den Islam. 1985 erscheint »Biographie du XXe siècle«, sein »philosophisches Testament«. Dort heißt es: »Der Islam verfügt heute über weitaus größere Expansionsmöglichkeiten als zur Zeit seiner Blüte; angesichts des doppelten, unumstößlichen Scheiterns des amerikanischen und des sowjetischen Modells kann er einer Welt Hoffnung geben, die durch dieses zweifache Scheitern in ihrem Überleben bedroht ist.« 1986 erscheint »Palestine, terre des messages divins« — Palästina, Land göttlicher Botschaften. 1989 ist er anlässlich der 10-Jahresfeierlichkeiten der Revolution Staatsgast im Iran. Garaudy vergleicht die iranische Revolution mit der Französischen und erklärt: »Der Tschador ist zum Gegenbild des Striptease geworden, die immerwährende Lektüre der großen Dichtung des Koran wird die Antwort sein auf das Gekreisch der Rockmusik und ihr Gezucke.«
1990 erscheint in Beirut »Mon tour du siècle en solitaire« — Meine Jahrhundertreise als Einzelgänger. Über die Teheraner 10-Jahresfeierlichkeiten heißt es dort: »Von der Tribüne herab erscheint diese Menschenmenge wie ein fabelhafter Vogel mit weit gebreiteten Schwingen. An beiden Enden, von feinen schwarzen Federn umfangen, endlose Scharen von Frauen, Witwen, trauernden Müttern, jungen Mädchen in Trauerschleiern. Dahinter dichte Reihen kastanienbrauner Uniformen: die der ausrückenden Soldaten. … In der Mitte, einem Leib gleich, das Haupt und Herz des schwebenden Vogels, ein breites Band aus weißen Daunen; es sind Tausende von Freiwilligen der Selbstmordkommandos, mit Sprengstoff um ihre Körper oder in ihren Autos, die sie gegen ihre Feinde richten. Schon tragen sie ihre Leichentücher als Gewand des nahen, ersehnten Todes.«
Im Verlag La Vieille Taupe, der in seinen Anfängen linksradikal ist, bald aber ins Rechtsradikale umkippt und Faurissons negationistische Schriften veröffentlicht, erscheint 1995 »Les Mythes fondateurs de la politique israélienne« — Die Gründungsmythen der israelischen Politik. Garaudys These lautet, der Holocaust sei eine Erfindung von Zionisten, mit dem Ziel, die Palästinenser zu vertreiben und auf ihrem Land ein verbrecherisches Staatswesen zu errichten. Die Opferzahlen seien maßlos aufgebläht, allenfalls seien einige an Typhus gestorben und an Unterernährung; ein westlicher »intellektueller Terrorismus« erkläre jedoch jede Diskussion zum Tabu. Schließlich habe der Zweck der »Endlösung« lediglich darin bestanden, Europa von unmenschlichen, kriminellen Juden leerzuräumen.3
Der Vorsitzende des iranischen Wächterrats, Ayatollah Ahmad Dschannati, will das Buch in alle Sprachen der islamischen Welt übersetzen lassen und kostenlos verteilen. Garaudy unternimmt Reisen durch allerlei muslimische Länder, wo er häufig von den Staatsoberhäuptern empfangen wird. Ehemalige Konzentrationslagerinsassen reichen Klage ein. Aus Genf erreicht ihn eine Solidaritätsadresse von Jean Ziegler: »Mein werter Kollege und Freund, mich schockiert die Anklage, die man gegen Sie erhebt. … Da ich selbst angeklagt bin wegen mancher Bücher und Artikel, in denen ich von meinem Recht auf Kritik Gebrauch mache — von Spekulanten, Finanzleuten, einem ehemaligen afrikanischen Diktator —, ist mir das Heimtückische solcher Prozesse vertraut. Ihre ganze Tätigkeit als Schriftsteller und Philosoph zeugt von der Unnachgiebigkeit Ihrer Analysen und der unerschütterlichen Wahrhaftigkeit Ihrer Absichten. Sie hat aus Ihnen einen der führenden Denker unserer Zeit gemacht.«4 Garaudys Verteidiger ist das ehemalige KPF-Mitglied Jacques Vergès, der ebenfalls zum Islam konvertiert ist. Zwischen 1970 und 1978 war er untergetaucht, wahrscheinlich in Pol Pots Kambodscha. Vergès ist auch der Verteidiger von Klaus Barbie, dem »Schlächter von Lyon«, sowie des Terroristen Carlos, des RAF-Unterstützers und Stasi-Mitarbeiters Klaus Croissant und von Slobodan Milošević.
Am 20. April 1998 wird Garaudy in Teheran von Präsident Khatami und Ayatollah Khamenei mit allen Ehren empfangen. Dazu gehört ein Fernsehauftritt mit Khomeinis Nachfolger Khamenei, der ihm dankt für seinen Mut, dass er der Welt die Wahrheit verkündet. Planung einer Holocaust-Konferenz. Als Antwort auf 9/11 veröffentlicht Garaudy 2004 »Le Terrorisme occidental« — Der abendländische Terrorismus. Am 11. und 12. Dezember 2006 Holocaust-Konferenz in Teheran. Eingeladen sind neben Garaudy die Holocaust-Leugner Robert Faurisson, David Irving und das ehemalige RAF-Mitglied Horst Mahler, der inzwischen NPD-Mitglied ist und für einen reinrassigen Staat eintritt. Mahler kann nicht anreisen, weil er im Gefängnis sitzt, Garaudy muss aus gesundheitlichen Gründen absagen, schickt jedoch eine Videobotschaft, in der er Präsident Ahmadineschād unterstützt in seinem Kampf gegen den Staat Israel, der verschwinden muss. 2012 stirbt Garaudy mit knapp hundert Jahren.
Wandern von Gott zu Gott
Noch bevor Garaudy sich zum Islam bekehrt, bemerkt Jean Améry in einer Besprechung seines Buches »Menschenwort«: »Was ging, was geht da vor?« Seine Antwort: »Vielleicht nichts anderes als schlichte Regression.« Améry gibt seiner Besprechung den Titel: »Wandern von Gott zu Gott«.1
Sympathy for the devil
Bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 rückt eine Gestalt in den Mittelpunkt, die sich aufbäumt wie ein Stier und röhrt wie ein Hirsch, mit Kojotenfell und schwarzen Wikinger-Widderhörnern, das Bartgesicht mit den Farben der amerikanischen Flagge beschmiert, in dem einen Fausthandschuh ein Megaphon, im andern einen Stab mit Sternenbanner, der Oberkörper entblößt, auf der Herzseite ein Tattoo, von oben bis unten, mit germanischem Kriegshammer, dem Symbol des Gottes Thor, von dem es heißt, er zermalme alles, was sich ihm in den Weg stellt. Diese halb bedrohliche, halb groteske Faschingsgestalt führt vor, wie in dem Begriff Karneval das Karnalische steckt: das Fleisch, das Nackte, das Raubtierhafte. Während der wirkliche Fasching ein Spiel bleiben will, bei dem man für ein paar Stunden die zivilisatorische Hülle abstreift und ein bisschen die Sau rauslässt, geht es hier um viel mehr.
Dieser Widderhörnige will Amerika von Satanisten befreien, die sich um Hillary Clinton scharen und Kinder entführen, die sie vergewaltigen und deren Blut sie aussaugen. Indem er sich als einen Schamanen inszeniert, der Amerika von einer barbarischen Elite befreien will, fördert er wider Willen eine Wahrheit zutage, die darin besteht, dass Amerika seinen Namen erst seit fünfhundert Jahren trägt — dank dem Freiburger Kartographen Martin Waldseemüller, der diesen Kontinent im Jahr 1507 nach dem Seefahrer Amerigo Vespucci benannt hat. Hätte Waldseemüller Christoph Kolumbus gekannt, würde Amerika vermutlich Kolumbien heißen oder Christophien.
Jenes Land, das sich seit fünfhundert Jahren stolz Amerika nennt, fußt auf einer der schlimmsten Barbareien der Weltgeschichte. Nicht nur hat es die indigene Bevölkerung zum großen Teil ausgerottet, seinen Aufstieg und Wohlstand verdankt es der Sklaverei. Im Namen einer Zivilisation, die sich christlich nennt und ihre Wiege in der attischen Demokratie verortet, verkündet es bis heute dem Rest der Welt, dass es nichts Besseres gibt, als seinem Beispiel zu folgen. Das Outfit dieses Kapitol-Barbaren veranschaulicht mit einem Schlag die Anfänge Amerikas. Sinnfälliger lässt sich schwerlich zeigen, was Freud mit der Wiederkehr des Verdrängten meint. Mitten im Kapitol, dem Tempel der amerikanischen Demokratie, treten uns in seiner Gestalt die blutgetränkten Prärien vor Augen, denen dieses Land sein Gepräge verdankt. Mit seinem halbnackten Leib entblößt dieser karnevaleske Wilde nicht nur sich selbst, er entblößt die Geschichte eines Landes, das sich der Welt als leuchtendes Beispiel präsentiert, wenn es darum geht, Schurkenstaaten von Tyrannen zu befreien und die Menschheit mit hehren Idealen zu beglücken.
Allerdings erzählt dieser Barbar noch eine weitere, ganz und gar aktuelle Geschichte. Schließlich repräsentiert er Abermillionen von Amerikanern, die einem rücksichtslosen Rüpel zujubeln, der als Präsident in der ganzen Welt Entsetzen auslöst — was bei seinen Anhängern nur für umso größere Begeisterung sorgt. Um ihn im Amt zu halten, sind viele bereit, sogar Amerikas Allerheiligstes zu zerstören: die Demokratie. Ob sie tatsächlich glauben, dass man ihnen die Wahl gestohlen hat, spielt so gut wie keine Rolle. Sie bewundern ihr Idol dafür, dass es ganz allein bestimmt, was als wahr zu gelten hat und was nicht. Sie jubeln einem Mann zu, der kein Gesetz kennt außer sein eigenes. Sie feiern ihn, weil es ihm egal ist, wie ekelhaft ihn der Rest der Welt findet. Sie liegen ihm zu Füßen, weil es ihn einen Dreck schert, was andere für Moral und Anstand halten. Er führt vor, wie man die Ketten unserer zivilisatorischen Zwänge sprengt und sich nicht mehr domestizieren lässt. Wer sich ihm in den Weg stellt, gehört weggesperrt — »lock her up!« — oder auf den elektrischen Stuhl, wie er es für Joe Biden gefordert hat. Bereits während seines ersten Wahlkampfs jubelt man ihm zu, als er verkündet, er könne auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und würde trotzdem die Wahlen gewinnen. Auch der gehörnte Karnevalist im Kapitol hat sich aufgemacht, jeden Rahmen zu sprengen, nicht nur den der Demokratie, sondern den der Zivilisation.
Er bezeichnet sich selbst als Schamanen, was bedeutet, dass er Naturmächte beschwört, die tiefer liegen als alle Vernunft. Mit Hilfe archaischer Riten und ekstatischer Techniken setzen Schamanen Kräfte frei, die zwischen Tier und Mensch die Grenze einreißen. Wie sehr er sich mit dem Animalischen eins fühlt, offenbart nicht nur sein Äußeres; er nennt sich Yellowstone Wolf, was heißt, dass er sich im Besitz urwüchsiger Kräfte wähnt. Schamanen werden nicht gewählt wie Politiker und Präsidenten, sie sind es qua Natur. Ihre Autorität beziehen sie aus sich selbst, es gibt daran nichts zu diskutieren; im Naturreich herrschen andere Gesetzmäßigkeiten. Schamanen rufen Geister, sie rufen nicht zur Abstimmung. Wir bewegen uns hier nicht mehr in regelgelenkten Bahnen, Dialog und Konsens haben ausgespielt.
Schamanen machen rückgängig, was nicht erst seit Descartes als ausgemacht gilt: dass der Mensch etwas anderes ist als das Tier, dank seines Bewusstseins, das unseren Trieben und Begierden eine reflexive Sperre hinzufügt, die uns zweiteilt in ein körperliches Wesen und in ein geistiges. Diese Trennung hebt der Schamane auf, und zwar nicht intellektuell, sondern aktiv. Wenn Nietzsche die Wiederkehr des Dionysischen postuliert, ruft er keineswegs nach Wein, Weib und Gesang, vielmehr geht es ihm um die Befreiung von einem Kulturzwang, der permanente Selbstdisziplinierung verlangt. Schließlich heißt es vom Wagen des Dionysos, er werde von Panther und Tiger gezogen.1
Drei Jahre vor Hitlers Machtergreifung erscheint von Freud die Schrift »Das Unbehagen in der Kultur«. Für Freud steht fest, dass unter unserem zivilisatorischen Firnis Kräfte rumoren, die nie zum Verschwinden gelangen und immer wieder durchbrechen. Damit wir halbwegs pfleglich miteinander umgehen, bedarf es einer unentwegten Triebunterdrückung, die uns zur zweiten Natur geworden ist. Was wir Kultur nennen, verdankt sich einer Sublimationsleistung, die unsere animalischen Impulse umlenkt. Zum Verschwinden kommen sie dadurch nicht. Unter der äußeren Schicht brodeln weiterhin Kräfte, die wenig Lust haben auf Selbstkontrolle. Sieht man ab vom Schlaf, vergeht keine einzige Stunde, in der wir uns nicht in irgendeiner Weise zusammennehmen, meist ohne es noch zu registrieren. Während wir uns auf gebahnten Wegen bewegen, an denen rechts und links Verbotsschilder stehen, lockt rundum die Wildnis. Manieren erleichtern den Umgang miteinander, kosten aber auch Kraft. Sie hemmen jedwede Gier, zuweilen so sehr, dass der Kessel bedrohlich zu brodeln beginnt. Wird der Druck zu groß, gibt es kein Halten mehr. Mal läuft jemand Amok, mal lässt ein ganzes Volk sich in einen rauschhaften Vernichtungswahn hineinziehen. Manche sind auch bereit, die Demokratie zu opfern, um des eigenen Machterhalts willen, so wie das Idol dieses seltsamen Schamanen.
Wenn Freud von Libido spricht, denkt er nicht nur an Lüste, die auf Glücksmomente aus sind, ebenso denkt er an destruktive Energien. Das Gefühl, nicht zu kriegen, was man will, kann Kräfte freisetzen, die bloß noch auf Zerstörung zielen. Der Begriff Todestrieb besagt nicht in erster Linie, dass man sich selbst vernichten will. In einem viel grundsätzlicheren Sinn geht es um aufgestaute Spannungen, die nach Entladung rufen. Die Frage nach Gewinn und Schaden spielt dabei keine Rolle mehr. Die Hülle fällt, das zivile Gewand bleibt im Schrank.
Freud spricht von »Regressionen zu uralten, längst überlagerten Zuständen des Seelenlebens«.2 Man kann das phylogenetisch verstehen und ontogenetisch zugleich. Der Wilde Westen besitzt deshalb etwas so Faszinierendes, weil dort noch das Faustrecht gilt und der Colt. Man setzt das eigene Leben aufs Spiel. Laut Umfragen hat so gut wie keiner von denen, die das Kapitol gestürmt haben, bereut, dass es Tote gab. Für die meisten war es der intensivste Tag in ihrem Leben. Sie durften mit eigenen Augen erleben, wie Abgeordneten Todesangst im Gesicht stand. Sie haben es allen gezeigt, weltweit.
Bereits während seines ersten Wahlkampfs trägt Trump dazu bei, dass ein aufgestachelter Familienvater mit einem Sturmgewehr in eine Pizzeria dringt, um im Keller aufzuräumen. Dass es dort weder einen Keller gibt noch einen Kinderpornoring, beweist den QAnon-Anhängern lediglich, dass die vampireske Verbrecherbande um Hillary Clinton ihre satanischen Messen an immer anderen Orten zelebriert. Der Widderhörnige vom Kapitol gehört zu den Anführern von QAnon. Er kämpft den Kampf seines Lebens. Der Satan, das sind die andern.
Barrs Christlichkeit
Am 11. Oktober 2019 hält William Barr, Trumps Justizminister, eine Rede an der University of Notre Dame. In einem epochalen Rundumschlag macht er den militanten Säkularismus verantwortlich für die Zerstörung der Familie, für die Zunahme unehelicher Kinder, für steigende Selbstmordraten, für Depressionen, für psychische Krankheiten, für die Wut junger Männer, für das Anwachsen sinnloser Gewalt und die zunehmenden Zahl von Drogentoten. »Wir müssen feststellen, dass der Feldzug, mit dem man die traditionelle moralische Ordnung zerstört, unermessliches Leid, Verwüstung und Elend mit sich gebracht hat. Und dennoch setzen die Kräfte des Säkularismus ihr Treiben mit immer größerer Militanz fort, ungeachtet solcher tragischen Auswirkungen«, stellt Barr fest.
Im Namen einer Christlichkeit, die dem Wohlfahrtsstaat die Schuld gibt für das Schwinden persönlicher Verantwortung, plädiert Barr für die Rückkehr zu einem radikal freien Markt, in den der Staat sich nicht einmischt. Wohin ein falsch verstandenes Christentum führt, veranschaulicht er anhand eines Erlebnisses, das ihn entsetzt hat. »Ich besuchte die Messe in einer Gemeinde in Washington, D. C., in die ich normalerweise nicht gehe«, erzählt er. »Am Ende der Messe trat der Vorsitzende des Komitees für soziale Gerechtigkeit vor, um der Gemeinde seinen Bericht vorzulegen. Er wies auf das wachsende Obdachlosenproblem in D. C. hin und erklärte, man benötige mehr mobile Suppenküchen. Da es sich um eine katholische Kirche handelt, hatte ich erwartet, dass er nach Freiwilligen Ausschau hält, die sich darum kümmern. Stattdessen berichtete er von den Treffen des Komitees mit der Washingtoner Bezirksregierung, bei denen man sich für Steuererhöhungen starkgemacht hat, die den mobilen Suppenküchen zugutekommen sollen.«
Für Barr gehört dieser Mann zu der Sorte Leute, die vom Staat Abtreibungsfreiheit fordern, statt sich selbst sexuell verantwortlich zu verhalten. Er gehört zu denen, die dem Staat Erziehungsaufgaben aufbürden, statt in der Familie für das Wohl der Kinder zu sorgen. Er gehört zu denen, die wollen, dass man Drogenabhängigen Orte zur Verfügung stellt, wo sie legal konsumieren können, statt sie zu verfolgen. Wohin das führt, sieht man an Obamacare: in den Sozialismus. In Barrs Augen gedeiht ein richtig verstandenes Christentum am besten in einem Staat, der sich in nichts einmischt und lediglich für Law & Order sorgt. Alles andere führt in ein Elend, das die Linksliberalen als Fortschritt verkaufen. Was Barr unter Christlichkeit versteht, beschränkt sich auf gnädige Spenden. Was nottut, ist Zucht und Sitte.
Zählt man zusammen, was die notorischen Weltverbesserer anrichten, muss man laut Barr zu dem Schluss gelangen: »Es handelt sich nicht um Zerfall, es handelt sich um organisierte Zerstörung. Säkularisten und ihre Alliierten unter den ›Progressiven‹ blasen zum unerbittlichen Angriff auf die Religion und die traditionellen Werte, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln der Massenkommunikation, Populärkultur, Unterhaltungsindustrie und Wissenschaft.« Die Entschlossenheit, mit der sie ihr Vernichtungswerk vorantreiben, hat längst fanatische religiöse Züge angenommen, mit allem, was dazugehört: Inquisition und Exkommunikation.
Ohne Gott keine Ordnung. Daran krankt unser Leben, schon seit langem. »Die Allgegenwart und Macht unserer Hightech-Populärkultur fördert den Glaubensabfall. … Sie bietet ein noch nie da gewesenes Ausmaß an Zerstreuung.« Wie schon Heidegger bemüht auch Barr den zerknirschten Pascal, um die heutigen Massenmenschen radikaler Oberflächlichkeit zu zeihen: »Zur conditio humana gehören große Fragen, die uns ins Gesicht starren sollten. … Wie jedoch bereits Blaise Pascal beobachten musste, lassen die Menschen sich leicht ablenken vom Nachdenken über die ›Letzten Dinge‹, statt sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen.«1 Wie Legutko plädiert auch Barr für ein robustes Christentum, bei dem man sich fragt, was an ihm eigentlich christlich ist. Mit dem paulinischen Universalismus hat es wenig zu tun, dafür umso mehr mit dem Ruf nach Unterordnung und hohen Mauern. Ginge es nach Barr, dürfte Religionsfreiheit im Grunde nur für erzkonservative Christen gelten, heißt es in der liberalen Wochenzeitung »National Catholic Reporter«. Sie charakterisiert ihn als einen Kulturkrieger und sagt ihm eine Nähe zu Opus Dei nach.2
Das Werkzeug Gottes
Die jahrhundertealte Kritik am relativistischen Liberalismus der Neuzeit erlebt einen erstaunlichen Wiederaufschwung. Während die katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanum Frieden schließt mit der Moderne, melden sich auf philosophisch-politischem Feld immer mehr Stimmen zu Wort, die diesen Friedensschluss für fatal halten. Teils explizit, teils implizit knüpfen sie an die Lehren von Leo Strauss, Eric Voegelin und Carl Schmitt an, in unterschiedlicher Weise. Dass auf den Straßen und an den Wahlurnen die Stimmung seit einiger Zeit nach rechts tendiert, lässt sich schwer übersehen. Es handelt sich um einen Protest, der intellektuell meist dürftig daherkommt und mehr mit Gebell zu tun hat als mit Argumenten. Niemand hat anschaulicher vorgeführt als Trump, wie verkümmert das Sprachvermögen selbst ihrer Anführer ist. Es erschöpft sich in Twitter-Schüssen, die an der Abschaffung der Grammatik arbeiten und auf Abknallerei hinauslaufen. Trumps Anhänger bewundern an ihm, was andere abstößt: das Erratische, Instinktgetriebene, Brutale. Sie sehen in ihm einen der Ihren, obwohl er tausendmal reicher ist.
Allerdings besitzen diese Bewegungen auch Fürsprecher, denen man keineswegs nachsagen kann, sie seien ungebildet und derb. Sie sind intellektuell sattelfest und akademisch bestens vernetzt. Leo Strauss ist der bekannteste Vertreter einer ultrakonservativen Liberalismuskritik, die ein gespanntes Verhältnis zur Demokratie besitzt. Schon lange munitionieren seine Theorien den rechten Rand der Republikaner, deren Thinktanks von Straussianern durchsetzt sind. Strauss selbst hätte für Trump vermutlich nur Verachtung übriggehabt, schließlich wünscht er sich Staatslenker, die nicht allein Stärke beweisen, sondern auch Tugenden kennen und über Geist verfügen. Bei Strauss’ Schülern scheinen solche Grundsätze nur noch bedingt zu gelten; um den Linksliberalen die Macht zu entreißen, ist ihnen offenbar jedes Mittel recht. Weil das ohne den Druck der Straße nur schwer gelingt, sind auch Mob und Meute willkommen. Dass Trump ein halber Analphabet ist und TV-Shows für Kultur hält, nehmen sie in Kauf, solange er eine Wende herbeizwingt, die ihren Vorstellungen entspricht. Um die Welt in ihrem Sinne zu ändern, glauben sie, ihn als Instrument benutzen zu können.
Während Trumps zweitem Wahlkampf konnte man in Fernseh-Dokumentationen evangelikale Pastoren erleben, die in ihren Predigten die Demokraten als den Teufel an die Wand gemalt haben. Auch sie haben über Trump den Kopf geschüttelt, in ihm jedoch ein Werkzeug Gottes erkannt, nach dem Motto: Wenn die Verhältnisse es erfordern, darf man nicht lange fackeln; auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil; der Retter selbst muss kein Ausbund an Moral sein, das Wichtigste, er vollbringt, was vollbracht werden muss. Man verzeiht ihm dann sogar, dass er nicht einmal weiß, wie man richtig eine Bibel in Händen hält. Gottes Vorsehung geht ihre eigenen Wege. Solange das Werkzeug nicht schwul ist, ist nahezu alles in Ordnung. Dass ein richtiger Mann seine Schwächen hat, gehört zur Natur.
Wer von Werkzeugen spricht, hat einen Plan im Kopf. Heiligt der Zweck die Mittel, dürfen die Mittel auch mal wüst sein. Dem Gottgesandten selbst muss keineswegs bewusst sein, dass er ein Werkzeug Gottes ist, es genügt, wenn andere es wissen. Zu ihnen gehört William Barr, den Trump als einen seiner wenigen Minister nicht nach kurzer Zeit feuert. Anders als Trump besitzt Barr eine klare Agenda. Er weiß, wovon er spricht und was er will, weit über den Tag hinaus. So wie der polnische Philosoph Legutko der Partei für Recht und Gerechtigkeit als ideologischer Agitator dient, so liefert Barr den rechten Republikanern das geistige Modell für eine Umkehr, die viel umfassender sein soll, als bloße Politik es vermag. Barr verfügt über ein festes Koordinatensystem, das über die Frage, was falsch läuft in der Welt, keinerlei Zweifel aufkommen lässt. Schon seit er als junger Mann Ronald Reagan im innenpolitischen Stab des Weißen Hauses gedient hat, führt er einen Kampf gegen die Entchristlichung des Westens.
Als Verfassungsrechtler vertritt er die Ansicht, dass effiziente Regierungspolitik nur möglich ist, wenn dem Präsidenten nicht die Hände gebunden sind, weder von Seiten des Kongresses noch von Seiten der Justiz. Solange Richter oder Abgeordnete ihm Prügel in den Weg legen können, hindern sie ihn an seiner Amtsausübung. Barr behauptet, dass die Gewaltenteilung, wie man sie heute handhabt, dem Geist der Gründerväter widerspricht. Ihm schwebt ein System vor, das dem Präsidenten nahezu absolute Macht zuspricht — wie es den Souveränitätsvorstellungen von Carl Schmitt entspricht. Polen lässt grüßen und Ungarn, wo die Entwicklungen in dieselbe Richtung weisen. Am 15. November 2019 hält Barr in Washington eine Rede vor dem Nationalen Juristenkongress, wo er erklärt, die Väter der amerikanischen Verfassung hätten den Präsidenten mit vollkommener Exekutivgewalt ausgestattet, ohne jede Bremsmöglichkeit durch Gerichte oder Verfassungsorgane. »Denn sie glaubten«, erklärt er, »dass die Übertragung der Exekutivgewalt auf eine einzige Person die Präsidentschaft mit ebenjenen Vollmachten ausstatten würde, die für ein energisches Regieren nötig sind.« Diese Vollmachten sollten Signalwirkung besitzen für all diejenigen, die dem »gescheiterten republikanischen Experiment Frankreichs« nicht folgen wollten.
Barr warnt: »Sollte der Kongress versuchen, die Exekutivgewalt auf jemanden zu übertragen, der nicht der Kontrolle des Präsidenten unterliegt, verstößt er gegen die klare Absicht der Verfassungsväter.« Seit Watergate, erklärt er, würden interessierte Kräfte versuchen, die Souveränität des Präsidenten immer weiter zu beschneiden. Um ihrer eigenen Machtfülle willen malten die Legislative und Judikative das Zerrbild eines »raubgierigen Möchtegern-Autokraten«, den man in Schranken weisen muss. Unter Trump habe sich ein Widerstand gegen das Präsidentenamt herausgebildet, der einem Sabotageakt gleichkomme. Für Barr handelt es sich um eine staatsfeindliche Bewegung, die er als Résistance charakterisiert. »Der Begriff ›Résistance‹«, erläutert er, »entstammt einer Sprache, die man verwendet, um den Aufstand gegen eine von einer militärischen Besatzungsmacht auferlegte Ordnung zu bezeichnen. Womit man ganz offensichtlich voraussetzt, dass diese Regierung nicht legitim ist. … Es bedeutet, dass man sich nicht mehr als ›loyale Opposition‹ sieht, wie es gegnerische Parteien in der Vergangenheit getan haben; man sieht sich in einen Krieg verstrickt, bei dem es darum geht, eine rechtmäßig gewählte Regierung zu lähmen, mit allen Mitteln.«
Indem Barr die Opposition zu Verfassungsgegnern erklärt, legitimiert er Trump, sie als Staatsfeinde zu behandeln. Der wahre Feind sitzt nicht in China oder sonst wo, er sitzt im Kongress, in den Bundesgerichten und überall, wo jemand die Verfassung so auslegt, wie es seit über zweihundert Jahren der Fall ist, nämlich als ein System der Checks and Balances. Wie Legutko