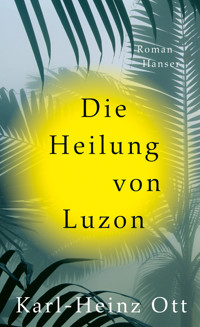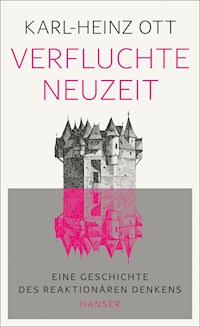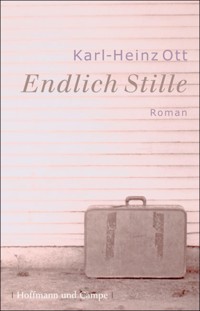9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann fährt in das oberschwäbische Dorf seiner Kindheit, um der sterbenden Mutter beizustehen: eine Reise in die Enge der Vergangenheit. Als unehelicher Sohn in einer erzkatholischen Gegend geboren, verbindet ihn mit seiner Mutter eine lebenslange Hassliebe. Nun setzt eine behutsame Annäherung ein - und ein aussichtsloser Wettlauf gegen den Tod, von dem Ott nicht ohne Lakonie und Humor erzählt. »Die sprachliche Dichte und Eigenständigkeit des Werkes sind bestechend. Alles an diesem Roman ist in Sprache verwandeltes Gefühl ... Jede einzelne der tausend Verlustanzeigen, von denen der Roman förmlich überquillt, bereichert diese Prosa.« (Martin Krumbholz, Süddeutsche Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Karl-Heinz Ott
Ins Offene
Roman
Hoffmann und Campe Verlag
Tod ward verhängt, die Erde zu entlasten.
Euripides
Heute, im ersten österlichen Frühlingslicht, fahre ich über jenes hügelige Land, in dem ich groß geworden bin. Vor zwei Tagen sagte mir ein Assistenzarzt nachts am Telefon, meine Mutter habe nur noch wenige Wochen zu leben. Er setze voraus, ich sei, ohne daß er mich kenne, ein vernünftiger Mensch, der ein klares Wort vertrage. Er hatte eine Pflicht hinter sich zu bringen, die ihn unwirsch machte.
Nach dem Anruf habe ich, ziellos trinkend, die Stunden bis zur Erschöpfung damit zugebracht, eine Liebe zu zerstören. Das Unfaßbare, das mich von außen angreift, habe ich in einen selbst herbeigeführten Schrecken verwandelt, dessen Herr ich schien. Jetzt übertüncht jener Bruch, den ich von mir aus zuwege gebracht habe, das dumpf schreiende, tobsüchtige Gefühl, das mich wie noch nie zum Opfer eines Schicksals bestimmt, das ich weder wählen noch beeinflussen kann. Doch vordergründig verzweifle ich nicht an der Gnadenlosigkeit der Natur, die meine Mutter für immer zerstört, sondern an mir selbst, an meiner Unbeherrschtheit.
Ausgelaugt, mit zitternden Gedanken, durchfahre ich all die Dörfer, die ich, solange Mutter herrisch meine Besuche einklagte, so gut es ging, gemieden habe. Als ich das letzte Mal auf dem Weg nach Hause war, um sie wie jedes Jahr über die Weihnachtstage zu besuchen, ekelte mich dieser diesige Landstrich an, dessen graue Ödnis von keinem Schnee barmherzig bedeckt war und der sich endlos hinzuziehen schien. Ich nahm ihn wie ein eigenartig bekanntes Ausland wahr, wie eine bedrückende Weltgegend, die schemenhaft aus trüben Träumen wieder ins Gedächtnis drang.
In diesen hellen Märztagen verwandelt sich das Land in einen lichten Garten, der, wenigstens auf den zweiten Blick, dem Auge eine milde Schönheit gewährt. Doch die Ortschaften scheinen wie immer unbewohnbar. Einem langen Leben in der teigigen Trägheit dieser Winkel und Weiler wäre, denke ich jedesmal, der kurze Schmerz des Selbstmords vorzuziehen.
Mutter büßt ihr Leben dort, wo es angefangen hat, ab. Als sie zum zweiten Mal schwanger war, dachte sie wohl daran, sich umzubringen. Doch die Drohungen der Kirche, außerhalb des Friedhofs verscharrt, auf ewig verdammt und den Hinterbliebenen als ein Haufen Schande erhalten zu bleiben, hielten sie vom letzten Schritt zurück. Schuld versammelte sich bereits genug in ihrer Seele. Ihr erstes Kind trieb eine Hebamme mit Stricknadeln auf dem Dachboden ab. Die Todsünde war zwei Tage nach der Tat im ganzen Dorf bekannt. Das zweite Kind hat sie gegen den Willen des tobenden Vaters unehelich zur Welt gebracht. Er verließ mit seiner Frau und seinen beiden ehelichen Söhnen unsere Ortschaft. Oma besuchte Mutter nicht einmal am Wochenbett. Nur Onkel Karl, der dreifingerige Zimmermann, kam nach der Entbindung ins Krankenhaus. Von ihm hatte eine solche Geste keiner erwartet.
Jetzt verabschiedet sich Mutter aus den Kampfhandlungen, die unser Leben, das wir gegeneinander führen, bestimmen. Manchmal empfinde ich ihr bloßes Dasein als Zumutung und sehne mich, wenn die eingeschnürte Seele unter ihrer Macht kaum atmen zu können glaubt, nach ihrem Tod. Während der letzten Weihnachtstage lag ich krank zu Hause und wehrte jeden ihrer Versuche, mich anzufassen, ab. Obwohl ich mich insgeheim für meine Abwehr bestrafe, befiehlt mir eine innere Stimme, an den verkrampften Zurückweisungen zäh festzuhalten.
Gelassen haben wir, falls je, seit langem nicht mehr miteinander geredet. Der Wechsel von Schweigen und Schreien, Verstummen und Wüten offenbart unsere mißlingende Distanz. Seit der Schulzeit flüchte ich in die Stille der Bücher, verstopfe mir vor ihr die Ohren und überschreie sie mit wüsten Worten, wenn die Wut keinen anderen Ausweg mehr kennt. Dann triumphieren ihre wässerigen Augen, und inmitten des Wimmerns gluckst sie verzückt. Ihr zitternder Leib weiß sich wahrgenommen, der Stillstand kippt, für sie pervers beglückend, ins Drama um.
Wenn ich ihr, selten genug, nach ein paar Gläsern Wein zuviel erzähle, bereue ich das Gerede am nächsten Morgen. Selbstverschuldet habe ich mich in ihre Krallen gestürzt und ihr durch eigenes Zutun erlaubt, in meine belanglosen Geheimnisse einzudringen. Dann schwöre ich mir für alle Zukunft, noch entschiedener als bisher zu schweigen, weil ich fürchte, daß alles, was sie über mich weiß, nicht mehr mir gehört.
Manchmal erwägt eine andere innere Stimme, nicht mit Geschichten zu geizen und sie unbekümmert mit Worten zu überschütten, um ihre Neugier in überfließenden Redeströmen zu ertränken. Dadurch würde sie sich von meinem Leben nicht mehr ausgeschlossen fühlen und dennoch nichts Bedeutsames erfahren. Im Rauschen ungebremster Worte dürfte sie sich an dem Gefühl erwärmen, an meiner Wirklichkeit teilzuhaben. Doch wenn ich beim Trinken ins Reden gerate, starrt sie stumpf durch mich hindurch, an mir vorbei, in leere Weiten. Sie hört nicht zu und schweift inmitten angefangener Sätze ab und stellt stets neue Fragen, die selten miteinander zusammenhängen. Es ist gleichgültig, was ich erzähle, weil sie nichts Bestimmtes wissen will, sondern nur danach giert, daß Kontakt hergestellt wird. Die aufgepeitschte Wortfuchtelei hat den Sinn, eine brodelnde Stille zu übertönen, die zwischen uns steht.
Von jetzt an soll alles sich ändern. Das Telefongespräch mit dem Assistenzarzt muß als Auftakt zu einer neuen Zeitzählung gelten und angesichts ihres endgültigen Endes ein milderes Leben einkehren, das die ständigen Kämpfe und Krämpfe vergessen läßt. Das Bisherige darf nach ihrem Tod nicht meine gesamte Erinnerung überschatten. Gleichzeitig will das Kind in mir an die Diagnose der Ärzte nicht glauben. Eine Stimme, die gegen den Verstand anrennt, behauptet, die Prognose der Doktoren beruhe auf Mißverständnissen und fahrlässig ausgewerteten Daten. Ich male mir aus, daß sie im Auftrag eines wohlmeinenden Schicksals handelten, ohne von ihrer moralischen Mission zu wissen, daß sie von fremden Mächten beauftragt wären, mich in allerbestem Glauben falsch zu informieren, um mir die Augen zu öffnen und mich zu zwingen, mein Verhalten Mutter gegenüber von Grund auf zu überdenken.
Seit langem kam mir die Situation von vor zwölf Jahren nicht mehr in den Sinn, als Mutter wegen eines Herzinfarkts in derselben Klinik lag. Damals faßten wir für alle Zukunft die besten Vorsätze, jeder für sich und beide gemeinsam, und kein einziger wurde, nachdem Mutter sich wieder als geheilt ansah, in die Tat umgesetzt. Wir wollten friedfertiger und freundlicher, gelassener und großzügiger miteinander umgehen und uns ständig den Tod als jene Grenze vor Augen halten, in deren Angesicht es sich nicht lohnt, einander zu quälen.
Als ich ein Jahr danach von der Schule abgehen und nach Amsterdam ziehen wollte, saß sie nächtelang kreischend, dem Irrsinn nahe, mit entstellten Gesichtszügen in ihrem Bett, bis ich ihr versprach, sie nie zu verlassen. Ich blieb zu Hause, weil ich mir ihre Einlieferung in eine Nervenanstalt nicht als bleibende Schuld aufladen und meinen Abschied nicht mit dieser Bürde belasten wollte. Seither weiß ich, daß Mutter mit einem zum Wahn neigenden Willen bereit ist, sich gegen bedrohliche Ansprüche ihres Kindes mit allen Mitteln zur Wehr zu setzen. Außerdem lebte Oma noch, die nichts von alledem begriffen hätte und nach meinem Verschwinden trübsinnig in sich zusammengesunken wäre.
Gelassenheit war nie ihre Stärke. Als wir wegen meiner Atemnot zum ersten Mal nach Zürich zu einem Asthmaspezialisten fuhren, war sie, wie bis dahin noch nie, ohne den Schutz eines Reiseleiters, eines Pfarrers und einer Schar von Pilgern, einzig auf sich selbst und die Gutmütigkeit fremder Leute angewiesen. Bei der Ankunft mit dem Bus in unserer Kreisstadt war das Bahnhofsgelände weiträumig abgesperrt und von Polizeikohorten bewacht. Königin Elizabeth machte einen Staatsbesuch, ihr Sonderzug blockierte den gesamten Gleisverkehr. Von Menschenmassen umringt, mußten wir hinter eigens errichteten Schranken warten, obwohl unser Zug längst abgefahren sein sollte. Einige Leute behaupteten, der Oberbürgermeister halte eine Rede, und vom Gesang der Stadtspatzen wehten Melodiefetzen zu uns herüber. Zum ersten Mal waren wir bei einem Ereignis zugegen, das am nächsten Tag die vorderen Zeitungsseiten füllen sollte. Doch Mutter schwebte nicht in erhabenen Gefühlen und legte wenig Wert darauf, an einem bedeutenden Geschehen teilzunehmen. Ihre Nerven glühten, und sie sah uns bereits verloren auf nächtlichen Straßen in irgendeiner fremden Stadt herumlungern.
Selbst als wir im Zug saßen, beruhigte sie sich nicht, weil die Ankunft bis zum Beweis des Gegenteils als ungewiß gelten mußte. Auch die Schiffahrt über den Bodensee hellte ihre Stimmung nicht auf, obwohl zur Freude der Reisenden eine Schar von Möwen vom Auslaufen bis zur Ankunft die Fähre umkreiste.
Noch am nächsten Morgen hatte sich ihr Seelenfieber nicht gelegt. Als wir in der Praxis des Doktor Höchli saßen und eine Arzthelferin meine Anamnese aufnehmen wollte, sah sie sich nicht in der Lage, ihre Formulare mit verwertbaren Angaben auszufüllen. Manisch blätterten wir in ausliegenden Zeitschriften, als müßten Hände und Augen sich an Dingen festkrallen, die uns vor den fremden Leuten schützen. Wir wußten nicht, wie man sich im Ausland bewegen, sich ausdrücken und unbekannten Menschen gegenübersitzen soll. Draußen in der Welt fehlten uns alle Anhaltspunkte. Nach einer halben Stunde schickte uns die Praxisgehilfin ungehalten weg und verlegte den Termin auf den Nachmittag. Ruhig und ausgeruht, befahl sie, sollten wir wiederkommen. Aus Angst, jetzt erst recht alles falsch zu machen, verstummten wir bei der Rückkehr vollkommen. Dem Einschreiten des Doktor Höchli ist es zu verdanken, daß die Behandlung dennoch zustande kam. Er veranlaßte Mutter, in ein benachbartes Café zu gehen, und nahm mich allein in sein Sprechzimmer mit.
Damals lebte Oma noch, die sich jeden Morgen im Stehen über den Stubentisch beugte, um, wie sie sagte, die Zeitung zu studieren. Während ihr Kopf sich kreisend über den ausgebreiteten Blättern bewegte, zischelte sie Unverständliches und beendete ihre Lektüre täglich mit dem Seufzer: »Was es in der Welt nicht alles gibt! Am besten bleibt man daheim!«
Außer auf Wallfahrten, die meistens im Herbst stattfanden, wenn die Gärten abgeräumt waren, sah sie nichts von der Welt. Man traf sich noch fast in der Nacht, drei Dutzend ältere Weiber und der Mesner und Pfarrer, auf dem Kirchplatz, und hatte ein Vesper und eine Thermoskanne, ein Gesangbuch und einen Rosenkranz in der Tasche, um singend und betend nach Einsiedeln oder Wigratzbad oder Nesselwang oder Konnersreuth oder Ettal oder Mariazell oder zur Schwarzen Madonna nach Altötting zu pilgern. Der Bus schlängelte sich durch Morgennebel über hügelige Wiesenlandschaften hinaus in bergige Gegenden, den Alpen zu, während drinnen Marienlieder angestimmt und nacheinander der schmerzensreiche und freudenreiche und glorreiche Rosenkranz und dazwischen, gleichsam zur Abwechslung, die lauretanische und die Allerseelen-Litanei im antiphonischen Hin und Her zwischen den Sitzreihen geleiert wurde, bis der anfangs noch rauhe, hüstelnde, allmählich gellend sich steigernde Singsang zunehmend wieder müder klang und schließlich nach ein paar Stunden in einen Zustand schläfriger Trance überging. Irgendwann ordnete der Pfarrer einen Halt an, um an einem Gnadenort eine Brotzeit einzulegen und anschließend zwischen Kirchenbänken wieder mit frischer Kraft ein paar Vaterunser und Gegrüßet seist du Maria zu beten. Dann nahm man im Bus wieder die Plätze ein, um auf der weiteren Fahrt den bereits hundertmal erzählten, schauerlich schönen Heiligenlegenden und Mirakelgeschichten des Pfarrers zuzuhören, die durch die eifrigen, mit Varianten und Ausschmückungen angereicherten Wiederholungen immer wahrscheinlicher klangen, wahrhaftiger wurden, sich in die Seelen einfraßen und allmählich mit dem In- und Auswendigkönnen zum innersten Bestand der düsterhellen Heilsgewißheiten gehörten. Die Geschichten von den Marienerscheinungen in Lourdes und Fatima und La Salette, von Blut weinenden Madonnenstatuen, von plötzlichen Gesundungen an Gnadenquellen, von Frauen, an deren Händen sich allmonatlich Jesu Wunden zeigen, von Hostien, die im Raum schweben, und von verschüttetem Meßwein, in dem sich das Antlitz Christi offenbart, konnte man sich mit jedem Wiederaufsagen noch bildhafter als beim vorigen Mal vorstellen und die Seele zunehmend von der Wirklichkeit des Unbegreiflichen überzeugen. Wenn die Wundergeschichten zu Ende erzählt und eine weitere Runde gebetet worden war, predigte der Pfarrer vom Teufel und gemahnte an die prophetischen Worte der Mutterkönigin, die bei ihrer letzten Erscheinung den Hirtenkindern in Fatima den Dritten Weltkrieg vorausgesagt hatte. Dann wurde der heilige Georg angerufen, um den Drachen zu töten, und ein Sturmgebet zum Himmel gesandt: Heilig Blut! Heilig Blut! Schütze unser Glaubensgut, bevor die Pilger, vor der Ankunft am gebenedeiten Ort, ein mildes Lied anstimmten, das die Gottesmutter und ihre versöhnlichen Werke pries: Die Glocken verkünden mit fröhlichem Laut das Ave Maria so lieb und so traut.
Während der Gebete und Gesänge starrten die Wallfahrer durch die Busfenster auf Wiesen, Wälder und Felder, Feldkreuze, Bildstöcke und Zwiebeltürme, die denen zu Hause glichen. Am Pilgerort knieten sie vor Gnadenbildern und sternenumkränzten Muttergotteshäuptern und Heiligengesichtern, die man in geringer Abwandlung auch in den heimischen Kapellen anflehen konnte. Nach einem Vesper in einem der Pilgergasthöfe fuhr man müde, aber zufrieden, matt, aber seelisch beglückt, als habe man die Strapazen eines kleinen Kreuzzugs hinter sich, nach Hause zurück und sang das Heilig, heilig, heilig und das Gegrüßet seist Du, Königin und stimmte zum Schluß, kurz vor der Heimkunft, wie immer das Großer Gott, wir loben Dich an.
Denen, die nicht mitkommen konnten, brachte man geweihte Rosenkränze, geschnitzte Marienfiguren, Andachtsbilder, Amulette, Medaillen, Weihwasserflaschen, Blutkorporalien, Wachsstöcke, Wetterkerzen, Sterbekreuze und silbrig schimmernde Votivbilder mit: Sebastianspfeile, Johanniszungen, Bäuche, Brüste, Beine, Augen und andere ausgedellte Darstellungen von Körperteilen, mit deren Hilfe man die Wassersucht und Gicht und allerlei andere Leiden kuriert.
Vor drei Wochen lief Mutters Haut dreckiggelb an. Dem Gallenausfluß war mit Medikamenten nicht beizukommen. Durch die Operation wurde eine vorläufige, spekulative Diagnose zur Gewißheit, der zufolge das Gallenleiden nur eine Folge und nicht die Quelle der Krankheit ist. Längst wuchert hinter dem gelbflüssigen Schleimhautsack in der Bauchspeicheldrüse der Krebs. Am Telefon erklärte mir der Arzt, Mutters Leib werde in absehbarer Zeit keine Verdauungssäfte mehr herstellen, die aufgenommene Nahrung nicht mehr spalten und auf diesem Wege sich selbst zerstören. Ich konnte das geklonte Graeco-Latein des Fachmanns nur zur Hälfte verstehen und wollte auch gar nicht wissen, wie der Zerfall sich im einzelnen vollzieht. Mir fiel wieder einmal auf, wie sehr die medizinische Terminologie den todbringenden Lebensverlauf in kühle Formeln einzufangen und jeden Anflug von Affekten auszuklammern weiß. Als ich mit dem Arzt sprach, war ich bereits betrunken und versuchte, den zunehmenden Zungenschlag zu verbergen.
Jahrelang kam mir das hoch über der Stadt gelegene Krankenhaus, in dem Mutter gegen Ende meiner Schulzeit wegen des Herzinfarkts lag, nicht mehr in den Sinn. Auf dem Weg in die Klinik konturiert sich ihr damaliges Krankenzimmer vor dem inneren Auge, und die einzelnen, durch Glaskorridore verbundenen Gebäude stehen wieder vor mir. In seiner Abgeschiedenheit gleicht das Gelände einem erhabenen Tempelbezirk, der vor der geschäftigen Welt geschützt und außerhalb des alltäglichen Tumults angesiedelt ist. Die Zufahrtsstraße endet vor einem gußeisernen Doppeltor, durch dessen Rundbogen ein Kiesweg an kahlen Neubauten und durchsichtigen Fluren vorbei zum alten Hauptgebäude führt, einem klassizistischen Bau aus rotem Sandstein, der inmitten der nüchternen Seitentrakte wie ein Prunkdenkmal aus herrschaftlichen Zeiten aussieht. Vor dem Portal markiert ein mit Ketten abgeschirmtes Oval den Landeplatz für die Rettungshubschrauber, der an Wochenenden meist von Kindern umringt ist, die auf die Ankunft eines Notfalls warten. Vom zerfallenden Umfassungsgemäuer aus blickt man auf die Stadt hinab, auf die weit entfernt wirkenden Häuser, die Straßenschluchten, die im Sonnenlicht silbern glänzende Schnürbodenkuppel des Theaters, den hellgrau schimmernden Fluß, der die Stadt in zwei Hälften bricht, den rostbraun aufragenden Münsterturm, der seit Jahren von Gerüsten umklammert ist, und auf das weithin flach auslaufende Land, das sich am Horizont in diesigem Licht auflöst. Wie durch einen Filter gedämmt hört man von unten herauf das Aufheulen, Hupen und Quietschen der Autos, Motorräder und Straßenbahnen. Das wogende Gesurre gilt dort oben als Zeichen eines umtriebigen Lebens. Nur die alles übertönenden Martinshörner erinnern daran, daß die gewaltsame Unterbrechung und der Tod zum Innersten dieser regsamen Welt gehören.
Das ruinöse Gemäuer bildet den Rand einer abgespaltenen, geschlossenen Welt, die anderen Rhythmen folgt, in der andere Gerüche herrschen und ein anderes Zeitempfinden den Gang der Stunden prägt. Im Park reden die Kranken und ihre Besucher flüsternd miteinander, als sei jedes laute Wort der Genesung abträglich, und auf den Fluren dämpfen Teppichböden den Aufschlag der Schuhe. Dort oben wirken auch jene verunsichert, denen man ansieht, daß sie es gewohnt sind, stets recht zu haben. Hinter dem Hauptgebäude führt ein von Zypressen gesäumter Weg zum alten Bergfriedhof hinauf, der wie ein Mahnzeichen all denjenigen den Blick in die Weite versperrt, die auf der sonnenabgewandten Seite der Klinik die Betten belegen. In diesem verwilderten Friedhofsgarten wird, von erlesenen Toten abgesehen, seit langem keiner mehr beerdigt. Er dient Spaziergängern und Genesenden als schattiger Ort.
In schlaflosen Stunden nehme ich seit Jahren Mutters Sterben vorweg. In nächtlichen Wachträumen kommt mir ihr endgültiges Wegsein wie eine horizontlose Ödnis und unheilbare Wunde vor, die alles Leben umfassen und den Rest meines Daseins zu einem bloßen Dahinvegetieren entwerten wird, das nur noch aus Warten auf den eigenen Niedergang bestehen kann.
Wenn ich bei Mutter zu Hause übernachte, male ich mir vor dem Einschlafen manchmal aus, wie es sich anfühlen könnte, wenn das Bett im Zimmer nebenan für immer leer sein wird. Das verworrene Gefühl, ohne sie sei keine Zukunft möglich, überlagert dann alle anderen Empfindungen. Der Nachthimmel offenbart in solchen Augenblicken nicht wie sonst eine bergende Weite, sondern einzig den Schlund, der uns alle vernichtet. Jene Lücke, die Mutters Tod hinterlassen wird, weitet sich in meinen Phantasien aus zu einer Leere, die keinerlei Orientierung mehr gewährt. Ein Mittelpunkt, von dem alle Kraft ausgeht und auf den alle Regungen sich beziehen, scheint aus jener verbleibenden Wirklichkeit verschwunden, die sich von Grund auf als todeskrank, als erbärmliche Anhäufung beschwerlicher Nichtigkeiten erweisen und allenfalls mit Trotz zu ertragen, aber in keinen Sinn umzudeuten sein wird. Die Welt wird zwar weiterhin ihren Gang gehen, und das, was in den Augen der Lebenden ansteht, wie bislang seinen Lauf nehmen, und die hilflos Aufgekratzten, die sich für Lebensmeister halten, werden weiterhin den schalen Leidensraum der Welt mit ihrem Lärmen übertönen, doch demjenigen, der die Mutter verloren hat, wird sich die Umtriebigkeit als schriller Tumult und blindes Ineinander mechanischer Gesten darbieten.
Die Hoffnung auf Erlösung von Mutters Umklammerungen kommt in solchen Nachtstunden nicht zu Wort, und der Gedanke, ihr Tod könnte mich von ihrer Zudringlichkeit und ihren Schuldzuweisungen befreien, will nicht mehr gelingen. Meine herrische Abgrenzung kommt mir dann selbstzerstörerisch und wahnwitzig vor, und ich fürchte, für die Narretei, von ihr unabhängig sein zu wollen, einst büßen zu müssen. Mutter ahnt nicht, wie ernst ich ihr Orakel nehme, einst an ihrem Grab an meinen Schuldgefühlen einzugehen.
Im Morgenlicht verfliegen die düsteren Nachtgesichte, und die Widerspenstigkeit gegen Mutters Übermacht kehrt wieder. Der sich ernüchternde Geist verwirft die trüben Phantasien, obwohl er nicht vergißt, daß jene Ängste, die im Finstern gegen die beschwichtigende Vernunft aufbegehren, eine unbezähmbare Sprache reden. In ihr kommt ein wimmerndes Kind zu Wort, das brüllt, wenn Mutter die Tür hinter sich schließt. Es möchte sie dafür tödlich bestrafen und sie gleichzeitig für immer in seiner Nähe behalten.
Die Straße schlängelt sich durch Dutzende von Dörfern, die sich alle ähneln und desto grauer aussehen, je mehr Neubauten sie anhäufen. Die Gassen wirken wie ausgestorben, als verschanzten die Leute sich in ihren Stuben, obwohl heute ein wärmendes Licht das Land erhellt. Die Bäume sind noch kahl, doch in den Gärten leuchten zwischen nackten Beeten bereits die gelb glühenden Forsythien.
Früher spazierten wir jeden Sonntag hinaus zu unserem Gottesacker, der vor dem Dorf inmitten von Äckern und Feldern liegt. Bei allen Erwachsenen, die uns entgegenkamen, blieben Mutter und Oma stehen, um über das Wetter, die Kinder und die Krankheiten zu reden. Auf dem Friedhof schritten wir nach einer ehernen Ordnung die Gräber der toten Verwandten und Bekannten ab, die ich, bis auf Onkel Max und Tante Lena und einen Buben, der ein Jahr älter war als ich, nicht gekannt hatte. Doch die Geburts- und Sterbedaten der Toten konnte ich auswendig aufsagen und wußte, wo der Schulzen- und Deißenbauer, der Vater vom Flaschner und vom Sattler gewohnt hatten. Vor jedem Grabstein murmelten wir ein Gebet, und Oma sagte manchmal beim Weggehen: »Seit der hier draußen liegt, ist viel Wasser die Donau hinabgeflossen.« Wir schlurften durch den Kies zur nächsten Ruhestätte und lasen die immerselben Vornamen, Hans, Franz, Josef, Agnes, Maria, Frieda, und die Zeit wollte an diesen Sonntagnachmittagen nicht vorwärtsgehen. Mutter und Oma fühlten sich auf dem Gottesacker wohl, als dürften sie inmitten der Gräber eine Ruhe finden, die ihnen an den Werktagen nie vergönnt war.
Ich konnte es kaum erwarten, bis wir bei Onkel Karl vorbeischauten, bei dem ich mich in die Werkstatt zurückziehen und am Schraubstock mit Sägen, Hobeln und Feilen spielen konnte. In seinem kahlen Flur hingen links und rechts der Türen ausgestopfte Greifvögel, Bussarde und Eulen, die ich jedesmal zaghaft anfaßte und dabei fürchtete, sie könnten plötzlich die Flügel spreizen und mir mit den Schnäbeln in die Finger hacken. Onkel Karl, dem Borstenbüschel aus der Nase wuchsen und dessen Hände wie haarige Hügellandschaften aussahen, saß mit einem Zigarrenstummel zwischen den Lippen in seiner Küche, vor ihm auf dem Tisch ein Krug mit Most. Immer hatten wir das Gefühl, ihn sowohl zu stören als auch willkommen zu sein. Halb abwesend, halb aufmerksam schien er sich für nichts und dabei für jede Kleinigkeit zu interessieren. Er wirkte oft ein bißchen mürrisch und dabei humorvoll zugleich, obwohl sein feines Schmunzeln unter dem Schnauzbart kaum sichtbar wurde. Seit ein paar Jahren liegt auch er draußen zwischen den Feldern. Ihn hat, wie es von denen heißt, die im Herbst sterben, das Laub mitgenommen.