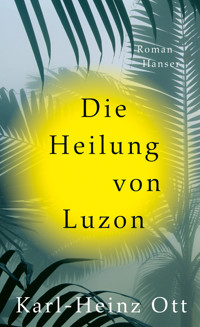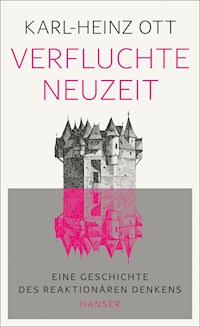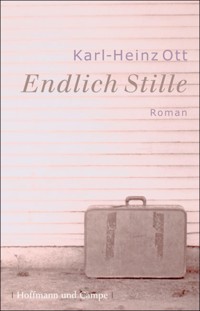Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Joschi ist eigentlich Clochard, irgendwo zwischen Karl Marx und verlottertem Mönch, Jakob ein quirliger Fernsehmann, Uli ein alternativer Aussteiger und Linda, die Schwester, ist auch im Privatleben eine Macherin. Ihren Vater haben die vier kaum noch gesehen, seit der sein Testament dem „Schwein“ übergeben hat und sich von der „ungarischen Hure“ pflegen lässt. Jetzt ist er tot. Morgen früh wird das Testament eröffnet. Bis dahin muss das Erbe verteilt sein. Keiner verlässt das Haus. Karl-Heinz Ott erzählt brillant und mit großer Komik von dem, was eine Familie zusammenhält – und was sie auseinanderreißt. Verwandt fühlt sich keiner mehr, bis nach einer langen Nacht der Augenblick der Wahrheit kommt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joschi ist eigentlich nur ein Clochard, irgendwo zwischen Karl Marx und verlottertem Mönch. Jakob ein Fernsehmann mit winziger Mansarde in Paris. Uli ein alternativer Aussteiger mit wechselnden Vorlieben, weitab auf der schwäbischen Alb. Nur Linda, die Schwester, ist auch im Privatleben eine Macherin, aber ob sie deshalb liebevoller ist? Ihren Vater haben sie kaum noch gesehen, seit der sein Testament dem »Schwein« übergeben hat und sich, nach dem Tod der Mutter, von der »ungarischen Hure« pflegen lässt. Und nun, da er tot ist, bringt gerade er sie noch einmal zusammen. Eigentlich soll es nur ums Handfeste gehen, das Erbe, das Geld, das Haus. Doch irgendwie drängt sich immer wieder etwas anderes dazwischen: Was kommt denn jetzt eigentlich nach dem Tod? Die Hölle? Das Weltall? Gar nichts? Oder etwa doch die Auferstehung? Karl-Heinz Ott erzählt brillant und mit großer Komik von dem, was eine Familie zusammenhält – und was sie auseinanderreißt. Verwandt fühlt sich keiner mehr, doch irgendwann kommt nach einer langen Nacht dann doch der Augenblick der Wahrheit. Ein bissiger, ironischer Roman über die Rechnungen, die schließlich jeder begleichen muss.
Hanser E-Book
Karl-Heinz Ott
Die Auferstehung
Roman
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-25007-9
© Carl Hanser Verlag München 2015
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München,
© plainpicture/Pictorium – aus plainpicture Rauschen
Satz: Gaby Michel, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Denn unser keiner lebt sich selber,
und keiner stirbt sich selber.
Paulus, Brief an die Römer 14,7
God’s finger touch’d him, and he slept.
Tennyson, In Memoriam A.H.H.
Komm heim, so schnell es geht, Papa ist tot, hatte Linda frühmorgens, kaum dass es Tag war, ins Telefon gehechelt und am Ende des knappen Gesprächs gestöhnt: Gottlob!
Was soll das heißen, dachte Jakob, obwohl doch klar war, was sie meinte. Seit gestern ist er also tot, vielleicht seit vorgestern schon, sie wissen es nicht. Erfahren darf es vorerst nur ein Einziger, das Schwein, Lindas schlimmster Feind, der plötzlich wieder gebraucht wird, und zwar augenblicklich. Ausgerechnet bei ihm hatte Vater sein Testament hinterlegt, bei diesem lumpigsten aller Lumpenhunde.
Und jetzt sitzen sie stumm um ihn herum, um eine Couch, die er sich erst kürzlich angeschafft haben muss und die mitten im Wohnzimmer steht, eine Couch ohne Lehne, in knalligem Rot, so breit, dass leicht zwei darauf Platz haben könnten.
Die Todesursache? Linda weiß es nicht. Die Totenglocken haben noch nicht geläutet, hatte sie am Telefon seltsam gestelzt formuliert, so gestelzt, wie man es sonst von ihr gar nicht kennt. Vielleicht sollte es locker klingen oder ironisch. Längst müsste man einen Arzt gerufen haben, schließlich wird sich nach drei, vier Tagen nur noch schwer behaupten lassen, er sei eben erst gestorben, nachdem die Nachbarn mit Sicherheit längst bemerkt haben, dass der ganze Stall auf einmal wieder da ist, wie seit Jahren nicht mehr, selbst einem Blinden kann das nicht entgehen. Ganz zu schweigen von Jakobs kindlicher Angst, es könnten sich bald schon Verwesungsgerüche verbreiten. Trotzdem will Linda erst einen Arzt holen, wenn alles geregelt ist. Darauf besteht sie, bei allen Bedenken, die ihre Brüder vorbringen. Anders lässt sich nichts mehr retten, hatte sie den dreien heute morgen am Telefon einzubläuen versucht und alle auf der Stelle nach Hause beordert, ohne jede Verzögerung, auch nicht um ein paar Stunden oder gar einen ganzen Tag.
Jakob war dennoch nicht sofort aufgebrochen, allein aus Trotz gegen ihren Ton und auch, um einen Zustand auszukosten, den es für ihn bislang nur einmal gegeben hatte, damals als Mutter starb, nur dass diesmal alles anders war, vollkommen anders. Er wollte das leichte Schweben von damals wieder erleben, dieses keineswegs unangenehme Bodenlosigkeitsgefühl, bei dem alles in einen Taumel zu geraten scheint, selbst die Welt draußen, der Himmel, die Häuser, das Leben überhaupt, als sei alles ferner gerückt, ungreifbar geworden und zugleich wie durchflutet von einem Licht, das aus dem All hereinzuschimmern scheint und von dem nie zuvor etwas zu erahnen war, eine schwirrende Wirklichkeit, die so unverhofft, wie man sie wahrzunehmen meint, auch wieder verschwindet.
Die Totenglocken haben noch nicht geläutet! Er hätte morgen drehen sollen, in fünf oder sechs Stunden wäre alles im Kasten gewesen: das Abseits und die Stille, ein Häuflein Ruinen, von Efeu umflort, das Kloster Port Royal in den Feldern, ein Katzensprung entfernt vom Pariser Gewimmel, im ländlichen Frieden bei Versailles um die Ecke, wo man auf Gottessucherspuren wandelt und Geistern hinterherhorcht, die ihr Leben lang vor allem eines gequält hat: die Frage, was danach kommt, nach dem Tod. Es hätte sein schönster Film werden können.
Wenn einer tot ist, kann er ruhig warten, es schmerzt ihn nicht, dachte Jakob und blieb noch ein paar Stunden, wie einer, der sich selbst zuschaut und denkt: Ich bin es, bin es nicht! Als sähe er sich von außen, wie einen andern, der im Café sitzt und durch die Straßen zieht. Gott könne alles sehen, hatte der Pfarrer ihnen als Kinder eingetrichtert, selbst die Gedanken. Auch die Toten könnten alles sehen, hatte er behauptet. Als Kinder hatten sie das alles geglaubt, und vielleicht, wer weiß, verhält es sich tatsächlich so. Vielleicht sieht Papa mich Kaffee trinken, stellte er sich vor, mit einer Zeitung in der Hand, als beginne dieser Tag wie jeder andere auch. Nur wird Vater sich, falls er ihn von dort oben sieht, fragen, warum es seinen Sohn in diesem Augenblick nicht sofort nach Hause drängt und er ihn selbst im Tod noch warten lässt.
Jakob nahm nicht den erstbesten Zug und auch nicht den nächsten. Er legte sich noch einmal hin, als könnten im Liegen Gedanken vorbeiziehen, die nicht geschaffen sind fürs Stehen und Gehen. Er wollte auf eine wohlige Trauer warten und auf Bilder, die zu ihr passten, ein bisschen Wehmut spüren, sich nach der Kindheit sehnen und etwas Sanftes empfinden, auch einen Schmerz, einen großen sogar, nur wollten sich ihm zu Papa kaum Gedanken einstellen und noch weniger klare Gefühle. Er lag nur da und dachte: Du bist in Paris, du bist zu beneiden! Ein bisschen Selbstmitleid kam in ihm auf, ein nebliges Verlustgefühl, das sich beinahe genießen ließ. Dabei hätte alles so einfach sein können: nach der Todesnachricht ein Stocken und Stammeln, Klagen und Weinen. Er aber dachte bloß: Du bist in Paris, du bist zu beneiden!, obwohl er eigentlich an Papa denken wollte.
Fast hätte er sich einen Hut gekauft, für die Beerdigung und überhaupt, als fange jetzt ein neues Leben an, ein Leben, das dem alten gleicht und trotzdem ab sofort ganz anders sein wird. Er ließ es jedoch, aus Furcht, ein Hut könnte auf seinem Kopf lächerlich wirken, zu aufgesetzt, zu mächtig, zu grotesk, ganz anders als bei Papa, der mit seinen Hüten filmreif aussah. Kopf hoch!, hatte Mama immer gesagt, damit man gar nicht erst zu klagen anfing. Kopf hoch!, hatte sie sogar noch zu Joschi gesagt, mit unterdrücktem Wimmern, als alles längst zu spät war, bei seinem Abschied ins Gefängnis. Kopf hoch!, hatte vermutlich auch Joschi oft gedacht, als er zehn Jahre lang an der Straße stand, in Budapest an den Brücken, einen Hut in der Hand, seinen Klingelbeutel. Und jetzt sitzen sie um Papa herum und warten, ohne wirklich zu wissen, worauf. Sie wissen es und wissen es nicht, es wird sich bald zeigen.
Linda hat ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, diesen Mann, der hier bloß noch das Schwein genannt wird und dessen Namen keiner mehr in den Mund nehmen durfte, im Grunde bis heute nicht, was Papa nicht hindern sollte, bei ihm sein Testament zu hinterlegen, warum auch immer, und sei es aus Wut auf Linda, die vor seinen eigenen Augen die Bilder an den Wänden abgerissen hatte und ihn entmündigen lassen wollte. Vielleicht begann Papa an diesem Tag, an Schmelers Rücksichtslosigkeit sogar Gefallen zu finden, als müsste man sich daran ein Beispiel nehmen.
Nie wieder wollte Linda diesen Schmeler sehen, das Schwein, nie wieder, nachdem er vor über dreißig Jahren nach einem Kurzurlaub aus Mallorca zurückgekommen war, und zwar als verheirateter Mann. Linda war mit ihm verlobt gewesen, die beiden kannten sich seit der Schulzeit. Kein Mensch konnte ahnen, dass er noch eine weitere Geschichte am Laufen hatte und nur nach Mallorca geflogen war, um mit einer anderen zurückzukehren, die noch niemand je zu Gesicht bekommen hatte, zumindest nicht hier, eine Frau, die in allem das Gegenteil von Linda darstellte: blond, dünn, um einen Kopf größer, ein Laufsteggeschöpf, mit kurzen Röcken und Stiefeln, riesigen Ohrringen und einer noch größeren Sonnenbrille. Schmeler schämte sich damals nicht, zwei Straßen weiter eine Kanzlei zu eröffnen, deren Hauptsitz jetzt in München ist.
Uli musste ihn anrufen, auf Geheiß von Linda, was ihm schwergefallen war, schließlich ist er der Letzte, der den Resoluten spielen kann und notfalls hart verhandeln. Er ist zu weich für alles, und im Namen anderer forsch aufzutreten, liegt ihm schon zweimal nicht. Schmeler hatte sofort zugesagt, als sei es für ihn das Selbstverständlichste der Welt, noch heute Abend in München ins Auto zu steigen und zu einer Frau zu düsen, die ihn seit Jahrzehnten hasst und nie wieder sehen wollte. Keiner hier mochte je wieder etwas mit ihm zu tun haben. Sie alle hatten sich gewundert, dass Max selbst nach diesem Skandal noch skrupellos an ihrem Haus vorbeischlenderte und in den Garten hinein grüßte, als sei nicht das Geringste vorgefallen. Man wandte sich ab, tat so, als bemerkte man ihn nicht, fluchte vor sich hin und staunte, dass er dabei sogar stolz seine Neue am Arm führte. Drüben im Garten hörte man ihn beim Kaffeetrinken lachen und große Reden schwingen, als sollte die ganze Welt von seinen Witzeleien und Weisheiten profitieren. Längst ist er wieder geschieden, schon drei- oder viermal. Im Grunde kann Linda froh sein, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Kaum dass sie mit Fred heute früh hier angekommen war und sich die beiden nach ein paar Schrecksekunden wieder gefangen hatten, fingen sie an, Papas Schubladen und Dokumentenmappen zu durchsuchen, in der Hoffnung, das Testament zu finden, oder genauer gesagt, keines zu finden, um nicht böse überrascht zu werden und bestenfalls doch noch davon ausgehen zu können, dass alles seinen geordneten Gang geht. Als Linda vor einem Jahr zum letzten Mal in Arona war, stand dort ein alter Daimler vor dem Haus, und es passten die Schlüssel nicht mehr. Sie klingelte, eine Frau und ein Mann öffneten, starrten sie an, brachten kein einziges Wort heraus und verschwanden wieder hinter der Tür. Sofort hatte sie Papa angerufen, der nicht mit ihr reden wollte. Alles sei in Ordnung, habe er nur gesagt, doch sie werde, wenn er aus ihrem Mund noch ein einziges Mal den Ausdruck ungarische Hure höre, vom Erbe keinen müden Pfennig mehr sehen.
Die beiden könnten aus dem Balkan gewesen sein, er klein und feist, mit ausgebeultem Jackett, halb kahl mit graumeliertem Kranz, leicht gelockt, sie mollig und ebenfalls nicht groß, mit gelbblonden Strähnen. Wann sich dieses Weib bei Vater eingeschlichen hat, weiß keiner genau. Der Wahnsinn mit diesen Bildern an den Wänden hatte jedenfalls erst vor drei, vier Jahren begonnen. Spätestens mit Papas peinlicher Geilheit, die er nicht einmal mehr zu verbergen suchte, fing alles an, ins Wanken zu geraten. Innerhalb weniger Wochen schien sich alles zu ändern, was gewiss nicht nur an den Parkinson-Tabletten lag, die seinen Trieb anstachelten. Schlimmstenfalls hat er diesem Weib alles vermacht. Als er mitbekam, dass Linda sich bei seinem Arzt erkundigt hatte, ob es keine anderen Medikamente gäbe oder sich die Nebenwirkungen mit Gegenmitteln eindämmen ließen, brach er den Kontakt mit ihr ab und wechselte das Schloss an der Haustür.
In den vierzig Jahren, die er mit Mama zusammen gewesen war, hatte man von einem allzu großen Trieb und Drang an ihm nie etwas bemerkt. Wenn er abends aus der Klinik kam, setzte er sich nach dem Essen in seinen Fernsehsessel, ohne noch viel reden zu wollen. Manchmal zog er sich auch in sein Zimmer zurück und saß über Papieren und Büchern, während an den Wochenenden Spiele angesagt waren, Federball, Mensch ärgere Dich nicht und Monopoly, worauf vor allem Mama Wert gelegt hatte. Sie hätte Papa am liebsten auch alle paar Wochen ins Theater mitgeschleppt, was er aber nur gelegentlich über sich ergehen ließ und bloß so lange, bis an seiner Stelle eines der Kinder mitging und er nicht mehr selbst das Abonnement absitzen musste. Gerne ging er lediglich ins Kino, in die Lichtburg mit ihren samtroten Sitzen, getäfelten Wänden und dem mächtigen Vorhang, den er dort viel lieber als im Theater aufgehen sah. Den letzten Film, den sie alle gemeinsam angeschaut hatten, war Ein seltsames Paar mit Jack Lemmon, kurz bevor Joschi nach Heidelberg ging. Sie lagen sich vor Lachen in den Armen. Bald danach war nichts mehr wie zuvor.
Und jetzt steht nicht einmal mehr fest, ob ihnen das Haus überhaupt noch gehört, in dem der tote Vater liegt. Es lasse sich noch alles ändern, behauptet Linda. Mein Gott, was glaubt sie denn? Willst du Papa noch als Toten entmündigen lassen, fragen ihre Brüder sie heute schon zum zehnten Mal. Sie alle wünschten sich, dass sich alles noch ändern ließe, sollte es so schlimm kommen wie befürchtet, auch wenn keiner weiß, wie. Seit Linda vor einem Jahr am Lago vor verschlossenem Haus stand, ist sie zu allem bereit, während Jakob, Uli und Joschi vermeiden möchten, dass sie am Ende noch einen Prozess an den Hals bekommen. Seit dem Vorfall in Arona ist Linda von Pontius zu Pilatus gerannt, von einem Arzt zum andern, einem Rechtsanwalt zum nächsten, nur tat ihr keiner den Gefallen, Papa eine Demenz anzudichten, einen Alzheimer oder sonst etwas Debiles. Dass ein gewisser Irrsinn in ihm tobte, konnte jeder sehen, was jedoch weniger mit medizinischen Fragen, sondern allenfalls mit moralischen zu tun hatte. Dass zwischen gefühlter und gesetzlicher Gerechtigkeit ein kapitaler Unterschied bestehen kann, wollte Linda mit jedem Tag weniger einleuchten. Weil kein Mensch ihn für unmündig erklären mochte, schob sie inzwischen eine Mordswut auf den Staat und sein beschissenes Recht, als lebte man hier in einer Bananenrepublik, womit sie auf einmal mit Joschi einer Meinung war, der das seit eh und je so sah und dem sie deshalb früher den Vogel gezeigt hatte.
Mit dem Gedanken, dass das Haus in Arona nicht mehr zu retten ist, haben sie sich fast schon abgefunden, doch schlimmstenfalls ist nicht nur Arona futsch, sondern alles Hab und Gut. Gäbe es kein Testament, würde das wenigstens bedeuten, dass den Kindern das Haus zustünde, in dem sie aufgewachsen sind, und alles sonst noch vorhandene Vermögen, von dem keiner weiß, ob es sich um ein paar Hunderttausend handelt oder ob so gut wie nichts mehr auf der Bank liegt.
Linda und Fred haben sich bei allerlei Rechtsanwälten und Notaren nach den Möglichkeiten erkundigt, die Vater zur Verfügung gestanden haben könnten, ihnen das Erbe vorzuenthalten. Einerseits sollen die Auskünfte beruhigend geklungen haben, da zumindest der Pflichtanteil gesichert scheint, andererseits hatte man ihnen gesagt, es gebe hierzulande fatale Gesetzeslücken, die immer brutaler ausgenutzt würden. Vaters früherer Hausarzt hatte Linda das Gerücht zugetragen, dass er jene ominöse Person, die hier seit Jahren im Haus herumgeistert, adoptieren wollte, was erbschaftsrechtlich einer Katastrophe gleichkäme. Dass ihr bereits das Haus am Lago gehört, ist schlimm genug, wobei selbst in diesem Fall noch die winzige Hoffnung besteht, dass die Hälfte von seinem geschätzten Wert an die Kinder ausgeschüttet werden muss. Unberechenbar, wie Vater in den letzten Jahren war, ließ er seine Kinder über all das vollkommen im Unklaren, als müssten sie für etwas bestraft werden, von dem sie nicht wissen, worin es besteht.
Früher hatte er sich noch mit geradezu kindlicher Unschuld für Landkarten, Sternbilder und Modelleisenbahnen interessiert. Abends stand er im Garten, rauchte eine, blickte zum Himmel hinauf und erklärte auch denen, die es nicht wissen wollten, welche Sternbilder gerade im Osten zu sehen waren und wohin sie sich im Laufe der Nacht verschieben. An Stelle der Pornoposter hingen in den Fluren alte Karten, auf denen irgendwo zwischen Asien und Afrika der Garten Eden eingezeichnet war, und an den Rändern der Welt, wo die Wildnis begann, stand: hic sunt leones – hier sind Löwen. Seit Jahren ist von diesen Karten nichts mehr zu sehen. Hatten ihn früher die Abgründe des Alls angezogen, waren es gegen Ende seines Lebens ganz andere Schlünde.
Gleich beim Heimkommen hatte Jakob unter der Hutablage einen Müllbeutel mit den zusammengeknüllten Pornoplakaten entdeckt, die Linda am Morgen erneut abgerissen hatte und von denen jetzt noch einzelne Fetzen an den Wänden hängen, an Tesaresten klebend. Ein paar von ihnen versuchte er auseinanderzufalten, es müssen an die drei Dutzend gewesen sein, Leiber in allen Stellungen und Lagen, frontal, anal, von vorn und hinten, rasiert, behaart, als Krankenschwestern, Dienstmädchen und Nonnen aufgemacht, in Strings und Slips und Lack, allein, zu zweit, im Dreierpack, in High Heels, Nylons, Stockings, Strapsen, mit Dildos und Peitschen, das übliche Programm in allen Varianten. Ein wahrer Harem muss hier gehangen haben, der den Vater vermutlich keine einzige Stunde mehr richtig zur Ruhe kommen ließ. Das einzige Kruzifix im Haus hängt im oberen Flur zwischen Elternschlafzimmer und Bad, wo der dornengekrönte Jesus inmitten dieser Nacktheiten seine Arme ausgebreitet hat.
Jetzt oder nie mehr, muss Papa, als Mama tot war, sich gesagt haben. Statt einem gemächlichen Dahinwelken wählte er die ständige Erregung, von morgens bis abends und ganze Nächte hindurch, stets von vorne, mit jedem neuen Aufwachen, das mit einem Blick auf die rundum an die Wände geklebten Mösen und Titten begann.
Er hätte, spottete Linda einmal, stattdessen auch Courbets Der Ursprung der Welt aufhängen und sich damit ebenso erregen können, so fotografisch echt und aufreizend wie dort der weibliche Unterleib gemalt ist. Mutter hatte alle Bildbände, die sie nicht für kindertauglich hielt, neben ihrem Bett aufbewahrt, wozu vornehmlich Maler gehörten, bei denen Nacktszenen eine Hauptrolle spielten, von den Bordellfresken aus Pompeji über Degas bis zu Klimt und Schiele, womit sie erreichte, dass die Kinder diese Bände weitaus genauer studierten als alles, was im Wohnzimmer im Regal stand.
Er komme so schnell wie möglich, hatte Max am Telefon versprochen. Spätestens gegen elf will er hier sein, mit allen Unterlagen. Ob Linda allein mit ihm verhandeln wird oder alle dabei sein sollen, steht noch nicht fest. Dass er für Dubioses zu haben ist, hat sich längst herumgesprochen, schließlich nimmt er seit je am liebsten Fälle an, mit denen man im Rampenlicht steht. Das eine Mal verteidigt er Leute von Attac, die von Konzernen überwacht werden, das andere Mal eine Mutter, die ihre Kinder verhungern ließ, ebenso DDR-Grenzsoldaten, die sich wegen Todesschüssen verantworten müssen, aber auch Rechtsradikale, die in einem Dönerimbiss eine Bombe hochgehen ließen. Kaum das Studium hinter sich, wollte er sofort in Stammheim einsteigen, hatte allerdings keine Chance gegen die Schilys und Ströbeles. Lauwarme Fälle interessieren ihn nicht, die üblichen Delikte überlässt er andern. Man könnte ihn für einen Gesinnungstäter halten, würde nur ersichtlicher werden, wofür er steht, ob er für oder gegen das Gesetz kämpft, ihn eine subversiv angehauchte Gerechtigkeitsobsession umtreibt, oder ob es ihm vor allem um Aufsehen geht und er weniger Überzeugungstäter als öffentlichkeitsgieriger Spieler ist. In Talkshows jedenfalls zieht er gegen den Terror der moralisch überhitzten Medien her, die in seinen Augen für eine gleichgeschaltete Gesinnung sorgen, wie man sie nur aus totalitären Regimen kennt, wobei auch hier unklar ist, ob er vor allem provozieren will oder tatsächlich die Freiheit bedroht sieht. Und jetzt soll Schmeler ausgerechnet Linda und ihren Brüdern bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus einer Not helfen, deren Ausmaß noch völlig unbekannt ist.
Papa sieht friedlich aus. Als Erstes hat Linda ihm heute Morgen die Augen zugedrückt, bevor sie anfing, die Bilder abzureißen und aufzuräumen.
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es hier ausgesehen hat, betont sie immer wieder. Dreckige Teller auf Tischen, Stühlen und Kommoden, einer voller Nudeln mit vertrockneter Tomatensoße, dazu ein Dutzend benutzter Gläser und Tassen, die vermutlich schon seit Wochen herumstanden, überall Tablettenschachteln, eine halbleere Flasche Schampus neben der Couch und das Radio an, irgendein Schlagersender, wie man das von Papa eigentlich gar nicht kannte. Im Unterhemd sei er dagelegen und mit kurzer Hose, den Mund offen, wie Leute, die schnarchen, die Arme von sich gestreckt, als habe er sich ergeben. Und der Hosenladen war offen, ergänzt Fred, was Linda gar nicht erwähnen wollte. Sie musste ihm, fügt Fred dennoch hinzu, das Ding regelrecht hineinschieben, um nicht zu sagen hineindrücken.
Und jetzt sieht er so friedlich aus, sagt Franziska.
Ja, ganz friedlich, nickt Uli.
Man kann’s kaum glauben, wie friedlich, betont auch Fred noch einmal, bevor er mit Kennermiene um die Couch herumschreitet und sich dabei ein paarmal zum Toten hinabbeugt, als komme er vom pathologischen Fach und habe heute noch eine Obduktion vorzunehmen. Wie erschöpft lässt er sich daraufhin in den Sessel fallen und streckt alle viere von sich, als müsse er nach einem harten Tagesgeschäft, das noch lange nicht zu Ende ist, kurz Luft holen. Dabei will die Zeit kaum vergehen. Man kann nichts tun als warten, bis jener Mann eintrifft, dessen Namen man in diesem Haus jahrzehntelang nicht in den Mund nehmen durfte.
Papa wurde von den beiden vorbildlich hergerichtet, sie haben ihm eine schöne Hose angezogen, die Sonntagshose, wie man früher gesagt hätte, und ein weißes Hemd, allerdings eines mit kurzen Ärmeln, was so aussieht, als wollte man ihn heute noch in den Garten setzen. An einem Toten herumzunotteln, war ein komisches Gefühl, sagt Fred nicht ohne Stolz. Franziska versteht nicht, was er mit Notteln meint. Seit gut dreißig Jahren lebt sie schon in dieser Gegend, hat aber mit dem Schwäbischen nach wie vor ihre Schwierigkeiten. Notteln heißt, an etwas herumzerren, erklärt ihr Uli, hin und her machen, ziehen und ruckeln.
Bugsieren?
Ja, irgendwie. Was glaubst du, wie das war, sagt Fred, man will halt mit einem Toten…
Ja, klar, nickt sie.
Ich hab das vorher auch noch nie gemacht.
Ich auch nicht, kann es mir auch gar nicht vorstellen.
Was hätten wir tun sollen?
Ja, klar.
Und das bei diesem Wetter, wo einem sowieso schon der Schweiß herabläuft!
War sicher nicht einfach.
Was?, will Joschi wissen, als habe er nicht zugehört.
So einem Toten die Hose herunterziehen.
Aber jetzt sieht er gut aus, sagt Franziska.
So friedlich.
Ja, so friedlich.
Ich hab früher immer geglaubt, man wird krank und stirbt, wenn man einen Toten küsst, auch wenn’s nur auf die Stirn ist, sagt Jakob.
Völliger Blödsinn, sagt Fred.
Ich hab’s aber gedacht.
Ammenmärchen.
Ich sag ja nur, dass ich’s gedacht hab.
Lange hatte Jakob sich bei der toten Mutter überlegt, ob er sie küssen sollte, bevor ihr Sarg für immer verschlossen wurde. Die anderen warteten draußen auf ihn, er wollte noch eine kleine Weile allein sein mit ihr und zögerte den Abschied wie unter Zwang hinaus. Ein paarmal, als er bereits die Türklinke in der Hand hatte, machte er wieder kehrt, um sie, bevor er endgültig ging, noch schnell auf die Stirn zu küssen, ihr übers Haar zu streicheln, sie nochmals zu küssen, fast sogar auf den Mund, was ihm dann doch ein wenig abstoßend erschien, wenngleich er sich dafür schämte, ausgerechnet die eigene Mutter, die ihm das Leben geschenkt hatte, beim allerletzten Auseinandergehen wie Gift abzuwehren, aus Angst, sie könnte ihn mit ihren Verwesungsviren anstecken.
Diesmal wirken auf ihn die Dinge im Haus weniger verwaist als nach Mamas Tod. Vielleicht kommt dieses Gefühl erst auf, wenn Papa nicht mehr hier liegt und erst danach alles leerer erscheint. Es ist, als sitze man wie zu Schulzeiten im Wohnzimmer, nur dass es damals diese rote Couch, auf der er liegt, noch nicht gab. Doch an den Leuchtern, Gardinen und Stühlen, der braunen, längst speckigen Ledergarnitur mit den karierten, an Schottenröcke erinnernden Decken, dem Teppich mit den bunten Rautenmustern, der ausladenden Lampe auf der Kommode mit ihrem knalligen Flower-Power-Schirm, dem metallenen Zeitschriftenständer und der Vitrine mit Mamas fein säuberlich nach Epochen geordneten Kunstbänden, von Leonardo über Dürer bis zu Monet und Picasso, scheint sich nichts geändert zu haben, außer dass man sich wundern muss, wie furchtbar altmodisch diese ganze Einrichtung mittlerweile aussieht, die in den Siebzigern als durch und durch modern galt. Bei allem Vertrauten ist einem das alles so ferngerückt, dass man sich kaum noch vorstellen kann, hier die ersten zwanzig Lebensjahre verbracht zu haben. Selbst nach Mutters Tod hatte Papa kaum etwas verändert und alles bloß verkommen lassen. Bei Blumen würde man sagen, sie seien verwelkt, was sich von Möbeln, Teppichen und Wänden schwer behaupten lässt, auch wenn einem genau dieses Bild in den Sinn kommt. Abgeschabt, ermüdet, erschöpft wirkt das alles, in einer morbid angehauchten Schönheit, wie man sie aus frühen Schwarzweißfilmen zu kennen meint, obwohl hier alles in Farbe ist.
Die zu Mutters Zeiten stets blütenweißen Gardinen sehen inzwischen graugelb aus, als seien sie seit ihrem Tod kein einziges Mal mehr gewaschen worden. Als Putzhilfe kann dieses Weib, das hier nur die ungarische Hure genannt wird, schlecht gedient haben, so wie es rundum aussieht. Bei Mutter musste immer alles picobello sein. Belebt war hier früher alles, aus Ulis Zimmer strömte ständig Musik, als Gegenprogramm lief bei Mama in der Küche das Radio, die Kaffeemaschine gurgelte, der Wasserkocher pfiff, im Flur telefonierte einer stundenlang, ein anderer lag lesend auf dem Sofa, Nachbars Katzen kamen zu Besuch, draußen dröhnten die Rasenmäher, während Linda sich aufregte, dass man sich in diesem Laden keine zehn Minuten auf etwas konzentrieren könne.
Vielleicht fühlte Papa sich tatsächlich jämmerlich allein, als selbst Mutter nicht mehr da war. Auf Geselligkeit hatte er zwar nie großen Wert gelegt, in sein Bürozimmer hatte er sich aber auch selten zurückgezogen. Das Gewusel um ihn herum störte ihn nicht, solange er selbst in Ruhe gelassen wurde. Doch plötzlich kehrte schiere Totenstille ein.
Selbst Linda hatte keinen einzigen von Mutters Kunstbänden mitgenommen, obwohl niemand sie daran gehindert hätte, am allerwenigsten Papa, der bei den vielen Kirchen- und Museumsbesuchen, die man in den Ferien eisern absolvieren musste, nur schwer verbergen konnte, wie sehr ihn das alles langweilte. Daten, Zahlen, Fakten, daraus bestand Mutters beflissenes Kunstwissen, mit dem sie einen regelrecht erschlagen konnte. In Museen steuerte sie zuerst auf die Schildchen mit Titel, Maler und Entstehungsjahr zu, um sich erst danach das Gemälde anzuschauen. Zuvor mussten die Eckdaten geklärt sein: Thema, Epoche, Name des Künstlers. Sie brauchte einen Namen für alles, der Name bedeutete Wissen.
Auf dem Mailänder Domplatz hatte Joschi einmal einen Anfall bekommen und sie angeschrien, das sei doch alles ein einziges Scheißwissen, bloß angelesen und auswendig gelernt, um damit angeben zu können. Mutter liefen die Tränen herab, sie verstand die Welt nicht mehr. Von jetzt auf gleich hatte er einen Wutausbruch gekriegt, der nicht nur mit Mutters Bildungsfimmel zu tun haben konnte. Er schrie so laut, dass man mit einem Schlag im Mittelpunkt stand und keiner mehr wusste, wohin schauen. Umgeben von Hunderten glotzender Passanten und Touristen, hätten sie sich am liebsten in die Erde gerammt. Zwischen Zornesanfällen, die weltgerichtliche Dimensionen annehmen konnten, und einem tagelangen Verstummen, das etwas Beleidigtes hatte, schwankten Joschis Stimmungen von da an immer häufiger hin und her. Bis zuletzt war er Mamas Sorgenkind geblieben, der Herr Karl Marx aus Heidelberg, wie Papa ihn gern titulierte, so lange jedenfalls, bis er vor Gericht stand und selbst Papa die Lust verging, noch Witze über ihn zu reißen.
Jakob, der schon während der Schulzeit lieber mit Adorno als mit Lenin argumentierte, musste sich von Joschi vorhalten lassen, sich für nichts anderes als parfümierte Theorien zu interessieren, wohingegen Linda mit ihrem Kunstfimmel, wie er das nannte, Mama nachschlug. Uli hielt er für einen verträumten Spinner, der Hermann Hesse liebt, sich den Verstand aus dem Hirn kifft und statt Gesellschaftsanalyse kindische Indianerverherrlichung betreibt, was er dem dreizehn Jahre Jüngeren so lange nachzusehen bereit war, bis man satisfaktionsfähig zu sein und ein kritisches Bewusstsein zu haben hatte. Papa wiederum hatte sich, nachdem Joschi auch im zwanzigsten Semester noch ohne Abschluss war, für seinen Ältesten bloß noch geschämt und keinerlei Verständnis dafür, dass Mama ihn nach wie vor bedauerte, als habe er es am schwersten von allen. Ausgerechnet er, der keinen Augenblick ernsthaft daran gedacht hatte, einen ordentlichen Abschluss zu machen, weil ihm die Bewegung, von der er unentwegt redete, hundertmal wichtiger war als seine eigene Zukunft, und zwar nicht irgendeine Bewegung, sondern die einzig mögliche, die es nur in der Einzahl gab, auch wenn sie aus lauter Splittergruppen bestand, die sich gegenseitig weit zäher bekämpften als den gemeinsamen Feind. Papa konnte das Wort Bewegung nicht mehr hören, er hatte genug von allen Bewegungen, egal ob sie ein tausendjähriges Reich errichten oder die Welt von aller Ungerechtigkeit befreien wollten. In seinen Augen steckte dahinter stets das Gleiche: Verbohrtheit, Wahn und Unduldsamkeit. Zu Joschi sagte er immer: Du weißt, ich bin nicht sonderlich religiös, aber dass wir aus dem Paradies vertrieben sind, steht nun einmal fest! Was hieß, dass es auch keines mehr geben werde, zumindest nicht auf dieser Welt. Im Übrigen waren in Papas Augen alle, die vom Himmel auf Erden träumten, geborene Versager. Für Joschi war das reaktionäres Geschwätz, hinter dem sich nichts als der Unwille verbarg, etwas verändern zu wollen.
Geändert hätte Papa allerdings gerne seinen eigenen Namen, als Joschi wegen der halben Million, die er veruntreut hatte, vor Gericht stand und man landauf, landab sein Gesicht in den Zeitungen sah. Selbst im Fernsehen war darüber berichtet worden. Papa merkte den Leuten an, wie sie ihn am liebsten gefragt hätten, ob er der Vater von diesem Bärtigen sei, schließlich gibt es den Namen Nido nicht tausendfach, zumindest nicht hier unten im Süden. Manche sprachen ihn unverblümt darauf an, anderen meinte er von weitem anzusehen, was in ihrem Kopf vor sich ging.
Und jetzt sitzt Joschi hier, die Hände gefaltet, ein bisschen schmächtiger geworden im Gesicht, soweit sich das durch seinen Bart hindurch beurteilen lässt. Als merke er gar nicht, wie heiß es ist, behält er seinen zerschlissenen Pullover an, den ihm wahrscheinlich Mutter vor Jahrzehnten gestrickt hat. Sein Äußeres war ihm immer schon egal, obgleich es keineswegs frei von Inszenierung ist, ganz im Gegenteil. In seinen schäbigen Klamotten fühlt er sich bis heute als Kämpfer wider jenen Konsumterror, der den Leuten die Gehirne vernebelt und sie blind für die wahre Wirklichkeit macht. Ginge es nach ihm, so höhnte Linda einmal, dürfte man sich frühestens nach vollendeter Revolution schöne Kleider leisten und die Korken knallen lassen. Dabei hatte er mit seiner Klasse, als er ungefähr vierzehn war, eine Gerichtsverhandlung besucht, in dem ein Dressman wegen Ehebetrugs angeklagt war. Es muss ein Schönling von Südländer gewesen sein, in weißem Anzug, mit schwarzer Lockenpracht und breiten Koteletten, der Joschi so tief beeindruckt hatte, dass er zu Hause verkündete: Ich will Dressman werden! Womit er ein neues Wort ins Haus schleppte, das ein wenig nach Dressurreiter klang, nur dass Papa, nachdem Joschi von seinem neuen Berufsziel gar nicht mehr zu schwärmen aufhören wollte, bemerkte: Muss ja eine ziemliche Schwuchtel gewesen sein! Auch das war ein neues Wort am Tisch daheim. Als Drittes kam noch Casanova hinzu, was Mutters Beitrag war. Am Ende schmollte er, weil die Eltern ihm seinen jüngsten Traumberuf madig gemacht hatten. Er ist als Einziger dem Schmuddellook der Siebziger treu geblieben, den selbst Uli im Laufe der Jahre ein Stück weit abgelegt hatte. Auch Linda ist sich, was die Mode angeht, treu geblieben, nur auf ganz andere Weise, denn sie trägt bis heute, wie ebenfalls schon zur Schulzeit, Hosenanzüge mit Bügelfalten.
Vollkommen anders, als man ihn früher kannte, hat Joschi sich inzwischen in einer Art Apathie zurückgezogen. Mit seinem Kellerloch ist er im wahrsten Sinne des Wortes so weit unten angekommen, dass nur noch das Männerwohnheim eine Steigerung darstellen könnte. Dass er früher so herrisch, so gnadenlos, so von oben herab auftrat, kann man sich kaum noch vorstellen, auch wenn das Unduldsame und Rechthaberische bei ihm nach wie vor aufblitzen. Seine einst allgegenwärtige Wut hat sich nicht bloß deshalb in Bitternis verwandelt, weil er jahrelang wie ein Hund unter Brücken leben musste, sondern weil der Gang der Geschichte sich nicht im Geringsten so entwickeln wollte, wie er das stur und starr prophezeit hat. Früher konnten selbst Leute, die ihn nicht für voll nahmen, vor seiner Rotzigkeit Angst kriegen, mit der er keinerlei andere Meinung gelten ließ, zumindest nicht, wenn es um die Gesellschaft und den Weltprozess als Ganzes ging. Wer die Dinge nicht sah wie er, stand auf der falschen Seite.
Vielleicht hatte Mutter sogar deshalb Mitleid mit ihm, weil sie hinter seinem sozialkritisch verbrämten Zorn etwas Hilf- und Heilloses zu entdecken meinte, das in ihren Augen damit zu tun haben musste, dass er sich von der Welt nie angenommen und nie in ihr aufgehoben fühlte. Bis zuletzt behandelte sie ihn wie den verlorenen Sohn, um den man sich, wie schon in der Bibel steht, inniger sorgen muss als um die andern. Er hat es am schwersten von allen, hatte sie immer wieder betont, nur dass niemand wusste, warum er es schwerer als die andern gehabt haben soll. Von Linda hatte sie das zwar auch gesagt, was sich bei ihr allerdings leichter behaupten ließ, da sie das einzige Mädchen war neben drei Brüdern. Vielleicht plagten Mutter, was Joschi angeht, wirre Schuldgefühle, von denen sie schwer hätte sagen können, woher sie rührten. Vielleicht weil sie ihm weitere Kinder vor die Nase setzte, die man ebenso lieben musste, und er nicht der Einzige blieb und seiner Besonderheit beraubt war, obwohl die andern keinem gefehlt hatten bis zu seinem sechsten Lebensjahr, zumindest nicht ihm. Bis Joschi siebzehn war oder achtzehn, schien trotzdem alles halbwegs normal zu verlaufen. Doch dann wurde er auf einmal bösartig. Alles war für ihn von da an bloß noch verlogen, allem musste man die Maske herunterreißen, alles entlarven. Was sich in aller Regel als pubertärer Moralismus, juvenile Gerechtigkeitsaufwallung und protestlerisches Potenzgehabe verbuchen lässt, wollte sich bei ihm nie wieder legen. Mit Anfang zwanzig ließ er sich einen Bart wachsen, um wie Marx auszusehen, der selbst etwas von jenen alttestamentarischen Propheten an sich haben wollte, die der Welt mit Untergang drohten, wenn sie sich nicht zu bekehren gedachte. Und nun könnte man, so wie Joschi hier mit gefalteten Händen sitzt, fast meinen, er bete im Stillen und sei vielleicht sogar fromm geworden.
Man könnte ein paar Kerzen anzünden, schlägt Franziska vor, und sie um den Toten herum aufstellen. Leider weiß keiner, wo es Kerzen gibt. In den Schubladen liegt allerlei Gerümpel, Schlüssel, Schraubenzieher, Glühbirnen, Servietten, Mehrfachstecker, Schnurballen und sogar Frauenstrümpfe, bloß keine Kerzen. Ich kann, schlägt Uli vor, zum Bahnhof fahren, etwas essen kaufen und auch Kerzen mitbringen.
Wie soll man jetzt Appetit haben, sagt Linda, als sei es absurd, in dieser Situation an Essen zu denken.
Ich sitze hier seit bald sechs Stunden ohne einen einzigen Bissen, protestiert Joschi, ohne sich in seinem Lehnstuhl zu regen, der für ihn ein wenig zu eng ist und ihn wie eingeklemmt aussehen lässt.
Wir können doch essen gehen, schlägt Jakob vor.
Nein, wir müssen hier sein, wenn er anruft, blafft Linda zurück, ohne noch verbergen zu können, wie ihre Nerven flattern. Jakob fragt sich, wie sie ihn heute Abend wohl anreden wird, wenn sie weder Max noch Schmeler zu ihm sagen will. Am Ende sagt sie noch Sie zu ihm. Man kann sich diese Begegnung überhaupt nicht vorstellen, ganz unabhängig von der Frage, worum genau es eigentlich gehen soll. Zwar sind alle, die hier um Papa herumsitzen, davon überzeugt, dass ihnen das Erbe zusteht, nur weiß keiner wirklich, was zu tun wäre, falls er ihnen tatsächlich nichts gelassen hätte. Sicher ist nur, dass Uli in seiner penetranten Friedfertigkeit wenig Lust zum Kämpfen besitzt, obwohl Franziska und er es mit ihren drei Kindern ganz gut brauchen könnten. Ihr Ältester hat gerade Abitur gemacht und absolviert seit drei Wochen in Australien ein soziales Jahr, was heißt, dass er, um Kängurus pflegen zu dürfen, pro Monat dreihundert Dollar abdrücken muss.
Franziska hält Ulis Hand in ihrem Schoß, Linda steht, die Arme verschränkt, am Fenster und schaut auf den Garten, Joschis Hände sind immer noch gefaltet. Er könnte bereits Rente bekommen, wäre er je einer Arbeit nachgegangen oder Geschäften, mit denen sich etwas verdienen lässt. Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu vernichten, hatte Papa gern Goethe parodiert, worauf Joschi ihm immer mit Hans im Glück kam, der nicht vom kapitalistischen Profitwahn angefressen ist, sondern Wichtigeres kennt als Geld und Güter.
Eigentlich hätte Jakob die Bilder gerne noch hängen gesehen. Selbst als Papa in den letzten Zügen lag, muss er auf sie geblickt haben. Vielleicht verschloss er am Ende die Augen vor ihnen, um sie nicht mehr ertragen zu müssen, vielleicht hätte er sie während der letzten Stunden am liebsten selbst abgerissen, vielleicht hat er aber auch in einer Erregung, wie sie ihn in den letzten Jahren vermutlich keinen Tag mehr loslassen wollte, den letzten Schnaufer von sich gegeben. Vielleicht wollte dieses Weib ihn regelrecht zu Tode reiten. Was Linda für durchaus denkbar hält.
Als sie zum ersten Mal vor drei Jahren diese Bilder abgerissen hatte, schrie sie ihn an: Du bist nicht mehr mein Vater! Und er schrie zurück: Und du nicht meine Tochter! Komm bloß nie wieder! Immer wieder erzählt sie diese Szene, immer und immer wieder, und sei es um allen einsichtig zu machen, warum sie ihn entmündigen lassen wollte. Die Bilder hätte sie noch tausendmal abreißen können, zwei Tage später wären neue an den Wänden gehangen, in ihrem Kindheitsreich, das er entweiht, besudelt, beschmutzt hatte. Ein Glück, dass sich wenigstens ein Teil dieser Wunderlichkeiten mit den Tabletten entschuldigen ließ, die er nehmen musste, mit diesen Hämmern, die ihn ganz wild machten, so wild, dass er sich überhaupt nicht mehr im Griff hatte, dabei aber glaubte, jetzt fange erst richtig das Leben an. Gegenüber Mama war bei ihm nie viel von Lust zu spüren, kaum dass sie aber ein paar Jährchen unter der Erde lag, schien er kein bisschen Scham mehr zu kennen.
Papa erklärte ihr: Du hast dich nicht in meine inneren Angelegenheiten einzumischen! So staatsmännisch, wie das klang, hatte er damit sogar einen Rest von Witz bewiesen. Dass er humorlos gewesen wäre, konnte man ihm zwar nicht nachsagen, nur dass bei ihm alles unter einer Hülle begraben lag, die man als Gleichgültigkeit oder Gelangweiltsein empfinden konnte und die ihm dazu diente, die Dinge auf Abstand zu halten. Wie seine Kollegen und Patienten ihn in der Klinik erlebten, weiß keiner, doch immerhin war er dort der Chef, was in gewisser Weise auch zu Hause der Fall war, man davon allerdings angenehm wenig mitbekam. Von seiner Arbeit erzählte er nie viel, außer die Kinder wollten makabre Geschichten von besonders delikaten Fällen hören, die auf seinem OP-Tisch gelandet waren, von Raucherbeinen, die amputiert werden mussten, von Selbstmördern, die noch lebten und deren Knochen er wieder zusammennagelte, von Metzgern, die einen abgehackten Finger mitbrachten, oder Zimmerleuten, die einen abgesägten bei sich hatten, nicht zu vergessen solche Silvesterzündler, die aus dem schlimmsten Krieg zu kommen schienen und zum Teil bloß noch aus Fleischfetzen bestanden. Ja, so etwas gibt’s, sagte Vater dann immer. Und manchmal sagte er auch: Man muss im Leben nicht jeden Blödsinn mitmachen!
Erst um die Mittagszeit, kurz bevor auf der Gare de l’Est der Zug einfuhr, hatte Jakob beim Sender angerufen, um seinen Beitrag abzusagen. Seit Wochen ist die Ausstrahlung angekündigt, für nächsten Freitag, zum zigsten Todestag von Pascal. Man war alles andere als begeistert in Baden-Baden, bei allem Bedauern und allem Verständnis. Sie wollten ihm einen Flug besorgen, den Kameramann für morgen früh zwei Stunden eher einbestellen, bereits um sieben, so dass Jakob hätte am späten Nachmittag in Stuttgart landen und eine Stunde später in Ulm sein können. Sie mochten nicht wirklich begreifen, dass er alles stehen und liegen ließ, ohne die geringste Verzögerung, schließlich werde die Beerdigung doch frühestens in drei Tagen stattfinden, redeten sie auf ihn ein. Ihm kam das reichlich frech und sogar gnadenlos vor, selbst wenn es ein Stück weit nachvollziehbar war, doch hatte Linda ihm strikt befohlen, augenblicklich heimzukommen. Er legte sich noch einmal hin und schaute auf die Dächer mit ihren gotisch verzierten Gauben und grotesken Kaminen.
Ich hätte nicht absagen sollen, sagt er sich, Tod hin, Tod her. Die Aufträge werden seit Jahren rarer, längst drängen die Jungen nach, zu denen man sich gestern selbst noch gezählt hat, die Klampfe in der Hand mit forever young!, tausendmal gegrölt, die immer gleichen drei, vier Akkorde, forever young!, und auf einmal wacht man auf und weiß: Das war es schon, mit Mitte, Ende fünfzig, mit einem Schlag, wie über Nacht, als sei man blind gewesen, so blind, dass man sich ewig für einen jener Jungen hielt, die alles anders machen wollten als die Alten, als diese Schufter und Schaffer, die ständig nur an Aufbau dachten, ans Häuslebauen, Sparen, Zinsenkriegen, während man sich selbst in der Gewissheit wähnte, dass einem, wenn sie tot sind, alles gehören würde, das Haus an der Donau, die Ferienvilla in Arona und möglichst viel Bares, von dem man sich insgeheim seit je erhoffte, es werde allein für sie, die Kinder, angehäuft.
Er hätte diese Fernsehsache zu Ende bringen sollen, alles war bestens vorbereitet, dieser Film über Pascal, den ein Leben lang die Panik umgetrieben hatte, es könnte ihn nach dem Tod die Verdammnis erwarten oder, schlimmer noch, das unendliche Nichts. Für Joschi, der nach wie vor mit gefalteten Händen dasitzt, war immer klar, dass Religion nichts als Opium ist. Doch selbst die hartgesottensten Atheisten, denkt Jakob, muss ein winziger Rest von Angst vor dem umtreiben, was danach kommen könnte. Ob es tatsächlich kein Jüngstes Gericht gibt und keine Hölle, weiß niemand. Schon so mancher hat im letzten Augenblick das Zittern bekommen und auf dem Sterbebett noch schnell einen Pfarrer rufen lassen, nicht nur Lenin, der sich an Tisch- und Stuhlbeinen festgekrallt und bebend nach Vergebung geschrien haben soll.
Glauben oder nicht glauben, das war nie Papas Frage, doch beichten hätte er am Ende vielleicht trotzdem gewollt, ohne noch Zeit dafür zu haben. Die ganze Familie habe er entehrt, vor allem seine Frau, und zwar noch im Tod, behauptet Fred, was nicht bloß Jakob maßlos vorkommt, zumal er nur der Schwager ist und es sich nicht um seine eigene Mutter handelt, die angeblich noch im Tod entehrt worden ist. Du weißt jetzt auch noch nicht, was aus dir einmal wird im Alter, hatte Jakob ihm beim letzten Zusammensitzen vor einigen Monaten entgegengehalten, während Linda sich sicher ist, das Fred niemals so wird wie Papa, auch nicht im Alter. Dabei hätte es schlimmer kommen, mit ständiger Pflege und weit grausameren Krankheiten. Zuweilen steigt in Jakob durchaus die leise Angst auf, vielleicht einmal so wie er zu enden, wofür es bislang zwar keinerlei Anzeichen gibt, was bei Vater in diesem Alter allerdings auch noch nicht absehbar war. Was ist der Mensch, fragt Pascal und klagt: Ein Schilfrohr im Wind, das denken kann und über sich selbst nachsinnt, was ihm aber, wenn es geschüttelt und gerüttelt wird, rein gar nichts nützt.
Es hätte schlimmer kommen können, sagt Fred auf einmal, als läse er Jakobs Gedanken.
Was redest du denn da, fährt Linda ihn an.
Ich mein’s, wie ich’s sage.
Was soll das heißen?
Es hätte schlimmer kommen können.
Red keinen Unsinn.
Wir müssen einen Arzt holen, trotz allem, sagt Uli.
Ein paar von euch haben’s immer noch nicht kapiert. Er bleibt hier liegen, bis alles geklärt ist, und vorher kommt mir hier kein Arzt ins Haus. Ihr könnt ja alles planen, die Beerdigung, die Totenkärtchen, euch überlegen, wer als Pfarrer in Frage kommt. Genug zu tun, mault Linda zurück.
Wieso Pfarrer?, will Joschi wissen.
Dass Joschi gegen eine kirchliche Beerdigung ist, war klar. Dabei ist Papa nie aus der Kirche ausgetreten, genauso wenig wie Mama. Wenn die Leute einmal überhaupt nichts mehr glauben, hatte Mama manchmal gesagt, dann gute Nacht! Das war ihr ganzer Beitrag zum Thema Religion. Bei ihrem Begräbnis hatte Joschi sich nicht gegen einen Pfarrer gewehrt. Seine Totenrede empfand er als reines Gesülze, was absehbar war.
Er kommt zu Mama ins Grab, und weil das so ist, muss auch ein Pfarrer her, stellt Linda klar. Die Frage ist bloß: Sarg oder Urne?
Zu Mama ins Grab? Das meinst du nicht im Ernst?
Ihr könnt, sagt Fred, ihn auch ewig hier liegen lassen und seine Rente einsacken. In Griechenland gibt’s deshalb hundertmal mehr Hundertjährige als sonst auf der Welt, weil die im Keller verfaulen und die Familie jeden Monat vom Staat den Zaster kassiert.
Kurz vor ihrem Tod erklärte Mama zu aller Erstaunen, sie wolle bei ihrer Mutter begraben werden, dort und sonst nirgends. Aus Furcht, man könnte ihrem Willen nicht entsprechen, ließ sie sogar einen Notar rufen, um es testamentarisch festzulegen. Vater versuchte vor den Kindern sein Entsetzen, so gut es ging, zu überspielen, konnte aber nur schwer verbergen, wie sehr er Mutter mit Geheul und Vorwürfen bedrängte, es doch bitte wie alle Welt zu halten und sich ordentlich auf dem hiesigen Friedhof beerdigen zu lassen, in einem Grab für sie beide, allein der Kinder wegen, aber auch um ihn nicht wie einen Hund zurückzulassen, von dem die Leute denken müssten, er habe sich ihr gegenüber wie ein Schwein verhalten. Mutter ließ sich davon keine einzige Sekunde beirren. Sie wollte heim. Heim zu ihrer eigenen Mama, die starb, als sie siebzehn war. Ihren Vater kannte sie nicht. Weil ihre Mutter nie über ihn reden wollte, wäre es ihr als Kind fast wie Verrat vorgekommen, überhaupt nach ihm zu fragen, auch wenn ihr nicht klar war, wen oder was sie damit eigentlich verraten hätte. Sie wusste bloß, dass er eine Hasenscharte hatte und man ihn schwer verstehen konnte. Für ihre Mutter war er nur ein Lump und Lügner, viel mehr gab es dazu nicht zu sagen. Weil er noch vor ihrer Geburt abgehauen war, sollte das Kind vom ersten Tag an alles ersetzen, was der Mutter fehlte und genommen wurde. Es war ihr Ein und Alles, ihr ganzer Lebenssinn, so sehr, dass das Kind im wahrsten Sinne des Wortes keine Luft mehr bekam. Jahrelang musste es wegen Asthma behandelt werden, das nach dem Tod der Mutter schlagartig aufgehört hatte.
Während sie die väterliche Verwandtschaft nie kannte, gab es auf Mutters Seite noch ein paar weitläufige Onkel und Tanten, zu denen der ohnehin bloß lose Kontakt im Lauf der Zeit abbrach. Aufgewachsen war sie in einem Kaff im Hintertaunus, worunter man sich nur abgelegene Waldgegenden vorstellen konnte und verlorene Weiler. Selbst den Namen des Ortes konnte keiner sich richtig merken, er klang wie eine Mischung aus Hannchen und Heintje, der mit seinem Mama Ende der Sechzigerjahre auch die Familie Nido zu Tränen gerührt hatte. Geblieben war ihr aus dieser Gegend nur eine Spur von Dialekt, bei dem Kirche wie Kirsche klang und das schwäbische Mädle zum Mädsche wurde. Richtig Dialekt geredet hatte Mutter nicht mehr, außer zum Spaß, wenn es Siedfleisch mit grie Soß gab oder sie gelegentlich rief: Des Ässe mit de Gedoffel isch fertisch. Ansonsten schien sie froh, mit dieser Welt nichts mehr zu tun zu haben.
Nie hatten sie mit ihr einen Ausflug dorthin gemacht. Man fährt doch nicht wegen ein paar lumpiger Häuser vier Stunden lang in eine Gegend, wo so gut wie kein Mensch wohnt und bloß das Selterswasser herkommt, hatte Mutter jedes Mal gesagt, wenn der Vorschlag aufkam, sich einmal ihr altes Dorf anzuschauen. Allenfalls besichtigen wir den Limes und den Limburger Dom, schlug sie vor, wenn jemand darauf beharrte. Bis wenige Wochen vor ihrem Tod zog sie nicht nur nichts dorthin zurück, man hatte sogar das Gefühl, dass sie ihre Kindheit am liebsten vergessen würde. Dabei hatte sich damals offenbar nichts Schlimmes zugetragen, außer dass sie unehelich war, was vor dreißig, vierzig Jahren in einem Dorf als furchtbare Schande galt, vor allem für die Mütter. Es muss die Enge gewesen sein, vor der sie fliehen wollte, wozu wohl auch die ständigen Beteuerungen ihrer Mutter gehörten, dass sie ihr Ein und Alles sei, was sie als Jugendliche mit jedem Tag weniger als Liebesbekundung empfunden haben muss denn als Drohung.
Doch plötzlich wollte sie wieder heim und im Grab ihrer Mutter beerdigt werden. Es war, von heute auf morgen, so sehr ihr Wunsch und Wille, dass man bloß staunen und nicht das Geringste dagegen ausrichten konnte. Etwas trieb sie mit einer Vehemenz in ihr Dorf zurück, von dem man nicht wusste, was es war und woher es rührte. Fast hätte man meinen können, ihr jahrzehntelanges Leben mit Mann und Kindern sei nur ein Abstecher gewesen, wenn nicht sogar ein Missverständnis, bei dem sie sich das Gefühl des Unheimischseins nie anmerken ließ oder von dem sie sogar die längste Zeit selbst nichts spürte. Ihre Heimat hatten die Kinder zum allerersten Mal bei der Beerdigung gesehen. Außer ihnen, dem Pfarrer, zwei Ministranten, dem Bestatter und einem Organisten war niemand anwesend. Sie bildeten ein jämmerlich kleines Häuflein, das in einer unbekannten Umgebung zwischen Gräbern stand, von denen kein einziger Name ihnen etwas sagte. Da nicht nur Vater es für absurd gehalten hätte, sich dort bloß deshalb in einem Gasthof einzuquartieren, um nicht mehr heimfahren und beim Leichenschmaus nüchtern bleiben zu müssen, stiegen sie nach der Beerdigung und einem kurzen Gang durch die Gassen gleich wieder in die Autos und saßen abends im Adler, wo sie Bratwürste mit Kartoffelsalat aßen und Fred nach Mitternacht noch einen Anfall bekam.
Uli und Franziska wollten, dass bei der Beerdigung Sailing gespielt würde. Jakob war strikt dagegen und konnte es mit Linda verhindern, die zwar nichts gegen diesen Song hatte, doch der Meinung war, das sei nicht Mutters Musik. Jakob fürchtet, dass derartige Diskussionen erneut auf dem Programm stehen und sie auch bei Vater Rod Stewarts Gekrächze abspielen wollen, wo sich sea auf free reimt und man ein paar Tränen verdrückt, die weniger dem Toten gelten als der eigenen verlorenen Jugend. So jedenfalls sieht Jakob die Dinge, dem an dieser Musik jenes Drüberhinaus fehlt, das man Transzendenz nennen könnte. Obwohl er sich für keinen Gläubigen, aber auch nicht für einen Ungläubigen hält, widerstrebt ihm ein sentimentales Gesinge, das wenig von einer noch anderen Welt erahnen lässt, wie sie in Werken aufscheint, die nicht bloß aus ein paar simplen Akkorden und billigen Phrasen zusammengezimmert sind. Überhaupt gehen Jakob Konserven auf die Nerven, die bei Beerdigungen auf Knopfdruck Stimmung liefern sollen, egal ob es sich um Mozart handelt oder um Rod Stewart. Auf ihn wirkt das so geschäftsmäßig, als wollte man den Abschied vom Toten möglichst mühelos hinter sich bringen. Weil er mehrfach im Laufe der Jahre erleben musste, wie kläglich Begräbnisse ablaufen, wenn ein kirchlicher Rahmen fehlt und eine liturgische Form, ist er der Meinung, dass es um eines würdigen Abschieds willen gleichgültig sein sollte, ob man sich als Atheist begreift oder als Agnostiker, schließlich geht es in jener Stunde, wo der Sarg der Erde übergeben wird, weit weniger um einen selbst als um den Toten, den man auf seinem letzten Weg begleitet.
Mama hatte sich für ihr Requiem das Ave verum gewünscht, bei dem ihr immer die Tränen kamen. Weil sie in ihrem Taunusdorf aber längst keiner mehr kannte, hielt der Pfarrer es dort für ausgeschlossen, den Kirchenchor zu verpflichten, zumal auch noch mitten unter der Woche. Im Übrigen, so ließ er anklingen, wäre es seltsam, wenn der Chor deutlich mehr als das Doppelte der Trauergemeinde ausmachte. Weil Papa es ohnehin absurd fand, dass seine Frau in einem Kaff beerdigt wurde, das in ihrem gemeinsamem Leben nie eine Rolle gespielt hatte, legte er auch keinerlei Wert auf das Ave verum, weshalb Jakob ihn fragte: Warum willst du Mama nicht ihren letzten Wunsch erfüllen? Für ihn war das alles nur eine absonderliche Flucht und ein Fluch, worüber er kein einziges Wort mehr verlieren mochte.
Ihren letzten Willen?! Ihr letzter Wille war ein Affront, ein Angriff, eine Attacke. Wofür, das wusste er selbst nicht. Auch die Kinder wissen es bis heute nicht. Mutters Entscheidung schien durch nichts vorbereitet, durch nichts angekündigt, durch nichts verständlich, zumindest nicht durch Dinge, von denen sie etwas mitbekommen hätten. Sollte Vater sich auf all das einen Reim gemacht haben können, ließ er sie davon nicht das Geringste wissen.
Von wo auch immer aus gesehen, von Memmingen oder Ulm, der Schwäbischen Alb oder Paris, der Hintertaunus liegt alles andere als um die Ecke. Allenfalls Joschi kann sich Mutter, rein kilometermäßig gesehen, ein bisschen näher fühlen. Nur hat er weder ein Auto noch Geld, um öfter ihr Grab aufzusuchen. Und doch ist er der Einzige, der jedes Jahr an ihrem Todestag dorthin fährt. Morgens nimmt er den Zug, steigt fünfmal um, von der einen Bimmelbahn in die nächste, noch kleinere, um kurz vor der Ankunft an zwei, drei Haltestellen in freier Pampa herumzustehen, wo bestenfalls einmal pro Stunde ein Bus hält, mit dem es über entlegenste Landstraßen durch Dörfer geht, die wie ausgestorben wirken. Um die Mittagszeit steht er auf dem Friedhof, dann geht er in die Dorfwirtschaft, isst Handkäs mit Musik oder eine Wurst mit Brot und trinkt zwei Bier, geht nochmals ans Grab, bei jedem Wind und Wetter, stellt sich wieder an die Straße und wartet auf den Bus, steigt abermals fünfmal um und ist abends wieder daheim. Auf diese Weise feiert er jedes Jahr am 27. September seine eigene Art von Muttertag.
Nachdem Papa sofort damit einverstanden war, dass es weder Chor noch Ave verum gab, schlug der Pfarrer vor, einen pensionierten Organisten zu fragen, ob er gegen ein Trinkgeld einspringen würde, was auch der Fall war, nur dass dieser bucklige, ganz und gar nicht verhandlungsbereite alte Mann ebenfalls nichts von Mozart wissen wollte, sondern sein übliches Programm durchzog, Heilig, heilig, heilig, Wohin soll ich mich wenden und Großer Gott, wir loben dich