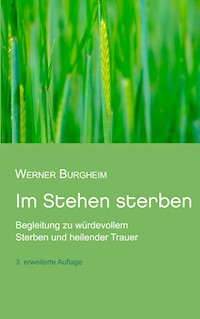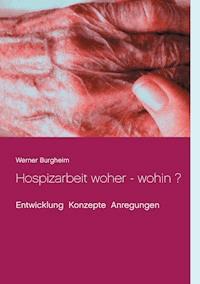
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Hospizarbeit und Palliative Care werden hier in ihren historischen Entwicklungen, ausgewählten Konzepten, Professionalisierungstendenzen und Qualitätskriterien wie auch mit einer Didaktik der Sterbebegleitung dargestellt. Kritische Ausblicke und Anregungen zur Zukunftsperspektive sollen nicht fehlen. Für alle, die sich für die Hospizbewegung und ihre Praxis interessieren, sich engagieren und Verantwortung tagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Sterben: Ein soziale Herausforderung
Die Geschichte der Hospizbewegung
Hospizarbeit auf dem Weg zur Professionalisierung
Qualitätsentwicklung in der Hospizarbeit
Modelle zum Umgang mit Sterbenden und den Toten in Institutionen
Lehren und Lernen für Sterbende und Trauernde Eine Didaktik der Sterbebegleitung
Zur Rollenunsicherheit der Ehrenamtlichen im Palliative Care-Konzept
Wohin, Hospizbewegung? Ein ungewöhnliches Interview mit Dame Palliativa Hospizia
Der Sterbende an seine Begleiter (G. Rest-Hartjes)
Danksagungen
Ein weiteres Buch (2017) vom gleichen Verfasser
Vorwort
Das Leben wird
vorwärts gelebt und
rückwärts verstanden.
Hospizarbeit und Palliative Care werden in ihren historischen Entwicklungen, ausgewählten Konzepten, Professionalisierungstendenzen und Qualitätskriterien sowie einer Didaktik der Sterbebegleitung dargestellt. Kritische Ausblicke und Anregungen zur Zukunftsperspektive sollen nicht fehlen.
Für alle, die sich für die Hospizbewegung und ihre Praxis interessieren, sich engagieren und Verantwortung tagen.
Mögen die Gedanken und Beiträge gute Lesefrüchte hervorbringen.
Mainz, im Frühjahr 2017 Werner Burgheim
1 Sterben: Ein soziale Herausforderung
Das Geheimnis des Lebens und
das Geheimnis des Todes
sind verschlossen in zwei Schatullen,
von denen jede den Schlüssel zur anderen enthält.
Mahatma Ghandi
Leben bis zuletzt, end-lich leben, den Schlüssel finden zu den Geheimnissen des Lebens und des Todes; vieldeutige Metapher für Suchbewegungen, um uns den Mysterien des Lebens und Sterbens zu nähern.
Seit Jahrtausenden sind die Menschen auf dem Weg und suchen das Schicksal ihnen Sterblichkeit zu ergründen. Sie stellen sich die existentiellen Fragen: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Alle Kulturen haben Rituale als Stützungen der Seele entwickelt, um bedeutsame Situationen des Lebens zu gestalten. Im Gutenberg-Museum in Mainz ist ein für über eine Million erworbenes Büchlein zu sehen mit dem Titel ,,ars moriendi“, also ,,Die Kunst des Sterbens“, ein Buch, das den Menschen damals in Schrift und Bild Hilfestellung gab.
Früher war das Sterben eingebunden in den Glauben, in die Großfamilie und in das Dorf. Diese Stützungen sind heute vielfach weg gebrochen. Neue Formen noch nicht hinreichend entwickelt. Intime Themen wie Geburt und Sexualität sind inzwischen entzaubert. Sterben ist eines der letzten Tabuthemen unserer Tage, es ist mit Diskursverweigerung belegt. Um uns gegenseitig zu schonen, sprechen wir nicht darüber. Sterben ist ja das Persönlichste und zugleich das Fremdeste des Lebens. In der Bedrohungssituation unserer leiblichen Existenz können wir verzweifeln und untergehen, aber auch über uns, unsere Vergänglichkeit und Todesangst hinauswachsen. In dieser Herausforderung könnten alle Beteiligten viel über das Leben und Sterben lernen,denn wenn wir uns mit einem Teil beschäftigen,den Schlüssel zu einem Geheimnis finden, dann erschließt sich dadurch auch den andere Teil.
Sterben ist eine Herausforderung an die Nächstenliebe, an die Gemeinschaft und Gesellschaft. Kultur holt die Zeit, die Räume, die Prozesse heraus aus der Alltäglichkeit und formt sie. Sterbekultur bedeutet demnach, Menschen Zeit zu lassen und Zeit zu schenken, ihnen vertraute und gestaltete Räume zu geben. Sterbekultur besagt, die Selbstbestimmung und den Willen des Menschen zu respektieren. In der Sterbebegleitung bestimmt den Sterbende den Weg. Hier geht es nicht um eine Missionierung und Kolonisierung von Lebenswelten. Durch Zuwendung, Nähe und konkrete Hilfe, wie z.B. angemessene Schmerztherapie, wird die Verzweiflungstat der Selbsttötung überflüssig gemacht. Lebensbeistand ist die Ermöglichung eines sinnvollen und humanen Lebens bis zuletzt, das Hilfestellungen bei Sinnfragen, bei der Selbstreflexion, bei der Biografiearbeit, den Fragen nach Schuld und Versöhnung und die Gestaltung des Abschiednehmens einschließt. Vielleicht wurde da Sterben uns zugemutet, um unser Miteinander ständig herauszufordern, um unsere Mitmenschlichkeit daran zu bewähren. Diese Bewährungsprobe ist in der heutigen Zeit noch nicht bestanden.
Die Hospizbewegung eröffnet Begegnungsorte, wo sich persönliche Betroffenheit, geistige Interessen und gesellschaftliches Engagement treffen können: In den Gruppen vor Ort fließen persönliche Erfahrungen mit Sterben und Leiden, Fähigkeiten der Pflege und Begleitung ein zum gemeinsamen Dienst an Schwerstkranken, Sterbenden und Trauernden ein. Hier ist den Ort, wo Begleiterinnen und Begleiter über ihre schwierige Arbeit berichten können, wo sie verstanden und aufgefangen werden. Solche Arbeit hat Ausstrahlung in die ganze Region.
Hospizarbeit ist die Gelegenheit, sich zu vernetzen und sich geistig zu verorten. Sier arbeitet an der Kunst des Sterbens, an der Formung einer Sterbekultur. Sie setzt Beispiele und Zeichen für Solidarität und einfühlsamer Zuwendung:
Dienst an Menschen.
2 Die Geschichte der Hospizbewegung
Schon immer waren Menschen vom Mitleid gerührt und bemühten sich, ihre Kranken und Sterbenden gut zu versorgen. In den Jahrtausenden ist dies unterschiedlich gelungen, je nach persönlichen und gesellschaftlichen Bedingungen, der Kultur und den religiösen Einstellungen und Vorstellungen.
Im Altertum
In dem Heiligtum des Äskulap in Epidaurus in Griechenland fanden Kranke Heilung durch die Orakel des Gottes und durch ärztliche Hilfe. Ohne diagnostische Techniken und chemische Mittel setzte die Therapie auf menschliche Zuwendungen, auf Gaben der Natur, Stärkung der körperlichen und seelischen Kräfte und auf die Botschaften der Götter. Die Räume waren für die Augen gestaltet, in den Vorhallen, in denen die Kranken lagen, blühten Pflanzen, sangen Vögel und waren nachts die Sterne zu sehen. Schlamm- und Wasserbäder, körperliche Übungen, Milch, Honig und Fruchtsäfte, das ärztliche Gespräch und die Deutung von Träumen gehörten zum therapeutischen Konzept. Allerdings wurden Sterbende nicht aufgenommen. So ist Epidaurus zwar ein gutes Beispiel für Heilstätten und Lebenshilfe, aber nicht für eine Hospizarbeit im heutigen Sinne, wobei die therapeutischen Konzepte von dort durchaus Gestalt annehmen können (vgl. Stoddard, 1987, 20 f.).
Im Morgenland
In den arabischen Staaten gehörte das Krankenhaus zu einer selbstverständlichen Einrichtung und war für die damalige Zeit mit großem Luxus versehen. Sie standen unter der ständigen Aufsicht des Sultans. Aus dem Brief eines Kranken: „Wenn du mich besuchst und Musik aus einem Raum vernimmst, bin ich vielleicht schon im Tagesraum für Genesende, wo es Musik und Bücher zur Unterhaltung gibt. Wenn ich entlassen werde, bekomme ich vom Krankenhaus einen neuen Anzug und fünf Goldstücke, damit ich nicht sofort wieder arbeiten muss. Zum Beweis der Gesundheit darf ich einen Laib Brot und ein ganzes Huhn verzehren.” Das war Lebenshilfe im Morgenland.
Im Abendland
Vor 1.000 Jahren boten im Abendland die Siechenhäuser vor den Mauern der Städte religiöse Betreuung und Hilfe beim Sterben. Große Seuchen bedrohten die Menschen mit dem Tod. Oft wurde vor der Behandlung des Arztes verlangt, zu beichten, da an einen Zusammenhang von körperlichen Gebrechen und Schuld geglaubt wurde, ja oft sogar Krankheit als Gottesstrafe für die Sünden angesehen wurde.
Auf den Höhen der Alpen standen Herbergen, in denen Wanderer und Reisende Schutz, aber auch Pflege bis zum Tod erhielten. In vielen Hospizen des Mittelalters pflegten Orden Kranke und Sterbende. Beispiele aus der Bibel und aus dem christlichen Glauben wie der barmherzige Samariter oder Sankt Christophorus waren Vorbilder. Gerade Notleidende und Ausgestoßene wurden bewusst begleitet und in ihnen begegnete den christlichen Männern und Frauen Christus selbst.
Die Neuzeit
Nach der Säkularisation nahmen Diakonissen und Pastor Theodor Fliedner 1836 in Friedensheim oder die „Irish Sisters of Charity” in London 1905 die Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden wieder auf. Neue Pflegeorden wurden wieder gegründet.
Die Sozialarbeiterin, Krankenschwester und Ärztin Cisely Saunders litt unter den Bedingungen inhumanen Sterbens in dem großen Krankensaal der Großstadt von London. Nicht nur die räumliche Enge, sondern auch die Orientierung an der technischen Medizin als Reparaturwerkstatt, in der das Sterben als Scheitern der ärztlichen Bemühungen empfunden wurde, und das Verschwinden der Sterbenden oft im Badezimmer war für sie kein humanes Konzept. Sie träumte von einem Haus, in dem in Geborgenheit gestorben werden konnte. Mit ihrer Konzeptbeschreibung des „total pain” machte sie deutlich, dass gerade der Schmerz nicht nur körperliche, sondern ebenso emotionale, psychosoziale und spirituelle Ursachen hat. Damit wurde sie Vorreiterin der ganzheitlichen Palliativ Care. Mit ihrem „St. Christopherus Hospiz” schuf sie 1967 ein Modell für eine weltweite Hospizbewegung.
Die Psychotherapeutin Elisabeth Kübler-Ross zeigte in ihrem bekannt gewordenen Buch „Interviews mit Sterbenden” die psychische Seite der Krisen und Sterbeprozesse auf und damit einen heute schon zum Allgemeinwissen gehörenden Weg, durch emotionale Begleitung Sterbenden diesen Weg zu erleichtern.
Im Jahre 1971, also genau vor 30 Jahren, wurde durch den Fernsehbericht des Jesuiten Reinhold Iblacker: „Nur noch 16 Tage”, ein Schwarz-Weiß-Film über das „St. Christopherus Hospiz” in London, eine große Betroffenheit über heutiges Sterben ausgelöst. Die Hospizidee war damit angestoßen und nicht mehr aufzuhalten. 1986 wurden Dachverbände gegründet und die Organisation der Bürgerbewegung Hospiz nahm ihren Anfang.
Der dreistufige Entwicklungsweg
Aus heutiger Sicht sind drei Phasen zu beschreiben:
Stufe 1: Als der Schwarz-Weiß-Film: „Nur noch 16 Tage” die Republik erschütterte und die Idee des Hospizes von London aus, vom St. Christopherus Hospiz den Kontinent erreichte, dauerte es nach meiner Einteilung ungefähr noch 20 Jahre, bis der Hospizbegriff und der Hospizgedanke sich bei uns durchsetzte und auch erste falsche Vorstellungen von einem Sterbe-Haus und einer Sterbe-Klinik korrigiert werden konnten. Bis heute sind, wie ich bei einer Anhörung vor Bundestagsabgeordneten erleben musste, immer noch Vorstellungen in den Köpfen, Hospiz sei ein Haus mit der Gefahr, dass dorthin Sterbende abgeschoben werden. In den ersten zehn Jahren wurde aus dem Hospiz-Haus eine Hospiz-Idee, eine Bürger- und Selbsthilfebewegung, entstanden aus der Erkenntnis und Not, dass auch in Deutschland noch zu häufig unmenschlich gestorben wird. Auch war der wieder aufkommenden Notlösung der aktiven Sterbehilfe (Euthanasie) durch den Hospizgedanken zu begegnen. Aus den Brüchen und Widerständen der Verhältnisse waren die „im Dunkel des gelebten Augenblicks” (Ernst Bloch) verborgenen Entwicklungschancen aufgespürt und weiterentwickelt worden zur Bürgerbewegung, zu einer Wertegemeinschaft und hospizlichen Netzwerken.
Stufe 2: In einer zweiten Phase, die ca. zehn Jahre dauerte, setzte ein wahrer Gründungsboom von Hospizgruppen ein, in einem ungeahnten und auch sehr fruchtbaren Ausmaß. Manche sprechen sogar von Wildwuchs und krebsartigem Wachstum in Bezug auf so viele Gruppengründungen. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass es heute über 1.000 ambulante Hospizdienste und hunderte stationäre Hospize und Palliativstationen gibt? Wer hätte damals gedacht, dass die Bewegung in 16 Landesarbeitsgemeinschaften, neun Dachorganisationen im “Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verband (DHPV)” zusammengefasst und organisiert sind. Die stationären Hospize sind finanziell gesichert und die Gesundheitsminister haben auf den Weg gebracht, auch die ambulante Hospizarbeit finanziell und bundesweit abzusichern, was 2001 durch Gesetz standfest geworden ist (§ 39 a, Abs.2 SGB V). Mit solchen finanziellen und personellen Absicherungen einher geht aber auch die Frage: Was trägt eine solche Tätigkeit für die Menschen und das Gemeinwohl tatsächlich aus?
Stufe 3: In den kommenden, vielleicht wieder zehn Jahren, wird nach dem Gründungsboom und der Schaffung organisatorischer Strukturen eine Konsolidierung, die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung eine wichtige Aufgabe sein. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz hat dazu einen Ausschuss eingesetzt. TQM: „Top Quality Management”, das seinen Ursprung in der Industrie hat und schon länger in den Nonprofit-Organisationen und in die soziale Arbeit Einzug gehalten hat, erreicht nun auch die Hospizbewegung mit den Fragen: Was ist eine qualitativ wirksame Sterbebegleitung? Was erwarten Sterbende und Angehörige von ihr? Wann können sich die haupt- und ehrenamtlich Beteiligten nach ihrem Beitrag und ihrer Arbeit zufrieden zurücklehnen? Die Liste von Qualitätskriterien der Rahmenvereinbarung hat unmittel-bare Auswirkungen auf Strukturen, auf politische Notwendigkeiten und Forderungen, hat aber insbesondere Konsequenzen für die Ausbildung und auch für die Befähigung der Ehrenamtlichen und der helfenden Berufe.
In der wissenschaftlichen Qualifizierung und fachlichpflegerischen Fortbildung sind Lehrstühle für Palliativmedizin und -pflege, Studienprojekte in Palliativ Care und Spezialisierungen für Ärzte und Pflegefachkräfte für die Palliativ-Versorgung entstanden.
In der Organisation sind die Hospizverbände und die Palliativmedizin verbunden und Netzwerke in gemeinnützingen GmbH’s organisiert.
Am Sterbebett und auch schon rechtzeitig früher kümmern sich seit 2007 Palliative-Teams, abgesichert und verordnet als Allgemeine (AAPV) und spezialiserte ambulante Palliativ-Versorgung (SAPV).
Problematisch wird beobachtet, ob die Idee der Hospizbewegung mit ihrer Begleitung statt Versorgung und ihrer überwiegenden Ehrenamtlichkeit nicht durch die Medizin verdrängt wird und ein Alleinstellungsmerkmal für Sterbende erhält (siehe Schluß im Kapitel 8).
Die Hospizidee darf nicht untergehen!
3 Hospizarbeit auf dem Weg zur Professionalisierung
Die Hospizarbeit ist entstanden aus Not, aus der Betroffenheit, dass vielerorts inhuman gestorben wird. Inzwischen ist sie zu einer Bürgerbewegung geworden, in der sich Menschen ehrenamtlich engagieren. In den Hospizgruppen arbeiten die Ehrenamtlichen in einem Sprecherkreis oder Vorstand, im Telefondienst, in der Öffentlichkeitsarbeit, also eher patientenfern. Andere arbeiten direkt in der Begleitung von Sterbenden und Trauernden. Daneben gibt es noch viele Mitglieder, welche die Gruppe finanziell und ideell und nur gelegentlich aktiv unterstützen.
Zum Begriff „Ehrenamt”
Die Bezeichnung „Ehrenamt” ist eigentlich falsch. Es wurde kein Amt verliehen und mit der Ehre ist es auch nicht weit her. Andere Bezeichnungen sind Freiwilligenarbeit, Bürgerengagement, Freiwilligenengagement, Selbsthilfe oder international „Volounteers”. Noch ist Ehrenamt bei uns am gebräuchlichsten und ich benutze den Begriff daher weiter.
Historisch sind viele Berufe zunächst aus ehrenamtlichem Engagement entstanden, so z. B. auch die soziale Arbeit, die Sozialpädagogik, die Fürsorge am Ende des 19. Jahrhunderts. Heute ist der Sozialstaat ohne Ehrenamtliche nicht mehr zu denken. Das Ehrenamt erhält neue Impulse durch den Umbau eines intervenierenden zum aktivierenden Sozialstaat. Die Agenda 2000 und das Internationale Jahr des Ehrenamtes 2001 versuchen, das Bürgerengagement als das fundamentale Engagement zu würdigen, so auch der Weltkongress der Freiwilligen in Amsterdam. Ehrenamtliche sind eine wichtige Quelle für die Wohlfahrtspflege, weil sie den Sozialstaat kompetent erweitern und Partizipation an der Gemeinschaft praktizieren. In den USA und in England ist Volounteersarbeit noch mehr verankert und anerkannt. Sie wird sogar von den Bürgern erwartet und bei Stellenbewerbungen nicht nur berücksichtigt, sondern oft zur Bedingung gemacht.
Das Engagement
21 Millionen Menschen, d. h. fast ein Drittel aller Deutschen über 14 Jahren, sind freiwillig und unbezahlt in Verbänden durchschnittlich 14,5 Std. im Monat engagiert. Davon sind (lediglich) 4 % im Sozialwesen und nur 1 % im Gesundheitswesen tätig. Die anderen engagieren sich in Sportvereinen, in Karnevalsvereinen und anderen Freizeitaktivitäten. In der Hospizarbeit selbst sind über 95 % ehrenamtlich engagiert.
Die allgemeinen Motive für die Bereitschaft zur Mitarbeit sind: soziale Bindung, Anerkennung, Verantwortung, Einflussnahme, Erlebnisse und Erfahrung, Verpflichtungen den Menschen und den Dingen gegenüber, Kontakt und Gemeinschaftsgefühl, Selbstbestätigung, öffentliche Anerkennung, sinnvolle Tätigkeit in einer wichtigen Sache, der Wille, die eigene Fähigkeit und die Kompetenz einzusetzen. Grundsätzlich verschenken Ehrenamtliche Zeit. Sie setzen ein Zeichen gegen Verzweckung und Verschwendung der Zeit, gegen Beliebigkeit und Egoismus, gegen Beliebigkeit und Ausgrenzung, gegen Egoismus und Eigennutz.
In der Hospizarbeit kommt oft eine persönliche Betroffenheit hinzu, entweder durch eine negative Erfahrung eines inhumanen Sterbens oder durch eine vorbildliche Sterbebegleitung (so möchte ich dann auch sterben, und ich setze mich dafür ein, dass dies auch für andere möglich wird). Die soziale und staatliche Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements lässt noch zu wünschen übrig. Neben den Menschen, die dafür stellvertretend ein Verdienstkreuz bekommen, müssen viele für Engagement noch Geld für Fahrtkosten, Qualifizierungsmaßnahmen und Fortbildung mitbringen.
Leitgesichtspunkte zur Gewinnung von Freiwilligen (nach Theresa Bock)
Spielräume geben für selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln und Entscheiden.
Chancen zur Einbringung eigener Neigungen und Fähigkeiten.
Chance, etwas subjektiv Sinnvolles zu tun.
Chance zur Beteiligung an der Festlegung von Tätigkeitszielen.
Chance zur Einbringung eines Interesses am Resultat der Tätigkeit.
Chancen zur selbstorganisierten Teamarbeit.
Chancen zur Ausgebung von Zeitsouveränität
Gewährleistung ausreichenden Wissens und Könnens.
Gewährleistung von Unterstützung und Begleitung
Professionalisierungstendenzen
Rudern zwei ein Boot, der eine kundig der Sterne,
der andere kundig der Stürme,
wird der eine führen durch die Sterne,
wird der andere führen durch die Stürme
und am Ende, ganz am Ende
wird das Meer in der Erinnerung blau sein.
Mit der Anerkennung, mit der zunehmenden Größe der Gruppen und den erweiterten Aufgaben wird die Hospizarbeit mit ehrenamtlichen Kräften allein nicht mehr zu leisten sein. Schon die Kontinuitäts- und Erreichbarkeitsprobleme machten hauptamtliche Kräfte notwendig. Zunächst waren es Honorarkräfte, Teilzeitkräfte, welche in den kleinen Räumen der Hospizgruppen, sofern sie überhaupt vor Ort waren, ihren regelmäßigen Dienst taten. Dann kam auch fachliches Personal hinzu, die als „Koordinatoren” die Arbeit begleiteten und vernetzten und eigens dafür zusätzlich ausgebildet waren, so z. B. in Rheinland-Pfalz die Hospizschwester, die nur nach Erfüllung der eigens dafür erarbeiteten Profil-Kriterien eingestellt werden konnte. Neben den Hospizschwestern sind Sozialarbeiter und Sozialpädagogen und / oder Theologen tätig. In den wenigen großen Hospizgruppen mit ambu-lanten und stationären Angeboten hat meist ein Arzt die fachliche Leitung, so z. B. Prof. Dr. med. Student in Stuttgart. Nach dem einstimmigen Beschluss des Bundesgesundheitsministers 1999 soll nun im Jahr 2001 durch ein Bundesgesetz die ambulante Hospizarbeit durch die Finanzierung hauptamtlichen Personals gefördert werden. Damit ist eine Kontinuität und Fachlichkeit garantiert.
Zwei Probleme ergeben sich: Einmal gibt es kein verbindliches Curriculum für die ständige Ausbildung und Zusatzausbildung und weiterhin keine Stellenbeschreibung, kein Anforderungsprofil.
Einen ersten Beitrag hat die Arbeitsgruppe bei der hessischen Landesregierung geleistet und ein Basis-Curriculum für die Grundausbildung von Ärzten, Pflegern, Sozialarbeitern, Psychologen und Theologen vorgeschlagen.