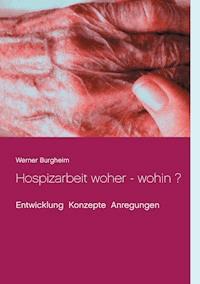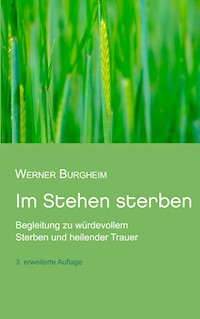
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sterben, Tod und Trauer sind schicksalhafte Ereignisse, die wir nie ganz begreifen und nicht auf einfache Weise erschließen können. Dennoch bestimmen sie unser Leben, unsere Gedanken, Ängste und Hoffnungen. Nachdenken lohnt sich, weil uns dadurch Zugang zu diesem Geheimnis eröffnet wird und wir viel über das Leben lernen können, um endlich zu leben. Wissenschaftliche Zusammenhänge werden verbunden mit Alltagspraxis der Begleitung und Versorgung von Sterbenden und Trauernden und das in einer verständlichen und abwechslungsreichen Sprache. Unmittelbar Betroffene wie auch Ehrenamtliche und Professionelle in Hospiz und Palliative Care werden von den wissenschaftlich angereicherten Erfahrungsschätzen profitieren. - wissenschaftlich fundiert - verständlich - praxisnah
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
“ ... wie ein Baum, den man fällt,
eine Ähre im Feld,
möcht’ ich im Stehen sterben.“
Reinhard Mey (2010)
Inhalt
Vorwort
Vorwort zur 3. erweiterten Auflage
Würdevoll sterben
Sterbe- und Trauerkultur als "soziale Plastik"
Im Stehen sterben
Uns allen blüht der Tod - doch welcher?
Sterben als erlebte Krise
Das Leiden am Leiden
Sterben lernen heißt leben lernen
Das Zeitliche segnen
Krisen- und Sterbephasen
Sterben leben - Eine Lehr-Erzählung
Sich wesenhaft begegnen
Sterbe- und Trauerbegleitung als Schulung von Achtsamkeit und Empathie
Einer trage des anderen Last
Psycho-soziale Unterstützungen für Sterbenskranke und deren Angehörige
Die Form des Lebens schließen Strukturierte Biografiearbeit mit Sterbenden und Trauernden
Von Verletzungen und Schuld, vom Verzeihen, Vergeben und Versöhnen
Die Trotz-Macht des Humors Humor in der Sterbebegleitung?
Womit habe ich das verdient? Vom Umgang mit Aggression, Wut und Zorn
Sich selbst bestimmen
Heilende Trauer
Nimm Abschied und gesunde
Trauer, zeig mir dein Gesicht
Abschied nehmen - ein vielschichtiger Prozess
Wenn uns die Zukunft stirbt
Kindern in der Trauer beistehen
Tod und Trauer in der Schule gestalten
Die Kraft der Rituale
TrauerWege - Eine Lehr-Erzählung
In besonderer Nähe
Trost durch gute Gedanken
Danksagung
Ein weiteres Buch vom gleichen Verfasser
Vorworte
Das Geheimnis des Lebens und
das Geheimnis des Todes
sind verschlossen in zwei Schatullen,
von denen jede den Schlüssel zur anderen enthält.
Mahatma Gandhi
Sterben, Tod und Trauer sind schicksalhafte Ereignisse, die wir nie ganz begreifen und nicht auf einfache Weise erschließen können. Dennoch bestimmen sie unser Leben, unsere Gedanken, Ängste und Hoffnungen. Nachdenken lohnt sich, weil uns dadurch Zugang zu diesem Geheimnis eröffnet wird und wir viel über das Leben lernen können, um „endlich“ zu leben.
Wissenschaftliche Zusammenhänge werden verbunden mit Alltagspraxis der Begleitung von Sterbenden und Trauernden und das in einer verständlichen und abwechslungsreichen Sprache.
Das Buch ist geschrieben und geeignet
für unmittelbar Betroffene,
für ehrenamtliche HospizhelferInnen,
für angehende Professionelle im Studium oder in Zusatzqualifikationen,
für pädagogische und helfende Berufe.
Der Titel des Buches ist angelehnt an ein Lied von Reinhard Mey zur Reflexionsfrage: Wie ich sterben möchte? Er singt: „... wie ein Baum, den man fällt, eine Ähre im Feld, möcht´ ich im Stehen sterben“, also aufrecht, erhobenen Hauptes.
Auch der Hl. Benedikt von Nursia soll, gestützt von seinen Mitbrüdern, am Altar in Stehen gestorben sein.
Würdevolles Sterben ist auch Beginn und Grundlage einer heilenden Trauer. Zu einer Sterbe- und Trauerkultur sind mit den Jahren von mir Texte entstanden, die jetzt zu meinem 75. Geburtstag zusammengefasst herausgegeben werden.
Mögen die Gedankenimpulse in den Betroffenen, in den ehrenamtlichen und professionellen Begleiterinnen und Begleitern bei der gemeinschaftlichen Gestaltung der Sterbe- und Trauerkultur als „soziale Plastik“ fruchtbar werden.
Im Frühjahr 2017
Werner Burgheim
Vorwort zur 3. erweiterten Auflage
Der Zuspruch für das Buch im ersten Jahr hat mich ermutigt, es um weitere sechs Kapitel zu ergänzen. Besonders wichtig war mir noch die Bedeutung von Schuld und Vergebung, insbesondere am Ende des Lebens, mit den notwendigen Erkenntnissen und Hilfestellungen für eine psycho-soziale und spirituelle Sterbebegleitung.
Die Inhalte des Buches sollen sich nun auch in der äußeren Gestalt ihren Ausdruck finden.
Mögen die Leserinnen und Leser
reiche Lesefrüchte ernten.
Mainz, im Herbst 2018
Werner Burgheim
1 Sterbe- und Trauerkultur als
„soziale Plastik“
Die alte Gestalt, die stirbt und erstarrt ist,
in eine lebendige, durchpulste, lebensförderne,
seelenfördernde, geistfördernde Gestalt umzugestalten:
Das ist der erweiterte Kunstbegriff.
Soziale Plastik ist, wie wir die Welt, in der wir leben,
formen und gestalten;
Plastik ist ein evolutionärer Prozess.
Jeder Mensch ist ein Künstler.
Joseph Beuys
Auf meinem Weg durch die Obstplantagen und Schrebergärten im Februar entdecke ich drei verschiedene Gestalten: Einige Bäume stehen auf verwilderten Grundstücken, einsam und verlassen da, im Wildwuchs und vernachlässigt, fast traurig. An anderen Orten stehen die Bäume in Reihen, mit Schere und Gewichten getrimmt, unnatürlich in der Form und verbildet, um dem Spalierobst einen möglichst hohen Ertrag abzuringen. Andere wieder strahlen in ihrer natürlichen Schönheit. Sie sind weder verwildert noch getrimmt. Jeder dieser Bäume hat seine Eigen-Art. Offenbar wurde hier mit menschlicher Hilfe der Wesenszug zur Erscheinung gebracht. So sind diese Bäume nicht reine Natur, weil von Menschen ,,behandelt“, aber auch nicht von Menschenhand ,,gemacht“.
In dieser Jahreszeit drängt sich mir ein zweiter Gedanke auf. Wenn man die vielen kahlen Äste sieht, kann man kaum glauben, sondern nur wissend guter Hoffnung sein, dass im Frühjahr alles wieder grünt und blüht. So gesehen sind Gärten eine Metapher für Verwandlung: Vom Tod zum Lebendigen. Diese Verwandlung unterliegt dem Lebensprozess der Natur. Verwandlung geschieht aber auch durch gärtnerisch- pflegerische Tätigkeit, was im Lateinischen mit dem Wort ,,colere“ bezeichnet wird. Kultur und Kult, Pflege und Verehrung, entstammen derselben Wurzel. Diese pflegende Tätigkeit braucht Sicherheit, Schutz und Geborgenheit. Darum stoßen wir oft bei Gärten auf Zäune, auf Wälle oder auf eine Mauer. Diese Grenzen ergeben den Raum, der herausgearbeitet wurde aus dem Chaos, aus dem Wildwuchs, der Alltäglichkeit und Zufälligkeit. In dem Gestaltungsraum kann sich Pflege und Verehrung, Kultur und Kultus ereignen.
Sterben und Trauer als natürliche Lebensprozesse gilt es ebenso aus dem Chaos, dem Wildwuchs herauszulösen, der Beliebigkeit des Alltags zu entziehen, um sie in Schutz und Schonraum zu gestalten.
Auch gilt es, der Überformung und Verschandlung zu widerstehen, die jeden lebendigen Prozess durch erstarrte Rituale und teuere ,,Bemühungen“ ertöten. Sterben und Trauer sind naturbedingte Prozesse menschlichen Lebens. Zu gestalten sind Orte und Räume, in denen sinnlich wahrnehmbar zum Ausdruck kommt, was erlebt wird, was geistig wieder hergestellt, also heil wenden soll, was verehrt wird. Sterben und Trauer sollen so eine Ordnung, ein individuelles Gesicht bekommen.
Die Idee der ,,sozialen Plastik“ von Joseph Beuys ist die Weiterentwicklung der Künste. Malerei, Plastik und Architektur gestalten die räumlichen Dimensionen, Orte und Denkmäler. Musik ist gestaltete Zeit mit Hilfe von Instrumenten. Sprache, Gesang und Bewegung gestaltet der Mensch leibhaftig.
In der sozialen Kunst werden nun neue Dimensionen eröffnet. Biographie, Begegnung, soziale Beziehung, Eigenschaften und Hilfeprozesse sind zu verlebendigen, mit Wärmequalität zu erfüllen, künstlerisch zu plastizieren und zu gestalten. Kunst und Kultur werden zum Ausdruck, zum Entdeckungs- und ÜbungsfeId. Ausdruck in vielgestalteten Formen trotz Sprachlosigkeit, Ausdruck, um etwas in Bewegung zu setzen, etwas hervorzurufen, auch in Form der Öffentlichmachung eigener Anliegen. Kunst und Kultur bieten Möglichkeiten auszuprobieren, Übersprünge zu wagen, Grenzen und Schwellen zu überwinden, Übergänge und Passagen zu ermöglichen, Verborgenes zu entdecken und Scham zu verbergen. Im Lesenlernen der Lebensskulptur, in der sich die Idee des individuellen Menschseins, auch der Verbeulungen und Verrostungen und des Leidens spiegeln, ist all dies gemeinsam zu entziffern. In diesem Sinne wird auch Teilhabe ermöglicht. So hat dieser künstlerische Prozess und das Ergebnis nicht in erster Linie etwas mit Herstellen gemein, sondern mit Teilhabe und Innewerden. Das Interesse an solcher Kunst und Kultur als Lebens-Kunst kann nicht groß genug sein. Hospizarbeit bemüht sich um eine neue Sterbe- und Trauerkultur. Sie ist damit eine soziale Plastik und wir sind die Künstlerinnen und Künstler.
2 Im Stehen sterben
Glücklich ist,
wer Dankbarkeit entfaltet und das Zerbrechliche
in seinem Leben annimmt und verwandeln lässt.
Lebendig bleibt,
wer lachen und weinen, hoffen und zweifeln, genießen
und sich engagieren kann.
Ausgeglichen lebt,
wer einen gesunden Lebensrhythmus mit seinen hellen
und dunklen Seiten
immer wieder neu einübt.
Glücklich wird,
wer jeden Tag auch unglücklich sein darf.
Pierré Stutz
In schweren Zeiten sind leidende Menschen geneigter, über tiefgehende Fragen und Themen des Lebens nachzudenken und zu sprechen. Solche existentiellen Schlüsselbegriffe sind beispielsweise: Liegen, aufstehen, fallen; Schuld, Verletzungen, Verzeihung. Für den Dialog seien hier einige Gesprächsimpulse formuliert:
„Mit welchem Fuß bist Du denn heute aufgestanden?“, so werde ich gefragt, wenn ich schlechte Laune habe. „Ich lege mich mal kurz hin“, so sage ich, wenn ich mich erholen, entspannen möchte und der Rentner legt sich zum Mittagsschlaf. Hinlegen und Aufstehen gehören zum Leben wie Einatmen und Ausatmen, ein notwendiger, heilender Rhythmus.
Aufstehen bedeutet für uns Menschen, im aufrechten Gang einen anderen Blickwinkel, auch eine andere Position zu anderen Lebewesen einzunehmen, Überblick zu bekommen.
Auch das Fallen gehört zum Menschen. Wie oft sind wir als Kinder hingefallen: Hunderte Male sind wir, als wir laufen lernten, gefallen und wieder aufgestanden. Oft sind wir beim Radfahren oder beim Skifahren lernen auf dem Boden gelandet. Die Blessuren haben wir kaum gespürt, weil wir Lust an diesem Lernen und Aufstehen hatten, denn dann geht es wieder weiter. Im Judo wird richtiges Fallen systematisch geübt. Wenn das Aufstehen im Alter nicht mehr so recht gelingen will, gibt es Sessel mit Aufstehhilfen.
Neben diesem körperlichen Fallen gibt es noch andere Arten des Fallens, die oft noch unerfreulicher sind - der seelische Fall: „Ich bin am Boden zerstört, hilflos und kraftlos. So schnell komme ich da nicht mehr hoch.“ Ins Bodenlose fallen, ohne Halt in ein Loch, - wenn man wenigstens noch Boden unter den Füßen hätte, etwas Bodenhaftung, um sich wenigstens abstützen, mit dem Widerstand des Bodens den Absprung, den Aufsprung wagen zu können. Bedrohlich wird die Situation, weil auch von außen der Druck groß ist. Liegenbleiben ist gefährlich, gleich ist man weg vom Fenster, ausgemustert, ausgezählt, oft sogar entsorgt.
Und in uns selbst: Sind schon genügend Kräfte gesammelt, um den Aufsprung zu wagen und auch zu bestehen? Wenn man zu früh aufsteht, fällt man bald wieder, wer vorschnell den Starken spielt, wird umso tiefer fallen. Ist schon genug Wille vorhanden, um zumindest nach ein, zwei Versuchen wieder standfest zu sein? Ein solch seelisches Loch wird subjektiv sehr verschieden empfunden. Manch einer ist schon an einem zur unrechten Zeit gerissenen Schuhbändel verzweifelt. Auf jeden Fall scheint es natürlich zu sein, zunächst mit dem Schicksal zu hadern, unzufrieden zu sein mit sich selbst, mit Gott, den Mitmenschen und der Welt, mit allen Kräften gegen das Schicksal zu kämpfen. Scheint der Kampf verloren und die Kraft am Ende, ist man eher bereit, das Schicksal anzunehmen, den Kampf gegen das Schicksal aufzugeben und die Kräfte zur Bewältigung des zukünftigen, dann anderen Lebens einzusetzen. Die Deutungen und Empfindungen solcher Situationen sind sehr unterschiedlich. „Ich war traurig, als ich keine Schuhe hatte, bis ich den traf, der keine Füße hatte.“ Solche Vergleiche mit Leidensgenossen, solche Katastrophenlisten mobilisieren Kräfte, um doch wieder aufzustehen und weiterzugehen.
Bei allem Willen, es alleine zu schaffen, sollten angebotene Hilfen nicht übersehen und ausgeschlagen werden. Christus wollte seinen Kreuzweg allein bis zum bitteren Ende gehen. Er ergab sich in das Schicksal und in den Willen seines Vaters. Und doch hat er Hilfe angenommen, von Simon von Zyrene, der als Fremder ihm das Kreuz tragen half, zunächst von den Soldaten gezwungen, dann aber doch als Christusbegegnung und Kreuz- nachfolge im wahren Sinne des Wortes. Nach der Legende verewigt Christus sein Gesicht im Schweißtuches, den Frauen zum Dank.
Auch geistig kann man fallen: In Ungnade. Wir sind nicht unfehlbar, sondern unvollkommene Menschen und geraten in Schuld. Schuldig werden gehört zu unserem Menschsein (vgl. Kap.15).
Wie können wir uns von Schuld wieder befreien? Schulden auf der Bank sind heute üblich und werden, mit Schuldzinsen versehen, eines Tages getilgt. Wir sind dann wieder entschuldet. Im mitmenschlichen Bereich sollte dies doch auch möglich sein. Wir gestehen ein, dass wir jemanden etwas schulden, uns schuldig gemacht haben, dass wir jemand oder mehrere verletzt haben. Wir entschuldigen uns. Die Geste auf der anderen Seite müsste folglich sein, diese Entschuldigung anzunehmen, sofern sie ernsthaft und glaubwürdig ist. Doch reicht das?
Manchmal ist eine verbale Entschuldigung nicht ausreichend, zu schnell formuliert und nicht angemessen. Manchmal gilt es, die fällige Strafe anzunehmen.
Und auch damit noch nicht genug: Ebenso wichtig ist die "tätige Reue" als aktive Handlung. Wenn dies an gleicher Stelle nicht möglich ist oder von dort abgelehnt wird, kann dies auch an anderer Stelle an anderen Menschen erfolgen.
Zwei Beispiele: Die Absicht des Kindermörders Magnus Gäfgen, eine Stiftung zu gründen, wird heftig kritisiert. Wichtigtuerei wird unterstellt. Vielleicht ist es aber auch der ehrliche Wille, aus Einsicht wieder etwas gut machen zu wollen? Er betreute jahrelang katholische Jugendgruppen in Frankfurt, war Delegierter der katholischen Jugend und fünf Jahre im Pfarrgemeinderat. Will der zur lebenslangen Haft Verurteilte an diese guten Jahre vielleicht wieder anknüpfen? Sein im Gefängnis geschriebenes Buch lautet: „Allein mit Gott – der Weg zurück“. Können wir es zulassen, einem Kindermörder, den ich zur Tatzeit mit eigenen Händen erwürgt hätte, den Willen zur tätigen Reue abzunehmen und zu erlauben?
Ist es überhaupt möglich, zu verstehen und zu verzeihen, wenn ein junger Pilot, der sich selbst umbringen will, noch weitere 149 Menschen mit in den Tod reißt und sich auch noch der Verantwortung und Strafe entzieht? Wer wird darüber richten? Welches Bild vom Jenseits, von der dortigen Strafe und Wiedergutmachung haben wir? Wie sieht unser Gottesbild aus, von dem strafenden, von dem gnädigen Gott, von Hölle, Karma? Dies gilt für die schweren Sünden, aber auch für die kleine Schuld, die wir nicht mehr ausgleichen können.
Es ist für uns und unser Leben hilfreich, in Form einer angeleiteten Biografiearbeit (siehe Kap.14) die Höhen und Tiefen unseres Lebens zu reflektieren, sich an die Highlights zu erinnern und zu erfreuen, aber auch an Schuld, die entstanden ist. Sie zu entdecken, zuzulassen und Wiedergutmachung, Verzeihung und Versöhnung einzuleiten, sind Möglichkeiten einer solchen Arbeit. Was uns in dieser Arbeit als Entschuldigung nicht gelingen kann, kann dann Gnade, ein verzeihender Gott gewähren und bewirken.
Alle diese körperlichen, seelischen und geistigen Kreuzwege finden sich wieder im Sterben. Es ist die existentiellste Situation unseres Lebens. Die Existenz des Körpers wird radikal bedroht, eine seelische Krise entsteht durch den Übergang von der derzeitigen Welt zur geistigen Welt. Viele spirituellen Fragen, auch nach dem Jenseits, stellen sich ein.
Das Negative, das wir infolge des Todes erleben, die Abschiede von den Freuden des Lebens, von Gewohnheiten, der Raub geliebter Menschen, die Vernichtung des eigenen Körpers, also die Umkehrung des Lebens, dieses Negative und Schwarze ist zugleich der Kontrast, der, wie im Foto, nach dem Positivem verlangt. Das Schwarz schafft doch erst die Möglichkeit, das Bild zu sehen. Nacht, Leere, Schatten, Wüste, Unbekanntes, Grenzen rufen nach den Antipoden, nach dem Tag, der Erfüllung, der Sonne, nach dem Erblühen und Übertritt. Wege durch die Wüste zeigen uns, was wesentlich ist. Wenn die Tiefe erreicht worden ist, die neues Leben möglich macht, dann blüht die Wüste auf. Wer mit der Weisheit der Wüste lebt, erkennt: Wüstenwege sind schwer, aber fruchtbar - Qual der Wonne. Und so dienen Angst und Dunkel des Todes dem Nachdenken, nicht so sehr über den Tod, sondern mehr über das Leben. An der Wand des Todes prallt das Dunkle ab und kehrt sich um ins Licht des Lebens. Statt vor Angst todblind zu werden, können wir versuchen, das Leben in seiner Tiefe neu zu sehen und zu begreifen. Es ist daher für unser Leben hilfreich und fruchtbar, sich rechtzeitig mit dem Sterben auseinanderzusetzen, um - endlich - Leben zu lernen.
Haben Sie sich schon einmal konkret Gedanken gemacht, wie Sie sterben möchten?
In meinen Hospizseminaren konfrontiere ich die Teilnehmer-innen zu dieser Gedankenarbeit mit einem Fragebogen (die Fragen siehe unten). Möchten Sie beispielsweise im Stehen sterben, so wie es Reinhard Mey in seinem Lied besingt: "Hätt' ich noch einen Wunsch zum Schluss. Ich möcht’ im Stehen sterben. Wie ein Baum, den man fällt, eine Ähre im Feld, möcht’ ich im Stehen sterben" ... (gemeint ist wohl: aufrecht, mit erhobenem Haupt, in Würde).
Gelingt es, auch das Sterben als Menschenschicksal anzunehmen, um versöhnt mit sich, mit Gott und der Welt im "Stehen", also erhobenen Hauptes das Diesseits zu verlassen, um in die Hände eines gnädigen Gottes zu fallen,– das wäre für mich Auferstehung!
Wie ich sterben möchte ...
Fünf Fragen zur Selbstreflexion. Die zunächst utopisch klingenden Fragen bewirken einen fruchtbaren Erkenntisgewinn.
Wenn Du Dir den Zeitpunkt Deines Todes aussuchen könntest ... Wann wolltest Du sterben? Wann nicht?
Wenn Du Dir aussuchen könntest, wie Du stirbst ...
Wie sollte es idealerweise sein? Wie sollte es nicht sein?
Wenn Du an die Personen denkst, die Dir am nächsten stehen ...
Wie wäre es für diese Person(en), wenn Du zuerst gingst?
Wie wäre es für Dich, wenn die andere(n) zuerst gingen?
Was fürchtest Du beim Sterben am meisten?
Was mir sonst noch bei Sterben und danach - ganz konkret - wichtig wäre?
Literatur
Burgheim, Werner: Am Boden - des Brunnens. Lebenskrisen, Schicksalsschläge meistern und das Sterben, Aachen 2005 2
Mey, Reinhard, Wie ein Baum, den man fällt (2010)
Hl. Benedikt, stehend im Sterben -
3 Uns allen blüht der Tod - doch welcher?
„Erst wenn wir im Dunkeln sitzen,
geht uns ein Licht auf,
erst wenn die Vernunft verstummt,
horchen wir auf,
erst wenn wir die Dummen sind,
werden wir klug.”
Dieter Höss
Machen wir uns nichts vor: Sterben ist eine schwierige Aufgabe, für den Sterbenden selbst wie für seine soziale Umwelt. Sterben ist eine existentielle Bedrohung, die uns radikal, d. h. von der Wurzel her aus unserem derzeitigen Zustand herausführt in einen nur vom Glauben her zu erfassenden anderen Zustand. Zwar versuchen die Menschen mit Bewusstheit und Reflexionsfähigkeit dieses Drama zu begreifen und das Geheimnis zu deuten. In Mythen, Archetypen und Symbolen sind solche Deutungsversuche überliefert. Vielleicht sind diese eher zu deuten wie die Künstler, wie die Maler, Bildhauer, Musiker, weil wir dann, wie sie, die verschlüsselte Symbolik eher intuitiv erfassen. Lässt sich das Mysterium vielleicht eher mit dem Herzen als mit dem Verstand verstehen?
Das Schicksal des Todes haben wir Menschen mit allem in der Natur gemein. Der Mensch ist ein Stück der Natur, mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter, mit der Wärme des Sommers und der Kälte des Winters, gemeinsam mit dem Rhythmus der Meere von Ebbe und Flut. Ein ganzes Leben eine Wiederholung von Leben und Sterben, ein Sterben, das mit der Geburt beginnt. Sterben trifft uns alle ausnahmslos, macht uns alle gleich. Tatsächliche oder eingebildete Macht, die Scheinsicherheit des Ruhmes und des Besitzes, all das wird im Tode relativ. Reichtum erschwert allenfalls das Sterben, weil er das Loslassen zuätzlich erschwert. Oft wird dann bis zuletzt gegen Sterben gekämpft, das Thema gemieden, tabuisiert und verdrängt. Doch all diese Abwehr nützt gar nichts.
Wenn dem so ist, dann ist es doch besser, sich auf das Thema einzulassen, sich schon im Leben dem Sterben vorsichtig zu nähern. Zunächst werden sich berechtigte oder eingebildete Ängste aufdrängen. Deren gibt es viele: die Trennungsangst, die Angst vor dem Verlust des geliebten Menschen, Angst vor dem Verlust an Selbstachtung, Angst vor Abhängigkeit und Entmündigung, vor dem Alleinsein, vor Schmerzen, Siechtum, der Angst, vergessen zu werden. Viele dieser Ängste sind, wie wir noch sehen werden, durchaus berechtigt. Viele sind beeinflussbar und auch mit Hilfe anderer zu bewältigen. Ängste mobilisieren Kräfte. Wenn unsere Abwehrmechanismen, die gegen Ängste, die gegen das Sterben und gegen den Tod errichtet worden sind, fragwürdig werden, zusammenbrechen oder aufgegeben werden, wenn wir die Fragen des Lebens auf neue Weise stellen, werden wir neue Einstellungen, Lebensweisheiten und Wertvorstellungen entwickeln.
Sterbe- und Trauerprozesse sind also gestaltbar und eine Herausforderung an die soziale Gemeinschaft und Nächstenliebe. Den Wüstengang können wir nur alleine gehen, wie wir nur selbst essen und schlafen können. Doch gerade in lebensbedrohlichen Situationen, auf dem letzten Weg, wird die Sehnsucht nach Geborgenheit und nach dem Zuhause groß. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 80 % aller Menschen zu Hause sterben wollen. Sie können diesen letzten Weg nur alleine gehen, aber gut begleitet geht es meist besser. Dies wird treffend in einem Spruch der amerikanischen Selbsthilfebewegung der 30er-Jahre so formuliert:
„You alone can do it, but you can’t do it alone.”
Wenn Sehen, Hören und Gehen versagen, werden andere für uns sehen, hören und gehen. Frühkindliche Ersterfahrung des Körperkontaktes und des Tastsinnes werden wieder bedeutsam. Die haltende Hand wird zum Trost. Die alten Ägypter glaubten, dass in den Händen, die den Sterbenden begleiten, bereits die Hände der Himmelsgöttin Nut zu spüren sind. Die Begleitung und Zuwendung und Liebe geschieht, ohne dass eine besondere Leistung erbracht wurde. In einer Welt, in der fast alles auf Leistung und Gegenleistung beruht, ist dies ungewöhnlich. Nur weil der andere als Mensch da ist, weil es ihn gibt mit all seiner Liebenswürdigkeit und all seinen Schwächen, wird er begleitet und geliebt, auch und gerade, wenn es mühsam und beschwerlich wird.
Freilich steht auch die Zuwendung in der Gefahr, übertrieben zu werden und in einem tödlichen Fürsorgeterror in einem Totlieben zu enden.
Die Fragen des Lebens neu zu stellen bedeutet auch, nachzudenken über den Körper als endliche Hülle, über die Bedeutung von Seele und Geist, über die Vergeistigung, über bleibende Liebe und über Gott. Solche Reflexionen geben ein neues Bewusstsein, Reifung und Tiefgang.
Dies fällt nicht leicht in einem gesellschaftlichen Klima, in dem vor allem Schaffenskraft und Erfolg zählen, in dem Unsterblichkeit und Machbarkeit, die Überlistung des Todes angestrebt und Leiden und Sterben bekämpft werden. Ob jemand am Ende eines langen Lebens schon lebenserfüllt oder ob er lebensmüde stirbt, immer ist es das Persönlichste und zugleich Fremdeste im Leben. Die Kunst des Sterbens, die „ars moriendi”, ist uns als immerwährend und gemeinschaftlich zu gestaltende Aufgabe aufgegeben.
4 Sterben als erlebte Krise
Zur Bivalenz von Krisen
Krisen und Sterben sind Stich-Worte, Situationen, denen wir am liebsten aus dem Wege gehen, Worte, die negativ besetzt sind. Krisen haben mit dem Sterben vieles gemeinsam. Beide bezeichnen einen Übergang: Altes geht zu Ende, die Sicherheit ist weggebrochen, aber das Neue ist noch nicht erreicht und erarbeitet. In dieser unangenehmen Übergangssituation, in der das Alte nicht mehr sicher und das Neue noch nicht gesichert ist, befindet sich der Mensch in der Krise. Inwieweit die verschiedenen Krisenarten auch in der Sterbesituation wirksam und bedeutsam sind, soll nun dargestellt und auf das Sterben übertragen werden.
Im Griechischen bedeutet „krinein” Scheidung, Streit oder Entscheidung nach einem Konflikt oder Urteil.
Im Lateinischen bezieht sich „crisis” auf eine Phase der Krankheit, welche einen Wendepunkt darstellt, eine kritische Phase von Tagen oder Stunden, in denen sich entscheidet, ob sich der krankhafte Zustand zum Guten oder zum Schlechten wendet.
Ein solcher Wendepunkt bezeichnet übrigens auch das Wort „Katastrophe”. Es ist der Wendepunkt, an dem der Bauer beim Pflügen das Ende der Furche erreicht und nun die nächste Furche (Strophe) nach einer Kehrtwende pflügt.
Im Chinesischen besteht das Wort Krise aus zwei Schriftzeichen, das eine Zeichen (wei) hat die Bedeutung von „Gefahr”, das zweite Zeichen (ji) bedeutet andererseits „Gelegenheit / Chance”. (Burgheim, 1994, 93, 2002)
Mehr wissenschaftlich und aus der psychologischen Perspektive ausgedrückt definiert Ulich Krise wie folgt: „Krise ist also ein belastender, temporärer, in seinem Verlaufe und seinen Folgen offener Veränderungsprozess einer Person, der gekennzeichnet ist durch eine Unterbrechung der Kontinuität des Erlebens und Handelns, durch eine partielle Deintegration der Handlungsorganisation und eine Destabilisierung im emotionalen Bereich” (Ulich, 1987, 51 ff).
In diese Definition gehen mehr die Unsicherheitsmerkmale der Übergangs-situation ein. Wichtig ist mir aber nach jahrzehntelanger Krisenforschung und -begleitung, die Bivalenz der Krise zu erkennen, wie es etwa in dem Wortspiel von C.G. Lichtenberg zum Ausdruck kommt:
„Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird.
Aber ich weiß, dass es anders werden muss,
wenn es besser werden soll.”
Ich habe beides erlebt: Menschen, die in der Krise hängen blieben, krank wurden und verzweifelten, aber auch viele, die gerade durch die Krise gewachsen und gereift sind und danach ein völlig anderes, neues und besseres Leben führten. Manche bezeichnen daher Krise auch als Werkzeug der Engel oder als das Winzermesser Gottes, damit der Weinstock nicht dem Wildwuchs verfalle, sondern viel Frucht bringe. Dies wird auch in einem Bericht eines Journalisten über die radikale Änderung seines Lebens deutlich:
„Ich saß im Flugzeug, kam von einem Termin und war im Gedanken schon beim nächsten. Aber diesmal erreichte ich das Ziel der Reise nicht. Ein unbeschreiblicher Schmerz würgte mich plötzlich. Ich war so hilflos wie noch nie in meinem Leben. In der Intensivstation wachte ich auf, aber es dauerte nicht lange, bis ich zu mir fand. Schwestern und Ärzte umsorgten mich vorbildlich, doch konnten sie mir das Gefühl der Verlassenheit und des Alleinseins nicht nehmen. Monate einer quälenden langsamen Rekonvaleszenz folgten. Danach aber war mein Leben verändert. Ich habe vieles preisgeben müssen. Ich war aus meiner beruflichen Bahn geworfen. Wenn ich es unter dem Gesichtspunkt bürgerlichen Fortkommens betrachte, dann finde ich auf der Habenseite nur Verluste. Aber was bedeutet das schon? Ist Erfolg haben im Leben alles? ... Ich habe durch eigenes Betroffensein ein anderes Verhältnis zum Leid gewonnen. Mir hat der Schlag, der meiner Gesundheit versetzt wurde, eine neue Richtung gegeben, neue Räume eröffnet, neue Horizonte aufgetan, mich mit Menschen zusammengeführt, denen ich sonst nie begegnet wäre. Ich habe die Grenzen sehen und respektieren gelernt, die dem eigenen Können und Vermögen gesetzt sind. Das fiel mir bitterschwer. Ganz andere Verabredungen stehen in meinem Kalender, an die ich früher nicht im Traum gedacht habe. Hinter Sachen und Vorgängen interessiert mich vor allem der Mensch ...” (Roser 1979).
Damit wird eindrucksvoll deutlich, wie das negativ belegte Wort „Krise” beide Aspekte beinhaltet: Bedrohung und Gefahr, Zusammensturz mit dem Risiko des Scheiterns, aber auch, oft vergessen, Möglichkeiten und Chancen des Neubeginns, der Reifung, des Wachstums, der Neuorientierung und Neuorganisation des (restlichen) Lebens. Da der Ausgang offen ist, liegt viel daran, Chancen und Entwicklungen zu ermöglichen, den leidvollen Untergang und die Verzweiflung zu vermeiden und ein sinnvolles Weiterleben zu ermöglichen.
Krisenvielfalt
Neben dieser mehr allgemeinen Charakterisierung der Krise soll nun eine Differenzierung angebracht werden. Eine Krisenbewältigung ist oft Arbeit genug. Bei manchem Menschen treten in Lebensituationen gleich mehrere dieser Krisen gleichzeitig auf. Eine fast nicht zu leistende Aufgabe.
1 Biografische Krisen
Biografische Krisen sind jene Zuspitzungen, Wachstums- und Reifeprozesse, die sich auf Grund von endogenen Einflüssen natürlich einstellen. Solche Wachstumsknoten oder Meilensteine im Leben sind oft begleitet von körperlichen oder sozialen Einschnitten: Der Zahnwechsel um das siebte Lebensjahr ist begleitet von der Einschulung, die Geschlechtsreife in der Pubertät von krisenhaften seelischen und sozialen Konflikten. Mit der Beendigung der Schulzeit und Lehrzeit, dem Abnabeln von zu Hause, kommt mit 20 Jahren die Frage auf: Was soll aus mir werden? Mit wem will ich arbeiten und zusammenleben? Um die 40 beginnt eine Rückschau auf das Drehbuch des bisherigen Lebens: Bilanz: War das alles? War das alles richtig und sinnvoll? Soll es die andere Hälfte des Lebens so weitergehen? Mit 60 die Vorschau auf das letzte Drittel des Lebens, auf das Schwinden der Kräfte, auf zunehmende Ersatzteile im Körper, das berufliche Ende, vielleicht frühzeitig ausgemustert, abgelegt und verrentet. Torschlusspanik oder Aufbruch in einen neuen letzten Lebensabschnitt? Bilanz- und Sinnkrise: Das Bewusstsein der Endlichkeit des Lebens und der Rückblick auf das Lebenswerk, die Freude über die Früchte eines reichen und erfüllten Lebens, oder aber auch der Ekel vor dem Leben und das Gefühl des Scheiterns sind individuelle Sichtweisen, die zunächst wahrgenommen, geprüft und ergänzt werden sollten. Dieser Rückblick wird von Menschen mit Nah-Toderfahrungen im sog. Lebenspanorama beim Tod beschrieben, in dem ein Mensch sein ganzes Leben in kürzester Zeit, wie in einem Film, nochmals rückwärts wahrnimmt.
Dies war nur ein kurzer Einblick in biografische Krisensituationen, die noch differenzierter beschrieben werden können (Burgheim 1994/2002). Erik Erikson hat ein Modell des Lebenslaufes entwickelt, das er in normative Entwicklungskrisen gliedert. Diese Krisen versteht Erik Erikson (1902 - 1994) als Wendepunkte in einem geordneten Ablauf von Entwicklungsstufen, wobei die acht Stufen aufeinander aufbauen und die angemessene Bewältigung der jeweils angesetzten Entwicklungsaufgaben zwischen gegensätzlichen Polen Voraussetzung für die Entwicklung ist. So beschreibt er z. B. am Ende des Lebens in Stufe 5: „Integrität gegen Verzweiflung / Weisheit und Sein, was aus uns geworden ist, wissen, dass man einmal nicht mehr sein wird.” (Erikson, 1989, 214)
2 Sinnkrisen
Sinnkrisen beinhalten die Fragen nach dem Sinn des Lebens. Dies kann die vorausschauende Frage sein: Was will ich Sinnvolles lernen, studieren, arbeiten? Mit wem soll ich zusammenleben? Das andere beinhaltet aber auch Zeiten der Rückschau. Schon bei den biografischen Krisen haben wir gesehen, dass es natürliche Stationen gibt, die eine Fragestellung, eine Rückschau provozieren, in der gefragt wird, ob denn das bisherige Leben und die getroffenen Entscheidungen richtig waren. Dies ist vor allem eine Hauptfrage in der so genannten Midlifecrisis um das 40. Lebensjahr. Aber auch der Rückblick auf die Berufsjahre und die Ernte am Schluss des Lebens werfen Sinnfragen auf und auch die Frage, ob noch etwas zu ändern ist. Noch eine berufliche Veränderung, eine andere Frau, eine andere Wohnung, wo und wie den Lebensabend verbringen?
Sinnfragen in der heutigen Zeit sind besonders häufig und werden leidvoll erfahren, da es in der Regel keine Normalbiografien mehr gibt. War früher eine Ausbildung ein ganzes Leben gültig und eine Familie seit Generationen in einer Firma beschäftigt, so spricht man heute von einer Patchwork-Biografie, einem Lebenslauf zusammengesetzt aus vielen Teilstücken: Ausbildung, Berufe, Beschäftigungen, Lebensabschnittspartnerschaften. Wie da noch den roten Faden des Lebens finden, ein sinnvolles Ganzes, eine anschauliche Lebenskultur erreichen? Wie dem Leben doch noch einen anderen, einen besseren Sinn geben? Früher gab es zur Orientierung die Zehn Gebote. Heute gibt es zehntausend Gebote von unterschiedlicher Strenge, ein Dschungel, der eine Suche nach dem richtigen Weg zu einer schwierigen Aufgabe macht.
3 Glaubenskrisen
Glaubenskrisen erwachsen oft aus Sinnkrisen. Wenn die Enttäuschung über Gott, der solches Leid (an mir) zulässt, zu groß wird, wenn das bisherige Weltbild erschüttert wird, nicht mehr zu mir passt oder mir nicht mehr glaubwürdig erscheint, ein neues Weltbild noch nicht gefunden oder erarbeitet worden ist, befinden wir uns in einer Glaubenskrise.
4 Identitätskrisen