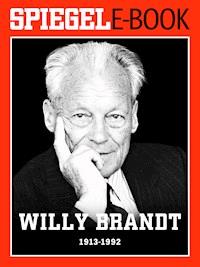9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fleischhauer in Hochform: Das Beste aus dem »Schwarzen Kanal« und darüber hinaus
Jan Fleischhauer ist der Meister der politischen Kolumne: Er ist nicht nur bissig, provokant und sehr unterhaltsam. Seine Fans lieben ihn vor allem deshalb, weil er sich die Freiheit nimmt, eine eigene Meinung zu vertreten – selbst wenn die meisten in seinem Gewerbe etwas ganz anderes richtig finden. Ob über die Ökoträume der Grünen, den Rudeltrieb in den Medien oder die neue Kultur der Empfindlichkeit: Fleischhauer traut sich, dagegen zu halten, auch wenn er dafür anschließend Prügel bezieht. In seinem Buch nimmt er die beliebtesten – und umstrittensten – Kolumnen als Ausgangspunkt für Nachfragen. In Gesprächen mit Andersdenkenden und Lieblingsgegnern wie Jakob Augstein, Margot Käßmann oder Armin Nassehi wird klar, dass die Auseinandersetzung erst anfängt, wo die Kolumne aufhört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Jan Fleischhauer
How dare you!
Vom Vorteil, eine eigene Meinung zu haben, wenn alle dasselbe denken
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Aktualisierte AusgabeCopyright © 2020 by Siedler Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Favoritbüro, München
Covermotive: © Robert Brembeck
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-27198-5V004
www.siedler-verlag.de
Zum Buch
Jan Fleischhauer ist der Meister der politischen Kolumne: Er ist nicht nur bissig, provokant und sehr unterhaltsam. Seine Fans lieben ihn vor allem deshalb, weil er sich die Freiheit nimmt, eine eigene Meinung zu vertreten – selbst wenn die meisten in seinem Gewerbe etwas ganz anderes richtig finden. Ob über die Ökoträume der Grünen, den Rudeltrieb in den Medien oder die neue Kultur der Empfindlichkeit: Fleischhauer traut sich, dagegen zu halten, auch wenn er dafür anschließend Prügel bezieht. In seinem Buch nimmt er die beliebtesten – und umstrittensten – Kolumnen als Ausgangspunkt für Nachfragen. In Gesprächen mit Andersdenkenden und Lieblingsgegnern wie Jakob Augstein, Margot Käßmann oder Armin Nassehi wird klar, dass die Auseinandersetzung erst anfängt, wo die Kolumne aufhört.
Zum Autor
Jan Fleischhauer, geboren 1962 in Hamburg, studierte Literaturwissenschaft und Philosophie. Nach 30 Jahren beim »Spiegel«, wo er unter anderem als Berliner Büroleiter und Wirtschaftskorrespondent in New York tätig war, wechselte er im Sommer 2019 zum »Focus«. Seine Kolumnen gehören zu den meistgelesenen Meinungstexten in Deutschland. 2009 erschien der Bestseller »Unter Linken. Von einem, der aus Versehen konservativ wurde«, 2017 sein Trennungsbuch »Alles ist besser als noch ein Tag mit dir«, das ebenfalls auf die Bestsellerliste gelangte. Fleischhauer lebt in München.
Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de
Inhalt
Über Glanz und Elend des Kolumnisten: Ein Vorwort
Über die sexuelle Veranlagung von Politikern
Über radikalen Tierschutz
Über Bettina Wulff und das therapeutische Sprechen
Über den hässlichen Deutschen
Über verbotene Worte
Über Polemik und Eigensinn: Ein Gespräch mit dem Journalisten Deniz Yücel
Über Richard David Precht und die Kunst des Prechtlns
Über politisch vorbildlichen Humor
Über Poverty Porn oder wie man es schafft, dass sich Anteilnahme bezahlt macht
Über die Frage, wie man Migranten korrekt anspricht
Über Menschen, die Impfen für Sünde halten
Über frauenfeindliche Werbung und den Versuch, sie zu beenden
Über die Verbindung von politischer Einstellung, Sex und Glück
Über historische Forschungsergebnisse zum Veganismus
Über den Vorzug von Bildungsbarrieren
Über den Kampf gegen den Hass
Über rechtes und linkes Denken: Ein Gespräch mit dem Soziologen Armin Nassehi
Über Pazifismus im Kinderzimmer
Über die Literaturwissenschaft als Mittel, Alexander Gauland zu verstehen
Über die Passform von Hemden und was sie uns über heterosexuelle Männer sagt
Über Frank-Walter Steinmeier und das schwierige Genre der Politikerbiografie
Über Ostdeutsche als Feindbild
Über die Frage, was Günter Gaus mit Götz Kubitschek gemacht hätte
Über Journalismus und Heldentum
Über Robert Habeck und den Gebrauch des Kopfes zu Gefühlszwecken
Über die Suche nach Perfektion
Über den Zusammenhang zwischen Rechthaberei und akademischer Bildung
Über den Besuch einer Geburtstagsparty
Über die Linke und den Kitsch: Ein Gespräch mit dem Verleger Klaus Bittermann
Über die Frage, wie man Menschen verrückt macht
Über das Bedürfnis nach sauberen Straßen
Über Hamburg als Weltstadt
Über eine Teufelsaustreibung in München
Über die Verführungskraft des Radikalen und ein Anti-Fanatismus-Programm
Über die Gleichheit der Geschlechter
Über die Verwandtschaft zwischen AfD-Politikern und Südländern
Über drei Formen des Opportunismus
Über Jan Böhmermann und das Fernsehen als moralische Anstalt
Über einen Auftritt bei einem Burschenschaftstag
Über Marius Müller-Westernhagen und die demonstrative Rückgabe von Preisen
Über Betroffenheit und schlechtes Englisch
Über die Grenze zwischen Moral und Doppelmoral
Über Berlin als das Venezuela Deutschlands
Über Cancel Culture in Hessen
Über das Sentimentale und die Diskriminierung dunkelhäutiger Tierarten
Über die Sprache des Himmels und die Frage, was Jesus gesagt hätte: Ein Gespräch mit der Theologin Margot Käßmann
Über die Angst vor der AfD
Über schlechten Umgang
Über den Unterschied zwischen Uwe Tellkamp und Heinrich Böll
Über die wahre Anzahl menschlicher Geschlechter
Über puritanisches Denken und den einwandfreien Bücherschrank
Über einen seltenen Fall von Tourette und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen
Über Schwierigkeiten im Kontakt zu einfachen Menschen
Über Solidarität mit Meghan und Harry und warum Geld allein auch nicht glücklich macht
Über Protestkultur und den Nutzen einer späten Marx-Lektüre: Ein Gespräch mit dem Achtundsechziger Mathias Greffrath
Über den Hang zur Empfindlichkeit sowie den Vorteil des regelmäßigen Verzehrs von Nüssen
Über die Suche nach einer Erklärung, warum die meisten Journalisten links sind
Über Nazis und woran man sie erkennt
Über die Krise als Weg der Läuterung
Über alternative Wahrheiten
Über die akzeptable Auswahl von Talkshowgästen
Über die Gültigkeit der Weisheit, dass man der Spur des Geldes folgen sollte
Über die unerwartete Rückkehr der Ahnenforschung
Über die Beziehung zwischen politischem Bewusstsein und ökonomischem Erfolg
Über das Ende der Schauspielkunst
Über die Grenzen der Freundschaft: Ein Gespräch mit dem Verleger Jakob Augstein
Über fünf Kategorien von Kolumnisten: Ein Nachwort von Stefan Kuzmany
Dank
Quellennachweis
Personenregister
»Denn es hat sich herumgesprochen, dass das Unglück nicht entsteht wie Regen, sondern von etlichen gemacht wird, welche ihren Vorteil davon haben.«
Bertolt Brecht, Die heilige Johanna der Schlachthöfe
Über Glanz und Elend des Kolumnisten:
Ein Vorwort
Die meisten Journalisten wollen, dass man sie mag. Sie wünschen sich, dass ihre Kollegen nicht schlecht über sie denken. Wenn ausnahmsweise doch jemand einmal schlecht über sie denkt, soll er wenigstens nicht schlecht über sie reden. Werden sie gefragt, wo sie politisch stehen, wählen sie einen Platz links der Mitte. Das ist der Ort, an dem auch die Mehrheit von ihnen steht.
Für meinen Beruf sind das schlechte Voraussetzungen. Wer den Job des Kolumnisten ernst nimmt, macht sich nicht beliebt. Es hagelt regelmäßig Eingaben an die Chefredaktion. Eine Reihe von Kollegen schaut misstrauisch auf das, was man macht. Entweder gilt man als überbezahlt oder als überschätzt. In jedem Fall aber als entbehrlich.
Das Dasein als Kolumnist hat Vorzüge. Man kann arbeiten, wo man will. Niemand verlangt von einem, jede Woche an Redaktionssitzungen teilzunehmen oder seine Zeit in Telefonaten mit Politikern zu vertrödeln. Man kommt notfalls ohne lästige Recherche aus. Um sich eine Meinung zu bilden, reicht die Zeitungslektüre. Man darf sogar zu allem seine Meinung äußern. Wer allerdings darauf spekuliert, dass einen die Menschen ins Herz schließen, sollte sich eine andere Beschäftigung suchen.
Es gibt Fans, sicher. Anders wäre es ja auch nicht auszuhalten. Aber auf jeden Fan kommt ein Hater. Ich will mich nicht beklagen, um Gottes willen. Ich lebe von den Menschen, die mich zum Teufel wünschen, und zwar mindestens genauso wie von denjenigen, die mich zu schätzen wissen. Wenn ich einen Hinweis absetze, dass eine neue Kolumne erschienen ist, können viele Leute dem Impuls nicht widerstehen, einmal nachzuschauen, was ich diese Woche wieder angestellt habe. Sie haben sich fest vorgenommen, keine Kolumne von mir mehr zu lesen. Aber dann sehen sie eine Überschrift, die sie aufregt, und, wusch, sind sie wieder dabei. Man nennt das masochistisches Lesen. Ich bin davon ein großer Profiteur.
Was macht eine gute Kolumne aus? Man muss sich, zumindest kurzzeitig, aufregen können. Wer alles mit der Gelassenheit eines buddhistischen Mönchs betrachtet, wird niemals einen Satz schreiben, der Schwung und Kraft hat. Es ist zweifellos auch hilfreich, wenn man so formuliert, dass die Leute nicht den Eindruck haben, sie wären im Proseminar oder in der Kirche. Es ist wie überall im Leben: Humor und die Fähigkeit zur Selbstironie, und sei diese nur vorgetäuscht, erleichtern die Sache. Dazu sollte ein Gedanke kommen, den noch nicht alle gefasst haben. Letzteres klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist aber nach meiner Beobachtung eine Voraussetzung, auf die weniger Menschen in meinem Gewerbe Wert legen, als man annehmen sollte.
Jeder Journalist hat seine Vorbilder. Zu meinen gehört der österreichische Autor Anton Kuh. Von Kuh stammt der Satz: »Warum sachlich, wenn’s auch persönlich geht?« Damit lässt sich arbeiten.
Der Journalist solle sich mit nichts gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache, lautet ein Rat, der angehenden Journalisten in Seminaren gegeben wird. Der einfachste Weg, dieser Empfehlung gerecht zu werden, ist, es sich mit Leuten, auf die es ankommt, zu verscherzen. Das wäre, wenn Sie so wollen, die Kombination aus Satz eins und zwei. Also angewandter Anton Kuh.
Eine nahezu todsichere Methode, Distanz zwischen sich und anderen zu schaffen, ist die Beleidigung. Als Stilform ist die Beleidigung etwas in Verruf geraten, zu Unrecht, wie ich meine. Einige meiner liebsten Journalisten waren große Beleidiger. Karl Kraus hatte am Ende nicht nur seine Leserschaft so weit dezimiert, dass er die »Fackel« einzeln austragen konnte, auch die Zahl der Menschen, die ihn auf der Straße noch grüßten, war überschaubar. Kurt Tucholsky, Alfred Kerr, Alfred Polgar – sie alle waren Meister der Boshaftigkeit. Das macht es ja bis heute auch so vergnüglich, sie zu lesen. Eines der Projekte, das auf meiner Liste unerledigter Aufgaben steht, ist ein Kompendium der schönsten Verbalinjurien. Titel: »Die Beleidigung durch die Jahrhunderte – wie man sich andere gekonnt zum Feind macht«.
Heinrich Heine über Alexandre Dumas: »Der Kopf von Dumas gleicht einem Gasthof, wo manchmal gute Gedanken einkehren, die sich dort aber nicht länger als eine Nacht aufhalten; sehr oft steht er leer.« Jean Cocteau über Jean Anouilh: »Er hat eine neue Mätresse? Unmöglich – bei dem schläft doch nur das Publikum.« Hans Wollschläger über Gabriele Wohmann: »Gabriele Wohmann oder: Mein Psychoanalytiker hat gesagt, ich solle mehr schreiben.« Sie ahnen, worauf es hinausläuft.
Es gilt als unfein, über andere in herabwürdigender oder abwertender Absicht zu schreiben. Das könne man doch nicht sagen, heißt es dann, das gehe zu weit. Dem würde ich erstens mit dem Kabarettisten Werner Finck entgegenhalten: Da, wo’s zu weit geht, fängt die Freiheit erst an. Außerdem steht die Spottlust am Anfang der Aufklärung, um mal ins hohe Fach zu greifen. Insofern sehe ich mich hier ganz in demokratischer Tradition.
Der Freiheitsgrad einer Gesellschaft lässt sich ziemlich genau daran bemessen, wie die Obrigkeit mit Leuten umspringen darf, die nach ihrem Geschmack zu frech und zu aufsässig zu sind. Nicht mehr im Gefängnis schmoren zu müssen, wenn sich einer auf den Schlips getreten fühlt, ist eine der großen Errungenschaften der Moderne. Es ist noch nicht so lange her, da reichte ein falscher Satz, um sich seine Karriere und auch seine Gesundheit zu zerstören. Dem Rechtsanwalt William Prynne ließ der englische König Karl I. wegen einer Theaterkritik beide Ohren vom Kopf säbeln. Die angebliche Beleidigung waren vier Worte, die Königin Henrietta als Anspielung auf sich verstanden hatte: »Schauspielerinnen sind gewohnheitsmäßige Huren.« Die Königin hatte kurz nach Erscheinen von Prynnes Kritik eine Rolle in einer dramatischen Darstellung am Hof übernommen. Bad timing, wie man so schön sagt.
Bei der üblen Nachrede kommt es, wie bei allen Stilformen, auf Witz und Originalität an. Die beste Form wird verhunzt, wenn Stümper sich daran versuchen. »Blödmann« oder »Idiot«, das kann jeder, dazu muss man nicht viel im Kopf haben. Aber die treffende Abwertung, die wirklich schmerzt, die verlangt den Könner. Mein Kollege Henryk M. Broder stand einmal vor Gericht, weil er über eine Kulturmoderatorin des ZDF gesagt hatte, sie halte beim Reden den Kopf immer leicht schräg, damit sich die Gedanken auf einer Seite sammeln könnten. Das nenne ich eine gelungene Beleidigung. Die arme Frau wollte diese Gemeinheit nicht hinnehmen und zog vor das Landgericht in Düsseldorf, das ihr 10 000 Euro an Schmerzensgeld zusprach. Zum Glück für Leute wie mich kassierte das Oberlandesgericht die Entscheidung wieder. Am Ende musste Broder 40 Prozent der Gerichtskosten tragen, was für ihn viel Geld war, für die Verteidigung der Meinungsfreiheit aber ein akzeptabler Preis ist, wie ich finde.
Die wahre Kunst ist die Beleidigung nach oben. Menschen herabzusetzen, die ohnehin schon klein sind, ist billig. Das schönste Spottwort ist nichts wert, wenn das Urteil über denjenigen, dem man es verpasst, längst gefallen ist. Leider herrscht auch hier in Deutschland ein unseliger Hang zum Herdentrieb. Wir sind inzwischen wahnsinnig empfindlich bei jeder Form der Diskriminierung, worunter bereits die vermutete Diskriminierung fällt. Undenkbar, dass jemand heute noch eine Kolumne schreiben könnte, die »100 Zeilen Hass« heißt. Auch Karl Kraus hätte in unserer diskriminierungsaversen Zeit einen schweren Stand. Aber wenn einer dann mal zum Abschuss freigegeben ist, arbeiten sich alle an ihm ab.
Ich versuche mich beim Schreiben an zwei Regeln zu halten. Die eine Regel habe ich von Harald Schmidt übernommen: »Keine Witze über Leute, die weniger als 10 000 Euro im Monat verdienen.« Ich kann nicht garantieren, dass ich dem immer gerecht werde. Aber ich bemühe mich. Die andere lautet: Kein böses Wort über Leute, die ohnehin schon am Boden liegen.
Wenn alle sich in ihrem Verdammungsurteil einig sind, braucht es nicht noch einen Kommentar von mir, der den Geschlagenen ein weiteres Mal trifft. Im Zweifel ergreife ich für den in Bedrängnis Geratenen lieber Partei, wenn es sonst schon keiner tut. Als alle über Jürgen Trittin herfielen, weil er als AStA-Aktivist in Göttingen mal einen Aufruf unterschrieben hatte, indem die Freigabe von Sex mit Kindern gefordert wurde, habe ich mich hingesetzt und eine Kolumne verfasst, weshalb ich es niederträchtig finde, Leute an 40 Jahre alten Zitaten aufknüpfen zu wollen. Ich würde mich auch vor Claudia Roth oder Katrin Göring-Eckardt stellen, wenn ich den Eindruck hätte, dass sich halb Mediendeutschland gegen sie zusammenrottet. Die Parteizugehörigkeit ist dabei für mich zweitrangig. Man sollte den Anwendungsfall für seine Prinzipien nicht danach ausrichten, ob er einem politisch genehm ist. In der Hinsicht denke ich ganz konservativ.
Manchmal treffe ich auf die Opfer meiner Texte, das lässt sich nicht immer vermeiden. Ich versuche, Politikern aus dem Weg zu gehen. Ich hänge nicht auf Partys herum, auf denen sie verkehren. Ich bin auch nicht Mitglied in irgendwelchen Hintergrundkreisen.
Ich kenne mich: Ich bin durch Nähe absolut korrumpierbar. Bei »Maybrit Illner« bin ich einmal auf Katja Kipping gestoßen, die langjährige Vorsitzende der Linkspartei. Nach der Talkshow standen wir noch etwas beisammen und tranken ein Glas Wein. Wir haben über die Probleme bei der Kindererziehung geplaudert. Ich fand sie sehr nett, außerdem sieht sie für eine Politikerin fabelhaft aus. Ich weiß, das darf man nicht schreiben, weil es als sexistisch gilt. Aber meine Kolumne heißt aus gutem Grund »Der schwarze Kanal«, manchmal muss das auch Vorteile haben. Wenn ich das nächste Mal über Katja Kipping schreiben müsste, würde es mir schwerfallen, etwas Boshaftes zu schreiben. Sie sehen das Problem: Würde ich ständig Politiker oder andere wichtige Menschen treffen, bliebe irgendwann niemand mehr übrig, über den ich noch einen wahren Satz zu Papier bringen könnte.
Trotzdem kommt es natürlich hin und wieder vor, dass ich auf Leute stoße, über die ich schon mal hergezogen habe. Einige Monate nach dem Zusammentreffen mit Katja Kipping saß ich mit Heiko Maas und der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel bei »Maischberger«. In dem Fall hatte ich mich über beide gerade lustig gemacht, bei Maas über seine Hemden, seine Freundin und seine politische Geschniegeltheit – bei Weidel über ihre dünnen Nerven. Die Sache ging glimpflich aus. Die beiden zogen es vor, einfach so zu tun, als sei nichts vorgefallen. Der gemeinsame Wein nach der Sendung fiel allerdings flach.
Ich glaube, hier liegt ein Grund, warum viele Journalisten Mühe haben zu schreiben, was sie wirklich denken. Wer damit rechnen muss, demjenigen, über den er sich abfällig äußert, morgen wieder zu begegnen, neigt dazu, milder zu urteilen. Die amerikanische Kultursoziologin Phillipa Chong hat ein Buch über die Literaturkritikszene in den USA veröffentlicht. Alle, mit denen sie redete, äußerten sich im privaten Gespräch sehr viel kritischer über die von ihnen rezensierten Bücher, als sie das zuvor in ihren Artikeln getan hatten. Chong führt die Zurückhaltung beim öffentlichen Qualitätsurteil darauf zurück, dass die Literaturszene sehr überschaubar ist und man sich Ärger ersparen will. Kritiker und Kritisierte gehören meist der gleichen sozialen Gruppe an. Früher oder später laufen sie sich wieder über den Weg. Ich glaube, das lässt sich auch auf den Politjournalismus übertragen. Die Zeit, als Journalisten stolz darauf waren, dass Politiker sie als »Scheißpack«, »Pinscher« und »Fünf-Mark-Nutten« beschimpften, sind vorbei. Klar, alle sind irgendwie kritisch. Aber die Kritik ist so kalibriert, dass man sich beim »Stern«-Fest oder beim Sommerfest der SPD dann wieder zuprosten kann, und sei es mit einem falschen Lächeln im Gesicht.
Die Anpassungsfähigkeit nach innen wird mit der Zurschaustellung der Aggressivität von außen kompensiert. Inzwischen ist es üblich geworden, Beschimpfungen wie ein Ehrenabzeichen zu tragen. Jeder und jede halbwegs begabte SchreiberIne kann heute eine Latte an Mails vorweisen, in denen er oder sie wüst angegangen wird. Eine Zeit lang war es üblich, vor Publikum auf »Hate Slams« die schlimmsten Stellen vorzulesen. Mich hat diese Art von Spektakel immer skeptisch gestimmt. Es erinnert mich an Flagellanten, die ihre Wunden ausstellen, um besondere Glaubensstärke zu demonstrieren.
Haben sich die Reaktionen der Leser über die Jahre verändert? Ich würde sagen: ja. Am Anfang, als ich bei »Spiegel Online« mit dem »Schwarzen Kanal« startete, gab es zu 90 Prozent Beschimpfungen. Dem ersten Kolumnenband, der alle Texte aus dem Anfangsjahr versammelte, hängte ich statt eines Nachworts ein Kompendium der Protestnoten der Ge- und Betroffenen an. Ich fürchte, es waren die am meisten gelesenen Seiten.
Inzwischen halten sich Lob und Ablehnung die Waage. Mit jedem empörten Aufschrei erreicht mich auch eine Aufmunterung. Ich führe das auf die steigende politische Spannung in der Gesellschaft zurück. Offenbar haben die Leser, die mir zustimmen, den Eindruck, sie müssten mir etwas Nettes schreiben, damit ich durchhalte. Genauso steht es denn auch in vielen Zuschriften: »Halten Sie durch!«
Mir wird oft nachgesagt, ich sei Provokateur. Das ist ein Missverständnis. Ich will nicht provozieren. Ich würde nie etwas schreiben, von dem ich nicht überzeugt bin, zumindest zu 51 Prozent. In dem Punkt halte ich mich an Rudolf Augstein, dem ich meine erste Festanstellung verdanke. Wenn das, was ich schreibe, eine Provokation darstellt, dann vor allem in dem Milieu, in dem ich mich bewege, also unter Journalisten und Journalistinnen sowie den Menschen, die in den deutschen Großstadtvierteln zu Hause sind, in denen der Anteil von Grünen-Wählern seit Jahren verlässlich bei über 40 Prozent liegt.
Es gibt zwei Sätze von Rudolf Augstein, die ich mir gemerkt habe. »Die Hand, die den Wechsel fälscht, darf nicht zittern«, lautet einer der beiden. Wer heute Chefredakteure reden hört, muss den Eindruck haben, dass sie kurz davor stehen, ins Schloss Bellevue einzuziehen. Der Satz von Augstein erinnert daran, dass mein Berufsstand auch immer etwas Schillerndes und Halbseidenes hatte. Über Journalisten, die vor Bedeutung nicht laufen können, hätte Augstein nur den Kopf geschüttelt.
Anlässlich des zehnten Todestags des Herausgebers hat der »Spiegel« Teile seines Briefverkehrs mit Helmut Schmidt veröffentlicht. Darin findet sich ein Schreiben, in dem Augstein auf den Vorwurf antwortet, der »Spiegel« würde Einseitigkeit und Häme fördern. Was der »Spiegel« leiste, lasse sich nun einmal nicht »nach dem Muster der Kollegen bei der ›Süddeutschen Zeitung‹ und der ›Zeit‹ bewerkstelligen«: »Das sind piekfeine Leute, und piekfein sind wir nicht.« Für mich einer der Gründe, warum ich mich beim »Spiegel« immer wohlgefühlt habe.
Der andere Augstein-Satz, den ich mir gemerkt haben, um ihn bei passender Gelegenheit zu zitieren, lautet: »Das Schwert der Guillotine darf nicht zu kurz sein.« Der Satz fiel in einem Gespräch über einen Artikel von mir, der gegen einen Mann ging, bei dem man sich zweimal überlegen musste, ob man ihn sich zum Feind machen wollte. Jemand hatte den Verleger über den Vorgang unterrichtet. Also rief er mich an, um sich ins Bild setzen zu lassen. »Natürlich drucken wir den Text«, sagte Augstein. Ich besaß die Geistesgegenwart zu fragen, ob denn auch in der vorgesehenen Länge. Jeder Artikel lässt sich durch Kürzungen vernichten. Darauf nahm er den Abstecher in die Französische Revolution. Woraus man zweierlei lernen kann: Neben der Distanz kann eine gewisse Kaltblütigkeit nicht schaden. Und man sollte sich, wie Augstein, einen Sinn für historische Proportionen bewahren.
Ich wollte immer möglichst viele Menschen erreichen. Deshalb habe ich nach der Journalistenschule auch in Hamburg beim »Spiegel« angeheuert, von dem es hieß, dass er seine Redakteure verheize, und nicht bei einer kleinen, aber feinen Zeitung mit einem garantiert diskriminierungsfreien Klima. Wenn man mir die Wahl zwischen einer Kapelle und einer Großkirche lässt, entscheide ich mich immer für die große Bühne. Ich dachte am Anfang, alle würden so denken. Aber da habe ich mich geirrt. Den meisten meiner Kollegen ist der Applaus ihrer Umgebung wichtiger als der publikumswirksame Auftritt.
Der Leser spielt, anders als man vielleicht vermuten sollte, auf Redaktionskonferenzen oft nur eine marginale Rolle. Die erste Frage, die sich viele Journalisten stellen, lautet: Was werden die Kollegen über meinen Text denken? Der mit der SPD-Berichterstattung betraute Redakteur hat vor allem die anderen mit der SPD-Berichterstattung betrauten Redakteure im Blick, der für die CDU zuständige Redakteur den Kreis der CDU-Kenner. Da den Experten andere Dinge interessieren als den Laien, verschiebt sich der Fokus der Berichterstattung: vom Allgemeinen aufs Spezielle und vom Außergewöhnlichen aufs Detail, mit dem man unter Seinesgleichen glänzen kann. Im Prinzip gilt das für alle Themengebiete, bei denen sich ein Spezialistentum herausbildet: Die Feministin richtet sich mit ihren Texten vornehmlich an andere Feministinnen, die Klimawandelwarner*in an die anderen Klimawandelwarner*innen, der Nazijäger an die Gemeinde der Nazijäger.
Das Internet hat die Dinge nicht zum Besseren gewendet. Tatsächlich verstärkt es die Tendenz zum Peer-Group-Denken. Das ist ein interessantes Paradox, weil die Netzpioniere ja mit dem Versprechen angetreten waren, auch denen eine Stimme zu geben, die vorher vom Diskurs ausgeschlossen waren. Von diesem basisdemokratischen Anspruch lebt das Internet bis heute. Nichts bewirtschaften die sogenannten Netzaktivisten so erfolgreich wie den Mythos des freien Meinungsaustausches, mit kaum etwas sind sie so schnell zur Hand wie dem Vorwurf der Zensur. Die Wahrheit ist: Jeder kann seine Meinung sagen, aber nicht alle sollen es können dürfen. Sobald es ernst wird mit Meinungsfreiheit und Pluralität, werden übergeordnete Argumente ins Feld geführt, um diese zu suspendieren: der Kampf gegen Rechts. Der Kampf gegen das Virus. Der Kampf gegen den Hass. Irgendein Kampf findet sich immer.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich wäre der Letzte, sich über das Internet zu beklagen. Ich verdanke dem Netz meine Bekanntheit als politischer Autor. Es wäre vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen, dass mir jemand im »Spiegel« eine wöchentliche Kolumne gegeben hätte. Dass es auf »Spiegel Online« dazu kam, ist, neben meiner Beharrlichkeit, der Tatsache geschuldet, dass damals kaum jemand im Mutterhaus die Onlinewelt wirklich ernst nahm. Ich war lange Zeit auch einer der ganz wenigen »Spiegel«-Redakteure, die regelmäßig für die Onliner schrieben. Irgendwann hatten sich die Dinge dann umgedreht. Über zwölf Millionen Klicks im Jahr ist eine Zahl, die selbst den netzskeptischsten Chefredakteur nachdenklich stimmt.
Warum fällt es gerade Journalisten so schwer, andere Meinungen zu ertragen? Niemand verlangt ja, dass sie diese teilen. Sie dürfen sogar an prominenter Stelle vehement widersprechen, dafür gibt es unzählige Debattenplätze. Aber schon die Aussicht, auf jemanden zu stoßen, der ganz anderer Meinung ist, führt bei einigen dazu, dass sie Milieuschutz verlangen.
Ich glaube, in Wahrheit sind viele Medienleute eher ängstliche Naturen. Nur weil jemand in Texten kräftig hinlangt, bedeutet das nicht, dass er auch im persönlichen Kontakt mutig wäre.
Die sozialen Medien haben einen eigenartigen Effekt auf Menschen. Alles tritt klar und ungeschminkt hervor: die Eitelkeit, die Rechthaberei, der Narzissmus. Jemand schreibt etwas Nettes, und das Erste, was derjenige, der gelobt wurde, tut, ist, alle daran teilhaben zu lassen, wie großartig ihn jemand anderes gefunden hat. Noch erstaunlicher ist allenfalls das maßlose Cheflob. Der Politikchef hat einen Text geschrieben, auf den er erkennbar stolz ist, und die Korrespondentin im Außenbüro twittert ergriffen, dass sie selten etwas so Weitsichtiges und Kluges gelesen habe, ja, dass sie bei der Lektüre beinahe habe weinen müssen, worauf der Politikchef dieses mit einem Herzchen versieht und seinerseits retweetet. Früher hätte das als Gipfel der Peinlichkeit gegolten, heute geht das als normaler Netzbeitrag durch.
Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich sehe, wie Leute im Netz die Nerven verlieren und sich in wüsten Streitereien verzetteln. Es ist wie in einem Dorf, in dem die Dorfältesten peinlich genau darauf achten, dass niemand gegen die Dorfregeln verstößt. Es gibt den Prediger, der versucht, die Gemeinde von der Heiligkeit seines Anliegens zu überzeugen. Es gibt den Oberlehrer, der seine Tage damit verbringt, das Fehlverhalten anderer zu geißeln. Es gibt den Bully, der die Meute aufheizt und aufhetzt und erst Ruhe gibt, wenn das Objekt seiner Wut sein Profil löscht und alle Aktivitäten einstellt. Natürlich haben wir auch den Netzweisen, der zur Mäßigung aufruft, und den trockenen Netznutzer, der sich indigniert abwendet und gelobt, für immer das Twittern einzustellen, nur um dann beim ersten Erregungssturm wieder rückfällig zu werden.
Eine der interessantesten Gestalten der Netzwelt ist der Blockwart, der jeden sperrt, mit dessen Meinung er nicht einverstanden ist. Ich habe den Sinn des Blockens nie ganz verstanden. Ist man nicht gerade deshalb auf Twitter und Facebook dabei, weil man hier Menschen trifft, denen man im normalen Leben nie begegnen würde? Sicher, es gibt furchtbare Nervensägen, die einem die Timeline vollspammen. Aber dafür hat das System eine praktikable Lösung. Ich stelle solche Leute einfach auf »stumm«. Sie können einem zwar weiter folgen, aber alle Antworten oder Ausfälligkeiten bleiben im Stummen-Filter hängen.
Dieses Buch trägt den Untertitel »Vom Vorteil, eine eigene Meinung zu haben, wenn alle dasselbe denken«. Ich empfinde das wirklich so. Es ist ungemein befreiend, sich von den Vorurteilen seiner Umgebung zu lösen. Wovor haben die Leute solche Angst? Wir leben nicht in Nordkorea oder China, wo einen schon ein unbedachtes Wort ins Lager bringt. Das Schlimmste, was einem bei uns passieren kann, wenn man sich nicht an die vorgegebenen Sprachregelungen hält, ist, dass man ein paar Freunde vor den Kopf stößt. Möglicherweise waren es auch gar nicht wirkliche Freunde, wenn sie einem schon bei einem offenen Wort die Freundschaft aufkündigen.
Ich glaube, in der Hinsicht bin ich ein Linker geblieben. Emanzipation ist für mich bis heute kein Übel, sondern eine Verheißung. Ich bin in den Siebzigerjahren politisch groß worden. Was die Bewegung damals stark gemacht hat, war das Versprechen, dass jeder so leben könne, wie er wolle, unabhängig von den Konventionen, Ängsten und Zwangsvorstellungen der Gesellschaft. »Easy Rider«, »Pourquoi pas!«, »Macht kaputt, was euch kaputt macht« – das war der Sound, der eine ganze Generation in die Arme der Linken trieb. Sicher, vieles ist in der Übertreibung geendet, manches im Wahnsinn. Aber dennoch: Gibt es etwas Schöneres, als im Kopf frei zu sein? Einfach darauf zu pfeifen, was irgendwelche Leute, die sich als Sittenwächter aufspielen, über einen denken?
Ich habe im Sommer 2019 den »Spiegel« verlassen, um zu Burda zu wechseln. Ich war 30 Jahre »Spiegel«-Redakteur, das ist länger, als die meisten Ehen halten. Es hat mich niemand gezwungen zu gehen. Ich wurde auch nicht schlecht behandelt, ganz im Gegenteil. Als ich meinen Chefredakteur über meinen Entschluss informierte, wirkte er ehrlich betroffen, jedenfalls tat er so. Ich wollte noch einmal etwas anderes ausprobieren. Einfach so weiterzumachen wie bisher empfand ich nicht als tröstliche, sondern als erschreckende Aussicht.
Manche Kritiker haben mir vorgeworfen, ich sei im Laufe der Jahre immer weiter nach außen gerutscht. Ich finde, das Gegenteil ist wahr. In letzter Zeit rede ich wie Frank-Walter Steinmeier, der die Deutschen in seinen Reden mittlerweile ermahnt, es sich im eigenen Meinungswinkel nicht zu gemütlich zu machen. Nichts ist so drückend wie die Kuhstallwärme der Gesinnungsgemeinschaft. Wenn es einen Grund gibt, warum ich bei der Linken Reißaus genommen habe, dann der Hang, sich ständig gegenseitig auf die Schultern zu klopfen, wie widerständig man doch denke.
Ich halte nichts davon, seinen Widerspruchsgeist zu zeigen, indem man sich möglichst unangepasst gibt. Was wäre damit bewiesen? Wo ich allerdings nicht mehr mitmache, ist, wenn ich den Eindruck habe, jemand gibt eine Richtung vor, und alle marschieren mit. Wenn die Kanzlerin sagt: »Hier entlang«, gehöre ich zu denen, die fragen: »Geht es nicht auch andersherum?« Man mag das für kindisch halten, für mich war es einer der Gründe, in den Journalismus zu gehen.
»Alternativlos« ist ein Wort, das in meinem Sprachgebrauch nicht vorkommt. Ich denke immer in Alternativen. Schon der Herrgott hat für eine Alternative gesorgt, als er den Teufel erschuf. Theologisch übrigens eine vertrackte Sache: Ist das Böse eine eigene Kraft, unabhängig vom Willen des Herren? Oder ist der Teufel ein Werkzeug Gottes und damit das Eingeständnis, dass der Herr nicht nur Gutes im Schilde führt?
Es geht nicht um Denkverbote. Man darf in Deutschland denken, was man will. Man findet sogar meist eine Plattform, auf der man das, was man denkt, der Allgemeinheit zugänglich machen kann. Was mich stört, ist, wenn so getan wird, als sei es unanständig, eine Minderheitenmeinung zu vertreten. Oder wenn Journalisten glauben, sie dienten einer höheren Wahrheit. Inzwischen glauben viele, dass es ihre Aufgabe sei, selbst aktiv zu werden, um Deutschland vor Schlimmerem zu bewahren. Heute geht es gegen den Faschismus, morgen gegen das Virus. Das Virus ist noch gefährlicher als der Faschismus, also müssen die Anstrengungen verdoppelt werden.
Es wird auch immer enger, ist mein Gefühl. Inzwischen reicht es schon, dass im Buchregal drei falsche Bücher stehen, damit die Vertreter der guten Sache das Weite suchen. Oder aber die Aussicht, dass sie, Gott behüte, auf fremde Menschen stoßen könnten.
Im vergangenen Herbst war ich zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Heimat eingeladen. Auf der Bühne sollte auch die Autorin Fatma Aydemir sitzen, die gerade als Herausgeberin eines Buches mit dem Titel »Eure Heimat ist unser Albtraum« hervorgetreten war. Einen Tag vor der Veranstaltung sagte sie ab. Sie habe nicht gewusst, mit wem sie auf dem Podium sitzen würde, erklärte sie. Der Veranstalter rollte nur mit den Augen, als ich ihn darauf ansprach. Vielleicht liest sie ja nie ihre Mails und guckt auch nicht in die Programmtexte, die man ihr zuschickt, sagte er. Ich glaube, in Wahrheit hatte sie Angst vor der eigenen Courage bekommen. Dass man sich nicht mit den falschen Leuten zeigt, ist auf der Linken ein Dogma geworden, gegen das man nur unter Androhung der Exkommunikation verstoßen darf. »Fast hätte sich Fatma Aydemir mal getraut, neben jemandem zu sitzen, der anders denkt und anders spricht als sie«, schrieb ich als Kommentar zu der seltsamen Fremdenangst von links. »Aber dann hat sie es doch vorgezogen, lieber dort zu bleiben, wo sie alles kennt, auch jedes Argument.«
Seit ich im Kolumnengeschäft bin, höre ich, dass meine Zeit abgelaufen sei. Wahrscheinlich schreibe ich deshalb so manisch gegen das Ende an. Noch ein paar Monate, und dann kommen die Nachwuchskräfte und schieben mich mit ihren vorbildlichen Ideen und ihrer aufregenden neuen Sprache zur Seite. Aber es passiert nichts. Ich warte, dass es mich erwischt, und dann ist schon wieder Donnerstag, und die Redaktion ruft an und fragt, wo denn der Text bleibe. Inzwischen glaube ich, dass Kolumnist ein Beruf ist, in dem weder Alter noch Hautfarbe oder Geschlecht eine Rolle spielen. Es ist der gerechteste Job der Welt. Es kommt allein darauf an, dass man so schreibt, dass einen die Leute lesen wollen. Alles andere ist nebensächlich.
Als ich in Berlin lebte, zählte zu meinen Nachbarn der »Bild«-Kolumnist Franz Josef Wagner. Wagner setzt sich jeden Tag an den Computer, um seine »Post von Wagner« zu schreiben – an die Queen, die Kanzlerin, das Wetter, den Fußballgott, was gerade anliegt. Nur Samstag hat er frei, weil am Sonntag keine »Bild« erscheint. Wahrscheinlich ist er der dienstälteste Kolumnist Deutschlands, in jedem Fall ist er der ausdauerndste.
Es sieht von außen so leicht aus, 25 Zeilen am Tag. Aber ich weiß, wie sehr sich Wagner quält. Zunächst braucht es eine Idee. Es gibt Tage, da passiert so viel, dass man zehn Briefe voll bekäme. Aber dann wieder gibt es diese Hundstage, an denen die Zeit still zu stehen scheint. Wagner ist Romantiker, das hilft. Er hat einen furchtbaren Ruf, doch in Wahrheit ist er ein ausgesprochen sentimentaler Mensch. Er hält an den Sozialdemokraten fest, selbst wenn sie Leute wie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die Spitze wählen. Er mag Merkel, weil sie ihn an seine Mutter erinnert. Zur Not schreibt er über seine Mutter und die Kindheit in Regensburg.
Auch 25 Zeilen können zur Qual werden, jedenfalls wenn man wie Wagner auf der Suche nach dem perfekten Satz ist. Einmal hat er mir gesagt, wie seine Erfolgsquote aussieht. Zwei Kolumnen seien Mist, zwei mittelmäßig und zwei gelungen. Wenn man den Schnitt halte, sei man gut. Ich habe in diesem Buch alle Texte versammelt, die nach meiner Meinung zu den zwei Texten gehören, die zu lesen sich lohnen. Auf der Suche nach dem perfekten Satz bin ich noch immer.
Über die sexuelle Veranlagung von Politikern
Ist Peter Altmaier schwul? Komische Frage, mögen Sie jetzt sagen: Was geht mich das an? Viel wichtiger ist doch, dass er seinen Job ordentlich erledigt.
Natürlich haben Sie völlig recht, wenn Sie so denken. Aber so abgeklärt kann man die Dinge nur sehen, wenn man nicht den ganzen Tag in Redaktionskonferenzen hockt, wo man sich zwangsläufig über die Leute an der Spitze Gedanken macht – oder zu dem Teil Deutschlands gehört, der jede private Frage nach wie vor für eine politische hält. Womit wir bei der »taz« wären, die genau die oben genannte Frage aufgebracht hat, wie es eigentlich um die sexuellen Präferenzen des Ministers steht.
Den Anstoß zu den Überlegungen gab Altmaier mit einem Interview in der »Bild am Sonntag«, in dem er auch zu der Frage Stellung nahm, warum man nie eine Frau an seiner Seite sehe. »Der liebe Gott hat es so gefügt, dass ich unverheiratet und allein durchs Leben gehe«, antwortete Altmaier in seiner angenehm barocken Art. Das nun wiederum fand die Redaktion der »taz« ein solches »Geschwurbel«, dass sie eine Übersetzung beziehungsweise »Dechiffrierung« für nötig hielt, wonach mit dem Bekenntnis zum Alleinleben wohl nur gemeint sein könne, dass Altmaier eigentlich schwul sei, dies offen zu sagen sich aber nicht traue.
Nun halten die Schwurbelspezialisten an der Rudi-Dutschke-Straße in Berlin grundsätzlich jeden für einen Klemmgeist, der sich auf Gott bezieht und damit eine Schicksalsergebenheit an den Tag legt, die in diesen Kreisen schon immer als Ausdruck von Hinterwäldlertum galt. Damit hätte es dann aber auch sein Bewenden haben können, wenn der Redaktion nicht anderntags Bedenken gekommen wären, ob sie mit ihrer Dechiffrierungsnummer nicht zu weit gegangen sei. Also folgte eine Entschuldigung der Chefredakteurin, was wiederum einige politisch besonders rege Geister so erzürnte, dass sie der »taz« vorwarfen, der Tabuisierung der Homosexualität Vorschub zu leisten.
Es scheint unausweichlich, aber jede Diskussion über sexuelle Minderheiten landet irgendwann auf der Ebene der Befreiungstheorie. Die meisten öffentlichen Vertreter der schwulen Sache operieren mit ihren Aufrufen zum Outing bis heute unter der Annahme, dass jedes Bekenntnis ein wertvoller Tabubruch sei. Dieser Lesart zufolge können Spitzenpolitiker über ihre Homosexualität nur kodiert reden, weil die Gesellschaft abweichendes Verhalten bestraft.
Umgekehrt wird daraus für mehr oder weniger bekannte Menschen die Pflicht abgeleitet, sich zu ihrem Anderssein zu bekennen, da nur so auf Dauer eine Normalität hergestellt werden könne, die es Schwulen erlaube, sich frei in der Öffentlichkeit zu bewegen.
Die Wahrheit ist, dass es den meisten Leuten ziemlich egal ist, welche sexuellen Vorlieben ihre Politiker haben. Sicher, es ist immer interessant, Näheres über das Privatleben von Prominenten zu erfahren, darauf beruht die Existenz einer ganzen Klatsch-und-Tratsch-Industrie. Aber die wenigsten machen von solchem Nebenwissen ihre Zustimmung, geschweige denn ihre Wahlentscheidung abhängig.
Selbst im konservativen Lager lockt man heute kaum noch jemanden mit dem Bekenntnis zur Homosexualität hinter irgendeinem Ofen hervor. Wer bei der CSU zum Parteivorsitzenden einen Mann bestimmt, der nicht nur ein uneheliches Kind erwartet, sondern dann auch noch Mühe hat, sich zwischen Geliebter und Ehefrau zu entscheiden, der ist so leicht nicht mehr aus der Fassung zu bringen.
Das mag vor einer Generation noch anders gewesen sein, als man als Mitglied der Bundesregierung tunlichst darauf achtete, größere Normabweichungen zu verheimlichen. Aber schon damals konnte jeder, der es partout wissen wollte, herausfinden, welche Männer im Kabinett Kohl nur Männer liebten. Inzwischen sind viele Wähler der Union schon froh, wenn sie nicht jede Woche auf ein neues Familienmodell verpflichtet werden.
Ich habe einmal nachgezählt, wer zum Zeitpunkt des »BamS«-Interviews in der Regierung ganz klassisch in erster Ehe mit mindestens zwei Kindern lebte. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann erfüllten sieben von 15 Mitgliedern im Kabinett dieses Kriterium. Das ist erkennbar die Minderheit. Die anderen waren geschieden oder kinderlos oder schwul oder wichen aus einem anderen Grund ab. So sieht die gesellschaftliche Wirklichkeit aus, da passt Herr Altmaier in jeder Kombination hinein.
Der Minister selbst scheint die Sache übrigens entspannt zu sehen. Seine Twitter-Gemeinde ließ er auf Nachfrage wissen, Politiker müssten immer mit »Spekulationen leben«. Außerdem habe er viel für Schwule, Frauen und Ausländer in der CDU getan, »weil es mir um Überzeugung, nicht um eigene Interessen ging«.
Es mag für einige ein überraschender Gedanke sein: Aber es soll vorkommen, dass man auch als Heteromann nicht die richtige Frau findet. Oder sich für das Alleinsein entscheidet, weil einem das Zusammenleben mit wem auch immer einfach zu anstrengend ist. Das verträgt sich allerdings ganz schlecht mit der Unterdrückungsthese, die hinter allem eine gesellschaftliche Verantwortung vermutet.
Über radikalen Tierschutz
Schicksalswochen für alle Freunde der Sodomie: Die Bundesregierung will den Geschlechtsverkehr mit Tieren verbieten. Seit dem Bewegungsjahr 1969 ist der Beischlaf mit anderen Arten straffrei gestellt – sofern das Tier dabei keine Schmerzen leidet. Es war ein erster Schritt zur sexuellen Befreiung der Deutschen. Nun drohen 25 000 Euro Bußgeld, wenn es bei den neuen Plänen bleibt. Das ist ziemlich viel Geld für Sex mit seinem Hund oder Schaf, entsprechend groß ist die Aufregung in den interessierten Kreisen.
Dabei waren die Tierfreunde gerade auf dem Weg, als Randgruppe respektabel zu werden. Als aufgeklärter Mensch spricht man nicht mehr von Sodomie, sondern von Zoophilie. Es gibt eine rege Unterstützerszene und natürlich jede Menge Foren, auf denen sich die Anhänger zusammenfinden und mit Gleichgesinnten austauschen können.
Die Bewegung hat sogar eine eigene Dachorganisation, die sich für »Toleranz und Aufklärung« und »eine offen gelebte Zoophilie ohne gesellschaftliche Benachteiligung« einsetzt. Wer die Webseite besucht, lernt dort, dass die Tierfetischisten ganz viel vom Kuscheln halten und jede Form der Gewalt in Beziehungen grundsätzlich ablehnen. Vermutlich dauert es nicht mehr lange, dass von einer kalifornischen Hochschule die Theorie um die Welt geht, dass neben dem Geschlecht auch die Artengrenze ein soziales Konstrukt sei, womit die Tür endgültig aufgestoßen wäre zu einer dann in jeder Hinsicht wirklich genderneutralen Zukunft.
Wie konnte es also so weit kommen, dass in Deutschland wieder von einem Verbot die Rede ist? Was auf den ersten Blick nach einem Versuch der Union aussieht, ihr konservatives Profil zu schärfen, ist offenbar eine Art Ablasshandel.
Treibende Kraft sind in diesem Fall die Tierschützer, die hartnäckig an der Vorstellung festhalten, dass es sich beim Sexualverkehr zwischen Mensch und Tier um einen widernatürlichen Akt handelt. Eigentlich sollte es bei der anstehenden Novelle des Tierschutzgesetzes unter anderem den Pferdezüchtern an den Kragen gehen, die ihre Fohlen immer noch mit Brandeisen traktieren. Aber weil diese als eine bedeutende Wählergruppe der Konservativen gelten, hat sich die Landwirtschaftsministerin die Sodomiten vorgenommen, die politisch bislang eher unauffällig waren.
Wer sich die Toleranz auf die Fahnen geschrieben hat, kann normalerweise auf Nachsicht hoffen. Die Zugehörigkeit zu einer Randgruppe ist gemeinhin der sicherste Weg, Anteilnahme und Zuwendung der Öffentlichkeit zu gewinnen. Das Problem beginnt dort, wo zwei Minderheiten in Konkurrenz zueinander treten. Man hat das schon bei dem Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen gesehen, bei dem nun auf Intervention der Lesbenverbände auch der Frauen gedacht wird, obwohl sich die Verfolgung ausschließlich gegen schwule Männer richtete.
Mit den radikalen Tierschützern ist ebenfalls nicht zu spaßen, das haben schon andere festgestellt. Wenn es um die Durchsetzung ihrer Anliegen geht, schrecken die Vertreter dieser Minderheit vor fragwürdigen Aktionen nicht zurück. 2012 musste der Europäische Menschenrechtsgerichtshof darüber urteilen, ob es zulässig sei, das Schicksal von Hühnern mit dem von KZ-Häftlingen gleichzusetzen. Es wurde dann erst einmal nichts mit der Wanderausstellung »Der Holocaust auf Ihrem Teller«, weil man auch in Straßburg die Kampagne als unzulässige Banalisierung des Judenmords empfand.
Sogar das Angeln erscheint in diesen Kreisen als krimineller Zeitvertreib. Als der Royal Fishing Club in Heiligenhafen vor einigen Jahren zum »Jugendangeln« aufrief, mobilisierten die Aktivisten von PETA gegen das »Blutbad«, weil Angeln »die Empfindungslosigkeit und die Ignoranz gegenüber allem Leben« verstärke. »Wenn Kinder und Jugendliche angeln, kann damit ein Grundstein dafür gelegt werden, dass sie sich später zu Gewalttätern entwickeln«, erklärte ein Sprecher, man wisse schließlich aus Untersuchungen, »dass Massenmörder im Vorfeld bereits Tiere gequält oder getötet haben«. Da können die Tierfetischisten noch von Glück sagen, wenn es für sie künftig bei einem Ordnungsgeld bleibt.
Die große Frage ist jetzt, wie man den praktizierenden Sodomiten auf die Schliche kommen will. Das Tier leidet stumm, wie man weiß. Vermutlich wird es demnächst die ersten Selbsthilfeorganisationen geben, die sich auf das Aufspüren von Missbrauchsopfern spezialisieren, eine Art »Wildwasser« gegen Tierschänder. Natürlich müssen entsprechende Aufklärungskampagnen folgen, und auch die Einrichtung eines Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs von Tieren wird, wie man den Lauf der Dinge kennt, nicht mehr lange auf sich warten lassen.
So bleibt eigentlich nur offen, welches Ministerium künftig zuständig sein soll: das Familienministerium, das in Fragen des Missbrauchs ansonsten federführend ist. Oder doch eher die Landwirtschaftsministerin, in deren Haus der Tierschutz ressortiert. Aber das werden die Damen schon untereinander klären. Notfalls spricht die Kanzlerin ein Machtwort.
Über Bettina Wulff und das therapeutische Sprechen
Die Woche ist erst halb rum, und schon hat man wieder etwas dazugelernt. Zum Beispiel, dass »exklusiv« ein relativer Begriff ist, jedenfalls in der Welt der Illustrierten. Als »Exklusiv-Interview mit Bettina Wulff« kündigte der »Stern« auf seinem Titel ein Gespräch an, in dem die »ehemalige First Lady« über ihre Eheprobleme und andere Sorgen Auskunft gibt – zeitgleich mit Interviews zum selben Themenkreis in »Bunte«, »Gala« und »Brigitte«.
Bislang dachte man, dass »exklusiv« so etwas wie »ausschließlich« bedeutet, nicht »besonders lang« oder »besonders tiefschürfend«, sonst könnte man ja gleich von Tiefen- oder Längeninterviews sprechen. Aber der People-Journalismus hat seine eigenen Gesetze.
Man weiß jetzt auch einiges über die Frau unseres ehemaligen Bundespräsidenten, was man so noch nicht wusste, angefangen von den Magenschmerzen, den Hautausschlägen und den Gewichtsproblemen, die das Leben im Schloss Bellevue mit sich brachte. Wenn man den Stand der bisherigen Auskünfte zusammenfassen sollte, scheint ein Grund für den Gang in die Öffentlichkeit gewesen zu sein, dass Christian Wulff in der Endphase seiner Präsidentschaft zu wenig Zeit fand, sich angemessen um die Bedürfnisse seiner Frau zu kümmern. Medieninteresse als Ersatz für die Vernachlässigung zu Haus: Das kennt man von den Bulimie-Geständnissen der Diana, Princess of Wales.
Wie man sieht, macht das therapeutische Sprechen auch vor CDU-Familien nicht halt. Weite Passagen der Mediengespräche sowie des zeitgleich erschienenen Buches lesen sich wie eine Verlängerung der Paarsitzungen, in die sich das Ehepaar Wulff zur Bewältigung der häuslichen Krise begeben hatte. Zurückhaltende Menschen mögen sich fragen, ob das alles in die Öffentlichkeit gehört. Aber solche Vorbehalte zeigen nur, dass man die Zeit verschlafen hat beziehungsweise keine Ahnung besitzt von den Imperativen der Ich-Kultur. Das therapeutische Sprechen lebt von der Idee, dass in der Mitteilung schon die Heilung liegt. Gerade in der radikalen Subjektivität steckt ein Moment der Befreiung.
»Jenseits des Protokolls«, wie Bettina Wulffs Bekenntnisbuch heißt, gehört zu einer Gattung, die man am besten als Mitleidsliteratur bezeichnet und die eine Kränkung oder Leidenserfahrung, die früher dem diskreten Gespräch mit einer vertrauten Seele vorbehalten geblieben wäre, möglichst anschaulich, um nicht zu sagen »schonungslos« für das große Publikum aufbereitet. Es muss dabei nicht immer Krebs sein, um mit seiner Geschichte erfolgreich auf den Markt zu treten. Es reicht, dass man beim Packen einen Weinkrampf bekommt, wie Miriam Meckel mit ihrem Burnout-Brenner »Brief an mein Leben« bewiesen hat. Oder vom Vater nicht genug beachtet wurde, eine Demütigung, mit der es der Kanzlersohn Walter Kohl auf ein Dauerabonnement in den Bestsellerlisten brachte.
Die Passionsliteratur entzieht sich normalen Bewertungsmaßstäben, weshalb auch jeder Spott ins Leere läuft. Entscheidendes Kriterium ist nicht das Ausdrucksvermögen des Autors, sondern allein der Eindruck, den er beim Leser hinterlässt: Je mehr sich dieser durch das Geschriebene angesprochen (und das heißt betroffen) fühlt, desto authentischer und damit lobenswerter das Buch. Tatsächlich ist die Identifikationsqualität dieser Texte das entscheidende Verkaufsargument, weshalb schon in den Verlagsankündigungen laufend davon die Rede ist, wie »offen« es in dem vorliegenden Werk zugehe.
Die einzige wirkliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere als Mitleidsliterat scheint die völlige Abwesenheit von Humor zu sein. Ironie schafft Distanz, auch zu sich selbst, genau das aber verträgt dieses Genre schlecht. »Der MENSCH meines Lebens bin ich«, erklärte schon Verena Stefan in »Häutungen«, dem großen Klassiker der Betroffenheitsliteratur.
Der heilige Ernst, mit dem sich die Sentimentalistin Stefan 1975 gegenübertrat, gilt ungebrochen für alle modernen Nachfolger. So wird am Ende sogar die Frage, was man abends aus dem Kleiderschrank ziehen soll, zur existenziellen Prüfung. Jedes Kleid sei eine Verkleidung gewesen, »die ich über mein eigentliches Ich stülpte«, heißt es bei Bettina Wulff.
Nächste Woche geht es weiter, nach den Zeitschriften kommen die Talkshows. Am Dienstag ist »Maischberger« dran, am Freitag folgt ein Auftritt bei »3 nach 9«. Auch Beckmann will was machen, Jauch überlegt noch. Wer nun allerdings gleich eine grundsätzliche Krise bürgerlicher Normen heraufziehen sieht, sollte zur Entspannung vielleicht woanders hingucken. Zum Beispiel aufs Kanzleramt.
Man weiß von der Bundeskanzlerin, dass sie ihrem Mann morgens gerne das Frühstück zubereitet, weil sie findet, er sollte etwas Ordentliches im Bauch haben, bevor er zur Uni zockelt. Aber das ist schon so ziemlich das Privateste, was man in den Jahren der Kanzlerschaft von Angela Merkel gehört hat. Wer hätte gedacht, dass man im Westen in puncto Bürgerlichkeit noch einmal etwas von jemandem aus der untergegangenen DDR lernen könnte.
Über den hässlichen Deutschen
Arme Schwaben: Sie haben der Welt Hölderlin, Lothar Späth und die S-Klasse beschert. Seit Jahren tüfteln und werkeln sie so emsig vor sich hin, dass ihre Schaffenskraft sprichwörtlich geworden ist. Ganz Deutschland lebt vom schwäbischen Fleiß (na gut, vielleicht nicht ganz Deutschland, aber immerhin beachtliche Teile, angefangen von Bremen, Brandenburg, dem Saarland und natürlich Berlin). Doch statt Bewunderung und Dank trägt ihnen ihr Einsatz nur Hohn und Spott ein. Dagegen hilft nicht einmal die Wahl einer grün-roten Landesregierung, sosehr man sich im Ländle das auch gewünscht haben mag.
Gerade hat der bekannte Großstadttheoretiker Wolfgang Thierse seinem Ärger über die Schwaben Luft gemacht, weil sie ihm in seinem Kiez überall auf die Pelle rücken und er ständig Wecken statt Schrippen sagen muss beziehungsweise Pflaumendatschi statt Pflaumenkuchen. »Ich wünsche mir, dass die Schwaben begreifen, dass sie jetzt in Berlin sind und nicht mehr in ihrer Kleinstadt mit Kehrwoche«, donnerte er via dem Berliner Volksblatt »Morgenpost« den Fremden entgegen, was wiederum bekannte Vertreter des internationalen Schwabentums wie den ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger pikiert darauf hinweisen ließ, dass ohne das Geld aus Baden-Württemberg das süße Leben in Berlin nur halb so schön wäre. Unnötig, darauf hinzuweisen, dass dies aus Sicht von Leuten wie Thierse nur einen weiteren Beweis für die schwäbische Spießigkeit liefert.
Thierse ist noch harmlos, muss man sagen. An manchen Ecken der Hauptstadt hängen Plakate mit der Aufforderung »Schwaben raus«. Schon äußere Zeichen der Fremdheit wie zu langes Verweilen oder Herumschauen können Unmut hervorrufen. Die Grünen in Kreuzberg luden zu einem Diskussionsabend mit dem Titel »Hilfe, die Touris kommen«, wo aufgebrachte Kiezbewohner eine Bannmeile um ihr Viertel forderten. Die Toleranzgrenze ist in den linksbürgerlichen Revieren dünn, wie man sieht. Man mag sich gar nicht ausmalen, was am Prenzlauer Berg los wäre, wenn man dort Köfte statt Bulette sagen müsste.
Wer glaubt, dass Überfremdungsängste ein Privileg der Rechten seien, ist lange nicht mehr vor die Tür getreten. Was dem Rechten der Muslim, ist dem Linken der Schwabe. Der Eindringling aus dem Südwesten der Republik steht für alles, was man in den aufgeklärten Kreisen für fremd und damit gefährlich hält. Glaubt man den Schwabenkritikern, dann hat sich zwischen Kollwitzplatz und Berlin-Friedrichshain eine Parallelgesellschaft entwickelt, die auch in der zweiten Generation noch alle Zeichen der Integrationsunwilligkeit trägt: mangelnde Hochdeutschkenntnisse, überdurchschnittlicher Kinderreichtum und das Beharren auf merkwürdigen Traditionen wie der wöchentlichen Reinigung des Treppenhauses.