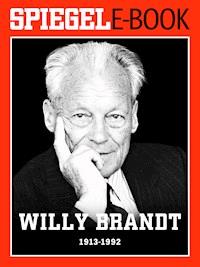9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Einer der erfolgreichsten Journalisten Deutschlands vor den Scherben seiner Ehe
»Alles ist besser als noch ein Tag mit dir!« Als ihm seine Frau Ella diesen Satz an den Kopf wirft, bricht für den erfolgreichen Journalisten eine Welt zusammen. Von einem Tag auf den anderen scheint alles verloren, worauf bis eben das gemeinsame Leben gründete. Dass ein jüngerer Mann im Spiel ist, erleichtert das Ganze auch nicht gerade. Also macht unser Held, was er immer tut, wenn er einer Sache auf den Grund gehen will: Er beginnt zu schreiben – über die Verzweiflung, die Wut, den Schmerz, aber auch die Kraft, die ihm in der Krise zuwächst, und seinen unerschütterlichen Glauben an die große Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
»Alles ist besser als noch ein Tag mit dir!« Als Ella ihm diesen Satz an den Kopf wirft, bricht für den erfolgreichen Journalisten eine Welt zusammen. Von einem Tag auf den anderen scheint alles verloren, worauf bis eben das gemeinsame Leben gründete. Dass ein jüngerer Mann im Spiel ist, erleichtert das Ganze auch nicht gerade. Also macht unser Held, was er immer tut, wenn er einer Sache auf den Grund gehen will. Er beginnt zu schreiben – über die Verzweiflung, die ihn in die Knie zwingt, die Wut, den Schmerz, aber auch die Kräfte, die ihm in der Krise zuwachsen, und seinen unerschütterlichen Glauben an die romantische Liebe.
Jan Fleischhauer erzählt in diesem Roman die Geschichte seines Alter Ego, mit Herz und viel Witz und ziemlich schonungslos gegen sich selbst.
Der Autor
JAN FLEISCHHAUER geboren 1962 in Hamburg, studierte Literaturwissenschaft und Philosophie. Seit 1989 gehört er der Redaktion des »Spiegel« an, zunächst als Büroleiter in Leipzig und Berlin, später als Amerika-Korrespondent. Seine wöchentliche Kolumne »Der schwarze Kanal« gehört zu den meistgelesenen Meinungsseiten in Deutschland. Zuletzt erschien der Bestseller »Unter Linken - Von einem, der aus Versehen konservativ wurde«. Fleischhauer lebt in München.
Jan Fleischhauer
Allesist besserals noch ein Tagmit dir
Über die Liebe, ihr Ende und das Leben danach
Knaus
Für alle Liebenden
Dieses Buch ist ein Werk der Fiktion. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig und in keiner Weise beabsichtigt.
»Komödie ist Tragödie plus Zeit.«
Woody Allen
Männer sind von heiliger Einfalt
KAPITEL EINS, in dem der Held feststellt, dass sein Leben auf Sand gebaut ist, und er sich mit dem Gedanken anfreunden muss, seine Frau an einen anderen verloren zu haben
Ich wünschte, meine Frau wäre eine Affäre eingegangen, bevor sie mich verließ. Eine schicksalhafte Verbindung, die sie mir unter Tränen gestanden hätte und gegen die, wie ich hätte einsehen müssen, unsere Ehe keine Chance mehr gehabt hätte: Das hätte ich verstanden. Nicht gebilligt, aber verstanden. Leider war ich wieder an allem allein schuld, wie sich herausstellen sollte.
Sicher, es muss schrecklich sein, wegen jemand anderem im Stich gelassen zu werden. Man zermartert sich das Hirn, was der oder die Neue besitzt, das man selber nicht hat oder vielleicht nie hatte. Man stellt sich vor, wie die Intimitäten und Geheimnisse, die einen als Paar haben zusammenwachsen lassen, langsam durch einen neuen Schatz an Intimitäten und Geheimnissen ersetzt werden, der so lange gedeiht, bis die alten Gemeinsamkeiten derart verblasst und vergilbt sind, dass es gar nicht mehr auffällt, wenn sie auf dem Komposthaufen der Geschichte landen. Ganz sicher ist er oder sie auch eine Granate im Bett.
Aber eine Affäre als Trennungsgrund hat ihre Vorteile. Man weiß, woran man ist. Keine Ausflüchte mehr. Kein Grund, sich länger etwas vormachen zu lassen. Außerdem bekommt die Wut über die Trennung, diese maßlose, jede Luft verzehrende Flamme aus Hass, Selbstmitleid und Weltanklage, ein Ziel. Wenn man mich fragt, ist es besser, einen Flammenwerfer in Händen zu halten als eine Handgranate. Eine Handgranate kann sich immer gegen einen selber richten, ein Flammenwerfer eher nicht.
Ich habe mich im Sommer vor sechs Jahren von meiner Frau getrennt. Na ja, das stimmt nicht ganz. Meine Frau hat sich von mir getrennt, was die Sache für mich nicht einfacher machte. Es war eine schockierende Erfahrung, die ich nicht meinem ärgsten Feind wünsche. Noch heute schrecke ich manchmal nachts mit dem Gedanken auf, dass alles wieder von vorne beginnt. Kein Ereignis hat mich so erschüttert wie das Ende meiner Ehe. Es war eine im wahrsten Sinne lebensverändernde Erfahrung. Ich weiß nicht, ob meine Frau das im Sinn hatte, als sie sich von mir verabschiedete. Wenn ja, dann hat sie erreicht, was sie wollte.
Ich habe meine Frau sehr geliebt, ein Teil von mir liebt sie vermutlich noch immer. Ich dachte, wir würden bis zum Ende zusammen bleiben, trotz aller Schwierigkeiten, die unsere Ehe mit sich brachte. Heute leben wir in zwei Städten: ich in München, sie in Frankfurt, beide gleich weit entfernt von unserer Berliner Wohnung, die jetzt einer netten älteren Dame gehört, von der ich nicht mehr weiß, als dass ihr Onkel Vicco von Bülow war, den die meisten Menschen unter seinem Künstlernamen Loriot kennen.
Für die meisten Menschen ist eine Scheidung die größte Katastrophe in ihrem Leben, so wie ich wissen sie es am Anfang nur noch nicht. Kein anderes Ereignis hat, wenn es einen schließlich ereilt, solch verheerende Auswirkungen, von schweren Unfällen und Krankheiten einmal abgesehen. Alles, worauf sich das gewohnte Leben gründete, wird mit einem Schlag infrage gestellt. Verloren ist die gesellschaftliche und emotionale Sicherheit, die eine Ehe mit sich bringt, selbst wenn sie unglücklich verläuft. Vieles, was bis dahin selbstverständlich erschien, muss neu erlernt werden. Finanziell droht der Ruin.
Man kann sich immer noch Schlimmeres vorstellen. Man kann einen Arm verlieren oder das Augenlicht. Ein naher Mensch stirbt. Manch Unglücklicher zieht sich im Laufe des Lebens ein quälendes, lebensverkürzendes Leiden zu. Aber das sind Schicksalsschläge, gegen die man sich nicht wappnen kann. Die Scheidung gehört zu der Art von Katastrophe, die Menschen sich selber zufügen. Sie ist, was die Wahrscheinlichkeit ihres Eintreffens angeht, auch bei Weitem die gewöhnlichste. Vielleicht wird sie deshalb so oft unterschätzt.
Wie immer, wenn etwas in die Brüche geht und großer Schmerz folgt, führt es einen an seine Belastungsgrenzen. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe es am eigenen Leib erfahren. Man lernt sich selbst ganz neu kennen, manchmal besser, als einem lieb ist. Das gilt für den Menschen, mit dem man bis eben noch verbunden war, leider auch.
Es soll Fälle geben, in denen ein Paar einvernehmlich beschließt, getrennte Wege zu gehen. Es gibt ja auch Italiener, die ihr Geld zusammenhalten, und Babys, die vom ersten Tag an durchschlafen. In der Regel folgt dem Entschluss allerdings eine Auseinandersetzung, bei der alle Übereinkommen, die zur Einhegung von Gewalt und Terror getroffen wurden, schlagartig außer Kraft gesetzt sind. Wer den völligen Zusammenbruch menschlicher Zivilisation erleben will, muss nicht nach Nigeria oder in den Kongo fahren. Es reicht, einen Tag an einem deutschen Familiengericht zu verbringen.
Eine Trennung setzt alle möglichen Formen von Emotionen frei, das Bedürfnis nach Rache zuallererst, dazu Angst, Wut, Hass. Es sind zerstörerische Gefühle, die einen überwältigen, wenn man verlassen wird. Aber auch derjenige, der verlässt, findet so schnell keinen Frieden. Am Anfang fühlt er sich schuldig, doch das hält nicht lange, wie einem der Psychologe sagen kann. Dann folgt Verachtung für den anderen, der sich nicht in sein Schicksal fügen will, schließlich ebenfalls Wut und tiefe Abneigung, weil man ja vor sich selbst eine Rechtfertigung braucht, warum die Trennung unausweichlich war. Einen guten Menschen verlässt man nicht, nur einen bösen.
Irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich entscheiden muss: Ob die Scheidung darüber bestimmt, wie man sich künftig verhält, man also zum Monster wird – oder man sein Schicksal in die Hand nimmt und versucht, das Beste daraus zu machen. Es ist wie in einem biblischen Gleichnis. Man kann den Moment der Entscheidung hinauszögern, sich Bedenkzeit erkaufen, irgendwann hilft es nichts mehr. Dann muss man seine Wahl treffen. Aber lassen Sie uns an diesem Punkt den Dingen nicht zu weit vorgreifen.
Kennen Sie »Sodbrennen« von Nora Ephron? Es ist eines der besten Bücher über Scheidung, das ich gelesen habe, und Sie können mir glauben: Ich habe viele Bücher zu dem Thema gelesen. Ephron, die Frau, der wir den Film »Harry und Sally« verdanken, war im siebten Monat schwanger, als sie entdeckte, dass ihr Mann sie mit einer Bekannten betrog. Bei Durchsicht seiner Unterlagen war sie auf die Widmung in einem Kinderbuch gestoßen, das ihr Mann von seiner Geliebten geschenkt bekommen hatte. »Mein Liebling«, lautete die Widmung, »ich wollte Dir etwas schenken, um zu markieren, was heute passiert ist und was unsere Zukunft so viel klarer erscheinen lässt.« Wie sich herausstellte, war die besondere Sache, die unbedingt markiert werden musste, der Kauf einer Schlafcouch für ein heimlich angemietetes Büro, das sich das Paar als Liebesnest einzurichten gedachte.
Selbstverständlich ist es eine scheußliche Sache, als Schwangere ausgerechnet in einem Buch mit Kinderliedern das Fait accompli zu entdecken, das eine Ehe zum Einsturz bringt. Um so ein Beweisstück als besondere Widerwärtigkeit zu empfinden, muss man nicht schwanger sein. Aber in jeder Entdeckung steckt auch eine Erlösung. Schlimmer als der Betrug ist die Gutgläubigkeit des Betrogenen, die zum Schaden Spott addiert. Wie Ephron schreibt, wusste sie jetzt wenigstens, wer daran schuld war, dass ihr Mann ganze Nachmittage auf der Suche nach neuen Socken verbracht hatte, ohne jemals mit Socken nach Hause zu kehren: Thelma, die einen Nacken »wie eine Giraffe« hatte und Füße so breit wie ein Wisent und die mindestens zwei Kopf größer war als Noras Buch-Ehemann Mark, der in Wirklichkeit Carl hieß, und über den man nun in »Sodbrennen« nachlesen kann, dass er sogar »mit einer Jalousie Sex haben konnte«.
Was hätte ich dafür gegeben, einmal so vom Leder ziehen zu dürfen. Was wäre es mir für eine Freude gewesen, mich über den Nichtsnutz auszulassen, der unsere Ehe auf dem Gewissen hatte, weil er seine Hände nicht von meiner Frau lassen konnte, wofür er in einer anderen Zeit eine Kugel zwischen die Augen verdient hätte, und der dann auch noch die Kühnheit besaß, ihr das Blaue vom Himmel zu versprechen, so dass sie alles zurückließ, was ihr eben noch heilig gewesen war.
Leider existierte bei uns keine Thelma. Oder, in dem Fall, ein Theodor. Wie mir meine Frau wieder und wieder versicherte, gab es nur einen einzigen Grund, warum es mit uns nicht weitergehen konnte, und das war ich. Kein Händchenhalten mit dem Nebenbuhler, keine Schmetterlinge im Bauch, die sie daran erinnerten, was sie über die Jahre vermisst hatte: Alles, was es brauchte, um sicher zu sein, dass diese Ehe hier und jetzt enden musste, war ein Blick auf mich.
»Lieber hocke ich allein in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Kreuzberg, als noch einen Tag mit dir zusammenzuleben.« Das waren die Worte, mit der Ella ihre Entscheidung begründete. Wir standen in unserer Küche. Sie hielt sich an der Kochinsel fest, die wir mit dem Architekten in der Mitte des Raumes platziert hatten. Ein Block im Wert von 5000 Euro, der bald den Besitzer wechseln würde, zusammen mit dem Backofen, der bei Bedarf auf Dampfkochen umspringen konnte, und dem Wok-Gasfeld, das aus unserer Küche im Handumdrehen eine chinesische Garstation machte. In dem Moment ahnte ich noch nicht, dass ich den Kreuzberger Verhältnissen schon bald sehr viel näher sein würde als meine Frau.
Zorn ist eine mächtige Waffe. Als Nietzsche von der »Umwertung aller Werte« schrieb, kannte er keine zur Trennung entschlossenen Frauen. Hätte er sie gekannt, wäre ihm sofort klar gewesen, wie kolossal richtig er mit seiner Betrachtung lag. Egal wie haltlos die Positionen zunächst auch sein mögen: Irgendwie drehen es Frauen es immer so hin, dass sie am Ende die Betrogenen sind. Ich meine das nicht als Kritik. Ich bewundere das, ehrlich. Wahrscheinlich würde die deutsch-polnische-Grenze heute irgendwo bei Königsberg verlaufen, wenn nach dem Mauerfall eine über ihren Mann erboste Frau mit den Siegermächten abschließend über das deutsche Staatsgebiet verhandelt hätte.
»Sag mir eine Sache, die ich falsch gemacht habe!«, rief meine Frau bei einer der Gelegenheiten, als es darum ging, die moralische Bühne für die unausweichlich folgenden Auseinandersetzungen zu bereiten.
»Nenn mir nur eine einzige Sache, die du mir vorwerfen kannst.«
Was soll man auf so einen Satz antworten? Ich war ratlos.
Haben wir nicht von Kindheit auf gelernt, dass es in Konflikten kein Schwarz und Weiß gibt? Heißt es nicht, wer auf andere mit dem ausgestreckten Zeigefinger zeigt, deutet mit drei Fingern auf sich selbst zurück? Aber hier stand Ella, meine Frau seit anderthalb Jahrzehnten, und erklärte ohne den Anflug eines Zweifels, dass sie über die Jahre alles versuchte habe, unsere Ehe zu retten, bis ihr am Ende kein Ausweg blieb, als ihre Rettungsbemühungen einzustellen. Diese Aussage erwischte mich kalt. Es war so, als ob jemand am Anfang des 21. Jahrhunderts noch immer behauptete, es gebe nur zwei Geschlechter. Oder in Abrede stellen würde, dass sich die Erde erwärmt. Sie müssen zugeben, Sie wären auch sprachlos.
Beziehungsmäßig war die Konfliktlage damit allerdings geklärt: Meine Frau war Polen, ich das Dritte Reich. Mit dem Dritten Reich hatte man ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr verhandelt. Mit Nazis verhandelt man nicht, wie die Geschichte lehrt. Mit Nazis macht man kurzen Prozess. Oder besser gesagt: Man bereitet sich auf einen langen, erbarmungslosen Krieg vor, der einen viel Blut, Schweiß und Tränen kosten wird, bevor man schlussendlich den Sieg in Händen hält.
»Wir werden an den Stränden kämpfen, wir werden auf den Straßen und auf den Feldern kämpfen, wir werden in den Hügeln kämpfen, wir werden uns nie ergeben«, hatte Churchill seinen Landsleuten mit auf den Weg gegeben, als er seine Entscheidung verkündete, alle Friedensangebote abzulehnen. Ella hatte die Lehren aus der Geschichte parat. Unser Kampf begann in der Küche, setzte sich im Hausflur fort, griff auf das Schlafzimmer, das Wohnzimmer und das Dach über, verlagerte sich auf die Straße, schloss Freunde, Bekannte und dann weitere Familienmitglieder ein, bevor er sich auf juristischem Gelände festbiss, wo, wie jeder Scheidungsveteran weiß, die Entscheidungsschlacht ausgetragen wird.
Tatsächlich hatte meine Frau wohl einen anderen Mann kennengelernt, bevor sie mich verließ. Aber als ich darauf kam, nützte mir dieses Wissen nichts mehr. Das Schlimmste lag da schon hinter mir. Die Anwälte hatten die Papiere ausgearbeitet. Das Einzige, was noch ausstand, war die formelle Entscheidung der Richters. Oder wir waren sogar schon vor Gericht gewesen, als ich ins Bild gesetzt wurde, ich weiß es nicht mehr. Die Erinnerung ist eine graue Katze. Was ich noch weiß, ist, dass ich so froh war, die Trennung überstanden zu haben, dass das Letzte, was ich mir wünschte, ein Streit über die Frage war, wann und mit wem alles begonnen hatte. Obwohl es mich natürlich brennend interessiert hätte. Wer will nicht wissen, gegen wen er ausgetauscht wurde und warum?
Nennen wir ihn Marc. Das scheint mir ein angemessener Name.
Beim Essen in dem italienischen Lokal, in dem wir uns jetzt trafen, wenn wir uns sehen wollten, erwähnte meine Tochter Julia eines Abends beiläufig, dass sie seit Kurzem zu dritt wohnten. Damit war die Katze aus dem Sack, wie man so schön sagt.
»Wie, zu dritt?«, fragte ich verblüfft.
»Vergangene Woche ist Marc bei uns eingezogen«, antwortete Julia in dem Ton jugendlicher Lässigkeit, in dem man seine Eltern über eine verhauene Mathearbeit aufklärt.
Aus meinem Blick muss sie geschlossen haben, dass die Mitteilung über die personellen Veränderungen im mütterlichen Haushalt von dem ihr gegenübersitzenden Vater doch nicht ganz so selbstverständlich aufgenommen wurde, wie sie dies angenommen hatte. Schnell schob sie nach, dass der neue Mitbewohner seine eigene Wohnung behalten werde; man wolle diese untervermieten, ein Mietkandidat sei auch schon gefunden. Als lasse diese Abfolge praktischer und für jedermann einsichtiger Schritte die ganz Sache in einem milderen, weniger spektakulären Licht erscheinen.
Ich kann nicht sagen, dass mich die Erkenntnis wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf. Natürlich, Marc! Es lag alles so nah, wenn man eins und eins zusammenzählte.
Marc war das, was man einen Hausfreund nennt. Ein Bekannter unseres Nachbarn, der immer zum Blumengießen vorbeischaute, wenn der Nachbar auf Reisen war. Irgendwann bot Marc an, auch bei uns nach den Pflanzen zu sehen, wenn Urlaube ins Haus standen – eine Gefälligkeit, für die wir uns mit einer Kiste Wein und einer Karte revanchierten. Manches Klischee ist so wahr, dass nicht einmal die Wirklichkeit dagegen ankommt.
Ich gebe zu, ich habe ihn nie richtig wahrgenommen. Er wirkte wie der ewige Student, freundlich, aber ohne ein Charakteristikum, das mich veranlasst hätte, mehr als ein paar Sätze mit ihm zu wechseln. Lange wusste ich nicht einmal seinen Nachnamen. Jetzt weiß ich ihn: Kathenhusen, wie aus einem Roman.
Später hieß es, Marc habe Karten fürs Theater. Marc hatte immer die richtigen Theaterkarten, wie sich zeigte. Ich habe mich nie wirklich fürs Theater interessiert. Ich weiß, ich hätte mich interessieren sollen, das sagt auch meine beste Freundin Sahra. Möglicherweise wäre ich heute noch mit meiner Frau zusammen, wenn ich mehr Begeisterung für das deutsche Regietheater und die Stücke der Saison gezeigt hätte. Berlin hat in dieser Hinsicht wirklich viel zu bieten. Zeitkritik, wohin man blickt. Schauspieler, die im kritischen Auftrag durch Bäche von Schweineblut waten. Akteure, die sich die Kleider vom Leibe reißen, um das kapitalistische System zu demaskieren.
Leider mache ich mir weder etwas aus Schweineblut noch aus Nacktheit auf der Bühne. Nach meiner Erfahrung gehört es zu den bedauerlichen Grundsätzen des Lebens, dass sich im Theater und am Strand immer die Falschen ausziehen. Wenn man mich fragt, scheint das ein Gesetz der Moderne zu sein, mit dem sich die Absurdität der menschlichen Existenz gut zusammenfassen lässt. Ich weiß, solche Gedanken sollte ich lieber für mich behalten. Selbst Sahra zieht die Stirn kraus, wenn ich so etwas sage. »Elender Reaktionär«, sagt sie dann, und sie meint das weniger neckisch, als ihre Stimme vermuten lässt.
Marc seinerseits war bei mindestens drei Berliner Bühnen treues Mitglied im Abonnement. Ich bin sicher, er kann noch mitten in der Nacht, wenn man ihn weckt, alle Pollesch-Inszenierungen der vergangenen zehn Jahre aufsagen und fehlerlos herunterbeten, welche Rollen Sophie Rois gespielt hat, bevor sie in der »1. sozialistischen Butterfahrt der M/S Clara Zetkin« groß herauskam. Keine Frage, dass so jemand auch einfühlsam auf Frauen zugeht, die in ihrer Ehe schrecklich unglücklich sind. Was gibt es für einen schöneren Ort, den Gleichklang der Herzen zu entdecken, als das Parkett der Berliner Schaubühne?
Ich wünschte, ich könnte über Marc Kathenhusen wenigstens sagen, dass er wie Thelma riesige Füße hat. Oder Hände wie ein Elefantenmensch. Oder dass er auf irgendeine andere Art und Weise verunstaltet ist. Tatsächlich sieht er ganz normal aus. Leute, die weniger voreingenommen sind als ich, würden vermutlich sogar meinen, er sei ziemlich gut aussehend. Er ist auch nicht wesentlich älter als meine Frau oder von Gebrechen gepeinigt, die darauf schließen lassen, dass sie ihn in naher Zukunft aufopfernd pflegen müsste. In Wirklichkeit ist er sogar deutlich jünger als sie.
Um genau zu sein: Er ist zwölf Jahre jünger.
Wie ich feststellen musste, lässt sich für mich nicht einmal aus dieser Tatsache Kapital schlagen. Mag sein, dass ältere Frauen mit Vorurteilen zu kämpfen haben, wenn sie sich bei der Partnerwahl beim Lebensalter nach unten orientieren. Moralisch schlägt der Altersunterschied nicht zu ihren Lasten aus. Ein Mann, der seine Frau für eine Jüngere im Stich lässt, ist ein Dreckskerl, der Probleme mit dem Älterwerden hat. Eine Frau, die sich auf einen Jüngeren einlässt, ist einfach eine Frau, die ihrem Herzen folgt.
Für die Kinder ist es nie einfach, wenn ein Elternteil durch jemand anderen ersetzt wird. Das gilt erst recht, wenn der oder die Neue altersmäßig heranrückt. Ich erinnere mich, wie mir ein Kollege von der eigenartigen Situation berichtete, als ihn seine Mutter darüber in Kenntnis setzte, dass sie einen deutlich jüngeren Partner gefunden hatte. Wenn es im Büro jemand gibt, der Verständnis für die Vielfalt der Beziehungen hat, dann der ehemalige »taz«-Redakteur »Bommi« mit seiner ungebrochenen Sympathie für alles Revolutionäre.
»Ich habe einen neuen Freund«, sagte die Mutter zu ihm.
»Das freut mich sehr für dich«, antwortete er.
»Er ist jünger als ich«, sagte sie.
»Das macht doch nichts, Mama«, antwortete er, noch immer ganz der abgeklärte Sohn von Welt.
»Er ist auch jünger als du.«
Gut, so weit war es bei uns nicht gekommen. Aber auch zwölf Jahre sind ein beträchtlicher Abstand. Noch lange nach unserer Scheidung habe ich mich mit der Vorstellung getröstet, dass die Zeit bei Ella ihr zerstörerisches Werk mit dem unbarmherzigen Gleichmut der Jahre verrichten würde, wenn nicht morgen, dann eben übermorgen. Ich bitte in dieser Hinsicht um Nachsicht. Nur Heilige und eingeschworene Margot-Käßmann-Fans, die sogar dem Taliban Versöhnung anbieten würden, sind auch als Betrogene von allen Rachegedanken frei.
Die Ausgangsbedingungen für eine stabile Partnerschaft waren bei Marc und Ella nicht gut, da war ich mir mit meiner Freundin Sahra einig. Sahras Urteil in Beziehungsdingen ist nahezu untrüglich. Manchmal sieht sie schon Monate vor den Beteiligten die Risse an der Wand.
»Er trägt jetzt die Haare kürzer«, bemerkte sie neulich über einen gemeinsamen Freund in dem Ton, mit dem man gewöhnlich eine bedeutsame Entdeckung annonciert.
»Ja, und?«, sagte ich.
»Er hat eine Affäre.«
»Woher willst du das wissen?«
»Warte es ab.«
Sechs Wochen später saß unser Freund in einem Hotelzimmer, wo er zu begreifen versuchte, wie sein Leben nun weitergehen sollte, während seine Frau sich vom Anwalt betreuen ließ. Unheimlich. Aber auch unheimlich beeindruckend.
Nora Ephrons Freundin Betty konnte an der Sitzordnung bei einem Abendessen erkennen, wie Liebesdinge standen. Oder wer drauf und dran war, seinen Job zu verlieren. Einmal bemerkte Betty nach einem Cocktailempfang, so erzählt es Ephron in »Sodbrennen«, dass der Gesundheitsminister kurz davor stehe, entlassen zu werden. Der Beweis? Die Frau des Vizepräsidenten hatte dem Mann nach der Begrüßung auf die Schulter geklopft. »Wenn dir als Mitglied des Kabinetts auf die Schulter geklopft wird, dann bist du echt in Schwierigkeiten«, war Bettys Kommentar. Auf die heimliche Affäre einer gemeinsamen Bekannten schloss sie beim Blick auf deren Beine, die so makellos gewachst waren, als stehe eine Woche Strandurlaub an. Und das im Winter.
Dem Gesundheitsminister blieben nach dem Empfang noch drei Tage bis zu seiner Entlassung. Auch im Fall der Frau mit den makellosen Beinen hatte Betty ins Schwarze getroffen, wie sich bald erwies. Was Betty leider nicht vorhergesehen hatte, war, dass es sich bei der Ehefrau, die bei dem Techtelmechtel die Betrogene war, um ihre Freundin Nora handelte. Irgendjemand bleibt bei einer Affäre immer auf der Strecke, das haben Dreiecksbeziehungen leider so an sich.
Man muss sagen: Gut, dass Betty und Sahra nie aufeinander gestoßen sind. Nicht auszudenken, was das für die Scheidungsquote in unserem Stadtteil bedeutet hätte. Manchmal ist es das Beste, die Dinge bleiben unter dem Teppich. Wenn die Menschen besser Geheimnisse bewahren könnten, würde allen viel erspart bleiben.
Auch was die Beziehung älterer Frauen zu jüngeren Männern anging, war sich Sahra sicher: Das kann nicht halten.
»Wer sich mit Mitte dreißig auf die Beziehung zu einer 47-Jährigen einlässt, muss auf vieles verzichten, was für andere Männer dieses Alters normal ist«, sagte Sahra. »Er kann keine eigenen Kinder haben. Er muss die Blicke seiner Umgebung ertragen, die sich insgeheim fragen, ob er einen Mutterkomplex hat.«
Ich gebe zu, es hätte mir keine schlaflosen Nächte verursacht, wenn meine Frau zur Abwechslung die Verlassene gewesen wäre. Ich sah das Ende genau vor mir: Mit einem Schlag wäre für Ella alles aus, und sie würde sich fragen, ob das Abenteuer mit Marc es wert gewesen war, auf die Sicherheit einer Beziehung zu verzichten, die bis ins hohe Alter Bestand gehabt hätte. Selbstverständlich würde ich Mitleid empfinden. So eine Trennung ist immer eine schreckliche Angelegenheit, wer wüsste das nicht besser als ich. Aber kein Wort des Triumphs oder der Genugtuung. Nicht eine Silbe! Alles, was Ella von mir zu hören bekäme, wäre vornehme Anteilnahme.
Aber auch den Gefallen hat sie mir nicht getan. Eine Zeit lang hängte ich meine Hoffnung noch an die Tatsache, dass Marc seine eigene Wohnung behalten hatte. Statt alles aufzugeben, wie man das macht, wenn man zusammenzieht, hatte er seine alte Bleibe nur untervermietet. Das sah verdächtig danach aus, als ob sich hier jemand eine Rückfalloption offen halten wollte.
Dann war auch die Zweitwohnung weg. An einem Wochenende waren die Packer erschienen, wie ich bei einem unserer Abendessen beiläufig von Julia erfuhr, und hatten alles, was von Wert war, in den Wagen geladen. Vier Jahre leben Ella und Marc nun zusammen, ohne jedes Anzeichen, dass sich daran etwas ändern würde. Ich muss mir langsam eingestehen, dass sogar Sahra sich täuschen kann.
Im Nachhinein bin ich selber verblüfft über meine Leichtgläubigkeit. Wie konnte ich übersehen, was offenkundig war?
Es ist nicht so, dass es keine Hinweise auf einen anderen Mann gegeben hätte. Ach, was heißt Hinweise: Ein Leuchtfeuer an Beweisen hatte meine Frau hinterlassen.
Einmal lag ihr Handy auf dem Küchentisch, als eine Nachricht auf dem Display erschien, bei der ein Blick genügte, um zu erkennen, dass es sich nicht um die Erinnerung an einen Tennistermin handelte. Ich kann den genauen Wortlaut nicht mehr wiedergeben, aber die Botschaft war eindeutig.
Ich habe es dennoch vergeigt. Statt das Telefon an mich zu nehmen, um gewissenhaft alle Nachrichten auszuwerten und Kopien anzulegen, stürmte ich ins Wohnzimmer, um Ella das Beweisstück entgegenzuhalten.
Was für ein Anfängerfehler! Schade, dass man aus Krimiserien so wenig lernt. Die Sicherung des Tatorts ist bei einem Verbrechen bekanntlich das erste Gebot der Stunde. Ich kann nur jedem raten, sich in einer vergleichbaren Situation nicht von der Erregung des Augenblicks hinwegtragen zu lassen.
Ella versuchte gar nicht erst, Entrüstung zu heucheln, dass ich ihre SMS gelesen hatte. Sie verlegte sich auf die kopfschüttelnd vorgetragene Behauptung reiner Unschuld. Ihre Freundin Caro habe ihr die Nachricht geschickt. Ich wüsste doch, dass Caro an einem Buch sitze, in dem es um eine Affäre zwischen zwei Frauen gehe. Was ich als geheime Liebesbotschaft missverstehen würde, sei in Wahrheit Teil von Caros Buchprojekt, ein Spaß unter Freundinnen.
Kann man sich eine lachhaftere Erklärung ausdenken? Aber ich war verunsichert. Es hätte die Telefonnummer des Absenders gebraucht, um Ella der Lüge zu überführen. Oder besser noch: den Mailverkehr, der dem verräterischen Satz mutmaßlich vorausgegangen war. Es bedurfte nicht viel kriminalistischen Verstandes, um zu vermuten, dass im Telefon weitere Liebesschwüre gespeichert waren, aus denen man bei ein wenig Umsicht den Verlauf der Affäre bis zu ihren Anfängen hätte rekonstruieren können.
Stattdessen stand ich mit leeren Händen da. Der Moment der Überrumpelung war verstrichen. Wenn es je eine Chance gegeben hatte, meine Frau unter dem Schock der Entdeckung zum Geständnis einer Liebschaft zu bewegen, war diese Chance durch mein tölpelhaftes Verhalten zunichte gemacht. Damit blieb das Thema erledigt. Alle Einwände und Insinuationen meinerseits galten fortan nur als der hilflose Versuch, einen Vorwurf am Leben zu halten, von dem doch längst erwiesen war, dass er jeder Grundlage entbehrte.
Einer Frau wäre das nicht passiert, da bin ich sicher. Frauen haben einen siebten Sinn, was den Betrug angeht. Ich weiß, das klingt nach einem schlimmen Geschlechterklischee, aber es ist die Wahrheit. Männer sind in Beziehungsdingen oft von einer heiligen Einfalt. Man muss sie schon mit der Nase darauf stoßen, dass sie hintergangen werden, damit sie aufwachen. Vielleicht trauen sie ihrer Frau die Fremdgeherei nicht zu. Oder es mangelt ihnen generell an Fantasie. Beides wären keine schmeichelhaften Erklärungen.
Keine Ahnung, ob Frauen auch bessere Betrüger sind als Männer. Jedenfalls sind sie die gewissenhafteren. Ein Mann hätte irgendwann aus Schusseligkeit oder aus Gedankenlosigkeit die Deckung fallen lassen. So zu tun, als ob, erfordert nicht nur Vorstellungsvermögen, es braucht dazu vor allem Disziplin. Wie so oft im Leben scheitern die besten Vorhaben häufig an mangelnder Achtsamkeit für die Details.
Bis heute beharrt meine Frau darauf, ein Leben in Einsamkeit einem Leben mit mir vorgezogen zu haben. Ella würde sich lieber die Zunge abbeißen, als meine Vermutung zu bestätigen, dass Marc schon als Partner in Betracht kam, bevor sie mich verließ. Das ist jetzt die Wahrheit, wie auch ich sie zähneknirschend anerkennen muss. Jeder Anlauf, daran zu rütteln, wäre so vergeblich wie der Versuch, eine Trappistin zur Aufgabe ihres Gelübdes zu bewegen.
Eine Scheidung ist nie vorbei, das mag einem nur so erscheinen. Wenn man Glück hat, schafft man es, zu einem zivilisierten Umgang zurückzukehren. Aber wehe, einer kommt auf ein kritisches Thema zu sprechen, dann stehen die Pforten zur Hölle wieder sperrangelweit offen. Mit einer Trennung ist es wie mit der Kleinstadtidylle in einem Stephen-King-Roman: Von außen betrachtet sieht alles friedlich aus, doch unter der Oberfläche lauern die Monster.
Haben meine Frau und ich eine gute Ehe geführt? Ich würde sagen, ja. Aber schon diese Antwort setzt mich vermutlich ins Unrecht. Wie kann man eine Ehe als gut bezeichnen, die in Scherben endet, weil es einer der beiden Eheleute nicht länger aushält?
Ich weiß, ich stehe hierbei auf verlorenem Posten: Nach meiner Beobachtung sind Männer in Beziehungen einfach duldsamer als Frauen. Man kann ihnen das als Phlegmatismus auslegen, man könnte es aber auch einer höheren Toleranzbereitschaft zuschreiben. Warum nehmen wir vom anderen immer das Schlechteste an? Ich frage mich das wirklich. Es ist ein wenig wie in der Politik. Gibt jemand nach kurzer Beratung die Richtung vor, heißt es, er sei beratungsresistent. Geht er auf seine Mitarbeiter ein und wartet die Meinungsbildung ab, gilt er als unentschieden und führungsschwach. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr neige ich zu der Auffassung, dass man vielleicht doch mehr auf Margot Käßmann hören sollte. Wo dem Taliban ein Vertrauensvorschuss gewährt wird, dürfte auch ich noch eine Chance bekommen. Dafür würde ich sogar im Stuhlkreis Platz nehmen.
Meine Frau und ich hatten unsere Schwierigkeiten als Paar, keine Frage. Welches Paar hat die nicht? Gut, einige Freunde meinten, während wir noch zusammen waren, dass es ein Wunder sei, dass wir uns nicht schon längst hatten scheiden lassen, so wie wir uns stritten. Das schien mir etwas dramatisch ausgedrückt. Aber ich gebe zu, dass sich in einer Beziehung die Perspektive auf das, was normal ist, verschieben kann. Mir erschien es zum Beispiel völlig normal, dass meine Frau mich mitten in der Nacht unsanft weckte, weil sie der Ärger über eine Bemerkung von mir so lange wach gehalten hatte, dass sie es als unfair empfunden hätte, wenn sie diesen Ärger für sich behalten hätte, statt ihn mit mir zu teilen.
Wir konnten aus dem kleinsten Anlass aneinandergeraten. Ein unbedachtes Wort genügte, um einen Streit zu entfachen, der sich zu einem Flammensturm auswuchs, der alle Luft im Umkreis von hundert Metern verzehrte und dessen Glutnester noch Wochen später nicht vollständig erkaltet waren. Dann wiederum konnte die Temperatur so jäh abfallen, dass man sich irgendwann nach einem wärmenden Wutanfall sehnte, weil das Leben im Eheeis noch unerträglicher erschien als das in der Gluthölle des offenen Ehekrachs.
In meinen schlaflosen Nächten bin ich am Computer auf einige aufschlussreiche Studien gestoßen. Es gibt Untersuchungen, wonach häusliche Gewalt mehrheitlich von Frauen ausgeht. Angeblich sind es in Beziehungen in 60 Prozent der Fälle die Frauen, die schlagen. Das ist ein heikles Thema, weil man schnell in den Verdacht gerät, männliche Gewalt verharmlosen zu wollen. Wenn Männer zulangen, hat das aufgrund des Kräfteunterschieds oft gravierende Folgen. Dass ein Mann Zuflucht bei Freunden sucht, weil er von seiner Frau so zugerichtet wird, dass man ihn in der Notaufnahme zusammenflicken muss, kommt hingegen eher selten vor. Für die Männer, die von ihren Frauen geschlagen werden, ist der häusliche Kampf dennoch peinlich. Statt Mitleid erfahren sie oft Spott und Belustigung. Wer lässt sich schon von seiner Frau verprügeln?
Ich muss sagen, ich glaube den Statistiken zur häuslichen Gewalt unbesehen. Ein Freund berichtete mir Jahre, nachdem er sich von seiner Frau getrennt hatte, von Auseinandersetzungen, die jeden Polizeibericht geschmückt hätten. So wie er es schilderte, hatte sich eine verhängnisvolle Dynamik entwickelt: Je mehr seine Frau außer sich geriet, desto ruhiger wurde er. Leider hatte das auf sie keinen beruhigenden Effekt, sondern stachelte sie im Gegenteil nur noch mehr auf. Dass er so ruhig blieb, während sie tobte, empfand sie als besonders hinterhältigen Versuch, sie ins Unrecht zu setzen. Außerdem bewies seine Beherrschtheit aus ihrer Sicht, wie unbeteiligt er in Wahrheit selbst bei der Bewältigung schwerer Krisen war.
Als ich ihn fragte, ob es auch zu Tätlichkeiten gekommen sei, winkte er ab. In der Regel sei es bei Faustschlägen geblieben, deren Spuren man durch lange Oberbekleidung habe verdecken können, klärte er mich auf. Auch mit Bissen lasse sich fertigwerden, wobei es ihn überrascht habe, wie er sagte, welche Blutergüsse das menschliche Gebiss auf einem Oberarm anrichten könne. Eigentlich habe man nur aufpassen müssen, dass seine Frau nicht in die Nähe schwerer Gegenstände oder Messer kam. »Die Küche war so gesehen ein ausgesprochen ungeeigneter Ort für Streitigkeiten, das Schlafzimmer dagegen deutlich empfehlenswerter. Leider befanden wir uns wie die meisten Paare selten im Schlafzimmer, wenn die Dinge eskalierten.«
Auch zwischen meiner Frau und mir konnten die Dinge schnell außer Kontrolle geraten. Einmal flog eine schwere Kasserolle so dicht an meinem Kopf vorbei, dass ich anschließend meinem Herrgott auf Knien dankte, dass er einen Schutzengel geschickt hatte, um die Hand dazwischenzuhalten. Aber was sollte ich mich beklagen? Hätte ich eine sanftere Frau geheiratet, die in der Lage gewesen wäre, ausgleichend und geduldig auf mich und meine Unzulänglichkeiten zu reagieren, wäre mir sicherlich langweilig geworden. Außerdem war die Impulsivität die Kehrseite großer Empfindsamkeit. Ein abgeklärterer Mensch als ich hätte diese Emotionalität zweifellos in die richtigen Bahnen zu lenken gewusst. Zu meinen Lieblingsfilmen gehört »The Hurt Locker« von Kathryn Bigelow über ein Bombenräumkommando im Irak. Leider fehlt mir für den Beruf des Bombenentschärfers die innere Ausgeglichenheit. Im entscheidenden Moment darf man keine Angst zeigen, sonst geht alles in die Luft.
Einer meiner Freunde hat mir später gesagt, er hätte schwören können, dass wir eines der Paare waren, die bis zum Ende durchhielten. Wer sich so in die Haare bekommen habe wie wir, der habe das Schlimmste hinter sich, davon sei er überzeugt gewesen. Als ich ihm dann stockbleich berichtete, dass Ella die Scheidung wollte, war er sprachlos. Er hatte mit allem gerechnet, aber damit nicht. Da ging es ihm wie mir.
Von meiner Tochter weiß ich, dass sich Ella und Marc noch nie gestritten haben. »Nicht ein Mal?«, fragte ich ungläubig, als wir bei einem Abendessen zufällig auf das Thema kamen.
»Nicht ein Mal«, sagte sie.
Vier Jahre sind eine lange Zeit, da kann sich viel ereignen. Einer fährt beim Ausparken eine Beule in den Wagen. Die Katze hat Durchfall, weil wieder mal das falsche Futter im Napf war. Der oder die dafür Ausersehene hat vergessen, rechtzeitig vor dem Urlaub die Zeitungen abzubestellen, so dass der Briefkasten der rumänischen Einbrecherbande schon von Weitem entgegenschreit: Hallo, alle ausgeflogen! Freie Bahn! Manche Leute geraten wegen weniger aneinander. Aber so wie es Julia schilderte, herrschte seit meinem Auszug engelsgleiche Harmonie.
Keine Ahnung, wie die beiden das hinbekommen. Vermutlich sitzen sie jeden Abend beisammen, wenn sie nicht gerade im Theater sind, und lesen sich gegenseitig Entspannungsliteratur vor. Außerdem wurden alle Gesellschaftsspiele in den Keller verbannt. Und Tennis gibt es auch nicht mehr. Wenn meine Frau eines nicht ausstehen konnte, dann, bei einem Wettbewerb zu unterliegen, egal ob es sich um eine Partie Mühle oder ein gemischtes Doppel handelte.
Wahrscheinlich lässt Marc Ella jedes Mal gewinnen. Das würde Marc ähnlich sehen. Er hat übrigens auch meinen Rotwein ausgetrunken, wie ich bei dieser Gelegenheit festgehalten wissen möchte. Ich hatte ein paar schöne Flaschen Pétrus gesammelt. Sie waren etwas zu warm gelagert. Aber ich bin sicher, sie haben immer noch vorzüglich geschmeckt.
Okay, das war jetzt unter der Gürtellinie. Aber wo steht geschrieben, dass man immer fair gegenüber seinem Nachfolger sein muss? Schon dieser Name: Marc. So heißen doch nur Anlageberater oder Leute, die einem überteuerte Versicherungen andrehen wollen.
Jaa, ich gebe es ja zu: Ich bin bei der Bewältigung der Trennung vielleicht doch noch nicht ganz so weit, wie ich dachte.
Was für eine verrückte Anomalie
KAPITEL ZWEI, in dem der Wert der Ehe gepriesen wird und sich der Held der Geschichte daran erinnert, wie hoffnungsvoll einst alles begann
Ich habe meine Frau auf einer Bürofeier kennengelernt. Sie stand mit einem Glas Wein in der Hand am Fenster, und ich wusste sofort, dass ich es mir nie verzeihen würde, wenn ich nicht den Platz neben ihr in Beschlag nähme, bevor jemand anderer das tat. Es war mein Büro, damit war ich strategisch schon mal im Vorteil. Wenn man gewollt hätte, hätte man darin Boule spielen können. Das erschien mir als ein weiteres Plus. Die meisten Menschen schließen von der Zimmergröße auf den Bewohner, so wie sie vom Preis eines Wagens Rückschlüsse auf dessen Fahrer ziehen – das bildete ich mir damals jedenfalls ein. In Wirklichkeit hatte Ella nur Augen für den peruanischen Strickpullover, den ich aus einem unerfindlichen Grund trug und der mich wie einen verhuschten Soziologiestudenten aussehen ließ und nicht wie einen ernst zu nehmenden Politikredakteur, der Bedeutsames über den gesellschaftlichen Umbruch im Osten zu sagen hat. Sie fand das sehr anziehend, wie sie mir sagte, als wir später auf den Tag zurückblickten, an dem alles begann. So kann man sich in Frauen täuschen beziehungsweise bei der Bedeutung von Quadratmetern bei der Partnerfindung.
Ich hatte im Revolutionsjahr 1989 eine Stelle beim »Spiegel« angetreten. Mein erster Artikel handelte von lustigen Ansagetexten auf Anrufbeantwortern. Im zweiten ging es darum, ob sich Bordellbesitzer der Förderung der Prostitution schuldig machen, wenn sie das Bordell zu gemütlich ausstatten. Man kann sich als Jungredakteur seine Themen nicht immer aussuchen. Wahrscheinlich hätte ich als Nächstes etwas zur Alternativkultur übertragen bekommen und später dann, wenn ich mich bewährt hatte, einen ersten politischen Auftrag. Aber dann war die Mauer aufgegangen, und damit hatte sich auch die journalistische Welt schlagartig gedreht. Jetzt waren es die in Hamburg ansässigen Redakteure, die das Nachsehen hatten, während Leute, die jung und unabhängig waren, die großen Geschichten schrieben. Als mich mein Ressortleiter fragte, ob ich nach Leipzig gehen wolle, um von dort aus zu berichten, was aus der DDR werden würde, brauchte ich nicht lange nachzudenken, um einzuschlagen. Wann hat man schon Gelegenheit, direkt danebenzustehen, wenn ein ganzes Gesellschaftssystem abgewickelt wird?
Es war ein großes Abenteuer, anders lässt es sich nicht sagen. Heute weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn alles, worauf man sich verlassen hat, über Nacht nichts mehr gilt. Aber damals empfand ich es nur als unerhört aufregend, an einem Ort zu leben, der für jemanden aus dem Westen bis eben noch ferner gewesen war als Tokio oder Lima.
Der »Spiegel« hatte eine Villa im Süden der Stadt angemietet, die vor dem Krieg dem Verleger Herrmann Julius Meyer gehört hatte, dann einem Nazi, dessen Name zu Recht in Vergessenheit geraten war, und anschließend, nach dem Sieg der Sowjets, dem Kulturbund der DDR. Jetzt saßen wir in dem Haus, drei Redakteure aus Hamburg, alle ledig, keiner älter als dreißig. Wir hatten eine Sekretärin (die ehemalige Leiterin des Kulturbundes), drei Funktelefone (jedes so groß wie ein Backstein) und sämtliche Freiheiten der Welt. So ähnlich müssen sich die jungen Offiziere gefühlt haben, die es mit der vorrückenden Front nach Deutschland verschlagen hatte, habe ich im Nachhinein manchmal gedacht. Der Unterschied war, dass sich unsere Kampferfahrung auf das Umfahren von Schlaglöchern auf der nahe gelegenen Käthe-Kollwitz-Straße beschränkte.
Es gab niemanden, der uns hätte Anweisungen erteilen oder beaufsichtigen können. Im Winter kam zweimal am Tag der Heizer, um Kohlen nachzulegen. Von diesen Unterbrechungen abgesehen, waren wir ungestört. Alles, was wir zu tun hatten, war, am Ende einer Woche die Texte zu liefern, die wir am Montag versprochen hatten. Wenn man zwischendurch nicht erreichbar sein wollte, musste man nur so tun, als ob die Telefonleitungen mal wieder unbrauchbar waren. Um das Funktelefon in Betrieb zu nehmen, bedurfte es eines erhöhten Ortes, vorzugsweise ein Berg oder das Dach eines größeren Hauses. Für kurze Zeit hatte es einen eilfertigen Kollegen gegeben, der für Gespräche mit der Redaktion vor die Stadt fuhr, wo er dann die Antenne nach Westen ausrichtete, in der zitternden Hoffnung, dass in der Zentrale jemand abnahm, der ihm sagte, was zu tun war. Nach drei Monaten im Osten war er wieder Richtung Heimat verschwunden. Wir anderen schickten unsere Texte weiter per Faxgerät und gingen davon aus, dass sie schon ihren Weg ins Blatt fanden. Es gab nie Klagen, also war man mit unserer Arbeit offenbar zufrieden. Am Freitag, wenn alles erledigt war, kauften wie einige Kisten Bier und Wein und öffneten das Haus für alle, die Party machen wollten.
Ein Kollege von der »Welt« hatte Ella mitgebracht. Sie war seit einem halben Jahr als Unternehmensberaterin in Leipzig, um dem Maschinenbaukombinat Takraf beim Übergang in die neue Zeit zu helfen. Meinetwegen hätte Ella auch eine Immobilienspekulantin sein können, wie sie in diesen Tagen in Scharen über die Stadt herfielen, oder ein Hai von der Treuhand. Ich war vom ersten Moment an hingerissen. Ihre Augen, der Mund, die Stimme; die Art, wie sie sprach, rauchte, lachte: Ich fand alles an ihr zum Niederknien.
Dass sie keine Journalistin war, sprach aus meiner Sicht ebenfalls für sie. Ich bin in meinem Leben noch nie mit einer Journalistin zusammen gewesen. Mir reicht es, dass ich den ganzen Tag am Schreibtisch verbringe, da bin ich für Abwechslung dankbar. Außerdem kommt in Journalistenbeziehungen unweigerlich die Frage auf, wer besser schreiben kann. Es gibt genug Probleme im Zusammenleben, man muss sie nicht mutwillig vergrößern. Wenn beide denselben Beruf ausüben, kann es nicht ausbleiben, dass man sich vergleicht.
Beinahe wäre die Sache zwischen uns noch schiefgegangen. Statt gleich am nächsten Tag bei ihr anzurufen, ließ ich fast eine Woche verstreichen, bis ich mich wieder meldete. In der Zwischenzeit hatte ein Bekannter, der versuchte, in Leipzig sein Glück als Steueranwalt zu machen, die Initiative ergriffen und sich mit Ella zum Abendessen verabredet. Weil sie am Telefon dachte, er sei ich, hatte sie spontan zugesagt. Erst als sie sich beim Chinesen gegenübersaßen, bemerkte sie ihren Fehler. Aus meiner Sicht war der Bekannte ein furchtbarer Aufschneider, insofern passte die Verwechslung ins Bild. Aber man weiß ja nie: Frauen fallen manchmal auf die seltsamsten Typen rein. Außerdem kannte er sich mit Kunst aus, oder er tat jedenfalls so. Kunst zieht immer, besser noch als Theater oder Literatur. Die Verbindung von Hochkultur und der Launenhaftigkeit der Börse, an der mit einem Federstrich Millionen gemacht werden können – das ist eine Kombination, die sogar Steueranwälten zusagt. Es ging dann noch einmal gut aus, weil ich nach fünf Tagen schließlich zum Telefon griff und Ella und ich den Abend in der richtigen Besetzung wiederholen konnten.