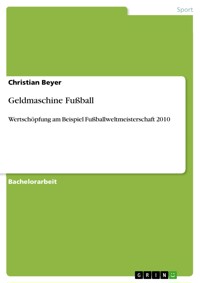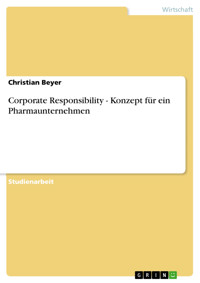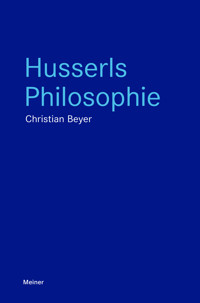
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Band bietet eine einführende Übersicht über Edmund Husserls transzendentale Phänomenologie. Ausgangspunkt und zentraler Text ist die deutsche Erstübersetzung des umfassenden und viel konsultierten Artikels über Husserl in der »Stanford Encyclopedia of Philosophy«. Die nachfolgenden Kapitel vertiefen einzelne Abschnitte dieses Artikels und stellen Bezüge zur neueren analytischen Philosophie her: So geht es zunächst um Husserls Auffassung von Konzepten wie Begriff, Bedeutung, Erfüllung, Lebenswelt, Indexikalität, propositionaler Gehalt und Singularität. Beyer liefert hier die weltweit wohl erste Rekonstruktion von Husserls Konzeption des Gehalts im Sinne des Externalismus (also der Auffassung, wonach die wahrgenommene Umwelt den Bedeutungsgehalt mitbestimmt). Das folgende Kapitel vertieft die Themen Bewusstsein und Zeitbewusstsein, das anschließende behandelt phänomenologische Epoché und Reduktion; dieses Kapitel kann auch als allgemeine Einführung in Husserls transzendentale Philosophie gelesen werden. Anschließend geht es um Personalität und Lebenswelt, Einfühlung und Intersubjektivität sowie Ethik und Wertlehre bei Husserl. Das letzte Kapitel vertieft die Themen Wahrheit, Existenz und Erfüllung, Noema und transzendentaler Idealismus. Der Autor vertritt hier die These, dass Husserl selbst als analytischer Philosoph gelten kann, und kritisiert seinen »Beweis« für den transzendentalen Idealismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Beyer
Husserls Philosophie
Meiner
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über ‹http://portal.dnb.de› abrufbar.
ISBN 978-3-7873-4924-1
ISBN eBook 978-3-7873-4923-4
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2025. Alle Rechte vorbehalten. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übertragungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, soweit es nicht §§ 53, 54 UrhG ausdrücklich gestatten.
Konvertierung: satz&sonders, Dülmen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1: Edmund Husserl
1. Leben und Werk
2. Reine Logik, Sinn, anschauliche Erfüllung und Intentionalität
3. Indexikalität und propositionaler Gehalt
4. Singularität, Bewusstsein und Horizont-Intentionalität
5. Die phänomenologische Epoché
6. Epoché, Wahrnehmungs-Noema, Hýle, Zeitbewusstsein und phänomenologische Reduktion
7. Passivität vs. Aktivität
8. Kommunikation, Sozialität, Personalität und persönliche Werte
9. Einfühlung, Intersubjektivität und Lebenswelt; Ethik und Wertlehre
10. Die intersubjektive Konstitution der Objektivität und das Argument für den „transzendentalen Idealismus“
Kapitel 2: Husserl über Begriffe
1.
2.
3.
4.
Kapitel 3: Eine neo-husserlianische Theorie der referentiellen und der demonstrativen Bezugnahme
1.
2.
3.
Kapitel 4: Husserls Konzeption des Bewusstseins
Kapitel 5: Husserls transzendentale Phänomenologie im Lichte der (neueren) Erkenntnistheorie
Kapitel 6: Einfühlung und das Verstehen einer Person
1. Husserls Ethik
2. Personenverstehen und Umwelt
3. Einfühlung und Personenverstehen
Kapitel 7: Husserl über Existenz und Existenzurteile
Einleitung
1. Singuläre Existenzaussagen
2. Husserls Lesart von Brentanos Existenzauffassung
3. Der „scharfsinnige Frege“. Singuläre Existenzaussagen als „Funktionalsätze mit einem Quasi-Subjekt ohne Setzung“
4. Husserls Diskussion von Bolzanos Auffassung singulärer Existenzurteile und seine Noema-Konzeption
5. Epilog: Ein „transzendentaler Idealist“ als analytischer Philosoph
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Weitere Literatur
Internet-Ressourcen
Fußnoten
Anmerkungen
Vorwort
Im Februar 2003 erschien die erste Fassung des Artikels über Edmund Husserl in der Stanford Encyclopedia of Philosophy, der seither regelmäßig überarbeitet und aktualisiert wurde. Kapitel 1 dieses Buches enthält die deutsche Übersetzung der letzten Version dieses Artikels (Oktober 2022). In den nachfolgenden Kapiteln werden zentrale Themen der einzelnen Abschnitte dieses Artikels vertieft und Bezüge zur neueren analytischen Philosophie hergestellt. Es handelt sich um eine Auswahl (z. T. gekürzter oder erweiterter) deutschsprachiger Beiträge aus den vergangenen 25 Jahren, die teilweise nur mehr schwer zugänglich sind (vgl. die gleichnamigen Titel im Literaturverzeichnis).
Kapitel 2 beleuchtet Husserls Auffassung von „Begriffen“ in den verschiedenen Entwicklungsphasen seines Denkens und vertieft vor allem die Themen Sinn (Bedeutungsgehalt), anschauliche Erfüllung und Lebenswelt. Kapitel 3, in dem insbesondere Husserls Sicht auf Indexikalität, propositionalen Gehalt und Singularität näher behandelt wird, bietet eine Rekonstruktion von Husserls Konzeption des Gehalts im Sinne des Externalismus (also der Auffassung, wonach die wahrgenommene Umwelt den Bedeutungsgehalt mitbestimmt). Kapitel 4 vertieft die Themen Bewusstsein und Zeitbewusstsein, Kapitel 5 die Themen phänomenologische Epoché und Reduktion; dieses Kapitel kann als allgemeine Einführung in Husserls transzendentale Phänomenologie gelesen werden. In Kapitel 6 geht es um Personalität und Lebenswelt, Einfühlung und Intersubjektivität sowie Ethik und Wertlehre bei Husserl. Kapitel 7 vertieft den für die „reine Logik“ relevanten Themenkomplex Wahrheit, Existenz und anschauliche Erfüllung und behandelt die Themen Noema und transzendentaler Idealismus ausführlicher. Es endet mit einer Argumentation zugunsten der These, dass Husserl selbst als analytischer Philosoph gelten kann, und einer Kritik an seinem „Beweis“ für den transzendentalen Idealismus.
Keine Interpretation von Husserls Wahrnehmungslehre (die in fast allen Kapiteln eine wichtige Rolle spielt) kommt heutzutage ohne einen Hinweis darauf aus, wie diese Lehre im Zusammenhang mit der Debatte um den sog. Konjunktivismus bzw. dessen Gegenposition, den Disjunktivismus, zu verorten ist. „Very roughly, conjunctivists believe an experiential state of the same type can be had across cases of veridical perception, illusion and hallucination – the difference between these being a matter of the extent to which the world is as it is presented in the experience. For disjunctivists, by contrast, the experience a person enjoys in a veridical case is of a type that could not have been had in a hallucinatory case [...]“ (Overgaard 2018, 26). Je nachdem, was unter einem „experiential state of the same type“ verstanden wird, lassen sich beide Benennungen auf Husserl anwenden. Nach meiner 1999 erstmals veröffentlichten (Kap. 3) und in Intentionalität und Referenz (2000) detaillierter ausgearbeiteten externalistischen Rekonstruktion hängt der intentionale „Auffassungssinn“ einer veridischen (also erfolgreichen) Wahrnehmung in seiner Identität vom (sich zeitübergreifend und intersubjektiv intentional konstituierenden) wahrgenommenen Gegenstand ab, so dass eine entsprechende Halluzination diesen Auffassungssinn mit der betreffenden Wahrnehmung ebenso wenig teilen kann wie die Wahrnehmung eines anderen Gegenstandes (Disjunktivismus bezüglich des Auffassungssinns). Dennoch lässt sich der jeweilige Auffassungssinn im Rahmen der phänomenologischen Epoché in existenzneutraler Weise als seinem Anspruch nach auf ein bestimmtes, im perzeptiven Erlebnis sozusagen persönlich anwesendes Objekt bezogen charakterisieren (vgl. Kap. 1, § 6), und einen so spezifizierbaren singulären Auffassungssinn besitzt die Halluzination ebenfalls – auch hier haben wir es mit dem „Phänomen des leibhaft dastehenden Objektes“ und insofern mit einer „Perzeption“ (Hua XVI, 16)1 zu tun (Konjunktivismus bezüglich des perzeptiven Charakters). Allerdings disponiert eine „entlarvte“, also als solche durchschaute „Halluzination“ (ebd., 15) ihr Subjekt nicht mehr in hinreichendem Maße zu einem entsprechenden Wahrnehmungsurteil – in diesem Sinne fehlt der „Charakter des Glaubens“ (ebd., 16). Eine Glaubenstendenz ist zwar (anders als bei einer bloßen Phantasievorstellung) noch vorhanden, sie ist aber zu schwach, um sich durchzusetzen. Eine nicht entlarvte Halluzination besitzt dagegen nicht nur perzeptiven, sondern auch Glaubenscharakter – nur weist sie (wie sich im Falle der Entlarvung herausstellen würde) einen anderen Auffassungssinn auf als ihre veridischen Gegenstücke. Husserls (so rekonstruierte) Auffassung vermag demnach disjunktivistischen und konjunktivistischen Intuitionen gleichermaßen Rechnung zu tragen.
Kapitel 1: Edmund Husserl
1. Leben und Werk
Husserl wurde am 8. April 1859 in Prossnitz (Mähren) geboren. Seine Eltern waren nicht-orthodoxe Juden; Husserl selbst und seine Frau konvertierten später zum Protestantismus. Sie hatten drei Kinder, von denen eines im Ersten Weltkrieg fiel.
In den Jahren 1876–78 studierte Husserl Astronomie in Leipzig, wo er auch Vorlesungen in Mathematik, Physik und Philosophie besuchte. Unter anderem hörte er die philosophischen Vorlesungen von Wilhelm Wundt. (Wundt war der Begründer des ersten Instituts für experimentelle Psychologie.) Husserls Mentor war Thomas Masaryk, ein ehemaliger Schüler Brentanos, der später der erste Präsident der Tschechoslowakei werden sollte. In den Jahren 1878–81 setzte Husserl seine Studien in den Fächern Mathematik, Physik und Philosophie in Berlin fort. Zu seinen Mathematikdozenten gehörten Leopold Kronecker und Karl Weierstraß, von dessen wissenschaftlichem Ethos Husserl besonders beeindruckt war. Er promovierte dann jedoch in Wien (Januar 1883) mit einer Arbeit zur Theorie der Variationsrechnung zum Doktor der Mathematik und ging anschließend wieder nach Berlin, um Assistent von Weierstraß zu werden. Als Weierstraß schwer erkrankte, schlug Masaryk vor, dass Husserl nach Wien zurückkehren solle, um bei Franz Brentano Philosophie zu studieren, dem Autor der Psychologie vom empirischen Standpunkt (1874). Nach einem kurzen Militärdienst in Wien folgte Husserl dem Rat Masaryks und studierte von 1884–86 bei Brentano. Brentanos Vorlesungen über Psychologie und Logik übten einen nachhaltigen Einfluss auf Husserl aus, ebenso wie seine allgemeine Konzeption einer streng wissenschaftlichen Philosophie.
Brentano empfahl Husserl dann seinem Schüler Carl Stumpf in Halle, dessen wohl bekanntestes Werk die Tonpsychologie (zwei Bände, 1883/90) ist. Diese Empfehlung ermöglichte es Husserl, seine Habilitationsschrift Über den Begriff der Zahl (1887) bei Stumpf anzufertigen und in Halle einzureichen.
Husserls Habilitationsschrift wurde später in seine erste veröffentlichte Monographie integriert: die Philosophie der Arithmetik, welche 1891 erschien. In diesem Werk brachte Husserl seine mathematischen, psychologischen und philosophischen Kompetenzen kombiniert zum Einsatz, um eine psychologisch basierte philosophische Begründung der Arithmetik zu erarbeiten (siehe Willard 1984, 38–118; Bell 1990, 31–84). Das Buch wurde jedoch von Gottlob Frege in einer Rezension wegen des ihm angeblich zugrundeliegenden „Psychologismus“ kritisiert. Es scheint, dass Husserl diese Kritik sehr ernst nahm (siehe Føllesdal 1958), obwohl keineswegs klar ist, dass der Autor der Philosophie der Arithmetik die Logik als einen Zweig der Psychologie betrachtet, wie es der „starke Psychologismus“ (Mohanty 1982, 20) tut. Jedenfalls hat Husserl diese Spielart des Psychologismus (in Gestalt von achtzehn Thesen; vgl. Soldati 1994, 117ff.) scharf angegriffen und im Anschluss an diese Kritik die philosophische Methode entwickelt, für die er heute berühmt ist: die Phänomenologie.
1900/01 wurde sein erstes phänomenologisches Werk in zwei Bänden unter dem Titel Logische Untersuchungen (Sigle: LU) veröffentlicht. Der erste Band enthält einen energischen Angriff auf den Psychologismus, während der (wesentlich umfangreichere) zweite Band aus sechs „deskriptiv-psychologischen“ und „erkenntnistheoretischen“ Untersuchungen über (I) Ausdruck und Bedeutung, (II) Universalien, (III) die formale Ontologie von Teilen und Ganzem (Mereologie), (IV) die „syntaktische“ und mereologische Struktur der Bedeutung, (V) das Wesen und die Struktur der Intentionalität sowie (VI) das Verhältnis von Wahrheit, Intuition (Anschauung) und Erkenntnis besteht. Husserl unterschreibt nun eine Version des Platonismus, die er aus Ideen von Hermann Lotze und vor allem Bernard Bolzano abgeleitet hat, wobei er den Platonismus in Bezug auf Bedeutung und mentalen, repräsentationalen Gehalt in eine Theorie des intentionalen Bewusstseins einbettet (siehe Beyer 1996).
Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hat Husserl seine Methode erheblich verfeinert und modifiziert, und zwar hin zu dem, was er „transzendentale Phänomenologie“ nannte. Bei dieser Methode konzentrieren wir uns auf die wesentlichen Strukturen, die es den in der „natürlichen Einstellung“ (die sowohl für unser Alltagsleben als auch für die gewöhnliche Wissenschaft charakteristisch ist) naiv angenommenen Gegenständen ermöglichen, sich im Bewusstsein zu „konstituieren“. (Zu denjenigen, die Husserl in dieser Hinsicht beeinflusst haben, gehören Descartes, Hume und Kant.) Wie Husserl in seinem zweiten Hauptwerk, den Ideen zu einer reinen Phänomenologie und zu einer phänomenologischen Philosophie (1913; Sigle: Ideen), ausführlich erläutert, soll die daraus resultierende Perspektive auf das Reich des intentionalen, d. h. (gleichsam thematisch) auf Gegenstände gerichteten Bewusstseins den Phänomenologen (bzw. die Phänomenologin) in die Lage versetzen, eine radikal vorurteilslose Begründung seines grundlegenden Welt- und Selbstverständnisses zu entwickeln und die wesentlichen rationalen Zusammenhänge zwischen den Elementen dieses Verständnisses zu erforschen.
Husserl entwickelte diese Ideen in Göttingen, wo er – dank seiner Logischen Untersuchungen und der Unterstützung durch Wilhelm Dilthey, der dieses Werk bewunderte und Husserl dem preußischen Kultusministerium empfahl – 1901 eine außerordentliche Professur („Extraordinariat“, später in ein „persönliches Ordinariat“ umgewandelt) erhielt. Ab 1910/11 bzw. 1913 war er Gründungsherausgeber der Zeitschrift Logos (in deren erster Ausgabe sein programmatischer Artikel „Philosophie als strenge Wissenschaft“ erschien, der eine Kritik des „Naturalismus“ beinhaltet) und des Jahrbuchs für Phänomenologie und phänomenologische Forschung (das er mit seinen Ideen eröffnete).
Husserl blieb bis 1916 in Göttingen. Hier gelangen ihm seine wichtigsten philosophischen Entdeckungen (vgl. Mohanty 1995), wie die transzendental-phänomenologische Methode, die phänomenologische Struktur des Zeitbewusstseins, die grundlegende Rolle des Begriffs der Intersubjektivität in unserem Weltverständnis, die Horizontstruktur unseres singulären (also fest auf ganz bestimmte Einzeldinge gerichteten) empirischen Denkens und vieles mehr. In späteren Werken – vor allem den Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1928), der Formalen und transzendentalen Logik (1929), den Cartesianischen Meditationen (1931), der Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (1954) und Erfahrung und Urteil (1939) – werden diese Ergebnisse weiterentwickelt und in neue Zusammenhänge eingeordnet, etwa im Rahmen des bahnbrechenden Projekts, die Grundbegriffe der exakten Wissenschaft auf ihre begrifflichen Wurzeln in der vorwissenschaftlichen „Lebenswelt“ zurückzuführen (Krisis).
1916 wurde Husserl Nachfolger von Heinrich Rickert als Ordinarius in Freiburg/Breisgau, wo er (neben vielen anderen Dingen) zum Thema „passive Synthesis“ arbeitete (vgl. Hua XI, XXXI). 1922 hielt er vier Vorlesungen über die phänomenologische Methode und Philosophie am University College, London (vgl. Hua XXXV). 1923 erhielt er einen Ruf nach Berlin, den er jedoch ablehnte. Husserl wurde 1928 emeritiert, Nachfolger wurde sein (und Rickerts) ehemaliger Assistent Martin Heidegger (dessen Hauptwerk Sein und Zeit 1927 in Husserls Jahrbuch veröffentlicht worden war). 1929 nahm er eine Einladung nach Paris an. Seine dort gehaltenen Vorträge wurden 1931 unter dem Titel Cartesianische Meditationen veröffentlicht. Im selben Jahr hielt Husserl eine Reihe von Vorträgen über „Phänomenologie und Anthropologie“, in denen er seine beiden „Antipoden“ Heidegger und Max Scheler kritisierte. 1933 übernahm Hitler die Macht in Deutschland. Husserl erhielt einen Ruf nach Los Angeles, lehnte diesen jedoch ab. Wegen seiner jüdischen Vorfahren wurde er zunehmend gedemütigt und isoliert. 1935 hielt er eine Reihe von Gastvorträgen in Prag, aus denen sein letztes veröffentlichtes Hauptwerk hervorging, die Krisis.
Edmund Husserl starb am 27. April 1938 in Freiburg im Breisgau. Seine Manuskripte (insgesamt mehr als 40.000 Seiten) wurden von dem Franziskaner Herman Leo Van Breda gerettet, der sie nach Löwen (Belgien) brachte, wo 1939 das erste Husserl-Archiv gegründet wurde. (Heute gibt es weitere Archive in Freiburg, Köln, Paris, New York und Pittsburgh.) Seit 1950 geben die Husserl-Archive Husserls Gesammelte Werke, die Husserliana, heraus.
2. Reine Logik, Sinn, anschauliche Erfüllung und Intentionalität1
Als Philosoph mit einem mathematischen Hintergrund war Husserl daran interessiert, eine allgemeine Theorie der Inferenzsysteme zu entwickeln, die er (in Anlehnung an Bolzano) als Wissenschaftslehre auffasste, da jede Wissenschaft (einschließlich der Mathematik) als ein System von Aussagen betrachtet werden kann, die durch eine Reihe von Inferenz- und Begründungsbeziehungen miteinander verbunden sind. In Anlehnung an John S. Mill argumentiert er in den Logischen Untersuchungen, dass der geeignetste Weg, das Wesen solcher Aussagesysteme zu untersuchen, darin besteht, von ihren sprachlichen Manifestationen, d. h. (Mengen von) Sätzen und ihren (assertiven) Äußerungen, auszugehen.
Wie sollen wir diese Sätze und die in ihnen ausgedrückten Aussagen analysieren? Husserls Ansatz besteht darin, die Bewusstseinseinheiten zu untersuchen, als deren Subjekt sich die jeweilige Sprecherin bei der Äußerung des fraglichen Satzes (z. B. beim Schreiben eines mathematischen Lehrbuchs oder beim Halten eines Vortrags) präsentiert – die sie „kundgibt“. Diese Bewusstseinseinheiten bezeichnet er als „Akte“ oder „intentionale Erlebnisse“ – „intentional“ deshalb, weil sie immer etwas (unter einem Gesichtspunkt, einer Perspektive) repräsentieren und damit das aufweisen, was Brentano „Intentionalität“ nannte: Sie sind (unter einem Gesichtspunkt) auf einen Gegenstand, ein Thema gerichtet. Husserl zufolge gibt es aber auch nicht-intentionale Bewusstseinseinheiten. (Als Beispiele führt er Schmerzen und Sinnesempfindungen wie z. B. farbige Nachbilder an.) Was intentionale von nicht-intentionalen Erlebnissen unterscheidet, ist seines Erachtens, dass erstere einen intentionalen Gehalt haben – einen „Auffassungssinn“, der etwa eine Farbempfindung so formt oder durchdringt, dass sie dadurch Teil der Wahrnehmung der Farbe eines Dinges (z. B. als das individuelle Rot einer bestimmten Rose) ist.
Auch gegenstandlose (d. h. so wie z. B. eine Halluzination ins Leere schießende) intentionale Erlebnisse wie etwa, wenn jemand an das Flügelross Pegasus denkt, haben einen solchen Gehalt. Nach Husserls Auffassung fehlt diesem Gedanken einfach ein entsprechendes Objekt; der intentionale Akt ist so beschaffen, „als ob“ er einen wirklichen Gegenstand hätte, hat aber nicht wirklich einen. Husserl lehnt sog. repräsentationalistische Darstellungen der Intentionalität ab, wie z. B. die „Abbildtheorie“, nach der intentionale Erlebnisse intra-mentale bildliche Repräsentationen von Objekten repräsentieren, wobei solche Bilder – wie andere Bilder auch (etwa eine Pegasus-Zeichnung) – existieren können, ohne dass es wirklich ein entsprechendes Objekt in der realen Welt gibt. Für Husserl führt diese Auffassung zu einer falschen „Verdoppelung“ der im veridischen Fall (also dann, wenn die Repräsentation nicht ins Leere schießt) repräsentierten Objekte; und sie setzt bereits voraus, was eine adäquate Konzeption der bildlichen Repräsentation allererst leisten muss: eine Erklärung dessen, was den zugrundeliegenden „Phantasieinhalt zum repräsentierenden Bild von etwas“ macht (Hua XXII, 305f.). Der intentionale Gehalt ist es, der hier (wie in allen Fällen intentionalen Bewusstseins) nach Husserl den Objektbezug herstellt – in einer Weise, die im Rahmen seiner Phänomenologie des Bewusstseins näher zu erläutern ist.
Im Falle von „propositionalen“ Akten, d. h. Bewusstseinseinheiten, die durch einen vollständigen Satz (paradigmatisch: einen Behauptungssatz) ausgedrückt werden können, identifiziert Husserl den intentionalen Gehalt mit der propositionalen Bedeutung (dem Sinn), die durch diesen Satz ausgedrückt wird. Im Falle ihrer nicht-propositionalen, aber dennoch intentionalen Teile identifiziert er den entsprechenden intentionalen Gehalt mit einer sub-propositionalen (z. B. adjektivischen) Bedeutung. Beispielsweise enthält das Urteil „Napoleon ist ein Franzose“ einen Akt des Denkens an Napoleon, dessen intentionaler Gehalt die sub-propositionale Bedeutung ist, die durch den Namen „Napoleon“ ausgedrückt wird. (Dementsprechend kann das Urteil als ein Akt der Zuschreibung der Eigenschaft, Franzose zu sein, an den Träger dieses Namens betrachtet werden.) Erlebnisse wie diese, die entweder durch einen singulären („Napoleon“) oder einen generellen („ein Franzose“) Terminus ausgedrückt werden können, werden „nominale Akte“ genannt (im Gegensatz zu den propositionalen Akten, die diese nominalen Akte als Teile enthalten). Ihre Gehalte heißen in den Logischen Untersuchungen „nominale Bedeutungen“.
Husserl betrachtet sowohl propositionale als auch nominale Bedeutungen als Gegenstand der „reinen Logik“ oder „Logik im weiteren Sinne“ – der Untersuchung dessen, (i) was Sinn (alias Bedeutung) von Unsinn unterscheidet (dieser Teil der reinen Logik wird „reine Grammatik“ genannt) und (ii) welche der von der reinen Grammatik gelieferten Bedeutungen logisch konsistent sind und welche nicht (dieser Teil der reinen Logik wird als „Logik im engeren Sinne“ bezeichnet).
Eine wichtige und noch wenig erforschte Behauptung Husserls lautet, dass jede logisch konsistente Bedeutung prinzipiell durch eine einheitliche Intuition (Anschauung), etwa einen Akt der kontinuierlichen Wahrnehmung oder der anschaulichen Phantasievorstellung, subjektiv mehr oder weniger adäquat erfüllt werden kann, wobei die Struktur und andere wesentliche Merkmale der fraglichen Bedeutung an der jeweiligen Art der anschaulichen Erfüllung abgelesen werden können. Inkonsistente Bedeutungen können durch (Reflexion auf) entsprechende Erlebnisse anschaulichen Konfligierens miteinander unverträglicher Gesichtspunkte herausgefiltert und untersucht werden, wie z. B. (um ein Beispiel von Wittgenstein/Jastrow anzuführen) dem diskreten Hin- und Herwechseln zwischen einer Entenkopf- und einer Kaninchenkopfvorstellung bei einer versuchten anschaulichen Phantasievorstellung eines Entenkopfes, der zugleich ein Kaninchenkopf ist. Einige Bedeutungen sind aus formal-logischen Gründen inkonsistent. Nach Husserl gehören alle analytisch falschen Sätze zu dieser Kategorie. Andere Bedeutungen sind inkonsistent, weil sie mit einer allgemeinen materialen Apriori-Wahrheit, auch „Wesensgesetz“ genannt, in Konflikt stehen. Die durch den Satz „Es gibt Wahrnehmungsobjekte, deren Oberfläche gleichzeitig (sichtbar) vollständig grün und vollständig rot ist“ ausgedrückte Proposition ist ein Beispiel hierfür.
Bedeutungen im Allgemeinen und Propositionen im Besonderen existieren unabhängig davon, ob sie tatsächlich als intentionaler Gehalt fungieren. Daher können wahre Propositionen wie der Satz des Pythagoras entdeckt werden. Propositionen und ihre Bestandteile sind abstrakte, d. h. atemporale Gegenstände. Was aber bedeutet es, eine Proposition oder, allgemeiner, einen Sinn zu erfassen? Wie kann ein abstrakter Gegenstand zum Gehalt eines „Aktes“ – eines intentionalen Erlebnisses – werden?
Husserl beantwortet diese Frage, indem er Ideen von Bolzano und Lotze miteinander verbindet und auf den Begriff einer „idealen“ (d. h. abstrakten) „Spezies“ oder eines idealen Typs zurückgreift, und zwar folgendermaßen. Propositionen und andere Bedeutungen sind ideale Spezies, die durch individuelle „Momente“, d. h. abhängige Teile, von intentionalen Erlebnissen instanziiert werden können (aber nicht müssen). Diese Spezies werden auch „ideale Materien“ genannt. Die individuellen Momente, die eine ideale Materie instanziieren – Husserl nennt sie „Materiemomente“ – werden durch phänomenologische Beschreibung freigelegt, eine reflexionsbasierte (oder introspektive) Analyse, die sowohl den sprachlichen Ausdruck (falls vorhanden) als auch die Weisen der (möglichen) anschaulichen Erfüllung bzw. Enttäuschung (durch anschauliches Konfligieren inkompatibler Auffassungen) berücksichtigt, die mit dem jeweiligen Erlebnis verbunden sind.
Da die phänomenologische Beschreibung ideale Spezies liefert, beinhaltet sie das, was Husserl später (insbesondere in den Ideen) als „eidetische Reduktion“ bezeichnen wird, d. h. eine Herausarbeitung abstrakter Merkmale, die von geeigneten Mengen fiktiver oder realer Beispiele geteilt werden, z. B. durch freie Variation eines willkürlich gewählten Ausgangsbeispiels in der Imagination (zur Methode der „freien Variation“ vgl. Erfahrung und Urteil [Husserl 71999], § 87).
Die phänomenologische Beschreibung liefert auch das „Qualitätsmoment“ des zu untersuchenden intentionalen Erlebnisses, d. h. das individuelle Moment, das dessen psychologischen Modus (Urteil, bewusste Überlegung, bewusster Wunsch, bewusste Hoffnung usw.) instanziiert, was in etwa dem Sprechaktmodus einer Äußerung entspricht, die dieses Erlebnis sprachlich kundgibt. Darüber hinaus ergeben sich aus dieser Beschreibung „Fundierungs“beziehungen, d. h. einseitige oder wechselseitige relative existenzielle Abhängigkeiten zwischen (1) dem fraglichen Erlebnis und anderen Erlebnissen und (2) den individuellen deskriptiven Momenten des Erlebnisses. So ist ein Erlebnis der Freude über ein bestimmtes Ereignis relativ zu dem Bewusstseinsstrom, zu dem das Erlebnis gehört, einseitig in einem bestimmten Urteil oder Glaubenszustand fundiert, der besagt, dass dieses Ereignis stattgefunden hat. (Die Relativierung auf einen bestimmten Bewusstseinsstrom stellt sicher, dass das fundierte und das fundierende Erlebnis beide im Bewusstsein derselben Person auftreten). Wie alle Fundierungsbeziehungen beruht auch diese auf einem Wesensgesetz, das in diesem Fall besagt, dass die bewusste Freude über einen bestimmten Zustand eine entsprechende (und gleichzeitige) Überzeugung erfordert. Ganz allgemein ist ein gegebenes Objekt a des Typs F in einem bestimmten Objekt b des Typs G (wobei a sich von b unterscheidet und F sich von G unterscheidet) in Bezug auf ein bestimmtes Ganzes c des Typs H dann und nur dann fundiert, wenn (i) es ein Wesensgesetz gibt, nach dem es für jedes Objekt x des Typs F ein Objekt y des Typs G und ein Ganzes z des Typs H gibt, so dass sowohl x als auch y (echte) Teile von z sind, und (ii) sowohl a als auch b (echte) Teile von c sind. Natürlich bedarf der Begriff des Wesensgesetzes einer weiteren Klärung (siehe De Santis 2021, Teile III ff.).
3. Indexikalität und propositionaler Gehalt2
Wie Husserl jedoch sehr wohl gesehen hat, sieht sich die Spezies-Theorie des intentionalen Gehalts mindestens einem ernsthaften Einwand ausgesetzt. Dieser Einwand betrifft sprachliche Äußerungen, die „wesentlich okkasionell“ sind, d. h. systematisch kontextabhängig – Ausdrücke wie ‚Ich bin jetzt hier‘ -, und die (wie wir sagen können) indexikalischen Erlebnisse, die sie kundgeben. Wenn der intentionale Gehalt eines indexikalischen Erlebnisses als (sub-)propositionaler Gehalt einer solchen Äußerung fungieren soll, muss er das Objekt (falls vorhanden), auf das sich das jeweilige Erlebnis bezieht, eindeutig bestimmen. Das heißt: Wenn zwei indexikalische Erlebnisse denselben intentionalen Gehalt aufweisen, müssen sie sich auf dasselbe Objekt beziehen (falls es eines gibt). Es scheint jedoch, dass die Materiemomente zweier solcher Erlebnisse dieselbe ideale Materie – dieselbe Spezies individueller Gehalte (Materiemomente) – instanziieren können, obwohl sie unterschiedliche Objekte repräsentieren. Wenn Sie und ich beide denken: „Ich bin hier“, dann haben unsere jeweiligen Gedanken denselben Gehalt, so scheint es jedenfalls, aber sie repräsentieren unterschiedliche Sachverhalte. Um dieser Beobachtung Rechnung zu tragen, unterscheidet Husserl zwischen der „allgemeinen Bedeutungsfunktion“ einer Äußerung (die grob dem entspricht, was David Kaplan als „character“ bezeichnet, d. h. der sprachlichen Bedeutung des verwendeten Ausdrucks) und der „jeweiligen Bedeutung“ (d. h. dem propositionalen oder subpropositionalen Gehalt, der im jeweiligen Äußerungskontext zum Ausdruck kommt). Es ist jedoch zweifelhaft, ob es diese Unterscheidung Husserl wirklich erlaubt, die Schwierigkeit zu überwinden, die das Phänomen der Kontextsensitivität für seine Speziestheorie des Gehalts darstellt. Wenn es sich bei intentionalen Gehalten um ideale Gegenstände im Sinne von Typen (Spezies) individueller Materiemomente handelt und wenn diese Art von Typ konstant bleiben kann, während sich der intentionale Gegenstand und damit der (sub-)propositionale Gehalt unterscheidet, dann können so konzipierte intentionale Gehalte gewiss nicht durchweg als (sub-)propositionale Gehalte fungieren, wie es die Husserl'sche Theorie vorsieht. Vielmehr muss ein anderer intentionaler Gehalt beteiligt sein, nämlich die „jeweilige Bedeutung“, die als (sub-)propositionaler Gehalt des indexikalischen Erlebnisses (der entsprechenden Bedeutungsintention) fungiert. Und dieser Gehalt scheint keine ideale Spezies zu sein. (Man könnte allerdings argumentieren, dass auch (sub-)propositionale Gehalte indexikalischer Äußerungen im Denken und Sprechen mehrfach instanziiert sein und somit doch als ideale Spezies gelten können. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob dies in voller Allgemeinheit zutrifft: Man denke an das obige Beispiel „Ich bin jetzt hier“.)
Wie dem auch sei, Husserl konzipiert (sub-)propositionale Gehalte („jeweilige Bedeutungen“) jedenfalls zweifaktoriell, wobei die allgemeine Bedeutungsfunktion plus der relevante Äußerungskontext (falls vorhanden) den fraglichen Gehalt bestimmen. Und zumindest im Fall von indexikalischen Erlebnissen scheint er deren intentionale Gehalte mit diesen zweifaktoriellen Gehalten zu identifizieren, denn er behauptet, dass der intentionale Gehalt, der in den Ideen als „noematischer Sinn“ oder „noematischer Kern“ bezeichnet wird, eindeutig die Referenz (den Referenten) bzw. das intentionale Objekt bestimmt. (Für die These, dass der noematische Sinn die kontextuell bestimmte jeweilige Bedeutung und nicht die allgemeine Bedeutungsfunktion ist, was jede internalistische Lesart von Husserls Konzeption des intentionalen Gehalts ausschließt, siehe unten Abschnitt 4 – vgl. Hua XX/1, 74–78; siehe auch Hua XXVI, 212, Fn.) Einige Interpreten gehen sogar so weit zu behaupten, Husserl definiere den noematischen Sinn als „eine bestimmte Person, einen bestimmten Gegenstand, ein bestimmtes Ereignis, einen bestimmten Zustand, der sich präsentiert, genau so genommen, wie er sich präsentiert oder wie er gemeint ist“ (Gurwitsch 1982, 61f.; vgl. Sokolowski 1987 und Drummond 1992; für eine vieldiskutierte Kritik an Gurwitschs Interpretation siehe Føllesdal 1969). Der Begriff eines intentionalen Objekts, „so wie es intendiert wird“, wird bereits in den LU eingeführt.
Husserl argumentiert in der V. LU, § 20, dafür, dass der Gegenstand (z. B. der Sachverhalt), so wie er intendiert wird, von dem (sub-)propositionalen Gehalt zu unterscheiden ist, weil z. B. der geurteilte Sachverhalt (der Sachverhalt, der im Urteil kategorial geformt wird) genau dann existiert, wenn er besteht (so dass das Urteil wahr ist), während der geurteilte Aussagegehalt auch dann existiert, wenn er falsch ist (vgl. Hua XIX/1, 427).
4. Singularität, Bewusstsein und Horizont-Intentionalität3
Husserl sieht ganz klar, dass indexikalische Erlebnisse (ebenso wie Erlebnisse, die durch eigentliche Eigennamen zum Ausdruck gebracht werden) unter anderem durch ihre Singularität gekennzeichnet sind: Sie repräsentieren einen bestimmten Gegenstand (oder eine Anzahl von Objekten) x, so dass x in allen relevanten möglichen Welten (d. h. in allen faktischen oder kontrafaktischen Umständen, in Bezug auf die wir das durch dieses Erlebnis repräsentierte Objekt bestimmen) als das intentionale Objekt der jeweiligen Erfahrung anzusehen ist. So beschreibt er z. B. in § 47 der Ideen, was ein erlebendes Subjekt zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lichte seiner (oder ihrer) gegenwärtigen indexikalischen Erlebnisse als „die tatsächliche Welt“ betrachtet, als einen „Spezialfall“ einer ganzen Reihe von „möglichen Welten und Umwelten“, deren jede einem möglichen zukünftigen Verlauf der Erfahrung entspricht (nämlich möglich in Bezug auf das betreffende indexikalische Erlebnis). Diese (tatsächlichen oder potentiellen) zukünftigen Erfahrungen können als vom erlebenden Subjekt zum jeweiligen Zeitpunkt (mehr oder weniger) antizipiert beschrieben werden und sie bilden das, was Husserl den „intentionalen Horizont“ des indexikalischen Erlebnisses nennt, im Hinblick auf dessen intentionalen Gehalt sie antizipiert werden (vgl. Smith und McIntyre 1982). Wenn Sie beispielsweise etwas als Tisch sehen, werden Sie erwarten, dass er Ihnen auf bestimmte Weise erscheint, wenn Sie um ihn herumgehen und ihn beobachten.
Was bindet den intentionalen Horizont eines gegebenen indexikalischen Erlebnisses zusammen? Husserl zufolge teilen alle (tatsächlichen oder potenziellen) Erlebnisse, die diesen Horizont bilden, einen noematischen Sinn bezüglich der Identität durch die Zeit, den er als das bestimmbare X bezeichnet, zu dem diese Erlebnisse gehören. In erster Näherung gehören zwei Erlebnisse eines bestimmten Subjekts dann und nur dann zu demselben bestimmbaren X, wenn das Subjekt glaubt, dass sie dasselbe Objekt repräsentieren. (Für ein verwandtes Kriterium der intersubjektiven Identität des bestimmbaren X siehe Beyer 2000, § 7.) Daher müssen Erlebnisse, die zu einem bestimmbaren X gehören, von mindestens einer Überzeugung höherer Ordnung begleitet sein.
Diese Sichtweise passt gut zu der These (die zumindest teilweise von den so genannten dispositionalen Metarepräsentationstheorien des Bewusstseins geteilt wird), dass intentionale Erlebnisse automatisch momentane mentale Dispositionen hervorrufen (bzw. motivieren), entsprechende reflektive Urteile höherer Ordnung (Metaurteile) zu fällen, die auf so etwas wie innerer Wahrnehmung beruhen und somit eine Form von implizitem oder „vorreflexivem Selbstbewusstsein“ (um Sartres Terminus zu verwenden) darstellen.
Es ist umstritten, ob Husserl eine solche dispositionale Metarepräsentationstheorie zugeschrieben werden kann (vgl. Zahavi 2015, Abschn. 1; für eine Replik vgl. Beyer 2018, Abschn. 1). Unstrittig dürfte sein, dass nach seiner Auffassung die motivationale Basis der jeweiligen dispositionellen Überzeugungen höherer Ordnung bereits unabhängig von einem okkurenten Denken höherer Ordnung das Wesensmerkmal des Bewusstseins aufweisen muss, um überhaupt für ein solches Denken verfügbar oder zugänglich zu sein (vgl. Beyer 2011, 44). Dies wird deutlich, wenn man sich näher mit Husserls Arbeiten zum „inneren Zeitbewusstsein“ beschäftigt (siehe den Eintrag der Stanford Encyclopedia of Philosophy über phänomenologische Ansätze zum Selbstbewusstsein; siehe auch weiter unten Abschnitt 6). Es gibt jedoch zahlreiche Textbelege dafür, dass er die Verfügbarkeit für die innere („immanente“) Wahrnehmung (im Sinne einer „realen Möglichkeit“ oder „praktischen Fähigkeit“; siehe Abschnitt 8) und für entsprechend motivierte reflektive Urteile höherer Ordnung (in denen ein bisher „latentes Ich“ „patent“ wird) als ein wesentliches Bewusstseinsmerkmal ansieht, das seine „Seinsweise“ ausmacht (vgl. Hua III/1, 77, Z. 27–35; 95, Z. 36–38; Hua III/1, 95, Z. 36–38; Husserliana VIII, 90).
Das bestimmbare X, zu dem ein bestimmtes indexikalisches Erlebnis in Bezug auf bestimmte andere Erlebnisse gehört, hilft uns bei der Beantwortung der Frage, was den Sachbezug dieses Erlebnisses bestimmt, wenn dies nicht allein ihre idealen Bedeutungsspezies leisten. Um die Rolle, die das bestimmbare X spielt, angemessen zu berücksichtigen, müssen wir eine Husserl'sche Forschungsstrategie anwenden, die man als dynamische Methode bezeichnen könnte. Das heißt, wir müssen intentionale Erlebnisse als momentane Bestandteile bestimmter transtemporaler kognitiver Strukturen – dynamischer intentionaler Strukturen – betrachten, in denen ein und dasselbe Objekt oder ein und derselbe Sachverhalt über eine Zeitspanne hinweg repräsentiert wird, in der sich die kognitive Perspektive des Subjekts auf dieses Objekt oder diesen Sachverhalt kontinuierlich ändert (siehe z. B. Ideen, § 86). (Typische Beispiele für dynamische intentionale Strukturen sind kontinuierliche Beobachtungen – die Husserls Standardbeispiel darstellen – sowie die Gesamtheit aufeinander folgender Urteile oder momentaner Glaubenszustände, die ein und dieselbe zeitübergreifend fortbestehende Überzeugung aktualisieren. Zum Beispiel aktualisiert mein Urteil, dass gestern Donnerstag war, dieselbe Überzeugung wie das Urteil, das ich gestern durch „Heute ist Donnerstag“ hätte kundgeben können.)
Folglich ist das bestimmbare X geeignet, uns durch die Zeit zurück zu der ursprünglichen Situation zu führen, in der die Referenz (der intentionale Sachbezug) der relevanten einheitlichen Reihe aufeinanderfolgender intentionaler Horizonte festgelegt wurde, wie zum Beispiel die Gelegenheit der ersten wahrnehmungsmäßigen Begegnung des Subjekts mit einem bestimmten Objekt: Das entsprechende Wahrnehmungserlebnis wird zu demselben bestimmbaren X gehören wie alle (übrigen) Erlebnisse, die zu der betreffenden zeitübergreifenden Erlebnisreihe gehören. In einer neueren Terminologie könnte man sagen, dass das Subjekt in dieser Wahrnehmungssituation eine mentale Akte oder Datei (engl: mental file) über ein bestimmtes Objekt angelegt hat (vgl. Perry 1980).
In einem Forschungsmanuskript von 1913 bezeichnet Husserl die mit Eigennamen verbundenen mentalen Dateien als „Eigenbegriffe“ (Hua XX/2, 358) und charakterisiert sie als unbegrenzt „offen“ und beständig „im Fluss“ befindlich (vgl. ebd., 359). Nun ist es der „Referent“ (der Bezugsgegenstand) der betreffenden mentalen Datei oder des betreffenden Eigenbegriffs, der normalerweise als das gemeinsame intentionale Objekt der Erlebnisse gilt, die in einer einheitlichen Reihe aufeinander folgender intentionaler Horizonte verbunden sind, in denen sich das Objekt empirisch „konstituiert“. (In Fällen, in denen sich der „Referent“ einer mentalen Datei im Laufe der Zeit ändert, d. h. unbemerkt durch ein anderes Objekt ersetzt wird, ist die Sachlage komplizierter. Dasselbe gilt für Fälle, in denen Wahrnehmungsurteile zu Einträgen in eine bereits bestehende Datei führen oder vom jeweiligen Subjekt als Bestätigung für solche Einträge angesehen werden. Vgl. dazu Beyer 2000, § 7.) Man beachte, dass „Konstitution“ in diesem Sinne nicht gleichbedeutend ist mit Kreation.
Nach dieser Interpretation von Husserls Konzeption des bestimmbaren X besteht zumindest im Fall der Eigennamen und im ubiquitären indexikalischen Fall eine Verbindung zwischen intentionalem Gehalt (einschließlich des bestimmbaren X) einerseits und der extra-mentalen Realität andererseits, derart dass der so verstandene intentionale Gehalt die Referenz in ähnlicher Weise bestimmt, wie dies gemäß neueren externalistischen Theorien des Gehalts der Fall ist, d. h. in einer solchen Weise, dass von dem Referenten (dem innerweltlichen intentionalen Bezugsobjekt) wiederum gesagt werden kann, dass es den intentionalen Gehalt mitbestimmt (vgl. Beyer 2000, 2001; vgl. auch Husserls Diskussion der Zwillingserde in Hua XXVI, 212). Man beachte jedoch, dass Husserl die Existenz eines extra-mentalen Referenten nicht naiv als gegeben voraussetzt. Stattdessen fragt er, welche Bewusstseinsstrukturen uns dazu berechtigen, die Welt so zu konzipieren, dass sie bestimmte Objekte enthält, die dasjenige transzendieren, was uns gegenwärtig in der Erfahrung gegeben ist (siehe Abschnitte 7 und 8).
Husserl kann also sowohl als früher Vertreter einer Theorie der direkten Referenz (Stichwort: Singularität) als auch als nicht-naiver Externalist bezüglich intentionaler Gehalte und (jeweiliger) Bedeutung gelesen (oder zumindest rational rekonstruiert) werden.
Die dynamische Methode sorgt dafür, dass wir den noematischen Sinn unter dem „funktionalen Aspekt“ betrachten, wie er es uns ermöglicht, den intentionalen Gegenstand „im Sinn“ zu behalten (Hua III/1, 196ff.), anstatt ihn lediglich statisch als einen psychologischen Typ oder eine Spezies zu betrachten, die durch isolierte Bewusstseinsmomente instanziiert wird. Sie bringt uns dazu, jeden Gehalt der letzteren Art, insbesondere „statische Wahrnehmungsgehalte“, als bloße „Abstraktion von dynamischen Gehalten“ zu betrachten (Mulligan 1995, 195, 197). Dies mag zum Teil erklären, warum die Spezies-Theorie des intentionalen Gehalts für Husserl zu der Zeit, als er die Ideen schrieb, weniger wichtig geworden war.
5. Die phänomenologische Epoché4
Eine externalistische Lesart (oder rationale Rekonstruktion) von Husserls Gehaltstheorie könnte jedoch in Konflikt mit den methodischen Anforderungen der phänomenologischen Epoché geraten, die – zusammen mit der dynamischen Methode und der eidetischen Reduktion – den wesentlichen Kern der in den Ideen eingeführten transzendental-phänomenologischen Methode bildet.
Husserl entwickelte die Methode der Epoché oder „Einklammerung“ um 1906 herum. Sie kann als eine Radikalisierung der methodologischen Anforderung betrachtet werden, die sich bereits in den Logischen Untersuchungen findet, wonach jede phänomenologische Beschreibung vom Standpunkt der ersten Person aus zu erfolgen hat, um sicherzustellen, dass der jeweilige Gegenstand genau so beschrieben wird, wie er vom Subjekt erlebt oder intendiert wird. Nun kann man aus der Ich-Perspektive natürlich nicht entscheiden, ob es für das, was man z. B. für einen Wahrnehmungsakt hält, den man gerade vollzieht, tatsächlich ein Objekt gibt, mit dem man wahrnehmungsmäßig konfrontiert ist. Es ist zum Beispiel gut möglich, dass man halluziniert. Aus der Sicht der Ich-Perspektive gibt es keinen Unterschied zwischen dem veridischen und dem nicht-veridischen Fall – aus dem einfachen Grund, dass man nicht gleichzeitig einem Wahrnehmungsfehler oder einer Täuschung zum Opfer fallen und diese als solche durchschauen kann. Auch im nicht-veridischen Fall scheint sich ein transzendenter Gegenstand im Bewusstsein zu „konstituieren“. Aus solchen Gründen forderte Husserl (in den Ideen), dass in einer phänomenologischen Beschreibung die Existenz des oder der Objekte (falls vorhanden), die den Gehalt des beschriebenen intentionalen Erlebnisses erfüllen, „eingeklammert“ werden muss. Das heißt: Die phänomenologische Beschreibung eines bestimmten Aktes und insbesondere die phänomenologische Spezifizierung seines intentionalen Gehalts darf sich nicht auf die Richtigkeit irgendeiner Existenzannahme in Bezug auf das/die Objekt(e) (falls vorhanden) stützen, um das/die es in dem jeweiligen Akt geht. Die Epoché sorgt also dafür, dass wir uns auf jene Aspekte unserer intentionalen Erlebnisse und ihrer Gehalte fokussieren, die nicht von der Existenz eines repräsentierten Objekts in der extra-mentalen Welt abhängen.
Bei näherer Betrachtung stützt sich Husserl bei der Einführung dieser Methode in den Ideen jedoch auf zwei verschiedene Versionen der Epoché, die er nicht so klar voneinander trennt, wie es wünschenswert wäre: die globale oder „universale Epoché“ auf der einen Seite und eine schwächere „lokale Epoché“ (wie man sie nennen könnte) auf der anderen. Die erstere Version scheint (so, wie sie in den Ideen beschrieben wird) vom Phänomenologen (bzw. der Phänomenologin) zu verlangen, dass er alle seine Existenzannahmen bezüglich der Außenwelt auf einmal, an jeder beliebigen Stelle, in Klammern setzt, während die schwächere Version von ihm lediglich verlangt, bestimmte Existenzannahmen in Klammern zu setzen. Die schwächere Version liegt der Einführung des Begriffs des Noema in den Ideen zugrunde, im Zusammenhang mit Beispielen wie der perzeptuellen Halluzination (ein Begriff, der innerhalb der universalen Epoché nicht anwendbar ist; vgl. Overgaard 2004, 23) eines blühenden Apfelbaums (Hua III/1, 204ff.): Husserl klammert hier tatsächlich nur die Existenz bestimmter realer Gegenstände ein (Beyer 2000, 140–148). Demgegenüber scheint die einzige Funktion der universalen Epoché in den Ideen darin zu bestehen, die „Residuumsthese“ zu etablieren, wonach der Bereich des „reinen Bewusstseins“ unabhängig von der Außenwelt existiert. Seine Argumentation für diese These in den Ideen, die sich auf die Möglichkeit der „Weltvernichtung“ bezieht, ist jedoch fehlerhaft (vgl. Beyer 2000, 138ff.; 2007, 76ff.), und wie Erhard (2014, Fn. 718) bemerkt hat, hat Husserl den entsprechenden Irrtum später selbst entdeckt (vgl. Hua XXXIX, 256f.).
Damit bleibt die Frage offen, welche andere Funktion die Epoché im Kontext der Husserl'schen Methodologie haben könnte. Die plausibelste Interpretation scheint zu sein, dass „das Einzige, was durch die Epoché ausgeschlossen wird, eine gewisse Naivität ist, die Naivität, die Welt einfach für selbstverständlich zu halten und dabei den Beitrag des Bewusstseins zu ignorieren (Hua 27/173)“ (Zahavi 2017, 67; vgl. auch Landgrebe 1982a, 26ff.), wobei „die fragliche Aufhebung [von Existenzsetzungen] lediglich propädeutisch und provisorisch ist“ (Zahavi 2017, 58).
Nur die Methode der universalen Epoché, wie sie in den Ideen eingeführt wird, scheint mit unserer externalistischen Lesart in Konflikt zu geraten: Wenn an keiner Stelle irgendwelche extra-mentalen Existenzannahmen zugelassen sind, dann kann es phänomenologisch gesehen keine objektabhängigen intentionalen Gehalte geben, wie der Externalismus es vorsieht. Im Gegensatz dazu könnte es einige solcher Gehalte geben, sogar viele, ohne dass der intentionale Gehalt generell von einem bestimmten extra-mentalen Objekt abhängig sein muss. Damit bleibt genug Raum für die (lokale) Anwendung der Epoché-Methode auf jeden gegebenen Einzelfall, wie in Abschnitt 6 deutlich werden wird.
6. Epoché, Wahrnehmungs-Noema, Hýle, Zeitbewusstsein und phänomenologische Reduktion5
Die Pointe der lokalen Epoché lässt sich vielleicht am besten herausarbeiten, wenn wir sie in Anknüpfung an Husserl auf den Fall der Wahrnehmungserfahrung anwenden. Der Phänomenologe soll seine Beschreibungen aus der Ich-Perspektive vornehmen, um sicherzustellen, dass der jeweilige Gegenstand genau so beschrieben wird, wie er erlebt wird. Nun kann man bei Wahrnehmungserfahrungen natürlich nicht gleichzeitig einem bestimmten Wahrnehmungsfehler zum Opfer fallen und ihn entdecken; es ist immer möglich, dass man einer Illusion oder gar einer Halluzination unterliegt, so dass die eigene Wahrnehmungserfahrung nicht veridisch ist. Wenn man halluziniert, existiert nicht wirklich ein Wahrnehmungsobjekt. Doch phänomenologisch gesehen ist die Erfahrung, die man macht, genau dieselbe wie dann, wenn man erfolgreich ein äußeres Objekt wahrnehmen würde.