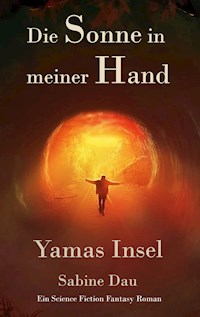Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Selbst Wesen, die weder Mitgefühl noch Liebe kennen, haben ein Recht zu leben. Davon ist Yama, der Herr des Totenreichs zutiefst überzeugt. Um das Überleben der dämonischen Asura zu sichern, unterbricht er sogar die Suche nach seinem verstorbenen Freund, der durch das Jenseits wandert. Doch um den drohenden Untergang der Dämonen zu verhindern, muss er einen Pakt mit den von ihnen gehassten Göttern eingehen. Wird Yama sein Versprechen halten und den brüchigen Frieden zwischen ihnen und den Völkern des Himmels bewahren? Die Autorin verbindet die Mythenwelt Asiens und eine dramatische Handlung zu einem packenden Fantasyroman. Die Yama-Chroniken dritter Teil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
„Die Menschen gaben mir viele Namen, Hades, Osiris oder Pluton.
Doch kaum jemand kennt meine wahre Natur.“
„Einst war ich Mensch.“
„Und ich ein Dämon.“
„Meine Mutter gab mir den Namen Jeng.“
„Und ich nannte mich selbst Varun.“
„Wir lagen tief in der Erde geborgen für sehr lange Zeit.
Gutes, inniges Dunkel.
Ich habe geschlafen.“
„Und ich gewacht.“
„Und als man uns wieder emporhob zum Licht, waren wir anders, als zuvor.“
„Weder Mensch noch Dämon sind wir gemeinsam der
Herr des Totenreichs,
durchdrungen von Licht und Dunkelheit.
Ich bin Yama!“
Leben ist wie eine Kerzenflamme im Wind!
Manches Leben verlöscht, noch bevor es geboren wird,
anderes bereits im Kindesalter,
viele leben lange und werden alt,
doch alle müssen gehen, wenn ihre Zeit gekommen ist.
Inhaltsverzeichnis
Alepou im Bardo
Harkandas
Yama
Harkandas
Alepou im Bardo
Harkandas
Yama
Indra
Yama
Indra
Orb Ria
Yama
Harkandas
Orb Ria
Naga
Yama
Manassa
Orb Ria
Naga
Orb Ria
Yama
Orb Ria
Yama
Manassa
Yama
Manassa
Orb Ria
Manassa
Orb Ria
Manassa
Orb Ria
Yama
Manassa
Orb Ria
Yama
Orb Ria
Yama
Orb Ria
Yama
Harkandas
Yama
Orb Ria
Harkandas
Orb Ria
Yama
Manassa
Harkandas
Yama
Orb Ria
Indra
Harkandas
Orb Ria
Alepou im Bardo
Alepou im Bardo1
Sein Körper wurde schwer. Es war ein Gefühl, als würde er im Schlamm versinken.
„Hilf mir!“, wollte er schreien, doch kein Laut drang aus seiner Kehle, deshalb dachte er:
‚Halt mich fest, bitte!‘
Dicht an seinem Ohr hörte er eine vertraute Stimme: „Hab keine Angst, bleib ruhig! Es gibt nichts zu bedauern oder zu bereuen. Denke immer daran, Alepou vieles, was dir auf deiner Reise begegnen wird, ist eine Illusion. Versuche dich daran zu erinnern! Versuche aufzuwachen!“
Nach diesen Worten war es still. Die Wärme seines Körpers zog sich immer weiter zurück. Seine Glieder wurden kalt. Dann fühlte er nichts mehr, keine Schmerzen, keine Freude, nichts. Vor seinen geschlossenen Liedern sah er Rauchwölkchen aufsteigen. Glühwürmchen leuchteten in dem dunklen Rauch, sie tanzten und hüpften aufeinander zu und vereinigten sich schließlich zu einem flackernden Licht. War es das Licht eines Öllämpchens?
Zuerst brannte die Flamme unruhig, so als stände sie an einem zugigen Ort, doch langsam und unmerklich wurde sie ruhiger. Die Angst fiel von ihm ab und er konzentrierte sich ganz auf das Licht, das sich im Zentrum seines Geistes befand. Es kam näher, er fiel darauf zu, schließlich öffnete es sich zu einer klaren, leuchtend hellen Weite, wie die Morgendämmerung an einem klaren Herbsttag.
Eine orangerote Sonne erhob sich langsam aus dem klaren Licht. ‚Es dämmert‘, dachte er. Freude erfüllte ihn und eine tiefe Ruhe. Musik erklang feierlich und schön, er fühlte sich davon emporgehoben. Wie ein Windhauch, so leicht war er. Er sah auf den Körper herab, den er so lange bewohnt hatte und er sah seinen Freund, der zu ihm aufsah. „Wirst du mich begleiten, auf meiner Reise?“, fragte er ihn.
„Nein, doch ich werde zu dir kommen, sobald du deinen Platz gefunden hast, in der Nachwelt.“
„Mein Herz wird dich erkennen“, versprach Alepou noch, dann schwebte er zur Decke empor und befand sich mit einem Mal hoch über der Stadt. Ein Ton erklang im Osten, er wandte sich ihm zu. Unwiderstehlich fühlte er sich davon angezogen. Die Welt raste schnell und immer schneller an ihm vorbei. Alepou konnte nicht sagen, wie lange seine Reise dauerte, bis sie abrupt endete.
Vor ihm befand sich ein Tor, dessen Flügel weit offen standen. Es rief und lockte. Er schritt darauf zu, berührte die flimmernden Türflügel, doch zögerte er, es zu durchschreiten. Eine Zeit lang stand er nur da, dann drehte er sich um und sah erst jetzt, dass er sich hoch auf einem Berg befand. Einige Schritte entfernte er sich von dem Durchgang und sah hinab. Wolken versperrten ihm die Sicht auf die Landschaft unter ihm. Sie verdichteten sich und türmten sich immer mehr zu drohenden Gewitterwolken auf. Langsam stiegen sie höher und kamen auf ihn zu. Alepou schauderte. Zweifelnd wandte er sich um und ging zum Tor zurück, dicht davor blieb er stehen. Obwohl das Tor weit offen stand, konnte er nicht erkennen, was dahinter lag. Noch einmal drehte er sich um und sah den Berg hinab. Lautes Donnergrollen erklang, drohend und Unheil verkündend.
‚Werde ich zurückkehren können, wenn ich diese Welt verlasse?, fragte er sich. Werde ich Phila und meinen Sohn besuchen können, um zu sehen, wie es ihnen geht?‘
Donner polterte und grollte, diesmal lauter als zuvor. Blitze zogen ununterbrochen über tiefschwarze Wolken dahin. Dunkle Nebelschwaden umspülten bereits seine Füße. Er wich zurück und näher an das flimmernde Tor heran. Alepou spürte, dass er es durchschreiten musste. Trotzdem stand er noch eine Weile da, ohne sich zu regen. Er konnte sich nicht dazu entschließen hindurchzugehen, denn er wusste, dass er dann alles was er liebte und alles, was ihm im Leben wichtig gewesen war, hinter sich lassen musste.
Plötzlich traf ihn die Erkenntnis wie ein Blitzschlag: ‚Ich bin gestorben! Ich muss vorwärtsgehen! Was auch immer mich hinter dieser Tür erwartet, ich muss sie durchschreiten. Einen anderen Weg gibt es für mich nicht!‘
Ein Donnerschlag riss ihn jäh aus seinen Gedanken. Er schaute nicht noch einmal zurück, als er beherzt durch die Pforte schritt.
Tiefste Finsternis umgab ihn. ‚Wo bin ich? Ich kann nichts sehen!‘ Verwirrt tastete er umher. Ihm war, als ob ihm alles was ihn ausmachte, entrissen worden wäre. All seine Ziele und Pläne, die er im Leben gehabt hatte, waren zunichtegemacht und mit einem Schlag vergangen.
„Hallo, ist da wer?“, rief er.
„Wer bist du?“, fragte ihn jemand.
„Ich bin Alepou aus Athen.“
„Du meinst, du warst Alepou aus Athen, doch wer bist du jetzt?“
„Ich weiß es nicht, wo bin ich?“
„Ganz bei dir.“
„Ich kann nichts sehen!“
„Im Inneren deines Geistes herrscht Dunkelheit, wenn du es willst und Licht, wenn du es wünschst.“
„Ich möchte sehen, ich wünsche mir Licht!“
„Dann soll es so sein.“
Die Umgebung nahm Gestalt an und er sah einen langen Tunnel, der sich in die Tiefe wand, doch den Sprecher sah Alepou nicht. „Wo bist du?“
„Bei dir“, antwortete die Stimme.
„Ich kann dich nicht sehen!“
„Es ist nicht nötig, mich zu sehen, du musst vorwärtsgehen, denn umzukehren ist dir nicht mehr möglich. Folge dem Tunnel!“
Alepou tat, was die Stimme ihn riet und wanderte den langen Tunnel hinab. Einsam und verloren fühlte er sich. Kein Laut war zu hören, während er ging. Nicht einmal das Geräusch seiner eigenen Schritte durchbrach die Stille. Lange ging er so und während er ging, erinnerte er sich an Jengs Worte:
„Jede Seele fühlt sich im Leben zu Gleichgesinnten hingezogen. Deshalb bestimmt sie auch selbst, welche Gesellschaft sie im Nachleben haben wird. Was dir im Nachleben begegnet, hängt vor allem von deinem Geisteszustand ab. Wer schlecht ist, fühlt sich vom Schlechten angezogen, wer gut ist, vom Guten. Im Leben und auch im Tode muss er das erleiden und tun, was er anderen angetan hat. Niemand kann sich diesem Gesetz entziehen und wird sich nicht rühmen können, über die Götter die Oberhand behalten zu haben.“2
‚Vieles was mir hier begegnet, ist nur eine Illusion, ein Traum, der sich nach meinen Ängsten und Vorstellungen richtet, das hat Jeng zu mir gesagt. Wenn das so ist, bin ich die Ursache für all das, was mir in dieser Welt begegnet und es besteht kein Grund, sich zu fürchten. Ich bin bereits tot, deshalb kann mir auch nichts mehr schaden. Es ist wichtig, wach zu bleiben in meinem Traum!‘
Während er das dachte, gelangte er an das Ende des Tunnels und trat auf eine Ebene hinaus.
Nicht weit von ihm entfernt sah er einen Fluss. ‚Der Styx? Dann ist Charon nicht weit. Er ging auf das Gewässer zu und dachte besorgt: Ich kann den Fährmann nicht bezahlen, ich habe keinen Obolus dabei!‘
Das Ufer war dicht mit Schilf bewachsen, es raschelte leise im Wind, die Luft war feucht und warm. Während er am Ufer entlangging, überlegte er: ‚Phila wird meinen Körper bestatten und die vorgeschriebenen Totenriten ausführen. Sie wird den Obolus für den Fährmann nicht vergessen.‘ Noch während er dies dachte, spürte er eine Münze in seiner Hand und lächelte. Zuversichtlich ging er weiter und traf bald auf andere Seelen, die am Ufer umherirrten oder in die gleiche Richtung, wie er gingen. Manche grüßten oder nickten ihm freundlich zu, doch niemand sprach ihn an. Von Weitem sah er nun auch den Fährmann und seine Barke. Ströme von Seelen eilten auf ihn zu. Charon blickte ihm finster entgegen, sein schwarzer Schifferkittel war zerschlissen, seine Haltung von Gram gebeugt. Alepou ging auf ihn zu. Wortlos öffnete Charon seine Hand und forderte seinen Lohn ein. Alepou legte den Obolus hinein. Zufrieden schloss sich die Hand des Fährmanns darum.
„Steig ein!“, knurrte er.
Die Barke war voll besetzt. Alepou setzte sich auf eine Bank, zwischen die anderen Seelen, die sich dicht aneinander drängten.
Viele der Mitreisenden nahmen ihn gar nicht wahr. Sie starten ins Leere oder unterhielten sich mit jemandem, den nur sie sehen konnten. Nur wenige schienen wach zu sein, denn sie sahen sich um, so wie er. Doch Alepou zweifelte.
‚Vielleicht träume ich, genau wie alle anderen und glaube nur wach zu sein?‘, dachte er.
Der Fährmann stieß die Barke vom Ufer ab und sie trieben friedlich mit der Strömung dahin. Müßig betrachtete Alepou während der Fahrt das schilfbewachsene Ufer und das eintönige Hinterland.
Bei sich überlegte er: Charon entspricht genau meinen Vorstellungen! Dies kann nicht real sein! Er sah den Fährmann an und konzentrierte sich darauf, seinen Traum zu durchbrechen. Der Fährmann begann zu flimmern. Seine Konturen verschwammen und plötzlich sah Alepou ein grauenvolles Wesen an seiner Stelle stehen. Nachtschwarz war es, mit einer furchterregenden Fratze. Doch Alepou fürchtete sich nicht, denn er kannte solche Wesen. ‚Er sieht aus wie Varun oder ist er es sogar selbst?‘
Auch die Landschaft hatte sich verändert. Das Schilf am Ufer war verschwunden, nur Ödnis war geblieben. Alepou erhob sich von der Bank und zwängte sich durch das Gedränge der Seelen, bis zu dem Fährmann durch.
„Setz dich hin!“, forderte der. Seine Stimme war kalt wie Eis.
Und Alepou erkannte: ‚Das ist nicht Varun, diese Stimme klingt anders!‘ Laut sagte er: „Du bist ein Unterirdischer, ein Dämon, habe ich recht?“
„Ja, setz dich hin!“
„Dann existiert Charon nicht?“, fragte Alepou weiter, ohne auf seine Aufforderung einzugehen.
„Er existiert in deiner Vorstellung. Setz dich!“
„Wie lange dauert diese Fahrt?“, fragte er unbeirrt.
„Nicht lang.“
Zufrieden drängte Alepou sich zwischen die anderen Seelen und setzte sich wieder an seinen Platz. Auf dem Fluss sah er nun weitere Barken, die alle träge in die gleiche Richtung fuhren. Tatsächlich dauerte es nicht mehr lange, bis der Dämon das Ufer ansteuerte und anlandete.
Alepou und all seine Reisegenossen verließen die Barke. Gleich darauf stieß sich der Fährmann eilig vom Ufer ab und die Barke entfernte sich rasch vom Steg.
Eine prachtvolle Stadt lag vor ihm, sie glitzerte silbern im Sonnenlicht. Genau wie alle anderen Seelen wurde auch Alepou von den prunkvollen Gebäuden angezogen. ‚Endet hier meine Reise? Bin ich am Ziel?‘, fragte er sich.
Eine Frau begrüßte die Neuankömmlinge freundlich. Sie trug ein Kleid aus filigranen Silberfäden und in ihrem Haar funkelten Edelsteine, doch trotz all des Glanzes wirkte die Frau seltsam ausgezehrt. „Willkommen Reisende! Lasst euch nieder in unserer schönen Stadt! Alles was ihr begehrt und wünscht, soll euch sogleich erfüllt werden. Alle Not und alle Entbehrungen des Lebens werdet ihr an diesem Ort schnell vergessen haben.“
So wunderschön und reich hätte sich Alepou die Nachwelt niemals vorstellen können. Er ging durch die Straßen und bewunderte die Häuser, mit ihren aufwendig verzierten Fassaden. Selbst die Wege und Plätze schienen ihm mit Gold gepflastert. Er kam an einem Haus vorbei, dessen Tür offen stand, und schaute neugierig hinein.
Keine Villa in Athen war eindrucksvoller als diese. Aufwendige Mosaike schmückten den Boden und die Wände waren reich und kunstvoll bemalt.
Heftig flammte Neid in ihm auf, während er sehnsüchtig, durch die Tür in das Innere sah. ‚Wie gern würde ich ein solches Haus besitzen. Mir steht das zu! Stets habe ich mich um das Wohl meiner Mitmenschen gesorgt. Ich war ein guter Arzt, ebenso gut, wie Xenokrates, doch im Gegensatz zu ihm, habe ich nie eine Villa besessen. Immer war ich arm.‘
Jemand räusperte sich hinter ihm, Alepou schreckte zusammen und drehte sich um.
„Entschuldigt mein Herr, ich wollte Euch nicht erschrecken“, sagte ein Mann und verbeugte sich tief vor ihm. Er wirkte eigentümlich farblos. „Darf ich mich vorstellen? Ich bin Sinas, der Diener dieses Hauses. Es hat keinen Besitzer, weshalb die Türen offen stehen. Wenn Euch das Haus gefällt, gehört es Euch.“
Ungläubig fragte Alepou: „Es gehört mir, wenn ich es haben will?“
„Ganz recht.“ Sinas verbeugte sich wieder vor ihm.
„Und ich muss nichts dafür tun?“
„Oh nein, das ist der Lohn, den Ihr Euch im Leben verdient habt, verehrter Herr.“
Zuerst fühlte Alepou große Freude und Stolz, doch dann zögerte er und fragte: „Gibt es noch schönere Häuser als dieses?“
„Oh, es gibt viele Häuser, die auf neue Bewohner warten. Sie sind nicht alle gleich, es mag sein, dass Euch ein anderes besser gefällt.“
„Gut, dann werde ich mich zunächst umsehen.“
Alepou ließ den Mann stehen und ging aufgeregt die Straßen entlang. Dabei hielt er nach weiteren geöffneten Haustüren Ausschau. Genau wie er schienen auch Andere auf der Suche zu sein. Er drängte sich an ihnen vorbei und hastete durch die Stadt, von unbestimmter Angst getrieben.
Die Stadtbewohner, an denen er vorbei kam, waren reich gekleidet und geschmückt, sodass Alepou sich wegen seiner einfachen Kleidung schämte. Er ging von einem Haus zum nächsten, ohne sich für eines entscheiden zu können. Jedes war von außen wie von innen prachtvoll und keines glich dem anderen.
Schließlich blieb er stehen und blickte mit ratlosen Augen auf das Treiben der Stadt. Erst jetzt, wo er innehielt, erkannte er, wie seltsam sich die Einwohner verhielten.
Ein Mann zog einen schweren Wagen, der mit Gold und Edelsteinen voll beladen war, sodass er ihn kaum von der Stelle bewegen konnte. Andere schleppten schwere Körbe oder zogen Säcke voll Kostbarkeiten hinter sich her. ‚Woher kommen all diese Schätze?‘, fragte er sich. Auch die Körper der Stadtbewohner wirkten seltsam unförmig, die Bäuche aufgebläht, während die Beine auffällig dünn waren. Entschlossen ging Alepou auf den Mann zu, der den Karren zog und sagte: „Wenn Ihr erlaubt, werde ich Euch helfen, den Wagen zu ziehen.“
Der Mann blickte auf und musterte ihn erschrocken, dann warf er sich schützend über die Kostbarkeiten. „Hau ab, du Dieb! Das ist mein Schatz, das steht mir zu!“
Beschwichtigend hob Alepou die Hände und versicherte hastig: „Ich wollte Euch nichts fortnehmen.“
Misstrauisch sah der Mann zu ihm auf. „Du bist nur neidisch, weil ich reicher bin als du. Geh weg! Lass mich in Ruhe!“
Alepou trat einige Schritte zurück und wandte sich dann wortlos ab. Er ließ den Mann und seinen Karren hinter sich und eilte davon. Ohne nachzudenken, betrat er das erstbeste Haus, das offen stand.
„Willkommen, Herr!“ begrüßte ihn Sinas.
Verwirrt schaute Alepou den kleinen Mann an. „Hast du mich verfolgt? Dies ist doch nicht dasselbe Haus wie vorhin?“
„Ihr habt eine außerordentliche Beobachtungsgabe, werter Herr. Alle Hausdiener der Stadt heißen Sinas und sehen gleich aus.“ Der Mann verbeugte sich unterwürfig.
„So? Na gut. Ich habe mich entschlossen, fürs Erste in diesem Haus zu wohnen.“
„Eure Entscheidung ist weise, geliebter Hausherr. Teilt mir Eure Wünsche mit, was es auch sein mag, ich werde sie erfüllen.“
Alepou ließ den Diener stehen und besichtigte die Räume seines neuen Heims. Es war reich und luxuriös ausgestattet, genau wie all die anderen Häuser der Stadt.
Dennoch konnte er sich über seinen neuen Besitz nicht freuen. Eine große Unzufriedenheit und ein gewaltiger Hunger erfüllten ihn. Schließlich wandte er sich an den Diener, der ihm unaufgefordert gefolgt war: „Ich bin hungrig und möchte essen!“
„Alles, wonach Ihr verlangt, werde ich Euch bringen, Herr.“
„Gut, dann bringt mir eine geschmorte Hammelkeule, Weintrauben und Apfelkuchen, ein feines Weizenbrot und süßes Gebäck, Möhren in Honig geschmort, einen Salat …“ Alepou verstummte.
„Ich werde eilen und alles sogleich besorgen.“ Sinas wollte bereits den Raum verlassen, doch Alepou hielt ihn auf.
„Warte! Bring mir außerdem: Eingelegte Sardinen, ein gebratenes Huhn, gegrillten Oktopus, Schweinekoteletts, frische Kirschen und Feigen und … mach schnell!“
Der Diener rannte auf die Straße, Alepou blieb allein zurück. Es verlangte ihn so sehr nach Nahrung, dass ihm sein Hunger entsetzliche Qualen bereitete. Visionen von unterschiedlichsten Köstlichkeiten traten vor seine Augen. Unruhig lief er hin und her, während sich die Zeit in die Länge zog, bis der Diener endlich zu ihm zurückkehrte.
„Die gewünschten Speisen habe ich bereitgestellt. Bitte folgt mir, hoher Herr.“
Alepou folgte. Schon von Weitem roch er den köstlichen Duft, der aus dem Speisezimmer drang. Der Tisch war reich gedeckt.
Er drängte sich an dem Diener vorbei und stürzte sich heißhungrig auf die dargebotenen Speisen. Er schlang und stopfte gierig alles wahllos in sich hinein, würgte und schluckte in großer Hast, doch obwohl er Unmengen verzehrte, wurde er nicht satt. Sein Hunger schien, während er aß, sogar noch zuzunehmen. Erst als der Tisch leer war, wandte er sich zu Sinas um.
„Seid Ihr zufrieden, Herr?“, fragte der Diener.
„Zufrieden? Nein, ich bin hungriger, als zuvor. Diese Speisen sättigen nicht.“
„Im Leben habt Ihr viel entbehrt und oft gehungert. Es wird lange brauchen, bis dieser Hunger gestillt ist. Ich werde mehr beschaffen, teilt mir mit, was Ihr begehrt.“
Alepou starrte den Mann an und sah dann an sich herab. Seine Kleidung war mit Speiseresten besudelt. ‚Dies kann nicht real sein! Die Speisen hätten viele satt machen können, doch mir ist, als hätte ich nur Luft verschlungen.‘ Er bemühte sich, die Illusion zu durchdringen und aufzuwachen, doch vergeblich.
Sinas sagte: „Seht doch Herr, der Tisch ist bereits wieder gedeckt!“
Alepou wandte sich um. Tatsächlich standen neue Speisen bereit, so als hätte er sie zuvor noch nicht angerührt. ‚Ich träume!‘, erkannte er. ‚Ich muss diesen Ort verlassen, und zwar schnell!‘
„Sag mir Sinas, gibt es einen Weg, aus dieser Stadt heraus?“
Entsetzt riss der Diener die Augen auf. „Nein Herr, es gibt keinen Weg hinaus. Der Fährmann bringt Seelen hierher, nimmt aber keine zurück.“
„Wenn nur Seelen zu euch gebracht werden, aber niemand diese Stadt verlassen kann, warum stehen dann so viele Häuser leer?“
„Außerhalb der Stadt gibt es ein Ungetüm, das jeden frisst, der ihm zu nahe kommt. Man nennt es die große Fresserin. Wer von ihr verschlungen wird, kehrt nicht zurück, ihn erwartet der Tod.“
‚Ich bin bereits tot!‘, dachte Alepou und forderte: „Zeig mir den Weg dorthin!“
„Bitte Herr, geht nicht zu ihr. Jeden anderen Wunsch werde ich Euch erfüllen. Doch wer zu ihr geht, der wird zermalmt.“
Ungerührt erwiderte er: „Ich habe den Wunsch, von ihr zermalmt zu werden. Also bringst du mich zu ihr oder nicht?“
„Reichtümer kann ich Euch bringen, erlesenen Schmuck und kostbarste Kleider. Frauen, schön und willig, alles, was Ihr wünscht, doch bitte zwingt mich nicht, Euch zu ihr zu führen“, jammerte der Diener.
„Jeder ist reich in dieser Stadt. Jeder trägt kostbare Kleidung und Schmuck, doch wenn man Kostbares so leicht gewinnt, verliert es seinen Wert. Meinen Hunger kann ich damit nicht stillen. Bring mich zu ihr! Es ist mein Wunsch, zermalmt zu werden!“
Kurz verbeugte sich Sinas, dann drehte er sich um und verließ das Haus.
Ohne Bedauern folgte Alepou. Stumm gingen sie durch die prunkvollen Gassen, an den reich verzierten Häusern und deren Bewohnern vorbei. Arm waren die Menschen hier, erkannte er, denn sie besaßen weder Zufriedenheit noch Freude.
Erst am Rande der Stadt hielt Sinas an und deutete auf einen gewaltigen Frauenkopf in der Ferne, so groß wie ein Berg. „Dort ist sie. Bitte zwingt mich nicht, weiterzugehen.“ Der Diener bebte vor Furcht.
„Das wird nicht nötig sein. Ich danke dir für deine Dienste.“
Sinas verbeugte sich rasch und kehrte danach eilig in die Stadt zurück.
Alepou sah ihm nach, dann wandte er sich ab und ging unbeirrt und ohne Angst auf den Frauenkopf zu. Er war tot, was also hatte er zu befürchten?
Die Fresserin sah ihm entgegen und sprach: „Komm zu mir, Wanderer! Wenn du die wüsten Regionen des Hungers verlassen willst, tritt ein!“ Sie öffnete ihren gigantischen Mund und atmete ein.
Der Sog zerrte an ihm, Alepou stemmte sich nicht dagegen.
Er fiel und rutschte den glitschigen Schlund hinab. Es stank bestialisch nach Moder und Verwesung. Nach und nach mischte sich Brandgeruch hinzu. Hitze schlug ihm entgegen, als seine Fahrt abrupt endete.
Alepou sah sich um. Er stand in einem Tal, das von hoch aufragenden Bergen umschlossen wurde. Direkt vor ihm brannte ein lodernder Feuersee, von dem ihn nur ein schmaler Strand aus Asche trennte. Instinktiv wich er vor der glühenden Hitze einige Schritte zurück.
Eine Stimme fragte: „Hat er Verstand?“
Eine andere antwortete: „Wohl kaum.“
Alepou entdeckte vier Tiere, die er nur von Abbildungen her kannte. Es waren Affen, die am Strand beieinandersaßen. Ihre Unterhaltung bezog ihn nicht ein.
„Er hat den Hunger überwunden und ist zu uns gelangt“, sagte einer.
Ein Anderer widersprach ihm: „Seinen Instinkten ist er gefolgt, nicht mehr.“
„Ein unwissendes Tier ist er!“ stimmte der eine Affe, dem anderen zu.
Alepou musste schmunzeln, über diese seltsam absurde Situation. Er riss sich zusammen und sagte: „Ich möchte nur einen Platz finden in der Nachwelt.“
„Es spricht mit uns!“
„Weiß er nicht, wer wir sind?“ Die Stimme des Affen klang empört.
Alepou unterdrückte ein Glucksen. „Ihr seid Illusionen meines Verstandes, mehr nicht.“
Zornig erhoben sich die Tiere und entblößten ihre Eckzähne. Zeternd riefen sie wie aus einem Munde: „Illusionen, nicht mehr?! Wie kannst du es wagen, uns zu schmähen? Wir, die Paviane des Feuersees sind erhaben! Wir nähren uns von der Wahrheit! Wir sind wahrhaftig, du bist eine Illusion!“
Alepou konnte sich nicht mehr beherrschen und begann schallend zu lachen.
Daraufhin schrien die Affen aufgebracht: „Du störst unsere Ruhe, einfältiger Mensch! Geh fort! Der Feuersee wird dich nicht verbrennen. Alles, was dir schaden könnte, ist vergangen!“
Als Alepou an den See herantrat, entfalteten weißglühende Feuerrosen ihre Blütenblätter, um gleich darauf zu zerfallen. Die Gluthitze war verschwunden. Flammen leckten über seine Füße, doch er spürte keinen Schmerz. Daher watete er mutig tiefer hinein, bis die Flammenwellen über ihn zusammenschlugen und er im Feuer des Sees versank.
Als er wieder auftauchte, befand er sich in der Mitte eines Flusses. Zügig schwamm er auf das Ufer zu und kletterte an Land. Ein Lied schwebte über der Ebene. Eine Frau sang und obwohl er die Worte nicht verstehen konnte, war der Gesang von unbegreiflicher Schönheit. Alepou fühlte sich unwiderstehlich davon angezogen und folgte dem lockenden Klang der Stimme. Bald stieß er auf andere. Gemeinsam gingen sie in einer feierlichen Prozession auf die Sängerin zu und stimmten bald in das Lied mit ein. Kraftvoll und beseelt sang Alepou, während ihm Tränen des Glücks über die Wangen liefen. Eine ganz eigentümliche Empfindung von Selbstvergessenheit und Harmonie entstand dabei in ihm.
Die Sängerin stand auf einem kleinen Hügel, der nun von immer mehr Seelen umringt wurde. Alle schauten verzückt und erwartungsvoll zu ihr auf.
Nachdem das Lied endete, sprach sie: „Kommt zu mir! Hört mir zu! Seid nicht zerstreut! Dieser Augenblick ist von großer Bedeutung. Nur wer weiß, dass er tot ist und die Illusionen der Nachwelt als Projektion des eigenen Selbst durchschaut, kann dieses Reich verlassen. Wer jetzt zerstreut ist, wird lange brauchen, um sich aus dem Morast der Illusionen zu befreien. Merkt euch meine Worte gut, durch sie wird vollkommene Befreiung erlangt.
Wisset, was ihr in der Nachwelt erleidet, wurde durch euch selbst hervorgerufen, durch eure Taten im Leben. Durch eure Schuld werdet ihr geängstigt, eingeschüchtert und erschreckt. Ihr werdet versucht sein, zu lügen und sagen: ‚Ich habe keine bösen Taten begangen!‘ Doch der Herr des Totenreiches wird deinen Spiegel befragen. Er wird in deine Augen sehen, worin er jede gute und jede böse Tat erkennt. Begreift also - lügen ist nutzlos!
Wenn ihr diese Wahrheit versteht, braucht ihr euch nicht zu fürchten. Denn hier besitzt ihr nur einen Geistkörper, er kann nicht sterben.
Außerhalb von euch selbst gibt es nichts als Leere. Handelt so, dass ihr dies erkennt. Erinnert euch so oft wie möglich daran, dass ihr tot seid und durch das Totenreich wandert.
Wenn euch etwas erschreckt, so untersucht die wahre Natur der Erscheinung. Fragt euch, warum es euch erscheint.
Denn wer auch jetzt Furcht und Schrecken erlebt, weil er nicht zuhört, wird zu einem Platz gelangen, von dem es lange Zeit keine Befreiung mehr gibt. Seid deshalb vorsichtig! Vermeidet Schauer und Schrecken!3“
Ein Raunen ging durch die Seelen, als die Frau sich von einem Augenblick zum anderen auflöste, wie Nebel im Wind. Gleichzeitig erschien eine Barke, die nicht weit entfernt anlandete.
Ein schimmernd weißer Pfad erschien vor seinen Füßen, der geradewegs auf die Barke zuführte. Alepou fragte sich, ob er ihm folgen sollte, und sah sich zögernd nach den anderen um. Einige wenige folgten dem Weg. Andere starrten ins Leere oder unterhielten sich mit jemandem, den er nicht sehen konnte. Manche liefen scheinbar ziellos umher. Direkt vor ihm tanzte eine Frau selbstvergessen und kicherte dabei wie ein junges Mädchen.
‚Sie träumen‘, erkannte er. ‚Wie kann ich sicher sein, dass ich nicht auch träume wie sie?‘
„Weil du erkennst, dass sie träumen“, hörte er eine Stimme sagen. „Geh! Steig in die Barke ein!“
Der Stimme vertrauend, ging er auf sie zu und blieb vor dem Fährmann stehen.
„Steig ein!“, forderte ihn der Dämon auf.
„Wohin bringst du mich?“, fragte Alepou.
Der Dämon knurrte bedrohlich, bevor er ihm widerwillig Antwort gab: „Ich bringe dich zum Tor des Hades4, dahinter liegt der Palastgarten. Steig ein!“
Diesmal war die Barke nur mit wenigen Seelen besetzt. Alepou setzte sich auf eine der Bänke. Sofort danach stieß der Fährmann die Barke vom Ufer ab.
Zunächst glitten sie ruhig dahin, während die öde Landschaft friedlich an ihnen vorüberzog, doch bald wurde die Strömung lebhafter. Es war, als wäre das Boot plötzlich in einen Sturm geraten. Unerwartet sprangen einige Mitreisende auf. Auf ihren Gesichtern lag Panik und Entsetzen. Manche schrien vor Angst. Das Boot geriet durch den Tumult bedrohlich ins Wanken. Alepou sah sich beunruhigt um, konnte den Grund ihrer Panik aber nirgends entdecken, daher fragte er sich, was sie sahen.
Da hörte er die Stimme wieder: „Wenn du wissen willst, was sie ängstigt, musst du mit ihnen träumen“, sagte sie.
Alepou sah sich nicht nach dem Sprecher um, stattdessen schloss er die Augen und dachte an Schlaf. Als er sie wieder aufschlug, begann die Luft um ihn herum zu flimmern. Zunächst sah er nur einen Schemen, der sich jedoch rasch zu einem gewaltigen Ungeheuer verdichtete. Ein Schlangenleib mit unzähligen Köpfen erhob sich aus dem Wasser. Gift tropfte aus nadelspitzen Zähnen. Es zischte und fauchte. Das Geräusch ließ Alepou zu Eis erstarren. Immer wieder ließ das Ungetüm die heimtückischen Schlangenköpfe auf die Insassen der Barke herabschnellen. Verzweifelt versuchten die Seelen, die Attacken abzuwehren. Mit einem Mal hielt Alepou ein Schwert in der Hand und stürzte, ohne nachzudenken, auf das Monster zu. Geschickt wich er einem der Köpfe aus und schlug kraftvoll nach einem anderen. Die Klinge traf und trennte den Schlangenkopf vom Rumpf, grünes Blut spritzte. Gleichzeitig biss ihm ein weiterer in die Schulter. Als die Zähne in den Körper eindrangen, krümmte sich Alepou vor Schmerz. Das Gift zeigte rasch Wirkung. Schwindel erfasste ihn und eine bleierne Schwäche. Er schrie, taumelte und fiel auf den Boden der Barke.
„Erinnere dich!“, mahnte eine Stimme.
Schlagartig erwachte Alepou aus seinem Traum, das Untier verschwand. Für einen Augenblick stand er nur da, dann setzte er sich zitternd auf die Bank zurück. Der Fährmann blickte ihn an, während er unbeirrt weiter flussabwärts fuhr. Die übrigen Seelen im Boot kämpften noch immer gegen den Feind, der in Wahrheit nur im eigenen Inneren zu finden war.
„Dort ist kein Monster! Wacht auf!“ rief Alepou ihnen zu.
„Sie werden dich nicht hören“, sagte der Fährmann.
„Aber man muss doch etwas tun, damit sie aufwachen.“
„Du kannst ihnen nicht helfen, wenn sie nicht aufwachen wollen.“
Alepou erhob sich und trat an eine Frau heran, die völlig verängstigt auf dem Boden hockte. Die Arme um sich geschlungen, starrte sie mit weit geöffneten Augen ins Leere und bebte vor Angst.
Er schüttelte sie. „Wach auf!“, rief er laut.
Sie wimmerte leise und schien ihn nicht wahrzunehmen.
Hinter ihm schrie ein Mann in Todesangst. Alepou drehte sich zu ihm um und sah gerade noch, wie er stolperte und ins Wasser fiel. So schnell er konnte, lief er zu der Stelle, um ihn wieder ins Boot zu ziehen, doch der Mann war verschwunden.
„Setz dich, du bist gleich da!“, verkündete der Fährmann. Tatsächlich entdeckte Alepou eine Anlegestelle in einiger Entfernung. Er setzte sich und unternahm keinen weiteren Versuch, die Mitreisenden zu wecken. Als die Barke anlegte, sprang er sofort an Land und lief ohne Eile an der hohen Mauer entlang, bis zu einem Tor, vor dem zwei Wächter saßen. Sie waren offensichtlich in ein Brettspiel vertieft und beachteten ihn nicht, als er an ihnen vorbei durch das Tor schritt.
Er betrat einen Garten von üppiger Pracht. Betörender Blütenduft lag in der Luft und die Äste der Bäume bogen sich unter der Last von reifen Früchten. Vögel sangen. Unzählige Blumen blühten farbenfroh und leuchtend im Gras. Der Anblick des Gartens versetzte Alepou in Erstaunen. Noch nie hatte er Derartiges gesehen. Seelen saßen müßig beisammen. Sie plauderten miteinander oder liebten sich ungeniert vor aller Augen.
Den Duft des Gartens nahm er tief in seine Seele auf und fühlte sich zunehmend wohler. Die Früchte der Bäume lockten, er pflückte eine und biss hinein. Er war sich sicher, dass er zuvor noch nie etwas so Gutes gekostet hatte. Er aß eine Weitere, die sogar noch besser schmeckte.
Eine Frau trat neben ihn, lächelte freundlich und sagte: „Wie ich sehe, schmeckt es dir. Iss so viel du magst.“
Alepou wollte ihr mit vollem Mund nicht antworten, deshalb nickte er nur und aß weiter. Jeder neue Bissen rief bei ihm ein unbegreifliches Entzücken hervor. Er seufzte hingerissen.
„Wenn du satt bist, ruh dich in meinem Garten aus. Du bist hier willkommen und kannst bleiben, solange du bleiben möchtest.“ Die Frau lachte herzlich und sah ihm noch eine Weile zu, doch schließlich wandte sie sich ab und ging davon.
Es dauerte lange, bis Alepou gesättigt war und sich umsah. Er schlenderte müßig herum, beobachtete die Bienen, die von Blüte zu Blüte flogen und Nektar sammelten, hörte dem Gesang der Vögel zu und beobachtete die Seelen, die beieinandersaßen.
War er endlich angekommen? Er setzte sich unter einem Baum und blinzelte in die Sonne. Schläfrig ließ er die Zeit vorüberrauschen, ohne an etwas Bestimmtes zu denken. Er ruhte sich aus, bis die Nacht hereinbrach und erste Sterne sich am Nachthimmel zeigten.
‚In der Unterwelt scheint keine Sonne am Tage und es leuchten keine Sterne des Nachts!‘ Jäh riss ihn diese Erkenntnis aus dem schönen Traum.
Erschrocken setzte er sich auf und sah sich um. Der blühende Garten war verschwunden. Nichts wuchs an diesem Ort. Für einen kurzen Augenblick fühlte Alepou in sich einen Schmerz über den Verlust der Schönheit, die ihn umgeben hatte, doch dann dachte er bei sich: ‚Es war nur ein weiterer Traum. Auch wenn er recht angenehm war, war es nicht real! Ich darf mich nicht blenden lassen.‘
Einzig die Mauer war vom Garten übrig geblieben, die ihn umschlossen hatte. Anstelle des Gartens erblickte er nun einen gewaltigen Palast, der sich genau im Zentrum befand. Helle Lichtadern durchzogen das dunkle Gestein des Bauwerks. Alepou schaute auf und sah hoch oben auf der Spitze des höchsten Turms das Licht, das diese Welt erhellte.
‚Ich kenne diesen Ort! Dort oben ist Hades zu Hause. Dies ist sein Palast!‘ Viele Male war Alepou bei dem Herrn des Totenreichs zu Gast gewesen und hatte vom Turm aus auf die Unterwelt herab geblickt. ‚Wenn dies sein Palast ist, dann ist Hades nahe. Sein Gericht muss sich irgendwo hier befinden.‘ Mit neuer Zuversicht ging er auf das Gebäude zu und daran entlang. Dabei kam er an vielen träumenden Seelen vorbei. Auch Dämonen sah er nun, die so schwarz wie erstarrte Lava waren und geschäftig ihren Aufgaben nachgingen. Sie schenkten ihm und auch den anderen Seelen keine Beachtung. Einen von ihnen sprach Alepou an. „Wo befindet sich das Gericht?“, fragte er.
Der Dämon musterte ihn für einen Augenblick, dann setzte er seinen Weg fort und ließ ihn einfach stehen. Alepou seufzte, ließ sich aber nicht davon entmutigen. Er entdeckte zwei weitere, die genau wie die Wächter am Tor in ein Spiel vertieft waren, und ging auf sie zu „Wo finde ich das Gericht?“, verlangte er noch einmal zu wissen.
Einer von ihnen sah auf. „Geh fort, du störst.“
„Ich werde gehen, wenn ihr mir die Richtung weist“, erwiderte er hartnäckig.
Verärgert gab der Dämon ein Grollen von sich, der andere musterte ihn ebenfalls.
Alepou ließ sich nicht einschüchtern. ‚Sie können mir nichts tun‘, dachte er überzeugt.
Schließlich gab der Dämon nach. Er wies in eine Richtung und sagte: „Dort, nahe dem westlichen Tor, befindet sich das Gericht. Geh, du störst.“
Alepou sah die Umgebung nun viel klarer als zuvor. Ohne Eile ging er in die ihm gewiesene Richtung. Unterirdische erschienen vor ihm aus dem Nichts. Sie beachteten weder ihn noch die anderen Seelen, an denen sie vorübergingen. Trotz ihrer furchterregenden Gestalt und den grotesken Tiergesichtern fürchtete Alepou sich nicht vor ihnen. Neugierig sah er zu, wie sie die verschiedensten Arbeiten verrichteten oder müßig miteinander spielten.
Auch Seelen beobachtete er, wie sie träumend umherliefen, und stellte dabei fest, dass sie die Unterirdischen nicht wahrnehmen konnten, denn sie beachteten sie nicht.
Während er weiter ging, bewunderte er die kunstvollen Mosaikarbeiten auf dem Boden und an der Mauer. Wie Flickwerk waren sie aneinandergereiht, ohne miteinander in Beziehung zu stehen. An manchen dieser Bilder wurde noch gearbeitet. An einen der Dämonen trat er heran und blickte ihm über die Schulter. Geschickt fügte er bunte Steine zu einem Bild zusammen. Es zeigte unverkennbar eine Schlachtenszene.
Der Dämon ignorierte ihn, daher zog Alepou bald weiter und traf kurz darauf auf einen Mann, der auf dem Boden saß und inbrünstig betete:
„Oh Ihr Götter, hört mich an,
um Eurer Liebe und der Barmherzigkeit willen,
weist mir den Weg!
Damit ich nicht umherirre in der Nachwelt.
Schützt mich vor Zorn,
Schützt mich vor Stolz.
Schützt mich vor Täuschung.
Ich gelobe, ich werde nicht dem anhängen,
was ich zurücklassen musste,
noch eifersüchtig sein, wenn andere jetzt das lieben,
was ich einst liebte.
Sendet zu mir den hellen Lichtpfad,
sodass ich gerettet werde,
aus dem schreckensvollen Totenreich.5“
Ein leuchtend weißer Pfad erschien vor dem Betenden. Der Mann erhob sich, mit einem entrückten Lächeln und lief den Pfad entlang. Alepou sah ihm hinterher und fragte sich, ob er ihm folgen sollte. Doch er verwarf den Gedanken sofort wieder. ‚Jeder muss seinen eigenen Weg finden!‘, dachte er bei sich. Er wandte sich ab und ging immer weiter am Palast entlang, bis er auf ein zweiflügeliges Tor traf. Aufwendige Intarsienarbeiten schmückten die Torflügel. Auf der linken Seite erkannte er das zornvolle Bild eines Dämons und auf der rechten das freundliche Abbild eines Menschen. Beide hielten ein Flammenschwert hoch über den Kopf und ein Buch in der Hand.
‚Das muss das Gericht sein!‘, erkannte Alepou aufgeregt und drückte gegen das Tor. Es war nicht verschlossen. Er stieß es auf und trat ohne Zögern hindurch. Es schloss es sich hinter ihm mit lautem Donnerhall, der durch den Raum dröhnte.
Alepou erstarrte. Am gegenüberliegenden Ende erblickte er ein grauenvolles Wesen auf einem Thron. Aus eisblauen Augen starrte es ihm kalt entgegen. Ein Mann kniete in demütiger Haltung vor ihm, auch er wandte sich um, genau wie die sechs Dämonen, die rechts und links zwischen den Säulen standen.
Einer der Sechs stürzte auf ihn zu und wuchs dabei zur doppelten Größe an. Entsetzt wich Alepou zur Tür zurück. Er schrie laut auf, als rasiermesserscharfe Krallen ihn packten und schmerzhaft in seine Schultern schnitten. Die Kiefer des hundeköpfigen Dämons schnappten dicht vor ihm zusammen, das drohende Grollen das er dabei ausstieß, fühlte er tief in seiner Seele.
Plötzlich hörte Alepou eine vertraute Stimme: „Harkandas, lass ihn los, sofort!“
Augenblicklich gehorchte der Dämon und wandte sich um. Die Schreckensgestalt auf dem Thron erhob sich.
Alepou stammelte hastig eine Entschuldigung. „Es … es tut mir leid, ich … wollte nicht …“
Doch das nachtschwarze Wesen schenkte ihm keinerlei Beachtung, stattdessen sagte es zu seinem Diener: „Bring ihn zum Tempel und bleib bei ihm, bis ich Zeit für ihn habe.“
„Ja, Herr“, bestätigte der Dämon, packte Alepou unsanft und schob ihn durch die Tür. Vor der Gerichtshalle ließ er ihn sofort los. „Folge mir!“, befahl er und wandte sich ab.
Alepou zögerte. Der Schreck, den er im Gerichtssaal erlebt hatte, saß tief. Es war die vertraute Stimme von Hades gewesen, die aus dem Wesen sprach, doch die Stimme hatte kalt und abweisend geklungen.
‚Ich habe seine Gerichtsverhandlung gestört. Ob er deshalb verärgert ist?‘
Der Gerichtsdiener schien es zu sein und war es noch immer. Als er bemerkte, dass Alepou nicht folgte, stieß er erneut ein bedrohliches Knurren aus. „Komm mit mir!“, rief er.
Alepou beeilte sich, zu dem Dämon aufzuschließen, denn er wollte unbedingt vermeiden, dass er noch einmal seine Krallen in ihn schlug.
‚Nur weil ich Angst hatte, habe ich den Schmerz gefühlt. Aber es besteht kein Grund, mich zu fürchten. Hades vertraut ihm, sonst hätte er mich ihm nicht anvertraut.‘
Um seine Angst zu überspielen, fragte er: „Dienst du Hades im Gericht, Harkandas?“
Der Dämon entblößte seine Reißzähne, bevor er ihm widerwillig Antwort gab: „Ich bin Hades Stellvertreter.“
„Ich wusste nicht, dass Hades einen Stellvertreter hat.“
Harkandas musterte ihn. „Wieso solltest du davon wissen?“
„Nun, weil ich ein Freund von Jeng und auch von Varun bin“, gab Alepou unbekümmert Auskunft.
Der Dämon blieb stehen und sah ihn intensiv an. „Was bedeutet das? Wer ist Jeng? Was ist ein Freund? Und wieso kennst du Varun?“
Ein unangenehmes Prickeln überzog seinen Geistkörper, wie Stiche von tausend glühenden Nadeln. Sofort erkannte Alepou, dass seine unbedachten Worte ein Fehler waren. Er überlegte gründlich, bevor er antwortete: „Ein Freund ist jemand, dem man vertraut. Aus diesem Grunde hat Hades mir verraten, das sein Name in Wahrheit Varun ist und Jeng…, nun das ist jemand, den Varun und ich gut kennen und der unser gemeinsamer Freund ist.“ Alepou glaubte eine Erklärung gefunden zu haben, die den Dämon zufriedenstellte, doch da täuschte er sich.
„Was bedeutet vertraut?“, bohrte Harkandas weiter.
Wie ein Seiltänzer versuchte Alepou nicht den Halt zu verlieren. „Das … bedeutet, dass man glaubt, dass der Andere es gut mit dir meint und dir nicht schaden will.“
„Ein Freund ist jemand, von dem man glaubt, dass er einem nicht schaden will?“, fragte der Dämon nach.