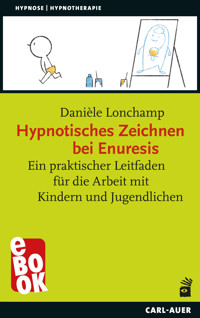
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Hypnose und Hypnotherapie
- Sprache: Deutsch
Du bist der Chef deines Körpers! Enuresis zählt zu den häufigsten urologischen Problemen: Im Alter von fünf Jahren nässt etwa jedes fünfte Kind nachts ein, teilweise auch tagsüber. Bei den sieben Jährigen ist es noch jedes zehnte. Manche haben noch bis ins Jugendalter damit zu kämpfen. Scham und sozialer Rückzug sind häufig die Konsequenz. Das vorliegende Buch stellt eine wirksame, nicht medikamentöse Methode zur Behandlung der Enuresis bei Kindern und Jugendlichen vor. Dass Hypnose den Betroffenen in solchen Fällen helfen kann, ist lange bekannt. Danièle Lonchamp fügt nun noch einen neuen Aspekt hinzu: das Zeichnen. In ihrem Ansatz entwickelt das Kind unter der Anleitung des Therapeuten oder der Therapeutin eine Zeichnung seines Harnwegsystems. Zunächst konzentriert es sich dabei auf die allgemeine Funktionsweise der betreffenden Organe. Danach betrachtet es ganz genau die Stellen, an denen Störungen dazu führen, dass sich die Blase im falschen Moment am falschen Ort entleert, und schlägt Alternativen vor. Mit dieser Technik aktiviert das Kind drei Wahrnehmungsbereiche – visuell, auditiv und kinästhetisch – und wird so selbst Akteur seiner Veränderung. Nach dem Zeichnen imaginiert das Kind in formeller Hypnose ein Erfolgserlebnis dank seiner eigenen Lösungsvorschläge und lernt, dieses Erfolgserlebnis autonom zu wiederholen. Nach einem kurzen theoretischen Überblick über Enuresis im Allgemeinen beschreibt die Autorin Schritt für Schritt, abgestimmt auf das Alter und die individuellen Bedürfnisse des entsprechenden Kindes bzw. Jugendlichen, ihre Vorgehensweise. Besonders hervorgehoben werden dabei die Bedeutung der kindlichen Motivation und die Utilisation individueller Ressourcen. Über die einzelne Therapiesitzung hinaus werden außerdem wichtige Hinweise zum Vorgespräch sowie zur Nachbereitung zur Verfügung gestellt. Im Anhang befinden sich Beispiele für weitere hypnotherapeutische Methoden und Geschichten. Die Autorin: Danièle Lonchamp, Kinderärztin und Hypnotherapeutin; Medizindiplom der Fakultät Lyon-Nord, Frankreich; Ausbildung zur Fachärztin für Pädiatrie in San Francisco, USA; derzeit im Base Hospital New Plymouth in Neuseeland tätig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carl-Auer
Danièle Lonchamp
Hypnotisches Zeichnenbei Enuresis
Ein praktischer Leitfaden für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Aus dem Französischen von Edith Schürkens und Siegfried Joel
2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Sebastian Baumann (Mannheim)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Carmen Beilfuß (Magdeburg)
Dr. Dirk Rohr (Köln)
Dr. Michael Bohne (Hannover)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Torsten Groth (Münster)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt † (Münster)
Reinert Hanswille (Essen)
Jakob R. Schneider (München)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Tom Levold (Köln)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Dr. Dr. Kurt Ludewig (Münster)
András Wienands (Berlin)
Dr. Stella Nkenke (Wien)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Rainer Orban (Osnabrück)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Themenreihe »Hypnose und Hypnotherapie«
hrsg. von Bernhard Trenkle
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Umschlagmotiv: © Ulf K., Düsseldorf
Redaktion: Celine Eßlinger
Satz: Drißner-Design u. DTP, Meßstetten
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0599-2 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8555-0 (ePUB)
© 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Das Original erschien unter dem Titel »Dessin hypnotique pour l'énurésie de l'enfant.
Guide pour le praticien«. Die Übersetzung entstand in Übereinkunft mit Satas SA, Belgien.
Aus dem Französischen übersetzt von Edith Schürkens und Siegfried Joel
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/
Inhalt
Einleitung
Zu diesem Buch
1 Enuresis – allgemeine Informationen
1.1 Definition
1.2 Medizinische Diagnostik
1.3 Ursachen
1.4 Konsequenzen
1.5 Statistik der Enuresis nocturna
1.6 Statistik der Enuresis diurna
1.7 Vorschläge für Interventionen
1.7.1 Das Kind ist jünger als 8 Jahre
1.7.2 Das Kind ist älter als 8 Jahre
2 Vorabgespräch vor der Therapiesitzung
2.1 Persönliche Vorstellung
2.2 Verständnis der Familie bzgl. der hypnotherapeutischen Beratung
2.3 Diagnostik durch den behandelnden Arzt
2.4 Problembezeichnung
2.5 Verständnis der Familie im Hinblick auf das Problem ihres Kindes
2.6 Familiäre Vorbelastung
2.7 Einfluss des Problems auf die Familiendynamik
2.8 Inter- und intrapersonelle Auswirkungen auf das Kind
2.9 Bisherige Behandlungsmethoden
2.10 Wie wird das Problem im Moment gehandhabt? – Status quo
2.11 Das Naturell des Kindes
2.12 Ressourcen des Kindes
2.13 Therapeutisches Vorgehen: das hypnotische Zeichnen
2.14 Rolle der Eltern während des Präsenztermins
2.15 Die Bitte um Erlaubnis, die Sitzung zu filmen
2.16 Abschluss
3 Die Therapiesitzung
3.1 Sitzordnung
3.2 Das Handy in der Behandlung
3.3 Arbeitsmaterialien
3.4 Aufbau und Gestaltung der therapeutischen Beziehung
3.4.1 Die Vorstellung
3.4.2 Die Begabungen des Kindes herausfinden
3.4.3 Bevorzugtes Repräsentationssystem für die Kommunikation mit dem Kind
3.4.4 Frage nach dem Einverständnis für eine Videoaufnahme
3.4.5 Bühne frei für Fragen aller Art
3.4.6 Verabschiedung von Nichtbetroffenen
3.5 Die Motivation des Kindes
3.5.1 Das Kind sagt, dass es nichts ändern will (eher selten)
3.5.2 Das Kind zögert noch
3.5.3 Das Kind sagt, dass es bereit ist
3.6 Wie sich das Kind sein Problem erklärt (Enuresis nocturna)
3.7 Dem Kind helfen, die Kontrolle über seinen Körper zu entdecken
3.7.1 Auflistung der bisherigen Interventionen
3.7.2 Destabilisierung
3.7.3 Reframing
3.7.4 Der Chef seiner Blase
3.8 Das hypnotische Zeichnen
3.8.1 Das hypnotische Gespräch
3.8.2 Die formelle Hypnose
3.8.3 Selbsthypnose
3.8.4 Ergänzende Kommentare
3.9 Was wird aus der Zeichnung?
3.9.1 Das Kind möchte die Zeichnung mitnehmen
3.9.2 Das Kind möchte die Zeichnung in seiner Patientenakte lassen
3.9.3 Das Kind möchte die Zeichnung verschwinden lassen
3.10 Der Abschluss der Sitzung
3.10.1 Kind und Elternteil waren während der gesamten Sitzung beide anwesend
3.10.2 Das Kind wird von den Eltern begleitet, befindet sich dann aber während der eigentlichen Arbeit allein im Behandlungsraum
3.10.3 Jugendliche ohne Begleitung
4 Das telefonische Nachgespräch
4.1 Warum?
4.2 Wann?
4.3 Wie?
4.4 Dauer
4.5 Themenbereiche
5 Die Utilisation der hypnotischen Zeichnung in den Folgesitzungen
5.1 Kontext
5.1.1 Wer bittet um einen zweiten Termin?
5.1.2 Der Zeitraum zwischen dem ersten Besuch und den folgenden Sitzungen
5.1.3 Gründe für die Bitte um einen Folgetermin Die Gründe fallen in eine der drei folgenden Kategorien, von denen jede eine andere Intervention erforderlich macht:
5.2 Vorschläge für Interventionen
5.2.1 Das Kind war noch nicht bereit
5.2.2 Das Kind empfindet die erzielte Verbesserung als ungenügend
5.2.3 Das Kind mit einem Rezidiv
6 Wahrnehmung des hypnotischen Zeichnens durch Kinder und Eltern
6.1 Die Rückmeldungen der Familien
6.2 Sekundärgewinn
Anhang: Der Kreativitätskoffer
Die magnetischen Hände
Der Lieblingsort
Metaphern und Geschichten
Die Stute
Der Bach, der Damm und die Boote
Die Astronautin
Der Kaiser Bumi und sein nasser Schlafanzug
Sug Arman, das Erdmännchen
Danksagung
Literatur
Weiterführende Literatur
Über die Autorin
Einleitung
Im Rahmen meiner praktischen Tätigkeit in der Pädiatrie habe ich im Laufe der Jahre dreierlei festgestellt:
Wo auch immer auf der Welt die Behandlung stattfindet, die Etablierung einer guten Beziehung zur Familie und ihrem Kind ist unerlässlich und hat oberste Priorität.
Wo auch immer die Behandlung stattfindet, es fehlt meist an Zeit. Man arbeitet immer unter Zeitdruck. Der humanistische, auf den Menschen bezogene Teil der Arbeit rückt in den Hintergrund.
Um eine Heilung zu erreichen, muss der Patient seinen Körper, seine Erkrankung und sein Problem auf seine Art verstehen. Der Behandelnde ist Experte auf seinem Gebiet, der Patient Experte seiner selbst.
Hypnosetechniken präsentieren ausgezeichnete Lösungen für diese Dilemmata. In der Folge meiner Fortbildungen wurden sie zu einem festen Bestandteil meiner Arbeit. Diese Strategien – man kann sie auch als Werkzeuge bezeichnen – umfassen die therapeutische Kommunikation, die Gesprächshypnose und die formelle Hypnose. Tatsächlich sind Hypnoseprozesse allgegenwärtig, ohne dass das Wort »Hypnose« benutzt werden müsste.
In der Regel kommen zu mir Kinder, deren bisherige Therapien gescheitert sind, das heißt nach den Interventionen eines Allgemeinmediziners im öffentlichen Gesundheitswesen. Was das nächtliche Einnässen betrifft, führt der Allgemeinmediziner eine medizinische Diagnostik durch, schlägt – falls die Familie das wünscht – ein Medikament vor und übergibt das Kind in die Hände des öffentlichen Gesundheitswesens. Die ambulante Hilfe nimmt Kontakt zur Familie auf und gibt nichtmedikamentöse Ratschläge zum Umgang mit der Enuresis (abends weniger trinken, den Tag über mehr trinken usw.) sowie ggf. psychologische Unterstützung beim Umgang mit dem verschriebenen Alarmgerät, bevor und nachdem es geliefert worden ist. Wenn das alles »nichts bringt«, oder bei Rückfällen, schickt der Allgemeinmediziner mir das Kind zur »Hypnose«. Bei einigen Kindern stelle ich fest, dass es auch tagsüber zu minimalem Einnässen kommt, was zuvor verschwiegen wurde, weil es der Familie unangenehm und lästig war. Das ausschließliche Einnässen über Tag wird von Allgemeinmedizinern manchmal medikamentös angegangen, in Zusammenarbeit mit der ambulanten Hilfe, die mit Erlaubnis der Eltern eine Unterstützung im häuslichen und schulischen Rahmen ergänzend anbietet. Im Falle des Scheiterns der genannten Interventionen erhalte ich eine Anfrage zur Beratung mittels »Hypnose«. Aufgrund einiger Anpassungen in der Vorgehensweise bei kindlicher Enuresis kann ich inzwischen eine effektive Intervention für Kinder anbieten.
Die Behandlung der Enuresis mit Hypnose wurde 1975 von Karen Olness in einem Artikel vorgestellt. Die dort beschriebene Hypnosesitzung beginnt mit einer Induktion (Armlevitation, Fokussierung auf einen Punkt), gefolgt von direkten Suggestionen, in der Nacht im Bedarfsfall aufzustehen, und schließt mit einer Ich-Stärkung (für eine positive emotionale Stimmung am Morgen). Das Kind wird dazu eingeladen, diese Intervention jeden Abend vor dem Schlafengehen eigenständig und ohne elterliche Beteiligung und Unterstützung zu praktizieren.
Dan Kohen (2024) beschreibt seine hypnotherapeutische Intervention im Detail so: Beim ersten Treffen erklärt er dem Kind ausführlich die Funktionsweise seines Harnwegssystems sowie die Kommunikation zwischen Gehirn und Harnblase und fertigt eine entsprechende Zeichnung dieses Schemas an. Anhand dieser visuellen Hilfe wird eine formelle Hypnose eingeleitet mit der Einladung, ideomotorische Signale zu etablieren, gefolgt von direkten Suggestionen, die während der Trance auf die Zeichnung Bezug nehmen.
Im Hinblick auf die genannte Zeichnung schlage ich kleine Modifikationen gegenüber dem Modell von Kohen vor. Beim ersten Mal entwickelt das Kind die Zeichnung unter der Anleitung der Therapeutin und bringt seine eigenen Vorstellungen von der Anatomie zu Papier. Es konzentriert sich zunächst auf die allgemeine Funktionsweise des Harnwegssystems. Danach betrachtet es ganz genau die Stellen, an denen Störungen dazu führen, dass sich die Blase im falschen Moment am falschen Ort entleert, und schlägt Alternativen vor. Dies visualisiert das Kind in seinem Gehirn, in seiner eigenen Vorstellungswelt. Es spricht seine eigenen Worte laut aus. Es zeichnet mit einem Stift auf ein Blatt Papier das, was sein Gehirn entwirft. Mit dieser Technik aktiviert das Kind drei Wahrnehmungsbereiche: visuell, auditiv und kinästhetisch. Das Kind ist damit der Akteur seiner Veränderung.
Im Anschluss daran bietet die Therapeutin dem Kind eine kurze individualisierte und maßgeschneiderte Hypnosesitzung an. Dabei werden Hilfestellungen gegeben, um ein Erfolgserlebnis am Tage bzw. in der Nacht zu realisieren. Die Therapeutin verwendet dabei die Worte des Kindes (kindspezifische Sprache). Zum Abschluss wird das Kind eingeladen, diese Erfahrung auf eigene Faust zu wiederholen (Selbsthypnose).
Diese Herangehensweise eignet sich für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren. Jüngere Kinder werden in der Regel von einer Bezugsperson (Eltern, Pflege- oder Adoptiveltern) begleitet, Jugendliche kommen allein.
Zu diesem Buch
Das Buch beschreibt eine typische Beratung, die mit der Vorgeschichte und dem Empfehlungsschreiben beginnt und mit den Worten des Kindes und seiner Familie endet, sobald das Problem gelöst ist.
Als Therapeutin weiß man, dass es im Gesundheitsbereich keine universellen Lösungen gibt. Wer die Methode nutzen möchte, wird gebeten, sie an seine Kultur anzupassen, an seine persönlichen Vorlieben, an seinen Geschmack und natürlich an das Kind, das vor ihm sitzt. Das Buch dient nur als Anleitung.
Der Einfachheit halber wird das Wort Kind für Kinder und Jugendliche genutzt.
Die Bezeichnung Therapeutin umfasst Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten und Praktiker aller Geschlechter, die mit medizinischer Hypnose vertraut sind.
Ansonsten wird aus Gründen der Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet, gemeint sind aber alle Geschlechter.
1 Enuresis – allgemeine Informationen
1.1 Definition
Als Enuresis wird der unfreiwillige und unbewusste Abgang von Urin bezeichnet, der über das normale Alter zum Erwerb der Blasenkontrolle hinausgeht (gewöhnlich bis zum Alter von 6 Jahren). Die Kinder drücken es perfekt aus: »Es läuft, es kommt einfach heraus.« Die behandelnde Person benutzt unter Umständen andere Begriffe, die die Familien verunsichern können. Der Urinabgang über Tag wird »Enuresis diurna« genannt, das Einnässen im Schlaf heißt »Enuresis nocturna«, d. h. »das Kind macht Pipi ins und im Bett« (Michel 2017, Kohen 2024).
Das Kind kann ausschließlich tagsüber oder nur nachts einnässen. Manche Kinder, die nachts ins Bett machen, sind auch tagsüber inkontinent, allerdings gehen oft nur einige Tropfen bzw. geringe Mengen in die Hose.
1.2 Medizinische Diagnostik
Das Wort »Enuresis« impliziert den Ausschluss von urologischen und neurologischen Erkrankungen oder anderen medizinischen Ursachen. Die Voraussetzung für die Diagnosestellung ist eine ärztliche Untersuchung bei einem Allgemeinmediziner oder einem Pädiater – abhängig vom Gesundheitssystem des jeweiligen Landes. Dieser Besuch umfasst u. a. eine Anamneseerhebung, eine körperliche und neurologische Untersuchung und eine Urinuntersuchung. Gelegentlich werden noch weitere, gründlichere Untersuchungen empfohlen, sollten Auffälligkeiten bei der Urinanalyse, bei der körperlich-neurologischen Untersuchung oder bei einer kombinierten Enuresisdiurna et nocturna auftreten. Eine organische Ursache, eine »Pathologie«, tritt in 5 % der Fälle auf und erfordert eine spezifische Diagnostik und Therapie, die den Rahmen dieses Buches sprengen würde.
Die Verstopfung stellt ein unterschätztes Krankheitsbild dar, das häufig unterdiagnostiziert wird und zur Enuresis beiträgt. Sobald das Kind selbständig auf die Toilette geht, achten die Bezugspersonen nicht mehr auf den Ausscheidungsprozess ihres Kindes. Nach einer Weile wird das Kind mit einer chronischen Verstopfung ohne Enkopresis (Einkoten) eine seltene und schmerzhafte Entleerung als vollkommen normal betrachten oder sich schämen, seinen Bezugspersonen davon zu berichten. Es ist wichtig, dieses Krankheitsbild deutlich anzusprechen, bevor man sich an die Therapie der Enuresis begibt.
Sollten sich bei der Untersuchung der ableitenden Harnwege keine Auffälligkeiten ergeben (und keine Verstopfung bestehen), werden dem Kind und seiner Familie mehrere Interventionen vorgeschlagen (Michel 2017).
1.3 Ursachen
Über die Ursachen des Einnässens ist nur wenig bekannt, obgleich es keine Seltenheit darstellt. Die Symptomatik wird beschrieben als »unreife Blase« oder »hyperaktive Blase«. Emotionale Probleme können auslösende Faktoren sein (z. B. Trennung der Eltern, Geburt eines Geschwisterkindes, Umzug, Schuleintritt ...). Eine familiäre Vorbelastung ist nicht ungewöhnlich, aber nicht immer gegeben.
1.4 Konsequenzen
Die medizinischen und körperlichen Nebenwirkungen des Einnässens sind minimal und beschränken sich auf Irritationen der Haut im Genitalbereich. Dagegen sind die psychologischen und emotionalen Folgen wesentlich bedeutender, insbesondere ab dem Alter von 8–9 Jahren, wenn das Kind zunehmend ein Bewusstsein für seinen Körper entwickelt und autonomer wird. Manche Kinder empfinden Scham, Unbehagen, ein schlechtes Selbstwertgefühl und beklagen einen sozialen Rückzug inklusive verminderter Aktivitäten mit ihren Freunden.
Diese Auswirkungen sind aufreibend für Familie und Geschwister. Die Bezugspersonen sind häufig genervt und hilflos. Familiäre Aktivitäten wie Camping, Reisen oder Familienbesuche werden abgesagt oder finden nicht mehr statt.
1.5 Statistik der Enuresis nocturna
Abb. 1: Prozentsatz der Kinder mit Enuresis in verschiedenen Altersstufen (Quelle: https://www.rch.org.asu/kidsinfo/fact_sheets/Bedwetting/)
Das obige Diagramm zeigt, dass:
20 % der Kinder im Alter von 5 Jahren noch nicht »trocken« sind
jedes Jahr 15 % der Kinder spontan trocken werden
3 % der Kinder bis zur Adoleszenz daran leiden.
Bei 1 % der 16–18-Jährigen besteht das Problem weiterhin.
Ein von Enuresis betroffenes Kind wird durch das Wissen, dass es mit seinem Problem nicht allein ist, entlastet. Die Tabelle zeigt ihm, dass es in seiner Schule in bester Gesellschaft ist und dass seine Mitschüler ihr Geheimnis genauso gut hüten, wie es selbst das tut.
Die Tabelle zeigt auch, dass das Kind das Recht hat, sich für das Nichtstun zu entscheiden, d. h., gar nichts gegen das Einnässen zu unternehmen; in einigen Tagen, Monaten oder auch Jahren wird es von selbst trocken werden. Aber mit ein wenig Training könnte es sein Ziel sogar schneller erreichen und die Statistik auf den Kopf stellen!
Während des Termins finde ich es sehr hilfreich, diese Tabelle bei der Hand zu haben. Sie ist eine gute visuelle Unterstützung.
1.6 Statistik der Enuresis diurna
Diese Statistiken finden sich selten in Studien, Veröffentlichungen oder medizinischen Zeitschriften. Die Enuresis diurna versteckt sich hinter der Scham, der Verlegenheit. Bezugspersonen und Kind akzeptieren diese Situation. Eine Windelhose fungiert als praktische Lösung. Infolgedessen ist der behandelnde Arzt häufig nicht informiert. Die meisten Kinder, die tagsüber einnässen, bleiben während der Nacht trocken.
1.7 Vorschläge für Interventionen
1.7.1 Das Kind ist jünger als 8 Jahre
Solange das Einnässen die Beteiligten wenig oder gar nicht stört, genügen in der Regel unterstützende und präventive Maßnahmen für Bezugspersonen und Kind.
Die Themenbereiche sind folgende:
Wie können Bezugspersonen mit dem Kind so sprechen, dass es seine Frustrationen in den Griff bekommt, ohne seine Moral zu untergraben oder zu zerstören?
Wie kann man eine positive Kommunikation zwischen Kind, Geschwistern und Familie anregen, ohne dass das Kind von seinen Geschwistern gehänselt wird (und das Hänseln durch die Geschwister beenden)?
Wie kann man das Kind ermutigen, Verantwortung zu übernehmen (sich säubern, die Kleidung wechseln ...)?
Wie kann eine positive Kommunikation mit der Schule hergestellt werden (Unterstützung beim Toilettengang etc.)?
Im Fall eines geringfügigen Einnässens tagsüber ist es wichtig, folgende Themen anzusprechen:
Toiletten als Orte, an denen das Kind sich sicher fühlt, um sich zu entleeren (physische und emotionale Sicherheit)
eine gute Position auf dem Toilettensitz, die Füße auf dem Boden oder auf einem kleinen Tritthocker
behagliche oder unbehagliche Gefühle während des Toilettenbesuchs (Hautkontakt mit dem Toilettensitz, die Seife, der Geruch vom vorherigen Benutzer, das Raumspray, das Aussehen der Toilette, das Fenster, das Geräusch der Wasserspülung, die Vibrationen der Rohrleitungen, Stimmen von der anderen Seite der Wand ...)
eine angemessene Zeit für den Toilettengang (Warteschlange vor der Tür in einer Großfamilie oder in der Schule)
die Notwendigkeit, während der Entleerung ruhig und gelassen zu bleiben (Kind will meist schnell zur vorherigen Aktivität zurückkehren)
und vor allem die Notwendigkeit, nicht bis zum letzten Moment zu warten, wenn die Blase »kurz davor ist überzulaufen«.
Medikamentöse Interventionen sind nicht erforderlich.
Alles in allem spielt die Zeichnung in der Kommunikation mit dem Kind und seiner Familie eine bedeutende Rolle im Rahmen der medizinischen Beratung. Wenn das Kind noch sehr jung ist (jünger als 5 Jahre), ist die Zeichnung mithilfe der Therapeutin sehr schnell mit einigen Strichen und Zeichen fertiggestellt (Kohen 2024). Die Zeichnung dient als visuelle Hilfe für die Bezugspersonen (Darstellung der Verbindung zwischen Blase und Gehirn). Ein aufgewecktes, kooperatives Kind zwischen 5 und 8 Jahren, das bereit ist, für sich selbst zu sorgen, trocken zu werden, um bei seinen Freunden übernachten zu können oder an einem Schulausflug teilzunehmen, profitiert gleichfalls von ebendieser Zeichnung in der Gesprächshypnose. Ein scheues oder ängstliches Kind wird dazu eingeladen, sich an Spielsachen oder am Malpapier zu orientieren.
Abb. 2: Zeichnung (von der Therapeutin angefertigt)
Häufig bringt das Kind zur Unterstützung seines Sicherheitsgefühls ein Kuscheltier mit. Dieses Objekt ist ein integraler Bestandteil der Arbeit in der Sitzung. Die Therapeutin fragt nach dem Namen und heißt das Kuscheltier willkommen. Die Anwesenheit dieses Objekts und seine Kräfte werden gewürdigt. Folgender Satz kann helfen:
»Ich sehe, dass du ein bisschen Angst hast; das ist ganz normal ... Du kennst mich noch nicht ... Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde es mir genauso gehen (Legitimation des Verhaltens). Du brauchst mir nicht zuzuhören. Während du spielst oder malst, wird dein Kuscheltier aufmerksam und wachsam bleiben. Es wird alles mitbekommen, sich an alles erinnern und dir davon erzählen, wenn du wieder zu Hause bist.«
1.7.2 Das Kind ist älter als 8 Jahre
Wenn der emotionale Impact des Einnässens auf das Kind offensichtlich ist (im Regelfall ab einem Alter von 8 Jahren), ist wohlüberlegtes medizinisches Handeln angesagt. Die sogenannte »Standardbehandlung« umfasst Medikamente und Alarmgeräte. Diese Interventionen erfordern medizinische Überwachung und Kontrolle und werden zum Teil schlecht toleriert. Ihre Effektivität hält sich in Grenzen und ist meist enttäuschend (Michel 2017). Dem Kind wird durch diese Behandlungsmethoden vermittelt, dass es an einer Krankheit leidet, ein Problem hat, das es nicht selbst lösen kann.
Die medizinische Hypnose ist eine wirkungsvolle Alternative zur herkömmlichen Behandlung der Enuresis (Olness 1975). Kohen (2024) beschreibt das Schema des Harntrakts und seine Verbindung mit dem Gehirn. Er präsentiert es am Anfang der hypnotischen Sitzung, um dem Kind zu erklären, wie der Körper funktioniert. Lazarus (2014) schlägt dieselbe Art der Intervention in seinem Online-Programm zur Behandlung der Enuresis vor (selbstgesteuerte medizinische Hypnose). Bayne (2023) konnte jüngst in einer Studie nachweisen, dass diese selbstgesteuerte medizinische Hypnose sehr effektiv ist und besonders bei motivierten Kindern angewandt werden kann.
2 Vorabgespräch vor der Therapiesitzung
Wenn die Therapeutin eine Anfrage für Hypnotherapie erhält, sollte sie sich folgende Frage stellen:
»Was muss ich wissen, bevor ich das Kind kennenlerne, um die Behandlung in der Einzelarbeit mit dem Kind möglichst effizient zu gestalten?«
Ein Gespräch mit der Familie ist dafür unentbehrlich und essenziell. Der verbale Austausch ermöglicht es:
der Therapeutin, der Familie gegenüber zu versichern: »Ja, ich habe die Überweisung / den Konsiliarschein1für das Anliegen ihres Kindes erhalten.«
den Bezugspersonen, sich idealerweise in der Abwesenheit des Kindes in einem sicheren Raum frei zu äußern: »Ja, ich höre Ihnen zu.«, »Ja, ich stehe Ihnen voll und ganz zur Verfügung.«
die Informationen aus dem Überweisungsschreiben oder der elektronischen Akte des Kindes zu vervollständigen: »Ja, ich werde Ihnen einige Fragen stellen, die mir erleichtern werden, Ihr Kind zu verstehen.«
Die Therapeutin fokussiert sich aufs wohlwollende Zuhören und behält dabei die Vorgeschichte des Kindes im Hinterkopf.
Im Laufe des Gesprächs entwickelt sich peu à peu die therapeutische Allianz.
Das Gespräch kann auf folgende Art und Weise stattfinden:
1) telefonisch (wie in dem Krankenhaus, wo ich tätig bin): Der Vorteil dabei ist, mit den Bezugspersonen allein sprechen und ihnen genügend Raum geben zu können, um sensible persönliche Themen anzusprechen. Sie wissen, dass diese Unterhaltung rein informell ist.
2) per Videokonferenz (wird derzeit vermehrt eingesetzt): Dies bedarf erheblicher logistischer Vorbereitungen, die in dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, nur eingeschränkt verfügbar sind.
Diese beiden Alternativen bieten den Vorteil, dass die Familie nicht erscheinen muss und die Kontaktaufnahme in einem familiären, sicheren Kontext stattfindet, sodass rasch Informationen erhalten werden.
3) in Präsenz:





























