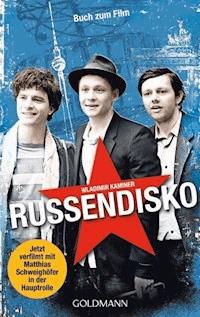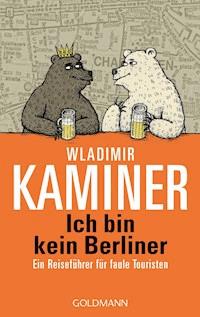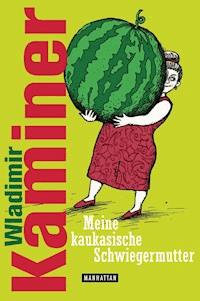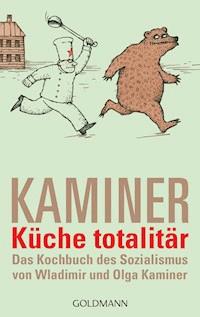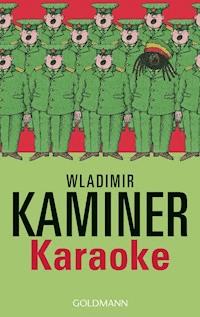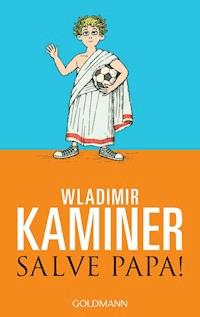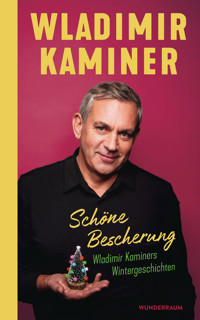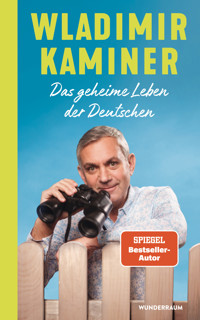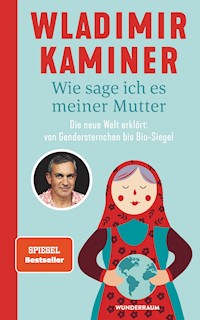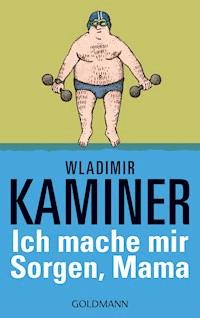
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wladimir Kaminer ist nicht nur ein berühmter Autor, er ist auch der Sohn seiner Eltern, der Mann seiner Frau Olga und der Vater ihrer beiden Kinder Nicole und Sebastian. Dank ihnen steckt das tägliche Leben voller Herausforderungen und kurioser Erfahrungen, egal ob es um die sportlichen Exzesse von Wladimirs Vater geht, um die Versuche, Sebastian anhand dreier Krokodile im Zoo in die Geheimnisse der Sexualität einzuweihen, oder darum, die Wahrheit über Sankt Martin herauszufinden, den Nicole für den Chef des Religionsunterrichts hält. Zum unvergesslichen Erlebnis wird auch der Versuch, für Sebastian eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Die Fragen nach den Familienverhältnissen, Exfrauen und Vorstrafen des Dreijährigen lassen sich noch eindeutig beantworten. Schon schwieriger wird es bei den Punkten »Zweck des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland« (der Vater wählt vorsichtig »usw.«), »Wie lange beabsichtigen Sie in der Bundesrepublik zu bleiben?« (»ewig« – oder doch lieber nur »lange«?) und »Haben Sie vor, eine Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik auszuüben?«. Wladimir Kaminer blickt seinem Sohn tief in die Augen und schreibt vorsichtig »nicht ausgeschlossen« … In diesen hinreißend komischen Geschichten beschreibt Wladimir Kaminer den ganz normalen Wahnsinn des Alltags wieder von seiner unterhaltsamsten Seite.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2004
Ähnliche
WLADIMIR KAMINER
Ich mache mir Sorgen, Mama
Roman
Copyright
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © der Originalausgabe 2004 by Wladimir Kaminer
Copyright © dieser Ausgabe 2006 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Design Team München unter Verwendung einer Illustration von © Vitali Konstantinov
AB · Herstellung: Str.
ISBN 978-3-89480-844-0V004
www.pep-ebooks.de
Inhaltsverzeichnis
Deutsch für AnfängerDie Geologen und ihre heimliche NachwuchsschulungDer FünftklässlerSebastian und die AusländerbehördeMein Vater, der SportsfreundDer KindergeburtstagAlle meine TerminatorenKrieg und Frieden in der BildungDas sexuelle Leben der Marfa K.Das Fernsehen in meinem LebenWerbung für ElternMein Vater, der ZynikerMenschenrechteTeneriffaPlaymobilDas dritte KrokodilVaters GeburtstagRotschwänzchen am Tag der LiebesparadeAb in die SchuleDostojewskiBerlin, wie es singt und tanztDeutscher PassMacho-MärchenFuApplikator LapkoMein Vater und der KrebsImmer lebe die SonneKein Wort mehr über meine TanteFrüher war alles besserSankt MartinWas taugen junge Weihnachtsmänner von heute gegen das alte Väterchen Frost?Mein Vater als GeschäftsmannFreche Früchtchen unterwegsWintersportIbizaSalsa für meinen VaterDas Leben ist ein dunkler ParkBerliner KaninchenMehr über die Welt erfahrenService-MentalitätDie RaubpflanzeZwei zweieiige Zwillinge entdecken BerlinEin Spaziergang auf der Schönhauser Allee an einem besonders heißen TagUnsere DialekteFauna auf der Schönhauser AlleeDie wahre NaturDas Bessere ist der Feind des GutenIrgendwasBerlin, Frühling, sechzehn Uhr zwanzigLosing my traditionDie Kinder der NachtÜber das BuchÜber den AutorCopyright
Meiner Mutter
Deutsch für Anfänger
Oft kommt es vor, dass ich von Schulklassen eingeladen werde. Nach der Lesung stellen mir die Schüler Fragen, allerdings wollen sie nie Näheres über den Inhalt meiner Geschichten wissen, sondern immer nur, was ich im Jahr verdiene und wie ich das ganze Geld ausgebe. Einige wenige fragen mich auch, ob ich auf Deutsch träume. Auch andere neugierige Leser versuchen, eine Verbindung zwischen mir und der deutschen Sprache herzustellen.
»Warum schreiben Sie auf Deutsch?«, fragen sie mich während der Lesungen und in ihren Briefen. »Haben Sie schon in Moskau in der Schule Deutsch gelernt? Sprechen Ihre Kinder Deutsch? Was lieben Sie an der deutschen Sprache?«
Ich verteidige mich mit aller Kraft. »Nein, ich habe Deutsch nicht in der Schule gelernt, sondern nur hier, aus Not«, erkläre ich. Als Schriftsteller und Journalist war ich an einem großen Lesepublikum interessiert, habe aber den Übersetzern immer misstraut. Und in Deutschland bleibt trotz aller Einwanderungsmassen Deutsch noch immer mit Abstand die einzige Sprache, die von den meisten verstanden und gelesen wird. Ein Sprachkünstler bin ich nie gewesen, für mich ist die Sprache nur ein Werkzeug, ein Hammer, der mir hilft, Verständigungsbrücken zu anderen zu schlagen. Der Umgang mit der Sprache kann unterschiedlich sein. So wie Musiker ihre Gitarren auch sehr unterschiedlich quälen – der eine kann mit zwölf Fingern und der Nase darauf spielen, der andere haut mit der Faust auf sein Instrument. Wenn er aber tatsächlich etwas zu sagen hat, kann er mit zwei Akkorden große Begeisterung beim Publikum hervorrufen. Selbst die verdorbensten Musikkritiker schütteln dann den Kopf und sagen: »Diese zwei Akkorde sind zwar total abgenutzt und belanglos, aber wie der Kerl auf die Saiten haut, das ist doch bemerkenswert. Ein großer Musiker.« Und so haue ich auf mein Deutsch, das bei weitem nicht perfekt ist, aber ausreicht, um sich damit Gedanken über das Leben zu machen und sie zu Papier zu bringen.
Meine erste Bekanntschaft mit der deutschen Sprache fand in der sowjetischen Schule Nr. 701 statt. Dort durften wir in der fünften Klasse auswählen, welche ausländische Sprache wir lernen wollten. Deutsch und Englisch standen zur Auswahl – alle Kinder entschieden sich für Englisch. Deutsch war als Nazisprache verpönt. Irgendjemand musste aber auch Deutsch lernen, immerhin lebten wir in einer Planwirtschaft. Also wurden die schlechten Schüler und Rowdys zum Deutschunterricht verdonnert.
Die beiden Sprachlehrerinnen kamen am Ende der großen Mittagspause in die Schulkantine. Die Englischlehrerin war eine junge gefärbte Blondine mit langen Fingernägeln. Sie hatte außerdem eine tiefe, erotische Stimme: »Ladies and gentlemen«, rief sie, »come on please – to the classroom!« Das klang für uns damals sehr cool, das war die Sprache unserer Propheten, die Sprache von Ozzy Osbourne, Manfred Mann und KISS. Die Deutschlehrerin war eine ältere Dame mit Hornbrille und einem grauen Zopf auf dem Kopf, sie trug eine selbst gestrickte graue Bluse und sah aus wie eine große alte Krähe. »Kommt zu mir, Kinder! In das Klassenzimmer«, krähte sie in der Kantine. Alle bekamen eine Gänsehaut von diesem »Klassenzimmer«.
Nicht nur die Schüler, auch die russischen Klassiker standen der deutschen Sprache kritisch gegenüber. Leo Tolstoi verglich sie mit den unendlichen Gleisen der Eisenbahn – bis an den Horizont. Nabokov ging noch weiter und behauptete, dass sich die deutsche Sprache so anhört, als würde einer Nägel in Bretter treiben. Ich war zwar kein guter Schüler, aber nicht schlecht genug für den Deutschunterricht. Also verbrachte ich meine jungen Jahre im classroom: »Desmond has a barrow in the market place / Molly is the singer in a band.«
Als ich 1990 nach Deutschland aufbrach, hatte ich nur einen alten russisch-deutschen Sprachführer aus der Bibliothek meiner Mutter dabei, extra für diesen Anlass enteignet. Das dünne Heft von 1957 bewies schon in den ersten Sätzen seine Nutzlosigkeit: »Wie komme ich zur Sowjetischen Botschaft?«, stand dort; und: »Ich muss dringend den sowjetischen Botschafter sprechen.« Die Sowjetische Botschaft stand nicht auf meiner Liste der Berliner Sehenswürdigkeiten, und der sowjetische Botschafter war der Letzte, den ich sprechen wollte. Meine Englischkenntnisse hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf natürliche Weise aus dem Kopf verflüchtigt. Wer war noch mal Desmond gewesen, und als was hatte Molly gearbeitet? Also fing ich in Berlin auf der Straße und in den Kneipen noch einmal von vorne an, die neue Sprache zu lernen. Später ging ich in einen Sprachkurs der Humboldt Universität. Schnell erkannte ich dort das System. Anders als in meiner Heimatsprache kann man im Deutschen alle Worte zusammensetzen, Substantive mit Adjektiven verbinden oder umgekehrt, man kann sogar neue Verben aus Substantiven ableiten. Dabei entstehen völlig neue Redewendungen, die aber von allen sofort verstanden werden. Anfangs experimentierte ich viel in der U-Bahn. Meine ersten Versuchskaninchen waren die Fahrausweiskontrolleure, die sich immer wieder gerne auf einen komplizierten Wortaustausch einließen. »Ihr Kurzstreckentarif ist nach einer Zwanzigminutenstrecke abgelaufen«, sagten sie zum Beispiel.
»Ich habe den Langstreckentarif nicht gefunden und wollte nur einmal kurzstrecken, habe aber die Ausstiegsgelegenheit leider verpasst«, antwortete ich.
»Die können wir für Sie organisieren«, meinten die Kontrolleure, »steigen Sie bitte mit aus.«
Mit oder aus? Aus oder mit? Ich war begeistert von der Flexibilität und Sensibilität dieser Sprache. Später, als ich zu schreiben anfing, betitelte ich alle meine Geschichten, ja sogar Bücher mit diesen zusammengeklappten wunderbaren Worten, die immer wieder neue Farben in die Sprache brachten. Die Russendisko zum Beispiel würde auf Russisch nur flach als »Russkaja Diskotheka« ausfallen. Und Militärmusik ist ebenfalls im Russischen nicht sagbar.
Inzwischen ist meine Bekanntschaft mit der deutschen Sprache dreizehn Jahre alt. Und ich weiß, dass das einst begehrte Englisch – die Sprache unserer damaligen Propheten wie Ozzy Osbourne – bloß eine Entgleisung des Plattdeutschen ist. Meine Heimatsprache Russisch ist sehr bildhaft und ausdrucksreich, man kann im Russischen für alles dutzende von treffenden Wörtern finden, die aber hier im Westen keiner versteht. Im Deutschen reimt sich dafür alles auf den Endungen, wenn man nur will. Diese Sprache hat mit den Gleisen bis an den Horizont nichts zu tun, sie ist vielmehr eine Art Lego-Baukasten, in dem alle Teile zueinander passen. Was man daraus baut, ist jedem selbst überlassen. Neulich zum Beispiel zeigte meine Schwiegermutter, die kein Deutsch kann, unserer siebenjährigen Tochter ein Foto von mir mit der Bildunterschrift »Schriftsteller Kaminer« und fragte sie, was da steht. »Ist doch klar«, sagte Nicole, »Schriftsteller – das ist ein Teller mit Schrift.« Meine Schwiegermutter guckte sich daraufhin das Foto noch einmal genauer an, konnte aber nirgendwo einen Teller entdecken. Deutsch bleibt nach wie vor geheimnisvoll.
Die Geologen und ihre heimliche Nachwuchsschulung
»Also eure beiden Kleinen, wenn die morgens zum Kindergarten ziehen, dann sieht man sofort – das sind Oma-Kinder«, erzählte mir meine Nachbarin. »Ist es nicht toll, eine Oma zu haben?« Das konnte ich nur bestätigen. Allein in diesem Jahr verbrachte meine Schwiegermutter drei Monate bei uns. Sie stand früh auf und kümmerte sich um alles: kochte, brachte die Kinder zum Kindergarten, las ihnen alte russische Märchen vor und sang jeden Abend vor dem Schlafengehen Gutenachtlieder, die wir nicht kannten. Meine Frau und ich gingen abends aus, mal in eine Kneipe, mal in ein Konzert, und freuten uns, dass unsere Kinder mit der Oma auch noch eine andere kulturelle Tradition kennen lernten und nicht nur auf solche Wessi-Figuren wie Peter Pan und die Biene Maja fixiert wurden. Mit meiner Schwiegermutter sollten sie ihren Horizont erweitern, was auch geschah.
Eines Tages kam mein vierjähriger Sohn Sebastian zu mir ins Arbeitszimmer. Ich war gerade dabei, eine Geschichte zu schreiben, aber die Arbeit ging nicht richtig voran. Sebastian klopfte mir auf die Schulter und sagte: »Halte durch, Geolog! Gib nicht auf, Geolog!«
»Wie bitte?«, fragte ich ihn. Wo hatte der Junge solche Sprüche her? Abends beschloss ich, mir das Gutenachtlied meiner Schwiegermutter anzuhören. Es war die Hymne der Geologen, die meine Kinder stark beeindruckte. Meine Schwiegermutter hatte dreißig Jahre lang auf Sachalin für eine Organisation namens GSO gearbeitet, was so viel wie »Geologische Schürfexpedition der Stadt Ocha« bedeutet. Früher, in der Sowjetunion, genossen die Geologen allgemeine Achtung, für viele junge Leute war es ein höchst erstrebenswerter Beruf, der alle traumhaften Elemente eines erfüllten Lebens in sich barg: Romantik und Heldentum, Zelten auf einem Berg, Lagerfeuer in der Schneewüste, mit dem Hubschrauber über die Taiga, aber auch ein doppeltes Gehalt plus Gefahrenzulage, zwei Monate Urlaub auf der Krim, wilde, kernige Frauen für die Männer und wilde, bärtige Männer für die Frauen, dazu Champagner bis zum Abwinken. Jeden ersten Sonntag im April wurde landesweit der »Tag des Geologen« gefeiert. Die Regierung zeichnete die Besten mit schicken Ehrenurkunden aus, namhafte sowjetische Komponisten widmeten ihnen ihre neuesten Lieder, das Fernsehen übertrug die »Große Geologen-Hymne«:
Niemals wirst du umkehren,
Denn das Sein ist dir lieber als der Schein;
Auch im Leben wirst du immer erkennen
Wertvolle Erze im tauben Gestein.
Halte durch, Geolog!
Gib nicht auf, Geolog!
Des Windes und Sturmes Freund!
Nach der Perestroika ging die geologische Forschungsarbeit in Russland rapide zurück. Heute ziehen ganz andere Berufe die Jugendlichen an: Börsenmakler, Immobilienhändler und Ähnliches. Der »Tag der Polizei« und der »Tag des Kleinhandels« werden zwar immer noch gefeiert, aber der »Tag des Geologen« ist zur belächelten Vergangenheit geworden. Auch die große Hymne von damals erklingt nicht mehr im Fernsehprogramm des Monats April, dafür aber neuerdings in Berlin. In unserem Kinderzimmer hat dieses Lied seine Wiedergeburt erlebt. Obwohl die Kinder nicht immer alles richtig verstehen, wovon die Schwiegermutter singt: »Niemals wirst du umkehren / Denn das Sein ist dir lieber als der Schein…«
»Arme, arme Geologen«, seufzte meine Tochter Nicole, »warum nur können sie niemals umkehren? Warum?«
»Geht nicht«, erklärte ihr die Schwiegermutter, »das können sie nicht, ich weiß nicht, warum.«
»Du bist aber doof, Nicole!«, sagte Sebastian. »Sie haben keinen Rückwärtsgang, und deswegen können sie nicht umkehren!« Er hält die Geologen aus dem Lied für eine Art Roboter, wie sein akkugeladenes Mondfahrzeug, das auch nicht umkehren kann. Beide Kinder haben die Geologen als tragische Figuren in ihre Kinderwelt aufgenommen. Sebastian nannte eine Zeit lang alle, die ihm Leid taten, Geologen. Unter anderem sein Lieblingskrokodil, dem er selbst einmal aus Versehen eine Pfote rausgedreht hatte. »Halte durch, Geolog!«, sagte er zum Krokodil.
Meine Frau und ich machen gelegentlich Witze über meine Schwiegermutter und ihre Geologen-Gesänge. »Aber sag mal«, fragte ich sie jedes Mal, wenn wir uns in der Küche trafen, »im Ernst: Warum können die Geologen denn nicht umkehren?«
»Geht nicht«, antwortete Schwiegermutter bloß und lachte.
Nach drei Monaten war ihr Touristenvisum abgelaufen, und wir mussten uns von ihr verabschieden. Sie fuhr zurück in den Nordkaukasus. Ihr Lied, von allen Mitgliedern der Familie inzwischen auswendig gelernt, blieb bei uns. Die Kinder singen es auf dem Weg zum Kindergarten.
»Geologen!«, ruft Sebastian, wenn er eine Straßenbahn oder einen U-Bahn-Zug sieht. Der Junge hat Recht. Sie können nicht umkehren. Morgens laufen etliche Arbeitgeber und vor allem Arbeitnehmer auf der Schönhauser Allee an uns vorüber. Unausgeschlafen, aber fest entschlossen, heute noch ihre Arbeitsplätze zu erreichen, ihre Fabriken, Baustellen, Büros. Es sind auch Geologen, sie können nicht umkehren – geht nicht.
Am Ende unseres Weges am Arnimplatz sitzt seit Ewigkeiten ein alter Mann schief auf einer Bank. Zwischen seinen Beinen steht eine Plastiktüte, in der er das Lebensnotwendige hat. »Schau ihm nicht in die Augen«, sage ich jedes Mal zu mir selbst, aber schon wieder treffen sich unsere Blicke. Mein betrübter und sein heller schlauer Blick eines Paranoikers, der das Leben verstanden hat und nicht mehr aufhören kann, immer weiter, immer weiter das ganze Leben zu verstehen. Er ist verloren für die Gesellschaft.
»Halte durch, Geolog!«, singt Sebastian ihm vor. »Gib nicht auf, Geolog! Du bist des Windes und Sturmes Freund!« Der Geologe wird ein wenig vom Wind gebeutelt, hält aber durch.
Der Fünftklässler
Den ganzen Tag klopften Leute an meine Tür. Bereits um zehn Uhr klingelten drei Zehnjährige, schwenkten eine Blechbüchse vor meiner Nase und behaupteten, sie würden Geld für die Restaurierung des Kollwitzplatzes sammeln. Ihre Augen strahlten wilde Entschlossenheit aus. Wahrscheinlich waren die Jungs schon lange unterwegs und mittlerweile auf alles gefasst. Diese Kinder erinnerten mich an meine eigene stürmische Jugend, auch wir haben damals die Zeit nicht sinnlos in der Schule vergeudet, sondern haben…hm… na ja… also gab ich den Jungs drei Euro. Daraufhin glaubten sie, in mir den richtigen Sponsor gefunden zu haben, und wollten gleich auch noch für die Renovierung des Falkplatzes abkassieren. Ich verabschiedete sie. Danach kamen zwei Erwachsene in gut gebügelten Anzügen und übergaben mir zwei frische Ausgaben der Zeitschrift »Wachtturm« mit der Überschrift: »Die Probleme der Menschheit werden bald enden!«
»Kommen Sie danach auch noch?«, fragte ich.
»Das können wir Ihnen gerne erklären«, meinten die beiden. Ich hatte aber keine Zeit, mit ihnen über die Probleme der Menschen zu diskutieren. Vor zwei Monaten hatte ich leichtsinnigerweise versprochen, an einer skurrilen Veranstaltung teilzunehmen. In einer Berliner Grundschule sollte ich mich mit Fünftklässlern treffen. Diese Begegnung würde im Schulfach Deutsch in der Unterrichtseinheit »Ein Treffen mit einem lebendigen Schriftsteller« stattfinden, sagte die Schulleiterin zu mir, die Schüler hätten bereits seit Wochen ihre Fragen vorbereitet. Jetzt musste ich hin.
Ich war aufgeregt. Das letzte Mal hatte ich eine Schulklasse von innen in Moskau vor fünfundzwanzig Jahren gesehen. Als ich nun wieder einen Klassenraum betrat, musste ich feststellen: Viel hatte sich nicht verändert. Diesmal sollte ich jedoch am Lehrertisch Platz nehmen. Ich versuchte, eine möglichst ernsthafte Miene zu machen. Alle Schüler hatten bunte Schildchen mit ihren Namen vor sich auf dem Tisch stehen. Es sah aus wie auf einer UNO-Konferenz. Die Kinder guckten in ihre Unterlagen und hielten die Hände hoch.
»Ihr könnt einfach so mit mir reden, ohne euch zu melden«, eröffnete ich das Gespräch.
»Aber nein«, meinte die Lehrerin, »die Kinder müssen lernen, wie anständige Menschen zu kommunizieren. Ich zeige Ihnen, wie es geht.«
Sie zeigte mir, wie es geht. Also machte ich ein ernstes Gesicht und sagte: »Bitte, Saskia!«
Saskia stand auf und fragte: »Wann haben Sie beschlossen, Schriftsteller zu werden?«
»Vor viereinhalb Jahren«, antwortete ich. Die Kinder notierten sich meine Antwort in ihren Heften. »Bitte, Simon!«
Der dicke Simon stand auf. »Wann haben Sie beschlossen, Schriftsteller zu werden?«
»Mensch, Junge, das hatten wir bereits!«, regte sich die Lehrerin auf. Simon schaute missmutig in sein Heft und schnaubte.
»Vor viereinhalb Jahren«, sagte ich noch einmal. »Bitte, Franziska!« Ich kam mir unglaublich blöd vor.
»Was ist Ihr Lieblingsfilm?«
»Eight Mile.«
»Ihr Lieblingsschauspieler?«
»Eminem.«
»Schreiben Sie Horrorgeschichten?«
»Sehr selten.«
»Was ist Ihr Lieblingsfilm?«
»Hatten wir schon!«, brüllte die halbe Klasse.
»Wann haben Sie beschlossen…«
»Hatten wir schon!« Der Pechvogel versank sofort hinter seinem Tisch.
Erst nach zwanzig Minuten merkte ich, dass wir eigentlich die ganze Zeit eine Art Bingo für Anfänger spielten. Dann war ich dran und suchte heftig nach der blödesten Frage, die ich den Kindern stellen konnte. Bei uns war das früher immer die Frage gewesen: »Was willst du denn später mal werden, Junge?« Ich hatte damals immer das darauf geantwortet, was der Frager meiner Meinung nach hören wollte. Zu Lehrern sagte ich: »Ich wäre gern Lehrer«, zu meinem Vater sagte ich: »Vater«, zu unserem Nachbarn, der Alkoholiker war, sagte ich: »Schnapsbrenner«. Die Erwachsenen schauten mich meist mitleidig an und schwiegen. Nun war ich in der Rolle des Erwachsenen. Wurde auch langsam Zeit, dachte ich, holte tief Luft und fragte mit einem finsteren Gesichtsausdruck: »Was wollt ihr denn eigentlich werden, Kinder? Bitte, Saskia, bitte, Simon, bitte, Franziska!«
Erstaunlicherweise wollte keiner von den Befragten Schriftsteller werden. Alle Mädchen in der Klasse hatten sich für intelligente, quasi bodenständige Berufe entschieden: Archäologin, Bergsteigerin und Gebärdensprachen-Dolmetscherin wollten sie werden, dazu ein anspruchsvolles Studium abschließen und sich anschließend nach einer passenden Arbeitsstelle umschauen. Die Jungs lebten dagegen noch in der Fantasiewelt. »Sänger«, »Rapper«, »Fußballspieler«, bekam ich zu hören und stellte mir vor, wie zwanzig Jahre später die Gebärden-Dolmetscherin nach einem langen anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt und auf dem Sofa der Rapper-Fußballspieler mit einer Bierbüchse vor der Glotze sitzt. Er guckt Tennis. Der Ball geht nach rechts, der Ball geht nach links… Hätte er nur damals in der Schule die richtige Entscheidung getroffen und sich für einen soliden Beruf entschieden, Schriftsteller zum Beispiel. Nun ist aber alles zu spät – der Ball geht nach rechts, dann wieder nach links, dann wieder nach rechts…
Das alles habe ich aber den Kindern nicht erzählt, nur ein wenig in die Faust gehustet: »Ach, weißt du, Simon, Fußballer ist ein harter Job. Du musst ständig Tore schießen. Das kann auf Dauer anstrengend sein. Außerdem sind Fußballer so schnell aufgebraucht, und was dann?«
»Na ja, dann kann ich ja immer noch Schriftsteller werden«, meinte der Junge, »aber warum nicht zuerst mal ein paar Tore schießen?«
Wir tranken eine Runde Früchtetee und wünschten einander viel Glück. Auf dem Weg nach Hause überlegte ich, dass Simon eigentlich Recht hatte. Und wenn ich mich genau erinnerte, wollte ich in seinem Alter eigentlich nichts anderes als Scharfschütze werden. Einmal habe ich sogar mit anderen angehenden Scharfschützen aus meiner Klasse mit einem Luftgewehr auf eine Gipsbüste des Schriftstellers Maxim Gorki geschossen, so lange, bis ihm ein Ohr abfiel.
»Aber diese Zeiten sind längst vorbei«, wie die dienstälteste Popsängerin der Sowjetunion Alla Pugatchowa einmal sang. Weiter heißt es bei ihr:
»Wohin geht unsere Kindheit?
Wie wird man plötzlich alt?
Wer das herausfindet
Der schweigt und schweigt und schweigt…
Sie geht auf leichten Füßen
Wenn alles schläft im Land
Und schreibt uns keine Briefe
Und ruft nicht mehr aaan…«
Sebastian und die Ausländerbehörde
Seit einiger Zeit bekommt mein dreijähriger Sohn Briefe, die an ihn persönlich adressiert sind. Nicht irgendwelche Liebesbriefe von seinen Kita-Kumpeln, sondern offizielle Anschreiben von der Ausländerbehörde. »Sehr geehrter Herr Sebastian«, steht da, »seit beinahe drei Jahren befinden Sie sich illegal in Deutschland. Das geht so nicht, rufen Sie uns so schnell wie möglich an. Hochachtungsvoll, Spende.«
Sebastian hat vor kurzem das Telefon als neues Spielzeug entdeckt und ruft nun dauernd alle möglichen Leute an, indem er wahllos auf die Tasten drückt. Er hat schnell gelernt, dass hinter jeder Zahlenkombination im Telefon eine lustige Stimme steckt. Dann hört er aufmerksam zu, doch viel zu erzählen hat er noch nicht. Er grunzt nur freundlich und legt nach einiger Zeit wieder auf. So ein Telefongespräch wäre für Herrn Spende ein schwacher Trost. Also nahm ich die Sache selbst in die Hand und telefonierte mit der Ausländerbehörde. Herr Spende erwies sich als eine Frau.
»Sie wissen sicher, Herr Kaminer, dass jedes Kind in Deutschland spätestens fünf Monate nach seiner Geburt einen Kinderpass beantragen muss. Ihr Kind ist nun aber schon drei Jahre alt und hat sich noch immer nicht bei uns gemeldet.«
»Seien Sie nicht sauer, wir haben es einfach vergessen, weil er im Kindergarten noch nie nach dem Pass gefragt wurde, und mit der Polizei oder dem Grenzschutz hat Sebastian auch noch keinen Kontakt gehabt. Außerdem hatten wir sehr viel zu tun«, verteidigte ich mich.
»Wollen Sie mich veräppeln? Denken Sie, wir spielen hier nur Spielchen?«, erwiderte Frau Spende wütend.
»Nein, ganz bestimmt nicht. Ich fahre jetzt gleich zu Ihnen und beantrage für Sebastian einen Kinderpass«, versuchte ich die Frau zu beruhigen.
»Sie werden aber keinen Kinderpass für Ihren Sohn bekommen, weil Sie und Ihre Frau keine deutschen Staatsbürger sind. Also gilt auch Ihr Sohn als Ausländer und muss zuerst eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen«, klärte mich Frau Spende auf.
»Aber er war doch noch gar nicht im Ausland, nur im Bauch seiner Mutter. Seit seiner Entbindung befindet sich Sebastian permanent in Deutschland. Selbst wenn er wollte, könnte er nicht verreisen, weil er, wie Sie ganz richtig schrieben, keinen Kinderpass besitzt«, entgegnete ich.
»Sie wollen mich schon wieder veräppeln«, meinte Frau Spende beleidigt.
Ich ahnte Schlimmes und fragte sie, ob ich den Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung nicht aus dem Internet herunterladen oder ihn per Post zugeschickt bekommen könne. »Weder noch«, war die knappe Antwort. Ich musste persönlich den Antrag abholen. Damit setzte ich mich dann zusammen mit Sebastian an den Schreibtisch. Der »Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung« bestand aus siebenundzwanzig Fragen, die alle ausführlich beantwortet werden sollten, wie Frau Spende im Gespräch mehrmals betont hatte.
Die ersten zehn Fragen betrafen Sebastians Familienverhältnisse: seine Vorstrafen, Ex-Ehefrauen und früheren Staatsangehörigkeiten. Ich beantwortete sie schlicht mit der Bemerkung »Kind«. Ab der zwanzigsten Frage wurde es richtig problematisch.
»Was ist der Zweck Ihres Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland?«, las ich Sebastian laut vor. Er grunzte. Er hatte den Zweck seines Aufenthaltes hier noch nicht kapiert. In dem Antrag gab es fünf verschiedene Antworten auf diese Frage: Besuch, Touristenreise, Studium, Arbeitsaufnahme, usw. Nach langem Hin und Her entschieden wir uns für »usw.«.
»Wie lange beabsichtigen Sie in der Bundesrepublik zu bleiben?«, fragte ich meinen Sohn. Sebastian grunzte wieder begeistert. Ihm gefiel das Ausfüllen des Antrags, aber er wollte trotzdem lieber »wilde Ferkeljagd« mit mir spielen. Das Spiel geht so: Sebastian versteckt sich als wildes Ferkel hinter einer Gardine, und ich muss als Jäger ganz leise auf Zehenspitzen durch die Wohnung laufen und nach dem wilden Ferkel rufen. Ihn quasi suchen, obwohl es gar nicht nötig ist, weil das Ferkel so laut grunzt, dass die richtige Gardine, hinter der es steckt, gar nicht zu verfehlen ist. Bei diesem Spiel amüsiert sich Sebastian über alle Maßen, und er kann gar nicht genug davon bekommen. Also schrieb ich »ewig« in den Antrag. Sofort kamen mir aber Zweifel: Ist »ewig« nicht doch ein wenig übertrieben? Ich strich das »ewig« durch und schrieb dafür »lange«.
»Haben Sie vor, eine Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik auszuüben?« Hmm… Ich schaute Sebastian tief in die Augen. Bisweilen sah es nicht danach aus, aber wer weiß… Ich schrieb vorsichtig »nicht ausgeschlossen« rein. Sebastian grunzte wieder.
Zwei Wochen später war ich wieder bei Frau Spende zu Gast. Sie las den Antrag durch und wurde wieder sauer.
»Sie wollen mich schon wieder veräppeln!«, sagte sie vorwurfsvoll. »Na gut«, meinte sie schließlich, »wir haben zwei Jahre auf Sie gewartet, jetzt werden Sie ein paar Stunden auf uns warten müssen.« Ich setzte mich in den Warteraum und nahm ein dickes Buch aus der Tasche. Doch Frau Spende erwies sich als guter Mensch und hervorragende Mitarbeiterin. Und diesen ganzen Quatsch mit den Anträgen hatte sie sich auch nicht selbst ausgedacht. Schon nach zwanzig Minuten wurde ich von ihr wieder hereingerufen und bekam gleich alles auf einmal in die Hand gedrückt: die Aufenthaltsgenehmigung für Sebastian und einen superdicken neuen Hardcover-Reisepass dazu. Jetzt können wir mit ihm um die ganze Welt fliegen.
Mein Vater, der Sportsfreund
Mein Großvater war einer der wenigen Männer, die aus dem Krieg zurückkamen, und genoss deswegen in seiner Heimatstadt einen besonderen Status. Von Montag bis Freitag schuftete er als Buchhalter in der Schuhfabrik, am Wochenende spielte er verrückt. Am Samstag gleich nach dem Frühstück trank er zuerst literweise selbst gebrannten Schnaps aus einem Bierglas, das er als Kriegstrophäe mitgebracht hatte, dann griff er nach seinen Pistolen – in jedem Haus gab es damals eine große Waffensammlung – und ging auf den Hof. Dort schoss er beidhändig die Äpfel von den Bäumen. Anschließend lief er durch die ganze Stadt zum Kulturklub, brach die Türen auf, setzte sich ans Klavier und spielte bis zum Umfallen Brahms. Seine Familie traute sich nicht, den Klub zu betreten, und wartete stattdessen so lange draußen, bis die wilden Akkorde nicht mehr zu hören waren. Erst dann trugen sie meinen Großvater vorsichtig nach Hause zurück. Nach jedem dieser Wochenenden gab es ein paar neue Einschusslöcher in den Häusern der Nachbarschaft. Trotzdem wurden die regelmäßigen Amok-Konzerte meines Großvaters von der Bevölkerung mit Verständnis aufgenommen. Meinem Vater, der damals zwölf Jahre alt war, erklärte man: »Dein Papa treibt Sport.«