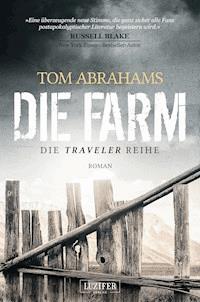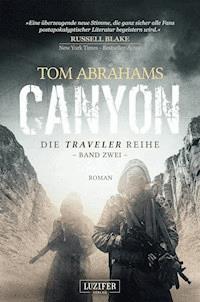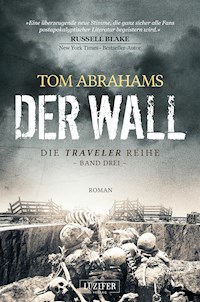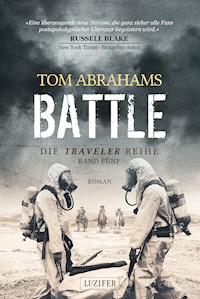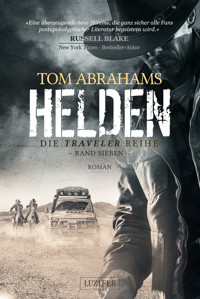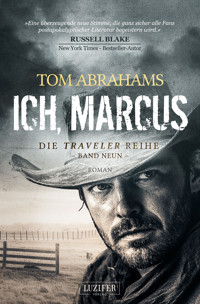
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Traveler
- Sprache: Deutsch
Er kam, sah und siegte. Die Seuche tötete zwei Drittel der Weltbevölkerung – und gebar einen einzigartigen Helden der Postapokalypse. Nun können Sie die Traveler-Reihe zum ersten Mal durch die Worte ihres Protagonisten Marcus Battle selbst erleben. Aus seiner Perspektive erzählt und digital aus seiner persönlichen Sammlung von Tagebüchern transkribiert, gewähren diese Texte neue Einblicke in seine Taten, seinen Humor, seine Reue und seinen Glauben. Die Tagebücher enthalten bislang unveröffentlichte Geschichten des Überlebens, in denen Battle durch die einsame Landschaft der von einer Pandemie verwüsteten Welt zieht, sowie einen ganz eigenen Blick auf die Höhepunkte der achtteiligen Romanreihe, die Fans von postapokalyptischen Survival-Geschichten weltweit in ihren Bann zog. ★★★★★ »Eine überzeugende neue Stimme, die ganz sicher alle Fans postapokalyptischer Literatur begeistern wird.« - Russell Blake, New York Times Bestseller Autor Die TRAVELER-Reihe – das sind actionreiche Endzeit-Abenteuer mit einem Schuss Neo-Western.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright © 2022 Tom Abrahams
Dieses Buch ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Schauplätze, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet.
Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
www.tomabrahamsbooks.com
Deutsche Erstausgabe
Originaltitel: I, MARCUS
Copyright Gesamtausgabe © 2025 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd.
Kontaktinformation:
LUZIFER Verlag Cyprus Ltd.
House U10, Toscana Hills, Poumboulinas Street, 8873 Argaka, Polis, Cyprus
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Umschlag: Michael Schubert | Luzifer-Verlag
Übersetzung: Peter Mehler
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2025) lektoriert.
ISBN: 978-3-95835-919-2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
VORWORT
TAGEBUCHEINTRAG 1
TAGEBUCHEINTRAG 8
TAGEBUCHEINTRAG 105
TAGEBUCHEINTRAG 106
TAGEBUCHEINTRAG 128
TAGEBUCHEINTRAG 131
TAGEBUCHEINTRAG 132
TAGEBUCHEINTRAG 133
TAGEBUCHEINTRAG 134
TAGEBUCHEINTRAG 135
TAGEBUCHEINTRAG 136
TAGEBUCHEINTRAG 137
TAGEBUCHEINTRAG 250
TAGEBUCHEINTRAG 300
TAGEBUCHEINTRAG 301
TAGEBUCHEINTRAG 302
TAGEBUCHEINTRAG 303
TAGEBUCHEINTRAG 305
TAGEBUCHEINTRAG 306
TAGEBUCHEINTRAG 307
TAGEBUCHEINTRAG 308
TAGEBUCHEINTRAG 309
TAGEBUCHEINTRAG 310
TAGEBUCHEINTRAG 311
TAGEBUCHEINTRAG 312
TAGEBUCHEINTRAG 995
TAGEBUCHEINTRAG 996
TAGEBUCHEINTRAG 445
TAGEBUCHEINTRAG 446
TAGEBUCHEINTRAG 447
TAGEBUCHEINTRAG 448
TAGEBUCHEINTRAG 449
TAGEBUCHEINTRAG 450
TAGEBUCHEINTRAG 451
TAGEBUCHEINTRAG 452
TAGEBUCHEINTRAG 453
TAGEBUCHEINTRAG 998
ANMERKUNG DES HERAUSGEBERS
VORWORT
Die folgenden Seiten sind Auszüge aus handschriftlichen Tagebüchern, die auf die ersten Jahrzehnte bis zur Mitte des einundzwanzigsten Jahrhunderts datieren. Archäologen entdeckten diese Aufzeichnungen auf dem Anwesen einer der legendärsten Personen jener Zeit, Marcus Battle.
Forensische Analysen sowie Experten der Wignock Data Storage and Authentication bestätigen die Echtheit der Tagebücher und datieren sie auf die frühen Jahre nach dem Ausbruch (2032–2054) zurück. Historische Querverweise verorten Mr. Battle zu jener Zeit auf seinem Grundstück außerhalb der Stadt Rising Star, Texas. Wir können dies zudem mit einer Suche in einem zwischengespeicherten Online-Register untermauern, das einst Grundsteuer- und Mineralienakten des Bezirks Eastland County, Texas, enthielt. Weitere Zeugenaussagen sowie andere beglaubigte Dokumente bestätigen Mr. Battles Aufenthaltsorte zu verschiedenen Zeitpunkten nach 2032.
Zum Kontext: Marcus Battle galt – je nach Quelle – als Held, Rächer oder Terrorist der Zeit nach dem Ausbruch. Unbestreitbar jedoch ist nach Maßgabe zahlreicher Forschungsarbeiten, die in Regierungsdokumenten des »Neuen Amerika« veröffentlicht, von dem angesehenen Historiker Bernard Francis umfassend ausgewertet und an Universitäten wie auch weiterführenden Schulen gelehrt wurden, dass Battle, ein US-Armee-Veteran mit Einsätzen in Syrien und für Tapferkeit ausgezeichnet, nach dem Tod seiner Frau und seines einzigen Kindes in den ersten Tagen des Ausbruchs allein lebte.
Jener Ausbruch – wie er im Sprachgebrauch des frühen und mittleren einundzwanzigsten Jahrhunderts genannt wurde – war eine mutierende Plage, die in Flüchtlingslagern im Nahen Osten und in Osteuropa ihren Ursprung nahm. Die Krankheit führte entweder direkt oder indirekt zum Tod von annähernd zwei Dritteln der Weltbevölkerung. Laut Daten der Vereinten Nationen, geborgen aus zwischengespeicherten Archiven, sank die Weltbevölkerung drastisch: von 8.687.227.873 am 1. Januar 2032 auf 3.174.292.929 am 31. Dezember 2033. In Nordamerika destabilisierte diese rapide Entvölkerung Regierung, Wirtschaft und lebenswichtige Infrastruktur – darunter sauberes Wasser und verlässliche Stromversorgung.
Battle lebte anhand mehrerer historischer Quellen, insbesondere des bereits erwähnten Bernard Francis, etwa fünf Jahre lang allein, nachdem seine Frau und sein Kind gestorben waren. Er verließ seine autarke Ranch erst, als eine Frau, die nur unter dem Namen »Lola« bekannt ist, ihn um Hilfe bat, ihren entführten Sohn Sawyer zu finden. Es gibt verschiedene Aufzeichnungen über das, was sich genau ereignete, nachdem Battle aufbrach, das vermisste Kind zu suchen, jedoch widersprechen sich diese Informationen immer wieder.
Gesichert ist, dass Battle später einen Aufstand gegen zwei organisierte Milizen anführte, die das Gebiet des einstigen Texas unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Aufgrund der dort herrschenden Gesetzlosigkeit – entstanden kurz nach dem Ausbruch der Seuche – errichtete die damalige Bundesregierung der Vereinigten Staaten eine Mauer an der Nordgrenze von Texas, um es vom Rest der inzwischen zerfallenen Union abzutrennen. Der Bau dieser Mauer war einer der letzten großen Akte der US-Regierung.
In späteren Jahren verließ Battle Texas und hielt sich zeitweise in Virginia, Georgia und North Carolina auf. Während große Teile seines späteren Lebens – nach 2053 – unzureichend dokumentiert sind, werfen diese Texte neues Licht auf den Geist eines der einflussreichsten, bisweilen auch verhasstesten Anführer der Welt nach dem Ausbruch.
Vieles von Battles überwältigendem Legendenstatus, heute in digitalisierten Texten und holografischen Nacherzählungen verewigt, bleibt unbewiesen und anekdotisch. Unter Gelehrten wird heftig diskutiert, ob er seine Gewaltbereitschaft als Werkzeug der Rettung oder der Unterdrückung einsetzte. Auch wenn diese Texte, sorgfältig in digitale und Audioform übertragen, jene Frage nicht beantworten oder die Debatte beenden können, so sind sie doch aufschlussreich: In Battles eigenen Worten gewinnen wir einen beispiellosen Einblick in den Verstand eines Mannes, der mit seinen Taten, seinem Glauben, seinen Fehlern und seiner Rolle in einem gesetzlosen Land haderte.
Diese Seiten spiegeln nicht die Ansichten oder Meinungen von Piton Press oder Wignock Data Storage and Authenticationwider, sondern sind ausschließlich Marcus Battle zuzuschreiben. Die einzige Veränderung gegenüber dem Originaltext besteht in Anmerkungen, die jedem Eintrag vorangestellt wurden, um dessen Einordnung in diesem Tagebuch zu erleichtern. Seien Sie gewarnt: Manche der enthaltenen Beschreibungen könnten für einige Leser oder Hörer verstörend wirken.
Jackson Ellsworth, Wignock Data Storage and Authentication
TAGEBUCHEINTRAG 1
12. November 2032
44 Tage nach dem Ausbruch
Östlich von Rising Star, Texas
Heute habe ich meine Frau Sylvia und unseren Sohn Wesson begraben. An den eigentlichen Vorgang kann ich mich kaum erinnern. Ich glaube, mein Gehirn versucht, mich vor dem Trauma zu schützen, und ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, warum ich das hier niederschreibe oder wer überhaupt das Publikum dafür sein sollte. Ich habe noch nie ein Tagebuch geführt. Man kann wohl sagen, dass das nicht mein Ding ist – oder zumindest nie war, bis zu diesem Moment.
Ironie ist vermutlich nicht das richtige Wort dafür, aber es liegt etwas traurig Poetisches darin, ein Tagebuch ausgerechnet an dem Tag zu beginnen, an dem ich mein Herz und meine Seele unter die Erde gebracht habe. Sylvia wollte immer, dass ich ein Tagebuch führe, weil sie glaubte, es sei eine gute Therapie. Sie war eine kluge Frau, intuitiv, nachdenklich, selbstbewusst. All das gehört nicht zu meiner DNA.
Sie lacht wahrscheinlich gerade über mich, weil ich hier mit Stift und Papier sitze und meine Gefühle ausschütte. Oder sie verflucht mich, dass ich bis nach ihrem Tod gewartet habe, um tatsächlich in mich zu schauen. Ich wünschte, ich hätte öfter auf sie gehört. Vielleicht wären sie und unser Sohn dann noch am Leben. Vielleicht wäre ich nicht allein.
Die Welt zerfällt. Zumindest meine Welt. Nein, eigentlich ist es die ganze Welt. Und falls das hier einmal in die Hände von jemandem gelangt, der keine Ahnung hat, was in den letzten Wochen passiert ist, wäre es wohl eine gute Idee, zu erklären, was geschah.
Wenn ich den letzten Absatz noch einmal lese, klingt es naiv zu glauben, irgendjemand könnte wirklich verstehen, was geschehen ist. Man sollte meinen, dass die Leute es nach der Pandemie vor etwas mehr als einem Jahrzehnt begriffen hätten. Haben sie aber nicht. Die Geschichte wiederholte sich – wie so oft –, nur viel, viel schlimmer, und niemand schien wirklich zu verstehen, was geschah. Kurz gesagt, verband sich ein Virus mit einer bakteriellen Krankheit und mutierte. Für mich klingt das nach Science-Fiction, aber ich bin Soldat, kein Wissenschaftler.
Andererseits lagen die Wissenschaftler falsch, ebenso wie die Politiker. Alle glaubten, sie hätten es unter Kontrolle, bis sie es nicht mehr hatten; bis sich etwas nicht mehr eindämmen ließ, das so klein war, dass es kein Mensch je mit eigenen Augen sehen konnte.
Einer nach dem anderen fiel tot um, und niemand konnte etwas dagegen tun. Nun ja, nicht ganz. Politiker hätten etwas tun können. Wissenschaftler hätten mehr tun können. Anders als beim letzten Mal gab es keinen schnellen Ruf nach einem Impfstoff, keine Abstandsregeln, keine Maskenpflicht. Ich hörte in den Nachrichten, ganz zu Beginn, dass sie an einer Art Impfstoff arbeiteten, aber nie, was daraus wurde. Vermutlich hätte es ohnehin keinen Unterschied gemacht. Die Menschen reagierten – soweit ich es im Fernsehen sah – nicht mehr so wie damals. Ich glaube, sie waren es leid. Sie hatten das alles schon einmal durchgemacht und hatten dieses Mal nun ganz eigene Ideen, wie man es stoppen könnte. Es funktionierte nicht. Und ob das Ganze nun in einem Labor entstand oder wirklich in Flüchtlingslagern begann – es spielt keine Rolle. Meine Frau ist tot. Mein Sohn ist tot. Ich bin allein.
Heute las ich eine Schlagzeile im Netz. Das Internet arbeitet unzuverlässig, aber meistens funktioniert es. Die Schlagzeile starrte mich eine ganze Weile an, bestätigte, was ich längst wusste, was ich vergeblich versucht hatte, von meinem Zuhause fernzuhalten.
Es war keine wirkliche Neuigkeit, auch wenn die fetten Buchstaben auf meinem Laptop-Bildschirm verkündeten: Chaos verwüstet Großstädte, Pandemie erreicht kritischen Punkt. Der Artikel darunter schilderte, wie die Welt im Grunde zu einem Moshpit geworden war, in dem Regierungen versagten und Infrastrukturen kollabierten. Die Irren waren drauf und dran, die Anstalt zu übernehmen.
Das war nichts Neues, auch wenn es diesmal in weit größerem Maßstab geschah, als ich es während meiner Einsätze in kriegsgebeutelten Gebieten erlebt hatte. Ohne zentrale Regierungen, ohne die Furcht vor echten Konsequenzen, würden Gewalt und Brutalität zunehmen und im Gegensatz zu Anstand zur Norm werden.
Ich las, dass in Florida, am allerersten Tag, als die Pandemie die Vereinigten Staaten erschütterte, in Supermärkten Schlägereien um Mineralwasser ausbrachen. Das war an Tag eins. Inzwischen waren mehr als sechs Wochen vergangen, und die Zivilisation war nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Gut und Böse werden aufeinanderprallen. Das ist unausweichlich. Meine einzige Frage ist jedoch jetzt, während ich das schreibe: Wie lange wird das Chaos herrschen? Ein Jahr? Fünf? Eine ganze Generation?
Entgegen besseren Wissens las ich den Artikel zu Ende. Er widerte mich an. Hier ein Auszug:
Der verbliebene Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hielt heute Morgen eine Online-Sitzung mit den überlebenden Leitungen der Weltgesundheitsorganisation und desCenters for Disease Control ab.
Die Diskussion, an der die Teilnehmer per Computer teilnahmen, offenbarte die dramatische Lage in vielen der größten Metropolen der Welt. Reporter von Associated Press und Reuters durften die Konferenz verfolgen, jedoch keine Fragen stellen.
»Die Zentralregierungen in Berlin, London, Moskau, Paris und Prag können ihren grundlegenden Pflichten nicht mehr nachkommen«, erklärte UN-Generalsekretär Lucius Dekaamp. »Ein Großteil Westeuropas steht unter einer Art Militärherrschaft. In Nordafrika und im Nahen Osten existiert faktisch kein Militär mehr. Die Chinesen wollen sich über die tatsächlichen Auswirkungen der Seuche auf ihre Bevölkerung nicht äußern.«
Mehr muss ich von dem Artikel nicht abschreiben – meine Hand verkrampft sonst –, aber Sie verstehen sicher, worum es geht. Der russische Botschafter sagte, Osteuropa werde von Krankheit, Hungersnot und Bandenwesen überrollt. Ich fragte mich beim Lesen, wie sich das eigentlich von manchen der früheren Sowjetrepubliken vor der Seuche unterschied – einschließlich eines Schwarzmarktes für nicht infizierte Kinder.
Aber noch ein letzter Punkt: Der Artikel endete damit, dass der UN-Sicherheitsrat keinerlei Lösungen, Ratschläge oder Trost für Überlebende anbieten konnte.
Dieser Teil ist fraglos die wahrste Aussage in dem gesamten Bericht. Für Überlebende wie mich gibt es keine Lösungen, niemanden, der Ratschläge erteilt oder irgendeine Form von Trost spendet.
Ich dachte, wäre vorbereitet gewesen. Ich dachte, meine Familie wäre sicher. Ich lag falsch.
Jetzt habe ich nur noch meine Waffen, meine Vorräte und die Erinnerungen an meine Familie – die ich nicht vor einem unsichtbaren Feind schützen konnte.
Überlebensschuld ist mir nicht neu. In Syrien tötete der Krieg Männer und Frauen, die besser waren als ich, und er hinterließ Kinder als Waisen oder Krüppel. Irgendwie überlebte ich und kam zurück. Doch dieses tiefe, schwere Gefühl der Beklemmung in meinem Innern, diese Last, die mich fast in völliger Untätigkeit erstarren lässt – das ist keine Überlebensschuld. Es ist vielmehr die überwältigende Angst, dass mein Leben bedeutungslos ist und ich nie wieder etwas so Wichtiges tun werde wie für Freiheit zu kämpfen, ein hingebungsvoller Ehemann zu sein und einen klugen, selbstbewussten Sohn großzuziehen.
Selbstmord ist für mich keine Option. Mein Glaube verbietet mir diesen selbstsüchtigen Ausweg. Aber ich fürchte um meinen Verstand.
Dieser Eintrag ist negativer geworden, als ich es beabsichtigte, als ich mich zum Schreiben hinsetzte. Aber ganz ehrlich: Wie könnte er heute auch anders sein?
Die Erde vom Grab meiner Familie steckt noch immer unter meinen Fingernägeln. Egal, wie sehr ich kratze oder mit Seife schrubbe – sie bleibt.
Vielleicht bleibt dies mein einziger Eintrag, weil ich nicht der Typ bin, der täglich Tagebuch führt, um sein Herz auf ein Stück Papier und für ein unsichtbares Publikum auszuschütten. Andererseits sagte meine Frau immer, ich sei ein Softie und dass ich, wenn ich der Welt zeigen würde, wie freundlich und sensibel ich sein könne, viel mehr Freunde hätte.
»Du bist ein guter Mensch«, pflegte sie zu sagen. »Du solltest den Leuten diese Seite zeigen, die lustige Seite. Sie würden dich genauso lieben wie ich, und vielleicht würden wir öfter zu Verabredungen eingeladen. Die Städter würden uns vielleicht einschließen, wenn sie ihre großen Spektakel feiern. Wir wären nicht so isoliert hier draußen auf der Ranch.«
Ich lachte immer, wenn sie das sagte – nicht, weil sie Wörter wie »Städter« und »Spektakel« benutzte, sondern weil sie sich über mein gottgegebenes Wesen so sehr irrte.
Meine Arme um sie gelegt, würde ich sie auf die Stirn küssen – was sie übrigens hasste –, ihr Gesicht in meine Hände nehmen und ihr tief in die Augen sehen.
»Aber wenn ich das täte«, würde ich zu ihr sagen, »müssten wir unter Menschen sein. Und du weißt genau, dass ich Menschen nicht mag. Ich mag sie so wenig, dass mich inzwischen sogar manche Hunde nerven.«
Sie lachte, dann verzog sie das Gesicht. Es war der gespielte Schmollmund einer Frau, die wusste, dass sie auf meine Liebe bauen konnte.
»Wir sollten uns einen Hund anschaffen. Wesson würde sich über einen Hund freuen.«
»Ich will keinen Hund«, sagte ich dann jedes Mal. Vor allem, weil ich wirklich keinen wollte. Hunde waren für mich nur ein weiteres Maul, das gefüttert werden musste.
»Wir sollten uns einen Hund anschaffen. Es geht nicht nur um dich. Es geht um Wes. Vielleicht zu seinem Geburtstag?«
»Ich baue ihm ein Baumhaus zum Geburtstag. Das bellt nicht.«
»Doch, das tut es.«
»Was?«
»Weil es bell-issimo sein wird.«
»Du bist doof«, sagte ich liebevoll.
»Und du noch doofer.«
»Mag sein. Denn irgendwann gebe ich nach, und dann haben wir einen Hund. Welche Rasse? Aber nicht so ein Designer-Ding, oder?«
Sie zögerte. »Ich liebe diese Designer-Dinger. Vor allem die Minis. Ich folge einem Account auf Instagram, hast du die gesehen? Sie sind so süß.«
»Natürlich hab ich sie gesehen. Du schickst mir ständig diese Videos, als ob das irgendetwas erweichen würde. Aber ernsthaft – was für einen Hund stellst du dir vor?«
»Einen Deutschen Schäferhund? Belgischer Malinois?«
»Dagegen habe ich nichts«, sagte ich. »Wir hatten Malinois in Syrien. Die haben großartige Arbeit geleistet.«
»Also irgendwann, ja?«
»Irgendwann.«
Traurig ist nur: Schließlich gab ich nach, und wir wollten tatsächlich diesen verdammten Hund holen. Wir hatten geplant, in die Stadt zu fahren. Nicht nach Rising Star – außer dem Cross-Eyed Pony und ein paar Läden gibt es da ja nicht viel. Stattdessen wollten wir nach Clyde, rund fünfunddreißig Meilen entfernt, und dort im Tierheim einen Hund holen. Clyde liegt nordwestlich von Rising Star und der Ranch und ist zwanzig Minuten näher als Abilene, wo wir sonst einkaufen gingen.
Wes sollte sich den Hund aussuchen dürfen, ganz egal, welcher es wäre – solange es kein Mini-irgendwas war.
Aber Pläne ändern sich wohl. Die Welt ändert sich.
Die Menschen jedoch nicht. Jedenfalls nicht genug. Und genau deshalb, glaube ich, sind meine Frau und mein Sohn jetzt tot.
TAGEBUCHEINTRAG 8
8. Januar 2033
101 Tage nach dem Ausbruch
Östlich von Rising Star, Texas
Man sagt, Selbstgespräche zu führen, würde einen nicht verrückt machen. Erst wenn man eine Antwort bekommt, hat man ein Problem. Genau deshalb glaube ich, dass ich langsam den Verstand verliere. Kein Witz. Die Isolation und die Einsamkeit sind ein Problem. Es spielt keine Rolle, wie sehr man glaubt, auf eine Apokalypse vorbereitet zu sein. Man kann alles Toilettenpapier oder Desinfektionsmittel der Welt besitzen, man kann autark und unabhängig leben, man kann bis an die Zähne bewaffnet sein – aber wenn man allein ist, zählt das alles nichts. Diese Einsamkeit ist wahrscheinlich der Grund, warum ich wieder angefangen habe zu schreiben, damit ich wenigstens das Gefühl habe, mit jemandem zu kommunizieren, auch wenn vielleicht niemals jemand ein einziges Wort davon lesen wird.
Dieses Tagebuch stand eine Weile unberührt im Regal. Ich schrieb eine Woche lang jeden Tag und hörte dann auf. Aber da stand es, schaute mich Tag für Tag an, als wollte es wissen, wann ich endlich den Mut aufbringe, es wieder aufzuschlagen und zu Stift und Papier zu greifen. Ich ignorierte es so lange, wie ich konnte. Aber jetzt, da ich sicher bin, dass mein Gehirn Schweizer Käse ist, fühle ich mich gezwungen zu schreiben.
Die Sache ist die: Ich besuche die Gräber fast jeden Tag, säubere sie und achte darauf, dass alles ordentlich aussieht. Manchmal pflücke ich Wildblumen und lege sie auf die handgemeißelten Grabsteine, und an den meisten Tagen rede ich mit ihnen. Ich erzähle, was gerade los ist, welche Filme ich gesehen habe, was ich zu Mittag oder Abend gegessen habe.
Wir sprechen über die Probleme, die ich mit der Technik auf der Farm habe, oder über einen Traum der letzten Nacht. Die meisten Träume sind nicht gut, manchmal jedoch erreichen sie ein Niveau von »okay«, und dann wache ich auf und bin niedergeschlagen, weil ich mir wünsche, die Welt meiner Träume wäre die Wirklichkeit – und die Realität das erfundene Albtraumszenario.
Zum Teufel, vielleicht ist ja tatsächlich alles nur erfunden. Ich bin eigentlich kein Verschwörungstheoretiker, aber hin und wieder spiele ich mit Gedanken an Vertuschungsmanöver und Ähnliches. Diese paranoiden Fantasien sind es jedoch nicht, die mich wahnsinnig machen. Vielmehr ist es die Tatsache, dass meine tote Familie jetzt mit mir spricht. Sie antwortet mir, gibt mir Ratschläge.
Ja, richtig gehört. So deutlich, wie ich sie höre. Sie reden mit mir.
Manchmal fühlt es sich an, als stünden sie direkt hinter oder neben mir – gerade außerhalb meines Blickfeldes. Es jagt mir eine Heidenangst ein. Und das sollte es auch, oder? Und dass es mir tatsächlich Angst macht, gibt mir ein wenig Hoffnung, dass in mir noch so etwas wie Restverstand steckt. Wie heißt es doch über Narzissten? Wenn man sich fragt, ob man einer ist, dann ist man keiner. So ähnlich sehe ich das hier auch. Das rede ich mir jedenfalls ein, und das ist es, was ich in diesem Tagebuch festhalte.
Das erste Mal geschah es in der Küche. Ich kochte Knochenbrühe auf dem Gasherd. Ich habe davon eine ganze Menge auf Vorrat, weil sie ewig haltbar ist und mir guttut – nicht, dass ich noch einmal bei einem Schönheitswettbewerb antreten würde.
Falls Sie sich fragen: Knochenbrühe soll wegen des Kollagens Anti-Aging-Eigenschaften haben, sie soll die Verdauung fördern, gut für die Gelenke sein und sogar für erholsamen Schlaf sorgen. Letzteres habe ich noch nicht erlebt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Während ich also über der Brühe stand, erzählte ich laut von diesem einen Mal, als meine Frau für meine Eltern gekocht hatte. Vielleicht war es das erste Mal, jedenfalls war sie so nervös, weil meine Mutter eine ziemlich gute Köchin war, als sie noch lebte. Klar, nach ihrem Tod war sie das nicht mehr – aber Sie wissen, was ich meine. Andererseits: Meine Mutter war so stur, dass es nicht völlig ausgeschlossen wäre, dass sie auch noch aus dem Grab einen Hackbraten zustande gebracht hätte.
Wie dem auch sei: Sylvia kochte, und sie machte sich solche Sorgen, dass die Rinderbrust nicht gelingen würde, dass sie den Rest des Essens vermasselte. Das Gemüse war versalzen, die Kartoffeln waren nicht durch. Ihr Bananenpudding war mehlig. Aber die Rinderbrust war in Ordnung.
Ich erzählte also ihr – oder ihrem himmlischen Geist – von dem Desaster, als ich plötzlich ihre Stimme so klar hörte wie nie. Kein Scherz. Es war Sylvia.
»Marcus Battle«, sagte sie, »deine Mutter war mir vom ersten Moment, als ich dich traf, bis zu dem Tag, an dem sie – Gott hab sie selig – zu unserem Himmlischen Vater ging, eine echte Nervensäge. Und an manchen Tagen ist sie es immer noch.«
Ich fuhr herum, riss fast den Topf vom Herd und verbrannte mir den Finger am Rand, weil ich damit rechnete, sie würde direkt hinter mir stehen. Aber die Küche war leer. Ihr Grab, das man durch die Hintertür sehen konnte, sah unverändert aus – was mich beruhigte, denn für einen kurzen Augenblick fragte ich mich, ob Sylvia als Zombie wiederauferstanden sei. Mit Zombies konnte ich noch nie viel anfangen, und ich war dankbar, dass diese Apokalypse wenigstens nicht eine von diesen war.
Mein Herz hämmerte in meiner Brust, der Puls dröhnte in meinen Ohren. Adrenalin schoss durch meinen Körper, Schweißperlen liefen mir über Gesicht und Nacken. Es war, als hätte jemand den Ofen geöffnet und mich mitten auf das Gitter gesetzt. Ich bekam kaum Luft, und als ich nichts sagte, fragte sie mich, ob ich sie hören könne – bevor sie mich beschuldigte, sie zu ignorieren.
Ich schüttelte den Kopf und flüsterte: »Ich höre dich.«
»Wie konnte ein so guter Mann nur von einer so selbstgerechten Frau abstammen?«
Mein Herz raste, aber ich brachte ein Lachen heraus. Sylvia hatte ihren Humor nicht verloren.
»Ich bin nur überrascht, dass du gesagt hast, sie sei zu unserem Himmlischen Vater gegangen – und nicht woandershin.«
»Den Vertrauensvorschuss gebe ich ihr«, antwortete Sylvia, »und übrigens: Das Gemüse war nicht versalzen.«
Wir redeten mehr als eine Stunde in jener Nacht, und seither spricht sie ständig mit mir: morgens, wenn ich mich für den Tag fertig mache, während meiner inzwischen langen Besuche am Grab, im Hof, in der Werkstatt, und auch, wenn ich schlafen gehe.
Wesson spricht ebenfalls mit mir, wenn auch seltener. Wes war immer ruhiger als seine Mutter, aber das Kind war so klug. Er wählte seine Worte mit Bedacht, handelte überlegt. Ich vermisse ihn.
Ich vermisse sie beide.
Die Sehnsucht, sie wiederzusehen, ist umso schmerzhafter, wenn ich ihre Stimmen höre. Das ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Es gibt Tage, da will ich gar nicht, dass sie aufhört zu reden. Und es gibt Tage, da halte ich es nicht aus, auch nur ein weiteres Wort von ihr zu hören. Ich wünschte, es wäre nicht so. Ich wünschte, sie wären wirklich hier – in Fleisch und Blut –, um dieses Leben mit mir zu teilen, statt mich allein zurückzulassen.
Eines allerdings würde ich niemandem wünschen – nicht einmal meinem schlimmsten Feind: diese Art von Einsamkeit.
TAGEBUCHEINTRAG 105
15. Mai 2033
228 Tage nach dem Ausbruch
Östlich von Rising Star, Texas
Heute habe ich jemanden getötet. Eigentlich waren es mehrere. Sie hatten es verdient. Ich glaube fest daran, dass manche Menschen es einfach herausfordern, getötet zu werden, und dass sie dieses Schicksal selbst heraufbeschwören. Das sage ich mir immer wieder – oder besser gesagt, ich tat es, während ich sie begrub.
Eine Leiche zu vergraben ist nie eine leichte Aufgabe. Es erschöpft einen, ganz gleich, wie viele Leute daran beteiligt sind. Allein ist es nahezu lähmend. In den Filmen lassen sie es immer so leicht aussehen. Da sticht jemand mit dem Spaten in die Erde, und im nächsten Moment ist er schon bis zu den Schultern im Loch und wischt sich den Schweiß mit dem Unterarm von der Stirn.
So ist es aber nicht. Leichen zu verbrennen ist in körperlicher Hinsicht zwar einfacher, aber der Geruch von verbrannter Haut und Haaren ist unauslöschlich, und selbst wenn er tief in den Schatten der Erinnerung verborgen liegt, kehrt er viel zu leicht zurück. Darum ziehe ich das Begraben trotz aller Mühsal der Einäscherung vor.
Das klingt wahrscheinlich gefühllos oder soziopathisch. Vielleicht ist es beides. Doch bevor Sie mich wegen meiner Neigung zur Gewalt und meiner Beschäftigung mit dem Tod verurteilen, sollten Sie eines verstehen: Wenn man gesehen hat, was ich gesehen habe, und erlebt hat, was ich durchlebt habe, begreift man unausweichlich, dass der Mensch das brutalste Geschöpf auf diesem Planeten ist.
Das ist eine harte Einschätzung, aber es ist wahr. Und vielleicht bin ich ein Heuchler. Einerseits beklage ich, wie gewalttätig und unterdrückerisch wir als Spezies sind, andererseits gestehe ich meine eigenen Neigungen ein und schreibe über die Leichen, die ich begraben habe, darunter die frischen Gräber auf meinem Land. Bin ich also ein Heuchler? Und wenn schon … ich bin so einiges.
Zumindest war ich so einiges.
Ich war ein Vater, und ich war ein Ehemann. Ich war Soldat und Held. Und jetzt – was bin ich jetzt? Ich bin ein Einsiedler, der mit den Toten redet und sich in einem Tagebuch mit sich selbst streitet. Ein Tagebuch. Ich, Marcus, führe ein Tagebuch.
Das ist lachhaft, aber nicht völlig überraschend. Sylvia hat mir immer gesagt, ich solle eines führen. Besonders, nachdem ich aus dem Krieg zurückkam – kaputt und auf der Suche nach Erlösung für die Dinge, die ich getan habe.
Es sind nicht nur die Dinge, die ich getan habe, die mich unablässig verfolgen. Es sind auch die Dinge, die der Krieg mir angetan hat. Denn mein Leben ist ein niemals endender Krieg. Für jene, die nicht eingeweiht sind, will ich es so einfach wie möglich erklären.
Ein Krieger mag zwar vom Schlachtfeld nach Hause zurückkehren, aber den Krieg verlässt er nie. Er haftet an ihm wie Leim, den man nicht abwaschen kann. Jeder, der aus einem Konflikt zurückkehrt und Ihnen sagt, er sei in Ordnung, sagt das wahrscheinlich nur, weil er Sie nicht mit dem Opfer belasten will, das er für Ihre Freiheit gegeben hat.
Ein Soldat ist wie Atlas, und die Last drückt unaufhörlich, droht ihn zu brechen. Wenn überhaupt, dann hat die Pandemie die Heimat noch mehr dem Schlachtfeld angenähert. Der Krieg hat nie aufgehört, aber er hat seine Frontlinien ganz sicher verschoben. Der beste Weg, den ich kenne, um diese Linie zu halten, ist, für mich allein zu bleiben, auf der Ranch, und nicht über die Zäune hinauszugehen, die mein Land umgeben. Dieses Tagebuch ist in gewisser Weise meine Art, diese Zäune zu überwinden und jemanden hereinzulassen. Einen imaginären Jemand, aber es reinigt die Seele, wenn man seine Gedanken auf dem Papier sieht, egal wie düster sie sind.
Sylvia wäre stolz. Ich setze mich mit meiner … nun, »weibliche Seite« ist nicht der richtige Ausdruck, das ist wahrscheinlich politisch nicht korrekt. Aber ich setze mich auf jeden Fall mit meinen Gefühlen auseinander. Ich habe immer gedacht, Frauen seien besser darin als Männer. Es ist wirklich eine Art Superkraft.
Wenn ich mir die letzten paar Absätze so anschaue, merke ich, dass ich weit vom eigentlichen Thema abgeschweift bin. Es ging ums Töten.
Die Wahrheit ist: Ich wollte eigentlich nur nett sein.
Und die Kerle haben das ausgenutzt.
Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Aber lassen Sie mich Ihnen erzählen, was passiert ist. Vielleicht nimmt mir das etwas von der Schuld, die ich jetzt spüre. Ich ahne, dass es nicht die letzten Leben waren, die ich nehmen werde, solange ich noch atme. Es könnte noch ein weiteres folgen oder Tausende, wer weiß das schon. Eines Tages werde ich vielleicht sogar einen Spitznamen wegen all der Gewalt bekommen. »Battle, der Schlächter« vielleicht. Oder »Malicious Marcus«. Ich kann nur hoffen, dass ich mir, falls es so weit kommen sollte, den Ruf als kaltblütiger Killer durch Selbstverteidigung oder den Schutz der Schwachen erarbeitet habe.
Nur der liebe Gott weiß, was mich noch erwartet. Aber trotz allem, was ich bisher über Töten und Begraben geschrieben habe: Jedes Leben hat seinen Wert. Jedes Mal, wenn ich jemanden töte, belastet es mich. Das war im Krieg so, und heute erst recht.
Genug geschrieben. Die Geschichte, wen ich getötet habe und warum, erzähle ich im nächsten Eintrag. Jetzt habe ich Hunger und will einen Film sehen. Ein Tom-Hanks-Streifen ist als Nächstes dran.
TAGEBUCHEINTRAG 106
16. Mai 2033
229 Tage nach dem Ausbruch
Östlich von Rising Star, Texas
Siebeneinhalb Monate, nachdem meine Familie gestorben war, bekam ich endlich Besuch. Ich saß im Wohnzimmer, schaute auf meinen Laptop, die Füße auf dem Couchtisch. Das ist übrigens etwas, was Sylvia niemals erlaubt hätte. Ich wundere mich, dass sie mich nicht aus dem Jenseits dafür gescholten hat.
Auf dem Bildschirm war Nicolas Cage auf dem Höhepunkt seines Cagetums zu sehen, in der Rolle von H. I. McDunnough in Arizona Junior. Er sprach die letzte Szene, die ich längst auswendig kenne:
»In jener Nacht hatte ich einen Traum. Ich träumte, ich sei so leicht wie Äther, ein schwebender Geist, der künftige Dinge besucht.«
Er gehört zu meinen Lieblingsfilmen, und wahrscheinlich werde ich irgendwann später einmal erklären, warum. Ich habe eine Hassliebe zu ihm – und das aus gutem Grund. Aber das ist wiederum eine Geschichte für ein andermal.
Wie dem auch sei: Ich war fast mit dem Film durch, den ich über eine drahtlose Festplatte aus der Küche streamte. Der Abspann lief, und ich stand auf, um mich zu strecken. Auf meiner Liste standen noch Arbeiten, also klappte ich den Rechner zu und schlurfte zur Haustür.
Draußen war es warm – diese Art von Hitze, die man nur an zwei Orten findet: in Texas und in der Hölle. Die Fliegengittertür flog auf, und eine Frau stand auf der Schwelle. Der Anblick traf mich wie ein Schlag, ich sprang zurück und zog die Tür zu.
Meine Sig steckte am Gürtel, verborgen unter meinem Kinky-for-Governor-T-Shirt. Ich gehe niemals unbewaffnet vor die Tür. Alte Gewohnheiten sterben schwer – genau wie Eindringlinge.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Das Haar der Frau war mausbraun und wirr, als hätte sie in eine Steckdose gefasst. Das schmutzverschmierte Gesicht und die gelben Zähne passten zu den Falten, die ihre Stirn durchzogen. Sie war verzweifelt.
»Ja, ich brauche Hilfe.«
»Welche Art von Hilfe?«
Ich stellte die Frage, ohne sie direkt anzusehen, und musterte stattdessen das Grundstück. Niemand anderes war zu sehen. Selbst der Boden verriet keine verdächtige Anzahl von Stiefelabdrücken, die auf einen Begleiter hätten hindeuten können.
»Ich habe seit einer Woche nichts gegessen und seit zwei Tagen nichts getrunken.«
Ihre Kleidung war zerschlissen und fleckig. Die Schuhe an ihren Füßen passten nicht, die Zehen waren herausgeschnitten, damit ihre größeren Füße hineinpassten. Sie beugte sich vor und warf einen Blick über meine Schulter ins Haus.
»Darf ich reinkommen und etwas Wasser trinken? Sie scheinen ja zurechtzukommen.«
»Ich kann Sie nicht reinlassen.«
»Bitte, Mister? Nur für eine Sekunde? Für einen Schluck Wasser?«
In diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich seit Monaten keine Menschenseele gesehen hatte. Diese Frau brauchte Hilfe, keine Frage, und ich konnte ihr etwas Wasser geben. Vielleicht auch etwas zu essen, wenn sie es mitnahm. Trotz meines Zynismus wollte ein Teil von mir glauben, dass Menschen von Natur aus gut sind. Wie viel Ärger konnte diese Frau schon machen? Sie hob die Hände an ihr Kinn und legte sie wie im Gebet zusammen, flehte um Mitleid.
Ich nahm die Hand von der Hüfte und wollte gerade etwas sagen, als mir etwas auffiel, das meine Meinung änderte.
Ihre Handgelenke waren aufgescheuert, die Haut gerötet. Es sah nach Striemen von Seilen aus. Wenn sie eine Gefangene gewesen und entkommen war, hätte dies Teil ihrer Geschichte sein müssen, vielleicht sogar der Aufhänger. Doch sie erwähnte nichts über eine Gefangenschaft. Das bedeutete: Sie war immer noch eine Gefangene.
Der Instinkt übernahm, Adrenalin schoss durch meinen Körper. Ich zog die Waffe, machte einen aggressiven Schritt auf sie zu, stellte die Füße schulterbreit auseinander und beugte die Schultern nach vorn.
»Wo sind sie?«
Mein Ton überraschte mich ebenso sehr wie sie. Ich knurrte mehr, als dass ich sprach. Es war eine Stimme, die ich sehr lange nicht mehr gebraucht hatte, ein warnendes Knurren wie das Rasseln einer Klapperschlange oder das Knurren eines Malinois. Es war eine Warnung – genau wie die Sig, die ich auf ihre schmutzige Stirn gerichtet hatte.
Ihre Augen flackerten, sie wich zurück, die Hände erhoben. »Wer?«
Ich wollte meine Forderung gerade wiederholen, als mich etwas Schweres von oben traf. Die Waffe flog mir aus der Hand, ich ging zu Boden. Jemand drosch von hinten auf meinen Kopf ein. Meine Sicht verschwamm, Sterne funkelten.
Bei jedem Schlag stieß der Angreifer ein kehliges Geräusch aus, und die Schläge machten, dass mir schwindelig wurde. Zuerst dachte ich in der Verwirrung, die Frau hätte mich irgendwie überwältigt, aber dann bekam ich meine Sinne wieder halbwegs zusammen. Es war offensichtlich, dass das nicht der Fall war.
Irgendwie schaffte ich es, bei Bewusstsein zu bleiben, und rammte meinen Ellbogen nach hinten. Ich traf etwas Hartes, hörte ein Knacken, und der Angreifer schrie auf. Benommen drehte ich mich herum. Ein Mann hielt sich das Auge, Blut quoll unter seiner Hand hervor.
Ich taumelte, mein Schädel hämmerte. Trotzdem schaffte ich es, ihm ins Gesicht zu treten. Sein Kopf schnellte zurück, sein Auge rollte nach hinten, dann sackte er bewusstlos zusammen. Da bemerkte ich, dass ihm ein Augapfel fehlte – und die Frau schrie plötzlich wie eine Furie, rief nach Hilfe. Nur konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, nach wem.
Ich tastete nach meinem Hinterkopf und spürte zwei große Beulen. Das war immerhin ein gutes Zeichen – schlimmer ist es, wenn nach einem Schlag keine Schwellung auftritt.
Mein Ziel war klar: die Sig finden. Doch meine Sicht war immer noch verschwommen. Mit pochendem Schädel machte ich ein paar Schritte – und sah den Dritten. Ein Mann, vielleicht drei Meter entfernt, mit einem Gewehr am Hüftgurt. Meine Waffe lag zwischen uns, und die neue Bedrohung deutete mit ihrem Gewehr darauf.
»Heb die Waffe auf, Frau«, befahl er.
Ich fixierte das flirrende Gewehr, hob langsam die Hände über den Kopf. »Was wollen Sie?«
Ich erkannte meine Stimme kaum wieder, doch dieses Mal lag es an den vernuschelten Worten: Ich lallte aufgrund des Schädeltraumas. Ich wollte mich hinlegen, die Augen schließen, den Schmerz wegschlafen.
»Alles, was du hast. Hast du ein Problem damit, alter Mann?«
Ich ließ die Hände sinken. Sie waren zu schwer, um sie oben zu halten. In meinem Kopf wollte ich dem Mistkerl etwas entgegenschleudern wie: »Wen nennst du hier alt?«, garniert mit einer ordentlichen Ladung Flüche, die ich mir in der Grundausbildung angewöhnt hatte.
Meine Ohren dröhnten, und ich konnte meinen Blick nicht fokussieren. Vielleicht stand da mehr als nur ein Mann vor mir. Also sah ich stattdessen zu dem Einäugigen hinab. Er lag immer noch bewusstlos am Boden.
Der verschwommene Schütze knurrte: »Irgendwelche letzten Worte?«
Das war mein Stichwort. Ich warf mich hinter den Körper des Einäugigen, kurz bevor ein Schuss krachte. Nur einer, was seltsam war für ein Gewehr, das ich für halbautomatisch hielt.
Das verschaffte mir die Chance, zu dem Mann aufzusehen. Er kämpfte mit seiner Waffe, als sei sie verklemmt. Gott stand in diesem Augenblick auf meiner Seite, und ich nutzte seine Kraft, warf mich auf den Schützen, traf ihn seitlich und riss ihn um, während sich seine Waffe dabei ein zweites und dann ein drittes Mal löste.
Die Frau kreischte. Meine Sig krachte. Warmes Blut rann mir über den Hals. Ich sage Ihnen, ich war mir sicher, dass es mit mir vorbei war. Ich rollte mich ab, griff an meinen Hals, tastete nach einer Wunde – fand aber keine.
Aber als ich meinen Blick wieder fokussierte, lag der Gewehrmann vor mir, auf der Seite. Seine Augen waren aufgerissen, das Leben jedoch war aus ihnen gewichen. Blut quoll aus seinem Mund. Es war sein Blut an meinem Hals.
Ich versuchte aufzustehen, weil mir klar war, dass die Frau wahrscheinlich im Besitz meiner Sig war, doch meine Beine versagten. Ich fiel auf den Rücken und starrte in den wirbelnden Himmel. Benommenheit erfasste mich wie ein Vollrausch, und das Schwindelgefühl drohte, mir den Magen umzudrehen.
Jeden Moment, dachte ich, würde die Frau mit dem mausbraunen Haar und den gelben Zähnen über mich treten und mich mit meiner eigenen Waffe ausknipsen. Trotz des Dröhnens in meinen Ohren versuchte ich herauszufinden, wo sie war. Vielleicht war sie im Haus und bediente sich. Und wenn sie satt war und ihren Durst gestillt hatte, würde sie zurückkommen, um mich zu erledigen.
Ich muss ehrlich sein … während ich mir das ausmalte, dachte ich: Hätte sie mich getötet, wäre das für mich in Ordnung gewesen. Ich war bereit.
»Ich komme nach Hause«, flüsterte ich zu Sylvia. »Bald bin ich bei dir.«
»Ich warte auf dich«, antwortete sie.
»Heb mir etwas Rinderbrust auf«, murmelte ich und lachte über meinen eigenen Witz.
Ich sprach fast zwei Stunden mit ihr. Sie erzählte mir vom Paradies und was mich dort erwarten würde, und es klang herrlich. Als unser Gespräch endete, stand die Sonne schon tief am Himmel. Das Dröhnen in meinen Ohren war verstummt, die Schmerzen im Kopf etwas abgeklungen. Die Welt war für einen Moment still, ein Windhauch strich über mich, und dann sprach Sylvia wieder zu mir.
»Du darfst das nicht tun«, sagte sie. »Du darfst nicht aufgeben.«
Das wollte ich nicht hören. Aber es war ihr egal, was ich wollte.
»Wir werden auf dich warten. Wir werden hier sein. Wenn du zu uns kommst, dann für alle Ewigkeit. Aber du darfst jetzt noch nicht aufgeben. Das bist nicht du, Marcus. Du bist ein Kämpfer. Mein Kämpfer.«
Man sagt ja, dass Frauen ständig ihre Meinung ändern würden. Aber gilt das auch, wenn die Frauenstimme eigentlich nur meine eigene Stimme in meinem Kopf ist? Wieder ein Beweis, dass ich verrückt bin. Nicht klinisch, aber trotzdem …
Und dann fand ich die Kraft, aufzustehen. Ich blinzelte, konnte wieder deutlich sehen und erkannte, warum die Frau nicht zurückgekommen war. Sie war tot, genau wie der Schütze, mit zwei Einschusslöchern in der Brust.
Soweit ich es rekonstruieren konnte, hatte der erste Schuss, der für mich bestimmt war, den Einäugigen getroffen. Der zweite hatte sich wegen der Ladehemmung nicht gelöst. Als ich den Schützen ansprang, funktionierte das Gewehr wieder, und es gelang ihm, zwei Schüsse abzufeuern. Beide trafen die Frau, die offenbar ebenfalls unwillkürlich abgedrückt hatte und ihrerseits den Schützen getötet hatte. Ich weiß nicht, ob es pures Glück war, Schicksal, Fügung oder göttliche Intervention. Vielleicht alles zusammen. Wie auch immer – ich sank auf die Knie, dankte dem Herrn und schleppte mich mit letzter Kraft ins Haus, wo ich auf das Sofa fiel.
Mein Schädel hämmerte, und ich hätte meinen letzten Dollar für einen Donut gewettet, dass ich eine Gehirnerschütterung davongetragen hatte.
Drei Tage dauerte es, bis ich wieder so weit war, das Haus verlassen und ein Grab für die Eindringlinge schaufeln zu können. Das Klingeln in meinen Ohren war verschwunden, die Kopfschmerzen abgeklungen. Doch der Anblick der Leichen im Hof machte mich erneut fast krank. Ich erspare Ihnen die Details und sage nur: Hitze und Maden.
Mit N-95-Maske, Stiefeln und Handschuhen schleifte ich die verrottenden Körper einen nach dem anderen zum nördlichen Ende des Grundstücks. Dort warf ich sie in das Loch. Es war ein Knochenjob und dauerte viele Stunden länger als von mir gedacht, als ich an diesem Morgen aufwachte, und ich verfluchte jeden einzelnen dieser armen Teufel, während ich sie durch Staub und Unterholz zog. Doch als ich sie schließlich begraben hatte, wurde mein Herz weicher. Diese Menschen waren die Kinder von irgendwem. Vielleicht hatten sie selbst Kinder, Geschwister, Partner, Menschen, die sie liebten. Vielleicht waren sie nicht böse. Vielleicht hatten Umstände und Verzweiflung sie zu etwas getrieben, das sie in einem anderen Leben niemals getan hätten.
Ich zog die Maske herunter und betete für sie. Der erste Gedanke, der mir kam, war Psalm 103. Ich war nie ein Kirchgänger gewesen, aber der Krieg hatte mich verändert. Er hatte mich dazu gebracht, Vergebung zu suchen – in mir selbst wie bei anderen – und meinen Glauben zu prüfen. Auswendig gelernte Verse zu rezitieren ist zwar nicht dasselbe wie Glauben, aber es erinnert daran, wie wir Menschen sein können und wie wir die Welt behandeln sollten.
»Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er gedenkt daran, dass wir Staub sind.«
Als ich zurück zum Haus kehrte, die Handschuhe in einer Hand, die Maske in der anderen, murmelte ich den Psalm immer wieder – und kam zu einer wichtigen Erkenntnis. So wie die Menschheit Gott fürchten und ihn lobpreisen sollte, so sollte jeder, der mein Grundstück, meine Welt betrat, auch mich fürchten. Ich bin weit entfernt vom Göttlichen, und ich vergebe nicht so leicht. So sehr ich auch ein besserer Mensch sein will, die Wahrheit ist: Ich kenne mich selbst. Und ich würde einen Menschen eher zu Staub werden lassen, bevor er die Chance bekommt, dasselbe mit mir zu tun.
Der Schütze, der Einäugige und die Frau, die hier begraben liegen, haben mir das beigebracht. Vertraue niemandem. Schieße zuerst. Stell’ keine Fragen.
TAGEBUCHEINTRAG 128
20. Juni 2034
629 Tage nach dem Ausbruch
Östlich von Rising Star, Texas
Ich wache morgens nicht mit der Erwartung auf, Gewalt zu erleben. Aber an manchen Tagen scheint sie mich einfach zu finden. Es ist wirklich schade, dass sich meine einzige menschliche Interaktion zumeist auf Leute beschränkt, die mir schaden wollen, aber ich bin meine eigene, gut geführte Miliz, und mir etwas anzutun ist nicht so leicht, wie man vielleicht denkt. Glaube schließt Selbstverteidigung nicht aus, selbst wenn diese Selbstverteidigung proaktiver Natur ist. Zumindest rede ich mir das immer wieder ein, um mich von der Last meiner Taten zu befreien. Sie können mich dafür verurteilen, aber Sie waren nicht hier. Sie wissen nicht, wie schwer es ist, solche Entscheidungen zu treffen, wenn es um Leben und Tod geht. Vielleicht wissen Sie es aber doch, weshalb Sie noch am Leben sind und dies gerade lesen können. Aber ich schätze, dass Sie diese Aufzeichnungen lange nach meinem Tod gefunden haben, denn es ist ausgeschlossen, dass sie an mir vorbeigekommen wären.
Vor dem Ausbruch war ich kein großer Jäger. Womit ich nicht sagen will, dass ich nicht gejagt hätte. Hin und wieder lud mich ein alter Armeekamerad auf eine Ranch bei Kingsville ein, wo wir ein paar Tage damit verbrachten, zu trinken, in Erinnerungen zu schwelgen und etliche Gelegenheiten zu verpassen, ein hundert Pfund schweres Weißwedelhirsch-Männchen oder ein vierzig Pfund schweres Nabelschwein zu erlegen. Es war nie der Sport, der mich reizte, sondern vielmehr die Erinnerungen, die man zusammen mit Männern schuf, die die Probleme, Traumata und Siege des anderen verstanden – das war es, was diese Ausflüge lohnenswert machte.
Seit der Pandemie jedoch habe ich mich immer wieder über die Grenzen meines Grundstücks hinausgewagt, um nach zusätzlichen Nahrungsquellen zu suchen. Ich habe reichlich haltbare Vorräte in Langzeitlagerung und Lebensmittel, die sich jahrelang halten. Meine Gefriertruhen sind voller Eiweiß, aber ich denke mir immer, dass es nicht schaden kann, wenn ich die Vorräte hier und da etwas strecke.
Es war früher Morgen, noch vor Sonnenaufgang, genau zu jener kältesten Stunde des Morgens, in der ich meinen Atem sehen konnte und die kühle Luft belebend wirkte. Obwohl ich jemand bin, der den Sonnenuntergang als Zeichen dafür zu schätzen gelernt hat, dass ich es irgendwie durch einen weiteren Tag geschafft habe, hat das Beobachten eines Sonnenaufgangs schon etwas Magisches. Ob mich das zu einem Menschen macht, für den das Glas immer halb leer ist, kann ich nicht sagen, aber ich bezweifle, dass mich jemals jemand als glühenden Optimisten bezeichnen würde.
Wie auch immer, ich saß auf der Astgabel einer Lebenseiche und wartete still auf Bewegungen im Unterholz. Als sich endlich etwas regte, lange nachdem die Kälte der ersten Hitze gewichen war, waren es nicht die Art von Tieren, die ich hätte essen wollen. Stattdessen waren es drei Männer. Ich kannte keinen von ihnen, und alle waren bewaffnet.
An der Art, wie sie sich fortbewegten, war zu erkennen, dass sie keine Profis waren, aber sie waren eindeutig verzweifelt. Verzweiflung kann einen Menschen rücksichtslos machen, und Rücksichtslosigkeit macht ihn gefährlich.
Es gibt da dieses Sprichwort, dass die Zivilisation nur neun Mahlzeiten vom Chaos entfernt sei. Wir sind längst weit über neun Mahlzeiten hinaus, und selbst gute Menschen tun böse Dinge, um zu überleben.