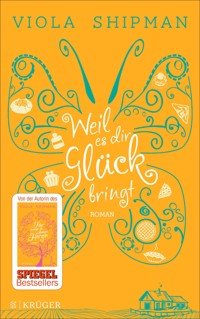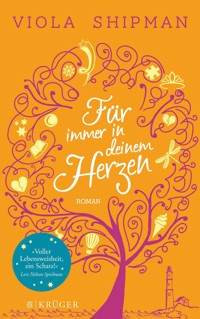9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die Chemieingenieurin Abby Peterson für eine neue Stelle nach Grand Haven an den Michigansee zieht, hofft sie, dass ihre kleine Familie hier ihr Glück findet. Nebenan wohnt ihre Vermieterin, die sie persönlich noch nicht kennengelernt haben. Iris Maynard lebt seit Jahrzehnten abgeschottet hinter einem turmhohen Zaun, der ihr Haus und ihr Grundstück umgibt. Nachdem sie ihren Mann im Krieg verlor, hat sie sich von der Welt zurückgezogen und lebt nur noch für ihre Pflanzen – und die Erinnerungen an ihre eigene Familie. Der Duft der Taglilien und Rosen, die Iris selbst züchtet, zieht Abby und ihre kleine Tochter magisch an. Vereint durch ihre Liebe zu Gärten, vertrauen sich Iris und Abby allmählich ihre Probleme an und lernen, dass Hoffnungen und Träume ebenso blühen können wie Blumen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Viola Shipman
Im Garten deiner Sehnsucht
Roman
Roman
Über dieses Buch
Als die Chemieingenieurin Abby Peterson für eine neue Stelle nach Grand Haven an den Michigansee zieht, hofft sie, dass ihre kleine Familie hier ihr Glück findet. Nebenan wohnt ihre Vermieterin, die sie persönlich noch nicht kennengelernt haben. Iris Maynard lebt seit Jahrzehnten abgeschottet hinter einem turmhohen Zaun, der ihr Haus und ihr Grundstück umgibt. Nachdem sie ihren Mann im Krieg verlor, hat sie sich von der Welt zurückgezogen und lebt nur noch für ihre Pflanzen – und die Erinnerungen an ihre eigene Familie. Der Duft der Taglilien und Rosen, die Iris selbst züchtet, zieht Abby und ihre kleine Tochter magisch an.
Vereint durch ihre Liebe zu Gärten, vertrauen sich Iris und Abby allmählich ihre Probleme an und lernen, dass Hoffnungen und Träume ebenso blühen können wie Blumen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Viola Shipman schreibt im Sommer in einem Ferienort, inspiriert von der grandiosen Kulisse des Michigansees. Ihre Romane »Für immer in deinem Herzen«, »So groß wie deine Träume«, »Weil es dir Glück bringt« und »Ein Cottage für deinen Sommer« waren sofort Bestseller.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »The Heirloom Garden« bei Graydon House Books, Toronto.
Copyright © 2020 by Viola Shipman
Für die deutschsprachige Ausgabe
© 2020 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Redaktion: Susanne Kiesow
Covergestaltung und -abbildung: www.buerosued.de
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491240-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
»Hätt’ ich eine Blume für jeden Gedanken an dich,
Dann könnt’ ich ewig durch meinen Garten wandeln.«
Alfred Lord Tennyson
PrologDie Rose
»Und mag die Vase auch zerschellen in tausend Stück,
Der Duft der Rosen bleibt dennoch zurück.«
Thomas Moore
Abby
Mai 2003
»Das ist das Haus, von dem ich Ihnen erzählt habe.«
Ich verrenke mir den Hals, um aus dem offenen Autofenster zu schauen, und ein Lächeln legt sich auf mein Gesicht, als ich ein weitläufiges Cottage mit breiter Veranda erblicke. Ein warmer Sommerwind bewegt die Hollywoodschaukel und lässt die amerikanische Flagge an einer Ecksäule flattern.
Unsere Maklerin Pam parkt ihren Audi in der engen Straße, die kaum breit genug für ein Auto ist und ganz oben auf einem sehr steilen Hügel liegt. Die Straße – und die ganze Nachbarschaft – erinnert mich an das eine Mal, als ich San Francisco besucht habe, nur in Miniaturgröße. Pam eilt herum, um uns die Türen zu öffnen.
»Hat Daddy die Flagge dort aufgehängt?«
»Ja«, schwindelt Pam meine Tochter Lily an. »Er ist ein Kriegsheld!«
Ein heftiger Stich schneidet mir das Herz entzwei.
Pam und ich sind ungefähr im selben Alter, Anfang dreißig, aber Pam ist irgendwie immer noch voller ungezügelter Begeisterung. Ich bin nur voll von dumpfem Schmerz und stiller Wut wegen eines verwirrenden Krieges, der mir den Mann genommen hat, den ich einmal kannte.
Pam salutiert Lily, die diese patriotische Geste imitiert. Dann dreht sich Pam zu mir um und salutiert mir.
»Nicht«, sage ich.
»Tut mir sehr leid, Mrs. Peterson.« Rasch nimmt sie den Arm wieder runter. Ihr blonder Bob bebt in der Brise, genau wie ihre mit pinkfarbenem Lipgloss überzogenen Lippen.
»Abby«, sage ich.
»Ich verstehe, Mrs. … Abby. Schon okay. Sie müssen sicher unglaublich angespannt sein wegen Ihres Mannes.«
Ich zwinge mich zu einem Lächeln. »Ja«, antworte ich. »Ich wollte nicht schroff sein.«
Sie dreht sich zum Haus um, und ihr Überschwang kehrt zurück, als sie wieder in den Maklermodus verfällt. »Das hier ist ein Sears-Haus«, verkündet sie, während meine Tochter zur Veranda sprintet und auf die Hollywoodschaukel hüpft.
»Ein was?«
»Ein Sears-Haus«, erklärt sie. »Die sind inzwischen historisch. Sears-Häuser waren Kataloghäuser, die meist per Eisenbahn in Güterwaggons ausgeliefert wurden, und jeder Bausatz enthielt eine fünfundsiebzig Seiten dicke Bauanleitung und tausend markierte Einzelteile. Man kann im ganzen Haus immer noch nummerierte Balken finden. Es gab sie in vielen verschiedenen Varianten, vom Cottage bis zur Kolonialstilvilla. Dieses Haus und das nebenan sind beides Sears-Häuser«, sagt sie, bevor sie nervös zu stammeln beginnt. »Aber … ähm … die beiden Häuser sind sich überhaupt nicht ähnlich.«
Auf Pams Gesicht zeigt sich absolute Panik, was mich dazu veranlasst, mich umzudrehen und zum ersten Mal das Nachbarhaus anzusehen.
»Das ist noch untertrieben«, erwidere ich. »Es sieht aus wie ein Gefängnis.«
Ein beeindruckender Holzzaun, der – ohne Übertreibung – mindestens drei Meter hoch ist, umgibt das Grundstück. Am ersten Stock des Hauses, das ungeachtet dessen, was Pam gerade gesagt hat, mit diesem hier baugleich zu sein scheint, blättert die Farbe ab. Moos wächst auf den Dachschindeln in einem schattigen Bereich unter einem hohen Baum, dessen junge Blätter rot gefärbt sind.
»Was hat es damit auf sich?«, frage ich.
Pams Gesicht wird so rot wie der Baum. Sie holt tief Luft.
»Dort nebenan wohnt eine sehr alte Dame«, antwortet sie. »In der Stadt sagt man, dass sie im Zweiten Weltkrieg ihren Mann verloren hat, und dann ist auch noch ihre kleine Tochter gestorben.« Pam wirft einen Blick auf das Haus und flüstert dann: »Sie ist verrückt geworden und lebt seit Jahren allein.« Sie verstummt kurz, dann spricht sie mit normalem Tonfall weiter und nickt dabei in Richtung des zu vermietenden Hauses. »Dieses Haus gehört ihr auch. War wohl früher das ihrer Mutter … oder ihrer Großmutter … Das weiß keiner mehr so genau. Ich habe gehört, dass sie es aus finanziellen Gründen vermieten muss.«
»Warum sollte sie in ihrem Alter noch mehr Geld brauchen?«, frage ich. »Die beiden Häuser dürften doch inzwischen abbezahlt sein. Ist sie krank?«
Wieder flüstert Pam: »Ich denke nicht. Wer weiß? Es gibt viele Gerüchte über sie und dieses Haus. Es heißt, sie hat einen regelrechten Garten Eden hinter diesem Zaun erschaffen. Sie züchtet Blumen oder so was in der Art. Sie ist eine Pflanzenwissenschaftlerin. Früher hat man sie in der Stadt die First Lady of Flowers genannt. Jedenfalls, ich habe gehört, dass sie ihr ganzes Geld ausgibt, um verschiedenste Blumensorten zu kaufen. Musterexemplare. Tatsächlich hatte dieses Haus hier rückwärtig auch einen schönen Garten. Die beiden Gärten waren einmal miteinander verbunden. Der hier ist ein bisschen verwildert, doch ich denke, mit ein wenig Liebe könnte man ihn wieder zum Leben erwecken. Aber richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht darauf«, sagt Pam. »Richten Sie sie auf das hier.«
Pam macht eine ausladende Geste mit ihren perfekt manikürten Händen wie eine Glücksfee bei Der Preis ist heiß, und ein Aufblitzen von Blau sticht mir ins Auge. Zum ersten Mal wird mir bewusst, dass wir uns nicht auf einem Hügel befinden, sondern auf einer Düne mit Blick auf den Michigansee.
»Vom Vorgarten aus sieht man nur ein kleines Stück, aber das Haus überblickt den ganzen See«, sagt sie. »Von Ihrer Terrasse aus können Sie sogar den Pier sehen, wenn Sie sich auf die Zehenspitzen stellen. Dieses Cottage gehört zu Highland Park, einer Gemeinschaft von auf diesen Dünen erbauten Cottages, die bis ins späte 19. Jahrhundert zurückdatiert. Ist es nicht malerisch?«
»Da haben Sie sich das Beste aber bis zum Schluss aufgehoben, Pam«, sage ich. »Doch ich bin sicher, wir können uns nichts am Wasser leisten. Wie hoch ist die Monatsmiete?«
Sie wendet sich mir zu und versucht, nicht nach nebenan zu sehen, aber ihre Augen verraten sie. »Ich bin sicher, wir können einen Deal aushandeln, wenn Sie interessiert sind.«
Ich drehe mich um und starre den beeindruckenden Zaun an. Warum möchte sie, dass jemand nebenan wohnt, wenn sie sich so anstrengt, alle fernzuhalten?
Pam lehnt sich zu mir. »Ich kann Ihre Gedanken lesen. Wollen Sie wissen, was ich denke? Ich denke, sie ist einfach nur einsam. Möchte in ihren letzten Jahren jemanden nebenan haben. Dieses Viertel ist voller Familien. Die Häuser werden einfach von einer Generation an die nächste weitergegeben. Nach ihr ist jedoch niemand mehr da.« Pam winkt mich näher zu sich, und ich lehne mich ihr noch weiter entgegen. »Sie trifft die endgültige Entscheidung, wer dieses Haus mietet«, flüstert Pam noch leiser.
»Dann sind Sie ihr schon begegnet?«, frage ich. »Wie ist sie so?«
»Nicht direkt«, erwidert Pam. »Wir kommunizieren nur per E-Mail.« Sie verstummt kurz. »Manchmal hinterlässt sie lediglich eine Nachricht am Tor ihres Zauns. In Schreibschrift auf hellblauem Papier, wie früher in der guten alten Zeit.« Wieder macht Pam eine kurze Pause. »Sie hat schon ein halbes Dutzend anderer Interessenten abgelehnt. Dann schreibt sie einfach nur ›Nein!‹ auf ein Stück Papier, nachdem ich den Leuten die Immobilie gezeigt habe. Ich weiß nicht, wie sie das beurteilt, da sie ihr Grundstück nie verlässt. Ich persönlich glaube, sie wartet auf eine junge Familie. Ich glaube, die Sache ist für sie ziemlich schwarz-weiß. Top oder Flop.«
Ihre Worte klingen mir in den Ohren nach.
Ich fand schon immer, dass es ein Segen sein muss, das Leben in Schwarz-weiß zu sehen. Es muss leichter sein, wenn die Dinge eindeutig sind. Wenn man Emotionen außer Acht lässt, sind Entscheidungen klar. Ich dagegen? Ich sehe schon immer tausend Schattierungen von Grau. Und das ergibt eine schwierigere Existenz.
»Was führt Sie übrigens nach Grand Haven?«, erkundigt sich Pam. »Sind Sie hier aufgewachsen? Haben Sie Verwandte in der Gegend? Wollen Sie mit Ihrer Familie einen Sommer am Wasser verbringen?« Sie hält kurz inne und sieht mich mit Besorgnis an, bevor sie ihre Stimme senkt. »Ich könnte es natürlich verstehen, falls das der Fall wäre.«
»Nein, nein, nein«, stammle ich. »Ich bin in Detroit aufgewachsen.«
Wie soll ich es erklären, denke ich. Warum muss ich es erklären? Ich bin zu müde, um es noch zu erklären.
Ein Summen wächst in meinen Ohren, als hätten sich Zikaden in meinem Kopf eingenistet. Die Welt kippt wie eine alte Batman-Folge, und all ihre Farben – die amerikanische Flagge, das braune Cottage, der blaue Himmel, der rote Baum, Pams pinkfarbener Lipgloss – werden schwarzweiß.
»Ich habe ein Jobangebot bekommen«, fahre ich fort.
»Aber«, setzt Pam an, »Ihr Mann …«
»Oh«, stammle ich erneut. »Er … äh … er ist aus dem Krieg zurück.«
»Was für ein Segen!«, ruft Pam. »Das war mir nicht bewusst. Ich dachte, er wäre …«
Sie bricht ab.
Tot?, will ich fragen. Das ist er. Nur nicht im wörtlichen Sinn.
»Meine Güte«, sagt Pam in zu fröhlichem Tonfall. »Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?«
Was gesagt?, will ich fragen. Dass mein Mann mir als leere Hülle seines früheren Selbst zurückgebracht wurde? Dass unser Leben auf den Kopf gestellt wurde wegen eines Krieges, an den ich nie geglaubt habe? Dass ich mir ständig Sorgen um meinen Mann mache, weil ich die Hälfte der Zeit über keine Ahnung habe, wo er ist oder was er macht, wenn er nicht trinkt oder depressiv ist? Dass ich ein schrecklicher Mensch bin, weil ich all das denke?
Tausend Schattierungen von Grau.
»Ja, es ist ein Segen«, antworte ich. »Es fällt nur schwer, darüber zu reden.«
»Das verstehe ich«, erwidert Pam. Mitfühlend legt sie eine Hand auf meinen Arm. »Sie tun, was Sie können für Ihre Familie.«
»Ja«, antworte ich und ringe mir ein Lächeln ab.
»Sind Sie Lehrerin?«, fragt sie. »Oder Sekretärin?«
Ich beiße mir auf die Innenseite meiner Wange. »Ich bin Chemieingenieurin«, antworte ich.
»Oh!«
»Ich arbeite für einen Hersteller von Boots- und Yachtanstrichen hier«, fahre ich fort. »Ich entwickle einen neuen Schiffslack – in vielen Farben –, um Rost und Muschelbewuchs an Schiffen und Stegen zu verhindern.«
»Das ist ja erstaunlich«, sagt Pam. Ich weiß nicht, ob sie sich auf den Job bezieht oder auf die Tatsache, dass ich Chemieingenieurin bin. Sie mustert mich aufmerksam, als würde sie mich zum ersten Mal richtig sehen, und ich kann mein Spiegelbild in der glänzenden Glossschicht auf ihren Lippen erkennen: mein braunes, strähniges Haar, spärliches Make-up, dicke schwarze Brillenfassung. Ich muss an den Zaun der Nachbarin denken: Vielleicht versuche ich ja auch, die Welt auf Abstand zu halten. »Ich habe mir Ingenieure nie, na ja, kreativ vorgestellt.«
Ich nicke. »Die Leute sagen immer, Ingenieure wären nicht kreativ, aber das sind wir. Genau genommen ist meine Arbeit eine Art Kunst, wissenschaftliche Malerei, wenn man so will.« Ich hebe die Hände und zeige um mich herum. »Unsere Welt setzt sich aus einer wissenschaftlichen Farbmischung zusammen. Ich meine, schauen Sie sich nur die Luft an, die wir atmen. Sie besteht noch aus vielen anderen Dingen außer Sauerstoff, der nur ungefähr einundzwanzig Prozent der Luft ausmacht. Ungefähr achtundsiebzig Prozent der Luft, die wir atmen, bestehen aus Stickstoff. Da sind auch noch winzige Mengen anderer Gase wie Argon, Kohlendioxid und Methan.« Ich mache eine kurze Pause und zeige auf den See. »Und woraus besteht Wasser?«
Pam starrt mich an.
»Faszinierend«, sagt sie, während sie ihren Lipgloss nachlegt. »Nun, dann ist das hier ein perfekter Ort für Ihre Familie. Grand Haven ist ein Wasser- und Bootsparadies. Sie wissen, dass das hier die einzige Stadt in den Vereinigten Staaten ist, die offiziell die Bezeichnung Coast Guard City trägt, nicht wahr? Und wir veranstalten das jährliche Coast Guard Festival, um die Männer und Frauen der US-Küstenwache zu ehren und zu würdigen. Ihr Mann sollte sich hier wie zu Hause fühlen. Und Sie auch.« Sie lächelt. »Jetzt lassen Sie mich Ihnen das Haus zeigen, okay? Und natürlich die Aussicht!«
Bevor wir uns in Bewegung setzen können, rennt Lily die Stufen herab und hinüber zum Zaun, der den Vorgarten von dem nebenan trennt. Sie klettert auf einen großen Stein und springt hoch zu einem langen Haken, der aus dem Holzzaun hervorragt und aussieht, als habe er einst eine Hängepflanze getragen. Während sie versucht, am Zaun hochzuklettern wie ein Eichhörnchen, scharren ihre Turnschuhe über das Holz.
»Lily!«, schreie ich. »Du tust dir noch weh.«
Sie springt wieder runter. »Mom«, jammert sie.
»Sie ist ein kleiner Wildfang«, entschuldige ich mich bei Pam, die ihre Enttäuschung nicht verbergen kann.
Lily drückt ihre Nase an die schmalen Schlitze im Zaun. »Wow«, sagt sie. »Das musst du dir ansehen!«
Ich gehe zu Lily, lege mein rechtes Auge an eine winzige Öffnung und blinzle hindurch. Auf der anderen Seite des Zauns ist ein Garten, der einem meiner eigenen chemischen Experimente gleicht: Überall sind Dutzende von Stäben mit kleinen Fähnchen, die im Wind flattern. Es wimmelt von Taglilien, und an ihren Stängeln ist etwas Eigenartiges befestigt, das ich nicht ganz erkennen kann.
So früh in der Saison blüht zwar noch wenig, aber ich kann mir vorstellen, was noch kommen wird.
Ich verändere meine Haltung und versuche, weiter in den Garten hineinzusehen, aber die Öffnung ist zu klein und strengt mein Auge an. Das Einzige allerdings, was ich direkt vor mir erkennen kann, ist eine schöne Laube mit einem Rankgitter, das nicht nur so aussieht, als könnten dort Rosen wachsen, sondern auch, als könnte dort ein Weg zwischen diesen beiden Häusern gewesen sein.
Ich spüre den Zaun erzittern, und als ich hochblicke, sehe ich, dass Lily erneut versucht hinaufzuklettern.
»Lily!«, rufe ich noch mal.
Sie springt wieder zu Boden und rennt zur Veranda.
»Warum zeige ich Ihnen jetzt nicht das Haus?«, schlägt Pam erneut vor. »Sie müssen diese Aussicht sehen!«
»Natürlich«, antworte ich.
Ich drehe mich um und gehe den kurzen Weg aus Steinplatten zum Eingang. Bevor ich die Stufen hinaufsteige, sehe ich mich noch einmal zum Nachbarhaus um.
Im ersten Stock bewegt sich ein Vorhang, kaum wahrnehmbar. Ich mache einen Schritt, bleibe stehen und schaue noch mal hin. Das Fenster ist nicht offen, aber der Vorhang schwingt immer noch leicht.
Ich mache einen weiteren Schritt die Stufen hoch, drehe mich blitzschnell noch einmal um und kneife die Augen hinter meiner Brille zusammen.
Ein Schatten huscht vorbei und verschwindet.
Teil EinsFlieder
»Der Duft von feuchter Erde und Flieder hing in der Luft
wie ein Hauch der Vergangenheit und
eine Ahnung der Zukunft.«
Margaret Millar
Abby
Mai 2003
Schnipp, schnipp, schnipp …
Ich lege die Küchenkästen, Vorratsschränke und Schubladen mit Schrankpapier aus. Ich bin nicht gerade das, was man von Natur aus häuslich nennen würde, aber meine Mutter – eine Meisterin der Konzentration auf das Ungefährliche – hat mir eine Sauberkeits- und Ordnungsliebe eingebläut, die ans Zwanghafte grenzt.
Vielleicht bin ich deshalb Ingenieurin geworden.
Ich putze nicht gern – ich lasse lieber jemanden kommen, der die Fenster putzt, Sockelleisten abwischt und auf Tritthocker steigt, um Deckenventilatoren abzustauben –, aber ich mache, was ich als »Ordnung halten« bezeichne. Das Bett muss gemacht sein, Geschirr darf nicht in der Spüle herumstehen, Lilys Spielsachen müssen wieder in ihr Zimmer zurückgebracht werden.
Alles muss an seinem Platz sein.
Ich lege die Schere weg und sehe mich in der überraschend geräumigen Küche unseres neuen Heims um. Es wurde eindeutig irgendwann seit seiner Erbauung in den – was sagte Pam? – zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts renoviert, aber auch das scheint schon wieder eine ganze Weile her zu sein. Die Schränke sind knallgelb, und ich meine knallgelb. Pam hat es als ›sonnige Küche‹ angepriesen, aber es grenzt eher an geschmacklos. Die Schränke haben flache Fronten und antike Griffe, und die Arbeitsplatten sind aus glänzendem rosa Resopal. Dazu passend gibt es noch eine rosa Retro-Essecke neben einem großen Fenster und ein rosa Wählscheibentelefon in einer kleinen Nische mit einer Klappschublade. Die habe ich mir bereits als mein Homeoffice ausgesucht, wobei mein Mac in dieser Zeitkapsel von einer Küche ebenso fehl am Platz wirkt wie die neueren Küchengeräte.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Küche nun retro oder kitschig ist, aber ich liebe sie. Sie erinnert mich an meine Großeltern, und der Raum fühlt sich wie eine warme Umarmung an.
Im Keller habe ich Rollen mit Schrankpapier gefunden. Das Muster besteht aus Sternchen in Türkis und Limettengrün. Als ich das Papier zum ersten Mal abgerollt hatte, waren die Kanten von der Feuchtigkeit wellig gewesen, aber ich habe es flachgebügelt, ein weiterer Trick, den ich von meiner Mom gelernt habe.
Ich lege ein weiteres Regal aus, dann gehe ich zu einem offenen Karton auf der Arbeitsfläche und fange an, Gläser und Kaffeetassen auszuwickeln und das Zeitungspapier auf den Fußboden zu werfen.
Wir alle fangen neu an, denke ich, auf so viele Weisen.
Ich denke an unser Haus in Detroit mit seinem offenen Konzept und dem winzigen Garten. Es sollte unser Zuhause für immer sein, stattdessen war es zu einem Haus des Schreckens geworden. Wir haben das moderne Zuhause in der Stadt, auf dem wir noch eine Hypothek hatten, verkauft, um ein altes Haus in einem Erholungsort zu mieten, über den keiner von uns irgendetwas weiß.
Ich sehe mich in der farbenfrohen Küche um. Nicht gerade schwarz-weiß, Pam, denke ich.
»Nein! Nein! Nein!«
Mit einem Glas in der Hand renne ich ins Wohnzimmer, wo mein Mann Cory im Schlaf schreit.
»Liebling«, sage ich, während ich mich auf den Rand der Couch setze und die Stimme senke. »Alles ist gut. Alles ist gut. Du bist okay. Du bist okay.«
Jäh wacht Cory auf und schreckt hoch. Dabei stößt er mir das Glas aus der Hand, das durch die Luft fliegt und auf dem Holzboden zerspringt. Bei der plötzlichen Explosion hält Cory sich die Ohren zu und sinkt wieder auf die Couch.
»Schhh«, flüstere ich meinem einst unbesiegbaren neunzig Kilo schweren Mann zu, der unkontrolliert zittert.
»Wo bin ich?«
»Zu Hause«, antworte ich und streiche ihm das goldblonde Haar aus der Stirn. »In unserem neuen Zuhause. Grand Haven. Erinnerst du dich? Alles ist gut. Ich bin ja da.«
Er nickt mit glasigen Augen und greift nach dem Bier, das er auf dem Beistelltisch hat stehen lassen.
»Bist du sicher, dass du das brauchst?«, frage ich.
Mit schmalen Augen, die so eisblau wie das Logo auf der Bierflasche sind, starrt Cory mich finster an.
»Ja«, sagt er. »Ich bin sicher.«
Er leert die Flasche und reicht sie mir. »Bring mir noch eins«, sagt er.
Ich nehme die Fernbedienung und will den Fernseher ausschalten, auf dem immer ein Nachrichtensender läuft, CNN, Fox, MSNBC, ganz egal. Cory ist besessen davon, sich Berichte über den Krieg anzusehen. Es macht ihn fassungslos, nach seiner Heimkehr feststellen zu müssen, dass so viele Leute in dem Land, das er verteidigt hat, den Krieg nicht unterstützen, aber auch, zunehmend Berichte zu sehen, dass es den Auslöser dazu – die Existenz von Massenvernichtungswaffen – niemals gegeben hatte.
»Nicht«, sagt er.
»Liebling, das macht dich nur noch nervöser. Warum siehst du dir nicht was Leichteres an?«
Cory schüttelt den Kopf. Du bist auch eine Verräterin, scheinen seine Augen zu sagen.
»Ich hol dir noch ein Bier«, sage ich, um ihn zu besänftigen.
Ich mache mich auf den Weg in die Küche, doch dann bleibe ich wie angewurzelt im Esszimmer stehen. Obwohl wir gerade erst eingezogen sind, bedeckt Corys militärischer Papierkram – für Versicherungen, Leistungen, Beratung – unseren kompletten Esstisch. Da ist Papierkram in Kartons, Papierkram in Ordnern, Papierkram in Mappen und Heftern, Papierkram in schwankenden Stapeln.
Unordnung, die niemals weggeht.
Ich gehe in die Küche und bleibe in der Tür stehen. Mit angehaltenem Atem sehe ich zu, wie Corys Kopf langsam wieder absinkt – einmal, zweimal –, bis ich weiß, dass er schläft. Dann presse ich meine Stirn an den Türrahmen, als könne ich so all die gärenden Gefühle wieder in meinen Kopf zurückdrängen. Auf Zehenspitzen schleiche ich zurück ins Wohnzimmer – wobei der alte Holzfußboden, bei dem ich erst noch herausfinden muss, welche Dielen knarren, sich größte Mühe gibt, mich zu verraten –, nehme die Fernbedienung und schalte den Fernseher aus.
Selige Stille.
Ich betrachte meinen schlafenden Mann. Ein paar Sekunden lang sieht er friedlich aus. Sein Gesicht ist entspannt, sein Atem gleichmäßig.
»Nein!«, schreit er plötzlich mit zuckenden Beinen und gequältem Gesicht. Ich halte den Atem an.
Und dann ist er wieder ruhig.
Cory hat mir nur wenig darüber erzählt, was während seiner Stationierung im Irak passiert ist, aber ich weiß, dass eine selbstgebastelte, im Wüstensand versteckte Landmine ausgelöst wurde und zwei aus seinem Zug getötet hat, darunter seinen besten Freund. Corys Körper ist von Narben übersät, und obwohl er sagt, dass er mir und Lily den Schrecken in seinem Kopf ersparen möchte, sprechen seine Albträume, sein Trinken und seine zunehmende Abschottung Bände.
Die Ironie, dass unser Land die neuesten Waffen und Technologien zur Verfügung hat, aber eine behelfsmäßig zusammengebastelte Sprengfalle seinen Freund getötet hat, quält ihn.
Krieg ist Krieg. Da gibt es keine Grauschattierungen.
Ich atme tief durch, um mich zu beruhigen. Ich bin erschöpft, aber ich muss weiterkämpfen: Das Haus muss fertig eingerichtet sein, bevor ich in einer Woche mit meinem neuen Job anfange. Und Lily muss diesen Sommer neue Freunde in einer neuen Stadt finden. Ich sehe Cory an. Ich muss ihm noch erzählen, dass ich Lily für praktisch jeden Ferienkurs angemeldet habe, den ich finden konnte, von Schwimmen bis Segeln. Ich will nicht, dass er denkt, ich würde ihm nicht vertrauen, aber um die Wahrheit zu sagen, vertraue ich ihm tatsächlich nicht. Er liebt Lily mehr als sein eigenes Leben, aber das würde ihn nicht davon abhalten, zu viel zu trinken, einzuschlafen oder einfach nur zu vergessen, dass sie im Garten oder am Wasser spielt.
Mein Mann ist nur noch ein Schatten dessen, der er mal war.
Wieder atme ich tief ein.
Das Wohnzimmer riecht nach Bohnerwachs und Bier, genau wie das Twilight Inn, die heruntergekommene Collegebar, in der ich früher gearbeitet habe. Montags habe ich den Fußboden gewischt und die ganzen Flaschen und Plastikbecher weggeworfen, um zu versuchen, die Geschichte des Wochenendes auszulöschen. Aber es roch trotzdem immer noch nach Putzmittel und Bier.
Cory stöhnt.
Die Geister kehren immer zurück, denke ich.
Nachdenklich mustere ich ein Fenster an der Vorderseite des Hauses.
Ich sollte dieses Zimmer auslüften, denke ich. Den Geistern Gelegenheit geben zu entkommen.
Auf Zehenspitzen schleiche ich zu dem schönen antiken Schiebefenster. Es gibt zwei solche Fenster im Wohnzimmer und zwei im Esszimmer, noch mit der Originalverglasung, umrahmt von schönen, dick mit weißer Farbe überzogenen Leisten. Ehrfürchtig streiche ich mit der Hand über das wellige Glas und die hübschen Scheiben.
Welche Geschichten du wohl erzählen könntest?
Als ich den Rahmen hochschieben will, weigert er sich nachzugeben. Ich gehe in die Hocke und stemme mich dagegen, worauf sich das Fenster bewegt – um zwei Zentimeter vielleicht – und meine Rückenwirbel so laut knacken, dass ich ihnen tatsächlich ›pssst‹ zuzische. Frustriert halte ich inne und mustere das Fenster.
Du magst ja hübsch sein, denke ich, aber du bist alt und störrisch.
Die Fenster haben noch die alten Seilzüge, und die Rahmen sind vom Wasser und der Feuchtigkeit des Sees aufgequollen. Ich schiebe mir die Brille runter auf die Nasenspitze und spähe in die Öffnung, in der der Seilzug im Fensterrahmen verschwindet. Diese Fenster funktionieren mit altmodischen Gegengewichten, die in den Hohlräumen der Fensterlaibungen verlaufen. Wenn man das Fenster öffnet oder schließt, bewegen sich die Gewichte an den Seilzügen rauf oder runter, um das Fenster offen zu halten, ohne dass eine Verankerung nötig wäre.
Faszinierend, diese alten Erfindungen, denke ich.
Die Schnüre sind ausgefranst und werden ein wenig Arbeit benötigen. Ich hole tief Luft, lege meine Hände noch mal unter den Rahmen und drücke mit aller Kraft nach oben wie ein Muskelprotz auf dem Jahrmarkt. Unvermittelt fliegt das Fenster auf, als gäbe es keine Schwerkraft.
Ich kann hören, wie Cory sich regt. Erneut halte ich den Atem an und drehe mich um. Er rollt sich mit dem Gesicht zur Rückenlehne und schnarcht weiter.
Erleichtert atme ich auf und will gerade in die Küche zurückgehen, da höre ich ein leises Maunzen. Ich halte mitten in der Bewegung inne und drehe mich wieder zum Fenster um. Ich versuche, in dem dunklen Garten zu erkennen, woher das Maunzen kam, sehe jedoch nichts, nur das Wasser des Sees, das in der Ferne ruhig und glänzend daliegt. Innerhalb weniger Tage ist der See bereits zu einem vertrauten Geruch geworden. Das waldige, feuchte Aroma hat eine mächtige Wirkung auf mich, als wäre ich schon immer dazu bestimmt gewesen, am Wasser zu sein, und endlich nach Hause gekommen. Der Geruch von Süßwasser vermischt mit Kiefernduft, den der Wind mit sich trägt, beruhigt mich.
Aber heute Abend liegt noch etwas anderes in der Luft, ein parfümartiger Duft, der so süß und vertraut ist, so überwältigend, dass ich nicht anders kann, als die Augen zu schließen und erneut tief einzuatmen.
Flieder!
Sofort fühle ich mich ins Haus meiner Großmutter in einem Vorort von Detroit zurückversetzt. Jede Wand im Haus von Grandma Midge war in einer Schattierung von Rosa oder Lila gestrichen. Ihr Badezimmer war altrosa gestrichen und ihre Küche knallpink. Aber ihr Schlafzimmer zu betreten war, als käme man in ein Zimmer voller Flieder: zartlila Wände mit einem leichten Stich ins Rosé, ein weißes, mit Fliederblüten bemaltes Kopfteil, Blumengardinen und violetter Zottelteppich.
Wenn wir sie zum Muttertag besuchten, stand ihr Flieder für gewöhnlich in voller Blüte. Sie wartete immer, bis ich kam, bevor sie die duftenden Dolden abschnitt.
Meine Grandma lebte in einer alten Siedlung voller Familien, deren Männer ihr Leben lang in der Automobilindustrie gearbeitet hatten. Mit der Zeit allerdings wurden die Reihen winziger Häuser, die sich mit einer Armeslänge Abstand aneinanderdrängten, zunehmend von Witwen bewohnt, die alle eine Schwäche für Flieder im Garten und für Bridgepartien zu haben schienen.
»Flieder braucht eine hübsche Vase«, wies meine Grandma mich immer an. »Das Leben braucht eine hübsche Vase.«
Dann führte sie mich zu einer ihrer vielen Eckvitrinen und versetzte ihr mit dem Pantoffel einen leichten Tritt, um die klemmende Tür zu öffnen. Wir suchten ihre schönsten McCoy-Vasen in der Form von Hyazinthen aus oder hohe türkisfarbene Vasen mit Vögeln und Zweigen.
Wir schnupperten an fast jeder Fliederdolde, bevor wir ganze Armvoll Blüten abschnitten und ins Haus trugen. Wir füllten zahllose Vasen damit und stellten sie in jedes Zimmer, bis ihr Haus duftete, als wäre es in himmlisches Parfüm getränkt.
Und wenn ich ins Bett ging, dann hob sie die Vase auf meinem Nachttisch hoch und hielt sie mir unter die Nase.
»Träum von Blumen, mein Engelchen«, flüsterte sie. »Träum von Flieder.«
Cory raschelt auf dem Sofa, und ich schleiche vom Fenster fort. Auf Zehenspitzen gehe ich durch die Küche, nehme eine Taschenlampe und mache leise die Tür auf, die hinaus auf die große Veranda mit Blick auf den See führt. Ein heller Mond steht am Himmel und schimmert auf der Wasseroberfläche, was mir das Gefühl gibt, in einem alten Film zu sein und darauf zu warten, dass mein Mann vom Meer zurückkehrt. Der Mond ist noch nicht ganz voll, wird jedoch jede Nacht runder und leuchtender.
Erneut höre ich das Mauzen. Ich folge dem Geräusch hinaus auf die Terrasse und dann die Stufen hinunter in den heruntergekommenen Garten. Es ist eine relativ warme Mainacht für Michigan-Verhältnisse, was bedeutet, dass ich ohne Jacke nicht fröstle. Ich hätte gedacht, dass ich am See stärker frieren würde als in Detroit, aber das Wasser des Sees hat sich schneller erwärmt als gewöhnlich, und das bewirkt, dass es in der Umgebung des Sees eine Spur milder ist.
Unser neuer Garten ist ziemlich groß, besteht jedoch hauptsächlich aus Gestrüpp und Unkraut. Begrenzungen aus Fundsteinen vom See deuten an, wo sich einmal Beete befunden haben, und hier und da steht ein bröckelndes Vogelbad und dekorative Gartenkugeln auf rostenden Metallstäben.
Das wird ein Projekt für mich werden, falls ich je die Zeit dazu finde. Cory hat früher gern im Garten gearbeitet. Bevor …
Ich drehe mich um und betrachte den vom Mond erhellten hohen Zaun. Es ist wirklich wie die Mauer eines Gefängnisses.
Oder einer Burg, denke ich. Entweder versucht die alte Dame, alle anderen draußen oder sich selbst drinnen zu halten.
Ich gehe zum Zaun und schalte die Taschenlampe ein. Ich suche links und rechts, oben und unten, und da – in einer der dicken Zaunlatten, ungefähr auf Kniehöhe – ist ein kleines Loch, gerade groß genug für eine Katze, um hindurchzuschlüpfen.
Dann gehe ich in die Hocke, schaue durch das Loch und inhaliere tief.
Fliederduft.
Ich richte meine Taschenlampe durch die schmale Öffnung und sehe eine dichte Reihe von Fliederbüschen in voller Blüte. Ihre violetten, vom Mondlicht beschienenen Zweige wippen in der leichten Brise und winken mir zu, als wollten sie sagen: »Hi, Abby, schön, dich kennenzulernen.«
Ich versuche, den Garten meiner Nachbarin abzusuchen, aber das Loch ist zu schmal. Ich kann nur sehen, was direkt vor mir ist.
In dem Moment springt die Katze ins Licht der Taschenlampe und verschwindet unter den Fliederbüschen.
Iris
Mai 2003
Ich arbeite gern bei Mondlicht im Mai.
Die Abende sind frisch und still, und die Luftfeuchtigkeit durch den See kommt erst noch, genau wie die Touristen, die auf die umliegenden Cottages und den Strand einfallen werden wie Heuschrecken.
Ich sehe mich in meinem Garten um, der von vereinzelten Solarlampen erleuchtet wird.
Keine Heuschrecken hier, denke ich. Die kann ich kontrollieren.
Dann betrachte ich meinen Zaun.
Ich kann jeden Außenstehenden kontrollieren, der es wagt, in mein Heim einzudringen.
Aber das Beste am Mai ist für mich der Duft von Flieder. Er erfüllt die Luft wie ein antikes Parfüm, etwas, das Aphrodite getragen haben könnte. Der Geruch gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, wie ein kleines Mädchen. Ich denke an meine Großmutter und schließe die Augen.
»Im Himmel duftet es nach Flieder, Iris«, flüstere ich lautlos, als ich mich daran erinnere, was meine Grandma immer zu mir gesagt hat, wenn sie mich im Bett zudeckte. Energisch würge ich den Gedanken ab.
Es gibt keinen Himmel, Iris.
Sogar nach sechs Jahrzehnten sind die Nächte immer noch der härteste Teil des Tages für mich. Sie sind eine beständige Erinnerung dran, dass ich nicht in Sicherheit bin, dass ich nie in Sicherheit war, dass niemand von uns je in Sicherheit ist. Schlaf will sich nicht einstellen, und wenn er es doch tut, ist er voller Albträume von meinem Mann und meiner Tochter, die beide um Hilfe schreien, und ich bin nicht in der Lage, sie zu retten.
Der süße Duft weht erneut an mir vorbei, und schließlich öffne ich meine Augen. Der Flieder schaukelt im leichten Wind.
Nur die kann ich retten. Meine Blumen.
Ich schaue hinaus zu meinem Zaun. Nur mich selbst kann ich beschützen.
Ich lege die Samen weg, die ich gerade gezählt habe, und nehme die Teetasse mit dem Wildrosendekor, um einen Schluck Kamillentee zu trinken, während ich mich auf meiner Fliegengitterveranda umsehe.
Alles um mich herum ist alt.
Ich stelle die zerbrechliche Tasse zurück auf ihre zierliche Untertasse, die unter meiner unsicheren Hand klappert.
Ich bin alt.
Meine Fliegengitterveranda ist zu meinem Büro und Rückzugsort geworden, besonders in Michigans mildesten Monaten von Mai bis Oktober. Die optimistischsten Michiganer mögen zwar den November noch Herbst und den April schon Frühling nennen, aber im Handschuhstaat, wie wir ihn auch nennen, zählen beide offiziell immer noch zum Winter. Hier in Michigan ist es sogar erst nach Muttertag sicher, seine einjährigen Gewächse ins Freie zu pflanzen. Meine Fensterkästen bleiben also noch auf Standby.
Ich habe meine Fliegengitterveranda vor Jahrzehnten bauen lassen, als ich meinen ersten Zaun aufstellen ließ, zusammen mit einem erweiterten Gewächshaus.
»Sind Sie sicher, Ma’am?«, hatten mich die Bauarbeiter gefragt, als ich ihnen gesagt hatte, wie hoch ich meinen Zaun haben wollte. »Was ist mit Ihren Nachbarn?«
»Das Haus im Süden gehört mir, und das im Norden wurde von Fremden gekauft. In Highland Park sind jetzt nur noch Fremde. Bringt man denn Kindern nicht bei, nicht mit Fremden zu reden?«
Und schon wurde der Zaun aufgestellt, ruck, zuck, ohne weitere Fragen.
Aber der wahre Grund, warum ich diesen Zaun aufstellen ließ, war, dass ich die Blicke nicht ertragen konnte, die die Leute der Frau zuwarfen, die ihre Familie verloren hatte, als wäre ich eine Art kuriose Zirkusattraktion. Ich konnte es nicht ertragen, wie Ehemänner ihre Frauen bei der Hand packten und Mütter die Arme um ihre Kinder legten – Nachbarn und Freunde noch dazu –, Gesten, die sagten: Geh nicht zu nah an sie ran. Ihr Unglück könnte auf dich abfärben.
Ja, der erste Zaun sollte die Leute am Hereinsehen hindern, aber der zweite Zaun sollte die Leute draußen halten.
Für immer.
Ironischerweise betrachte ich ihn gar nicht mehr als Zaun. Er ist eine Leinwand. Clematis, Rosen, Trompetenblumen und Duftwicken kriechen und klettern über das Holz, während Hibiskus und Scharonrose es mit breiten Farbtupfern in Pink und Weiß überziehen.
Die Fliegengitterveranda liegt erhöht und hat ein Giebeldach, was einen Panoramablick auf den Michigansee in seiner ganzen Pracht sowie meinen Garten bietet. Es ist ein hoher Raum, an zwei Seiten von Fliegengittern begrenzt. Die Nordseite ist eine Wand mit einem alten Sprossenfenster, das eine antike Bugholzlampe ziert, die mein Großvater bei einer Anglerwette im Norden Michigans gewonnen hatte. Mein Grampa nahm uns immer mit zu einer alten Hütte am Lake Superior, wo das Wasser sogar im Hochsommer kalt wie ein Eisbad ist. Er fuhr nur aus einem einzigen Grund dorthin: um Hechte zu angeln. Dort wettete er mit dem Barbesitzer nach ein paar Bierchen und Whiskeys, dass er einen größeren Hecht an Land ziehen konnte als alle, die der Barbesitzer an seiner Wand hängen hatte. Ich war dabei, als das Monster anbiss, nachdem es dem Köder stundenlang gefolgt war. Die Größe und die Zähne des Hechts machten mir eine Todesangst, aber am Ende holte mein Grampa den Fisch ein.
»Was willst du haben, Grampa?«, fragte ich. »Er hat gesagt, er gibt dir, was du willst.«
Mein Grampa ging mit dieser Lampe nach Hause, unter der er jahrelang seine Sonntagszeitung las, trotz der Tatsache, dass die Lampe nach Zigarettenrauch und billigem Bier roch, bis sie nach ein paar Jahrzehnten auf dieser Veranda genug Gelegenheit gehabt hatte auszulüften.
Nun erhellen zwei meiner liebsten Lichtquellen, diese Lampe und das Mondlicht, den gelben Block, auf dem ich die Samen und Ergebnisse der Taglilien aufzeichne, die ich vermehre. In meinem Alter brauche ich inzwischen mehrere Lichtquellen und zwei – ja, zwei! – Brillen dafür. Ich setze eine Lesebrille auf meine Nasenspitze, und direkt vor meinen Augen sitzt eine mit Strass verzierte Katzenaugenbrille, deren Gläser so dick wie Glasbausteine sind.
Dann trinke ich einen Schluck Tee und atme den Duft des Flieders ein.
Plötzlich versteife ich mich bei einem knarrenden Geräusch und drehe den Kopf zum offenen Teil der Veranda, der nur mit Fliegengitter umschlossen, aber geschützt durch eine Reihe kleiner Kiefern und wilder Hortensien ist, die ich in den Wäldern in der Nähe der Dünen ausgegraben habe, wo ich früher gern gewandert bin. Sie sind inzwischen fast zweieinhalb Meter hoch und werden riesige, spitzenartige weiße Blüten bekommen, die so groß sind wie Basebälle. Ich lausche.
Muss ein Ast gewesen sein, denke ich. Oder mein Körper hat geknackst.
Leise vor mich hin glucksend trinke ich einen weiteren Schluck Tee.
Die Veranda kommt mir inzwischen so vor, als gäbe es sie schon genauso lange wie mich, hauptsächlich weil sie mit all den Lieblingsdingen meiner Mom und meiner Grandma dekoriert ist.
In der Ecke ragt ein zimmerhoher Kamin aus runden bunten Steinen empor, die ich vom Michigansee hochgeschleppt habe, nachdem sie durch heftige Gewitter an Land gespült worden waren. Über dem Kaminsims prangt immer noch ein Waagscheit, das aus einer Scheune aus dem neunzehnten Jahrhundert gerettet wurde, die gleich hier die Straße hinunter abgerissen worden war, um Platz für ein Mini-Herrenhaus zu machen.
Ich habe die alte gläserne Köderfischfalle meines Großvaters in eine Lampe verwandelt und vors Fenster Vorhänge mit altmodischen Motiven von Rehen im Wald an einem kalten Herbsttag gehängt, die meine Grandma genäht hat, als meine Mom noch ein kleines Mädchen war. Das Kanu, mit dem mein Dad und ich jedes Wochenende auf dem Michigansee gerudert sind, hängt ganz oben unter dem Dachgiebel. Die rote und grüne Farbe blättert ab, und von den Bänken hängen zwei Stalllaternen. Jede Oberfläche und jeder Winkel ist voller Kunstwerke und Erinnerungsstücke, die meine Familie gesammelt hat, und winzige Aquarelle meiner Lieblingsblumen hängen an Pfosten und bedecken jeden Quadratzentimeter Wandfläche.
Mein Herz – nein, das Herz meiner Familie! – schlägt auf dieser Veranda.
Sogar der massive Tisch, an dem ich arbeite, wurde von meinem Großvater, einem Holzarbeiter, aus einem vom Blitz getroffenen Walnussbaum in unserem Garten gemacht. Seine Beine bestehen aus massiven Baumstämmen. Er ist robust und abgenutzt wie ich. Sein Holz hat zahllose Tränen aufgesaugt und ist dadurch nur noch stärker geworden, wie es scheint. Er ist so schwer, dass ich ihn im Winter nicht mehr hineintragen oder bei einem Wolkenbruch verrücken kann, wenn der Wind den Regen seitlich durch die ungeschützten Fliegengitter hereindrückt. Er bleibt fest in der Mitte dieser Veranda verwurzelt.
Ich trinke meinen Tee aus und sehe mich um. Das Mondlicht und die Lampe hüllen die Veranda in ätherisches Licht.
Schon als kleines Mädchen habe ich Erinnerungsstücke geliebt. Ich habe mich in die Quilts meiner Grandma gekuschelt, ihre Schürzen getragen, obwohl sie dabei über den Boden schleiften, und ich habe ihr Nudelholz benutzt, um den Teig für ihre Blaubeerpasteten auszurollen. Ich habe jede alte Christbaumkugel geküsst, wenn ich mit ihnen die kräftigen, blaugrünen Zweige der Fraser-Tannen geschmückt habe, und ich habe der Musikbox meiner Mom gelauscht, wenn ich mir die Haare gebürstet habe.
Aber die Blumen meiner Familie waren es, die mein Herz eroberten. Die Geschichten zu hören, wie jede Blume weitergegeben wurde – von Mutter zu Tochter, Freundin zu Freundin, Garten zu Garten – und was sie jeder Gärtnerin bedeutet haben, war ein Tribut an Geduld, Sorgfalt, Zeit und Liebe.
Aber vor allem war es ein Tribut an die Hoffnung. Hoffnung, dass etwas Schönes wachsen würde trotz des harten Winters, der gefrorenen Erde und einer Welt, die sich ständig im Krieg befand.
Alles muss überwintern, um neu zu wachsen, hatte meine Grandma immer gesagt.
Ich nehme meinen linierten Schreibblock, um durchzugehen, was in meinem winzigen Glashaus in der hinteren Ecke meines Gartens wächst und was noch gepflanzt werden muss, und fange mit Bleistift an zu schreiben. Ich schaue hinunter auf die aufgeschnittenen Strümpfe, die mein Saatgut enthalten.
Die Welt würde mich auslachen, wenn sie sehen würde, wie ich immer noch lebe.
Gerade als ich zu schreiben beginne, weht erneut der Duft von Flieder auf die Veranda. Er ist so stark, so berauschend, so zauberhaft, dass ich nicht anders kann. Ich lege meine Lesebrille weg, stemme mich mit Hilfe des Tisches hoch und gehe langsam rüber zu den Stufen, die zum Garten führen. Als ich die Tür öffne, halte ich kurz inne. Eine kleine Glocke klingelt leise. Es ist die Glocke, mit der meine Grandma uns immer zum Abendessen gerufen hat, wenn wir am Strand gespielt haben. Ich setze mich wieder in Bewegung, gehe unter dem Klingeln der Glocke hinaus. Langsam, einen Schritt nach dem anderen, folge ich dem Duft des Flieders.
Als ich ihn erreiche, strecke ich die Hand aus und halte mir die Blüten unter die Nase. Sofort fühle ich mich in der Zeit zurückversetzt, zurück ins Haus meiner Großmutter, das im Mai nach Flieder duftete. Ich betrachte die hübsche lila Dolde und die zarten Blüten, aus denen sie sich zusammensetzt. Ich habe den Flieder in Michigan schon immer geliebt: Er ist ein verlässlicher Blüher, wenn er gut gepflegt wird.
Früher kamen Nachbarn jeden Mai zu mir und sagten: »Mein Flieder blüht nicht, Iris. Was soll ich tun?«