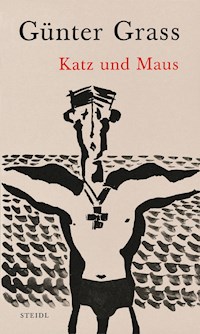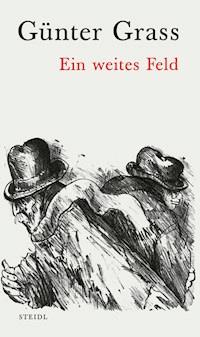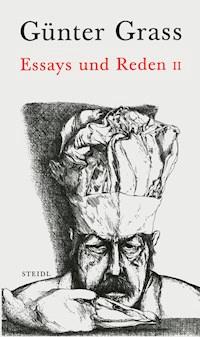Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Journalist, der hier in fremdem Auftrag arbeitet, hat wenig Lust, über die alte, fast vergessene Schiffskatastrophe zu schreiben, die sich 1945 in einer eisigen Januarnacht abspielte. Er hat die Ostsee-Story, die unabweisbar Teil seiner Biographie ist, unzählige Male aus dem Mund seiner Mutter gehört. Fünfzig Jahre später, beim Recherchieren im Internet, macht er die erschreckende Entdeckung, dass die Geschichte eine ihn unmittelbar betreffende Fortsetzung hat …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Grass
Im Krebsgang
1
»Warum erst jetzt?« sagte jemand, der nicht ich bin. Weil Mutter mir immer wieder… Weil ich wie damals, als der Schrei überm Wasser lag, schreien wollte, aber nicht konnte… Weil die Wahrheit kaum mehr als drei Zeilen… Weil jetzt erst…
Noch haben die Wörter Schwierigkeiten mit mir. Jemand, der keine Ausreden mag, nagelt mich auf meinen Beruf fest. Schon als junger Spund hätte ich, fix mit Worten, bei einer Springer-Zeitung volontiert, bald gekonnt die Kurve gekriegt, später für die »taz« Zeilen gegen Springer geschunden, mich dann als Söldner von Nachrichtenagenturen kurz gefaßt und lange Zeit freiberuflich all das zu Artikeln verknappt, was frisch vom Messer gesprungen sei: Täglich Neues. Neues vom Tage.
Mag schon sein, sagte ich. Aber nichts anderes hat unsereins gelernt. Wenn ich jetzt beginnen muß, mich selber abzuwickeln, wird alles, was mir schiefgegangen ist, dem Untergang eines Schiffes eingeschrieben sein, weil nämlich, weil Mutter damals hochschwanger, weil ich überhaupt nur zufällig lebe.
Und schon bin ich abermals jemand zu Diensten, darf aber vorerst von meinem bißchen Ich absehen, denn diese Geschichte fing lange vor mir, vor mehr als hundert Jahren an, und zwar in der mecklenburgischen Residenzstadt Schwerin, die sich zwischen sieben Seen erstreckt, mit der Schelfstadt und einem vieltürmigen Schloß auf Postkarten ausgewiesen ist und über die Kriege hinweg äußerlich heil blieb.
Anfangs glaubte ich nicht, daß ein von der Geschichte längst abgehaktes Provinznest irgendwen, außer Touristen, anlocken könnte, doch dann wurde der Ausgangsort meiner Story plötzlich im Internet aktuell. Ein Namenloser gab mit Daten, Straßennamen und Schulzeugnissen personenbezogene Auskunft, wollte für einen Vergangenheitskrämer wie mich unbedingt eine Fundgrube aufdecken.
Bereits als die Dinger auf den Markt kamen, habe ich mir einen Mac mit Modem angeschafft. Mein Beruf verlangt diesen Abruf weltweit vagabundierender Informationen. Lernte leidlich, mit meinem Computer umzugehen. Bald waren mir Wörter wie Browser und Hyperlink nicht mehr böhmisch. Holte Infos für den Gebrauch oder zum Wegschmeißen per Mausklick rein, begann aus Laune oder Langeweile von einem Chatroom zum anderen zu hüpfen und auf die blödeste Junk-Mail zu reagieren, war auch kurz auf zwei, drei Pornosites und stieß nach ziellosem Surfen schließlich auf Homepages, in denen sogenannte Vorgestrige, aber auch frischgebackene Jungnazis ihren Stumpfsinn auf Haßseiten abließen. Und plötzlich — mit einem Schiffsnamen als Suchwort — hatte ich die richtige Adresse angeklickt: »www.blutzeuge.de«. In gotischen Lettern klopfte eine »Kameradschaft Schwerin« markige Sprüche. Lauter nachträgliches Zeug. Mehr zum Lachen als zum Kotzen.
Seitdem steht fest, wessen Blut zeugen soll. Aber noch weiß ich nicht, ob, wie gelernt, erst das eine, dann das andere und danach dieser oder jener Lebenslauf abgespult werden soll oder ob ich der Zeit eher schrägläufig in die Quere kommen muß, etwa nach Art der Krebse, die den Rückwärtsgang seitlich ausscherend vortäuschen, doch ziemlich schnell vorankommen. Nur soviel ist sicher: Die Natur oder genauer gesagt die Ostsee hat zu all dem, was hier zu berichten sein wird, schon vor länger als einem halben Jahrhundert ihr Ja und Amen gesagt.
Zuerst ist jemand dran, dessen Grabstein zertrümmert wurde. Nach Schulabschluß — mittlere Reife — begann seine Banklehre, die er unauffällig beendete. Nichts davon fand sich im Internet. Dort wurde nur auf eigens ihm gewidmeter Website der 1895 in Schwerin geborene Wilhelm Gustloff als »Blutzeuge« gefeiert. So fehlten Hinweise auf den angegriffenen Kehlkopf, sein chronisches Lungenleiden, das ihn hinderte, im Ersten Weltkrieg tapfer zu sein. Während Hans Castorp, ein junger Mann aus hanseatischem Haus, auf Geheiß seines Erfinders den Zauberberg verlassen mußte, um auf Seite 994 des gleichnamigen Romans in Flandern als Kriegsfreiwilliger zu fallen oder ins literarische Ungefähr zu entkommen, schickte die Schweriner Lebensversicherungsbank ihren tüchtigen Angestellten im Jahr siebzehn fürsorglich in die Schweiz, wo er in Davos sein Leiden auskurieren sollte, woraufhin er in besonderer Luft so gesund wurde, daß ihm nur mit anderer Todesart beizukommen war; nach Schwerin, ins niederdeutsche Klima wollte er vorerst nicht zurück.
Als Gehilfe fand Wilhelm Gustloff Arbeit in einem Observatorium. Kaum war diese Forschungsstätte in eine eidgenössische Stiftung umgewandelt, stieg er zum Observatoriumssekretär auf, dem dennoch Zeit blieb, sich als reisender Vertreter einer Gesellschaft für Hausratsversicherungen ein Zubrot zu verdienen; so lernte er nebenberuflich die Kantone der Schweiz kennen. Gleichzeitig war seine Frau Hedwig fleißig: als Sekretärin half sie, ohne sich ihrer völkischen Gesinnung wegen überwinden zu müssen, bei einem Rechtsanwalt namens Moses Silberroth aus.
Bis hierhin ergeben die Fakten das Bild eines bürgerlich gefestigten Ehepaares, das aber, wie sich zeigen wird, eine dem schweizerischen Erwerbssinn angepaßte Lebensart nur vortäuschte; denn anfangs unterschwellig, später offen heraus — und lange geduldet vom Arbeitgeber — nutzte der Observatoriumssekretär erfolgreich sein angeborenes Organisationstalent: er trat in die Partei ein und hat bis Anfang sechsunddreißig unter den in der Schweiz lebenden Reichsdeutschen und Österreichern etwa fünftausend Mitglieder angeworben, landesweit in Ortsgruppen versammelt und auf jemanden vereidigt, den sich die Vorsehung als Führer ausgedacht hatte.
Zum Landesgruppenleiter jedoch war er von Gregor Strasser ernannt worden, dem die Organisation der Partei unterstand. Strasser, der dem linken Flügel angehörte, wurde, nachdem er zweiunddreißig aus Protest gegen seines Führers Nähe zur Großindustrie alle Ämter niedergelegt hatte, zwei Jahre später dem Röhmputsch zugezählt und von den eigenen Leuten liquidiert; sein Bruder Otto rettete sich ins Ausland. Daraufhin mußte sich Gustloff ein neues Vorbild suchen.
Als aufgrund einer Anfrage, gestellt im Kleinen Rat von Graubünden, ein Beamter der Fremdenpolizei von ihm wissen wollte, wie er inmitten der Eidgenossenschaft sein Amt als Landesgruppenleiter der NSDAP verstehe, soll er geantwortet haben: »Ich liebe auf der Welt am meisten meine Frau und meine Mutter. Wenn mein Führer mir befähle, sie zu töten, würde ich ihm gehorchen.«
Dieses Zitat wurde im Internet bestritten. Solche und weitere Lügen habe in seinem Machwerk der Jude Emil Ludwig erfunden, hieß es in dem von der Kameradschaft Schwerin angebotenen Chatroom. Vielmehr sei weiterhin der Einfluß von Gregor Strasser auf den Blutzeugen wirksam geblieben. Stets habe Gustloff vor dem Nationalen das Sozialistische seiner Weltanschauung betont. Bald tobten Flügelkämpfe zwischen den Chattern. Eine virtuelle Nacht der langen Messer forderte Opfer.
Dann jedoch wurde allen interessierten Usern ein Datum in Erinnerung gerufen, das als Ausweis der Vorsehung gelten sollte. Was ich mir als bloßen Zufall zu erklären versucht hatte, hob den Funktionär Gustloff in überirdische Zusammenhänge: am 30.Januar 1945 begann, auf den Tag genau fünfzig Jahre nach der Geburt des Blutzeugen, das auf ihn getaufte Schiff zu sinken und so zwölf Jahre nach der Machtergreifung, abermals auf den Tag genau, ein Zeichen des allgemeinen Untergangs zu setzen.
Da steht es wie mit Keilschrift in Granit gehauen. Das verfluchte Datum, mit dem alles begann, sich mordsmäßig steigerte, zum Höhepunkt kam, zu Ende ging. Auch ich bin, dank Mutter, auf den Tag des fortlebenden Unglücks datiert worden; dagegen lebt sie nach einem anderen Kalender und ermächtigt weder den Zufall noch ähnliche Alleserklärer.
»Aber nai doch!« ruft sie, die ich nie besitzergreifend »meine«, sondern immer nur »Mutter« nenne. »Das Schiff hätt auf sonst wen jetauft sain kennen ond wär trotzdem abjesoffen. Mecht mal bloß wissen, was sich dieser Russki jedacht hat, als er Befehl jab, die drai Dinger direktemang auf ons loszuschicken…«
So mault sie immer noch, als wäre seitdem nicht ein Haufen Zeit bachrunter gegangen. Wörter breitgetreten, Sätze in der Wäschemangel gewalkt. Sie sagt Bulwen zu Kartoffeln, Glumse zu Quark und Pomuchel, wenn sie Dorsch in Mostrichsud kocht. Mutters Eltern, August und Erna Pokriefke, kamen aus der Koschneiderei, wurden Koschnäwjer genannt. Sie jedoch wuchs in Langfuhr auf. Nicht aus Danzig stammt sie, sondern aus diesem langgestreckten, immer wieder ins Feld hinein erweiterten Vorort, dessen eine Straße Elsenstraße hieß und dem Kind Ursula, Tulla gerufen, Welt genug gewesen sein muß, denn wenn sie, wie es bei Mutter heißt, »von janz frieher« erzählt, geht es zwar oft um Badevergnügen am nahen Ostseestrand oder um Schlittenfahrten in den Wäldern südlich des Vorortes, doch meistens zwingt sie ihre Zuhörer auf den Hof des Mietshauses Elsenstraße 19 und von dort aus, am angeketteten Schäferhund Harras vorbei, in eine Tischlerei, deren Arbeitsgeräusch von einer Kreis-, einer Bandsäge, der Fräse, der Hobelmaschine und dem wummernden Gleichrichter bestimmt wurde. »Als klaine Göre schon hab ech im Knochenleimpott rumriehren jedurft…« Weshalb dem Kind Tulla, wo es stand, lag, ging, rannte oder in einer Ecke kauerte, jener, wie erzählt wird, legendäre Knochenleimgeruch anhing.
Kein Wunder also, daß Mutter, als wir gleich nach dem Krieg in Schwerin einquartiert wurden, in der Schelfstadt das Tischlerhandwerk gelernt hat. Als »Umsiedlerin«, wie es im Osten hieß, bekam sie prompt eine Lehrstelle bei einem Meister zugewiesen, dessen Bruchbude mit vier Hobelbänken und ständig blubberndem Leimpott als alteingesessen galt. Von dort aus war es nicht weit zur Lehmstraße, wo Mutter und ich ein Dach aus Teerpappe überm Kopf hatten. Doch wenn wir nach dem Unglück nicht in Kolberg an Land gegangen wären, wenn uns vielmehr das Torpedoboot Löwe nach Travemünde oder Kiel, also in den Westen gebracht hätte, wäre Mutter als »Ostflüchtling«, wie es drüben hieß, bestimmt auch Tischlerlehrling geworden. Ich sage Zufall, während sie vom ersten Tag an den Ort unserer Zwangseinweisung als vorbestimmt angesehen hat.
»Ond wann jenau hat nu dieser Russki, der Käpten auf dem U-Boot jewesen is, sain Jeburtstag jehabt? Du waißt doch sonst alles aufs Haar jenau…«
Nein, so wie bei Wilhelm Gustloff — und wie ich es mir aus dem Internet geholt habe — weiß ich das nicht. Nur das Geburtsjahr konnte ich rausfingern und sonst noch paar Fakten und Vermutungen, was Journalisten Hintergrundmaterial nennen.
Alexander Marinesko wurde 1913 geboren, und zwar in der Hafenstadt Odessa, am Schwarzen Meer gelegen, die einmal prächtig gewesen sein muß, was in Schwarzweißbildern der Film »Panzerkreuzer Potemkin« bezeugt. Seine Mutter stammte aus der Ukraine. Der Vater war Rumäne und hatte seinen Ausweis noch als Marinescu unterschrieben, bevor er wegen Meuterei zum Tode verurteilt wurde, doch in letzter Minute fliehen konnte.
Sein Sohn Alexander wuchs im Hafenviertel auf. Und weil in Odessa Russen, Ukrainer und Rumänen, Griechen und Bulgaren, Türken und Armenier, Zigeuner und Juden eng beieinanderlebten, sprach er ein Mischmasch aus vielerlei Sprachen, muß aber innerhalb seiner Jungenbande verstanden worden sein. Sosehr er sich später bemühte, Russisch zu sprechen, nie wollte es ihm ganz gelingen, sein von jiddischen Einschiebseln durchsupptes Ukrainisch von seines Vaters rumänischen Flüchen zu säubern. Als er schon Maat auf einem Handelsschiff war, lachte man über sein Kauderwelsch; doch im Verlauf der Jahre wird vielen das Lachen vergangen sein, so komisch in späterer Zeit die Befehle des U-Bootkommandanten geklungen haben mögen.
Jahre zurückgespult: der siebenjährige Alexander soll vom Überseekai aus gesehen haben, wie die restlichen Truppen der »Weißen« und der abgekämpfte Rest der britischen und französischen Interventionsarmeen fluchtartig Odessa verließen. Bald darauf erlebte er den Einmarsch der »Roten«. Säuberungen fanden statt. Dann war der Bürgerkrieg so gut wie vorbei. Und als einige Jahre später wieder ausländische Schiffe im Hafenbecken anlegen durften, soll der Junge nach Münzen, die von schöngekleideten Passagieren ins Brackwasser geworfen wurden, mit Ausdauer und bald mit Geschick getaucht haben.
Das Trio ist nicht komplett. Einer fehlt noch. Seine Tat hat etwas in Gang gesetzt, das Sogwirkung bewies und nicht aufzuhalten war. Da er, gewollt wie ungewollt, den einen, der aus Schwerin kam, zum Blutzeugen der Bewegung und den Jungen aus Odessa zum Helden der baltischen Rotbannerflotte gemacht hat, ist ihm für alle Zeit die Anklagebank sicher. Solche und ähnliche Beschuldigungen las ich, mittlerweile gierig geworden, der immer gleich firmierenden Homepage ab: »Ein Jude hat geschossen…«
Weniger eindeutig ist, wie ich inzwischen weiß, eine Streitschrift betitelt, die der Parteigenosse und Reichsredner Wolfgang Diewerge im Franz Eher Verlag, München, im Jahr 1936 erscheinen ließ. Allerdings wußte die Kameradschaft Schwerin, nach des Irrsinns schlüssiger Logik, mehr zu verkünden, als Diewerge zu wissen vorgab: »Ohne den Juden wäre es auf der von Minen geräumten Route, Höhe Stolpmünde, nie zur größten Schiffskatastrophe aller Zeiten gekommen. Der Jude hat… Der Jude ist schuld…«
Im Chatroom waren dem teils deutsch, teils englisch angerührten Gequassel dennoch einige Fakten abzulesen. Wußte der eine Chatter, daß Diewerge bald nach Kriegsbeginn Intendant des Reichssenders Danzig gewesen sei, hatte ein anderer Kenntnis von dessen Tätigkeiten während der Nachkriegszeit: er soll, verkumpelt mit anderen Obernazis, so mit dem späteren FDP-Bundestagsabgeordneten Achenbach, die nordrhein-westfälischen Liberalen unterwandert haben. Auch habe, ergänzte ein Dritter, der ehemalige NS-Propagandaexperte während der siebziger Jahre eine geräuscharme Spendenwaschanlage zugunsten der FDP betrieben, und zwar in Neuwied am Rhein. Schließlich drängten sich im randvollen Chatroom doch noch Fragen nach dem Täter von Davos, denen zielsichere Antworten Punkte setzten.
Vier Jahre älter als Marinesko und vierzehn Jahre jünger als Gustloff, wurde David Frankfurter 1909 in der westslawonischen Stadt Daruvar als Sohn eines Rabbiners geboren. Zu Hause sprach man Jiddisch und Deutsch, in der Schule lernte David Serbisch sprechen und schreiben, bekam aber auch den tagtäglichen Haß auf die Juden zu spüren. Vermutend nur steht hier: Damit umzugehen, bemühte er sich vergeblich, weil seine Konstitution keine robuste Gegenwehr erlaubte und ihm geschickte Anpassung an die Verhältnisse zuwider war.
Mit Wilhelm Gustloff hatte David Frankfurter nur soviel gemein: wie jener durch seine Lungenkrankheit behindert war, litt dieser seit seiner Kindheit an chronischer Knochenmarkeiterung. Doch wenn Gustloff sein Leiden in Davos bald hatte auskurieren können und später als gesunder Parteigenosse tüchtig wurde, konnten dem kranken David keine Ärzte helfen; vergeblich mußte er fünf Operationen erleiden: ein hoffnungsloser Fall.
Vielleicht hat er der Krankheit wegen ein Medizinstudium begonnen; auf familiären Rat hin in Deutschland, wo schon sein Vater und dessen Vater studiert hatten. Es heißt, weil fortwährend kränkelnd und deshalb an Konzentrationsschwäche leidend, sei er beim Physikum wie bei späteren Examen durchgefallen. Doch im Internet behauptete der Parteigenosse Diewerge im Gegensatz zum gleichfalls zitierten Schriftsteller Ludwig, den Diewerge stets »Emil Ludwig-Cohn« nannte: Der Jude Frankfurter sei nicht nur ein schwächlicher, sondern ein dem Rabbi-Vater auf der Tasche liegender, so fauler wie verbummelter Student gewesen, zudem ein stutzerhaft gekleideter Nichtsnutz und Kettenraucher.
Dann begann — wie jüngst im Internet gefeiert — mit dreimal verfluchtem Datum das Jahr der Machtergreifung. Der Kettenraucher David erlebte in Frankfurt am Main, was ihn und andere Studenten betraf. Er sah, wie die Bücher jüdischer Autoren verbrannt wurden. Seinen Studienplatz im Labor kennzeichnete plötzlich ein Davidstern. Körperlich nah schlug ihm Haß entgegen. Mit anderen wurde er von Studenten, die sich lauthals der arischen Rasse zuzählten, beschimpft. Damit konnte er nicht umgehen. Das hielt er nicht aus. Deshalb floh er in die Schweiz und setzte in Bern, am vermeintlich sicheren Ort, sein Studium fort, um wiederum bei Prüfungen durchzufallen. Dennoch schrieb er seinen Eltern heiter bis positiv gestimmte, den Unterhalt zahlenden Vater beschummelnde Briefe. Als im Jahr drauf seine Mutter starb, unterbrach er das Studium. Vielleicht um bei Verwandten Halt zu suchen, wagte er noch einmal eine Reise ins Reich, wo er in Berlin tatenlos sah, wie sein Onkel, der wie der Vater Rabbiner war, von einem jungen Mann, der laut »Jude, hepp hepp!« schrie, am rötlichen Bart gezerrt wurde.
Ähnlich steht es in Emil Ludwigs romanhaft gehaltener Schrift »Der Mord in Davos«, die der Erfolgsautor 1936 bei Querido in Amsterdam, dem Verlag der Emigranten, erscheinen ließ. Abermals wußte es die Kameradschaft Schwerin auf ihrer Website nicht besser, aber anders, indem sie wiederum den Parteigenossen Diewerge beim Wort nahm, weil dieser den von Berliner Polizisten verhörten Rabbiner Dr. Salomon Frankfurter in seinem Bericht als Zeugen zitiert hatte: »Es ist nicht wahr, daß ein halbwüchsiger Bursche mich am Barte (der übrigens schwarz und nicht rot ist) gezogen und dabei geschrien hat, ›Jude, hepp, hepp!‹«
Es war mir nicht möglich herauszufinden, ob das zwei Jahre nach der angeblichen Beschimpfung angeordnete Polizeiverhör unter Zwang seinen Verlauf genommen hatte. Jedenfalls kehrte David Frankfurter nach Bern zurück und wird aus mehreren Gründen verzweifelt gewesen sein. Zum einen begann wiederum das bis dahin erfolglose Studium, zum anderen litt er, ohnehin körperlich unter Dauerschmerz leidend, unter dem Tod der Mutter. Überdies wuchs sich seine Berliner Kurzvisite bedrückend aus, sobald er in in- und ausländischen Zeitungen Berichte über Konzentrationslager in Oranienburg, Dachau und anderenorts las.
So muß gegen Ende fünfunddreißig der Gedanke an Selbstmord aufgekommen sein und sich wiederholt haben. Später, als der Prozeß lief, hieß es in einem von der Verteidigung bestellten Gutachten: »Frankfurter kam aus inneren seelischen Gründen persönlicher Natur in die psychologisch unhaltbare Situation, von der er sich freimachen mußte. Seine Depression gebar die Selbstmordidee. Der in jedem immanente Selbsterhaltungstrieb hat aber die Kugel von sich selbst auf ein anderes Opfer abgelenkt.«
Dazu gab es im Internet keine spitzfindigen Kommentare. Dennoch beschlich mich mehr und mehr der Verdacht, daß sich hinter der Deckadresse »www.blutzeuge.de« keine glatzköpfige Mehrzahl als Kameradschaft Schwerin zusammengerottet hatte, sondern ein Schlaukopf als Einzelgänger verborgen blieb. Jemand, der wie ich querläufig nach Duftmarken und ähnlichen Absonderungen der Geschichte schnüffelte.
Ein verbummelter Student? Bin ich auch gewesen, als mir die Germanistik stinklangweilig und die Publizistik am Otto-Suhr-Institut zu theoretisch wurde.
Anfangs, als ich Schwerin verließ, dann von Ostberlin aus mit der S-Bahn nach Westberlin wechselte, gab ich mir, wie Mutter beim Abschied versprochen, noch ziemlich Mühe und büffelte wie ein Streber. Zählte — kurz vorm Mauerbau — sechzehneinhalb, als ich begann, Freiheit zu schnuppern. Bei Mutters Schulfreundin Jenny, mit der sie eine Menge verrückte Sachen erlebt haben will, wohnte ich in Schmargendorf nahe dem Roseneck. Hatte ein eigenes Zimmer mit Dachlukenfenster. War eigentlich eine schöne Zeit.
Tante Jennys Mansardenwohnung in der Karlsbader Straße sah wie eine Puppenstube aus. Auf Tischchen, Konsolen, unter Glasstürzen standen Porzellanfigürchen. Meistens Tänzerinnen im Tutu und auf Schuhspitzen stehend. Einige in gewagter Position, alle mit kleinem Köpfchen auf langem Hals. Als junges Ding war Tante Jenny Ballerina gewesen und ziemlich berühmt, bis ihr bei einem der vielen Luftangriffe, die die Reichshauptstadt mehr und mehr flachlegten, beide Füße verkrüppelt wurden, so daß sie mir nun einerseits humpelnd, andererseits mit immer noch graziösen Armbewegungen allerlei Knabberzeug zum Nachmittagstee servierte. Und gleich den zerbrechlichen Figurinen in ihrer putzigen Mansarde zeigte ihr kleiner, auf nunmehr dürrem Hals beweglicher Kopf immerfort ein Lächeln, das vereist zu sein schien. Auch fröstelte sie häufig, trank viel heiße Zitrone.
Ich wohnte gerne bei ihr. Sie verwöhnte mich. Und wenn sie von ihrer Schulfreundin sprach — »Meine liebe Tulla hat mir auf Schleichwegen neuerlich ein Briefchen zukommen lassen…« —, war ich für Minuten versucht, Mutter, dieses verflucht zähe Miststück, ein wenig liebzugewinnen; doch dann nervte sie wieder. Ihre von Schwerin aus in die Karlsbader Straße geschmuggelten Kassiber enthielten dichtgedrängte, mit Unterstreichungen ins Bedingungslose gesteigerte Ermahnungen, die mich, mit Mutters Wort, »piesacken« sollten: »Er muß lernen, lernen! Dafür, nur dafür hab ich den Jungen in den Westen geschickt, damit er was aus sich macht…«
In ihrer mir im Ohr nistenden Wortwörtlichkeit hieß das: »Ech leb nur noch dafier, daß main Sohn aines Tages mecht Zeugnis ablegen.« Und als ihrer Freundin Sprachrohr ermahnte mich Tante Jenny mit sanfter, doch immer den Punkt treffender Stimme. Mir blieb nichts übrig, als fleißig zu büffeln.
Ging damals mit einer Horde anderer Republikflüchtlinge meines Alters auf eine Oberschule. Mußte in Sachen Rechtsstaat und Demokratie eine Menge nachholen. Zu Englisch kam Französisch, dafür gab’s kein Russisch mehr. Auch wie der Kapitalismus, dank gesteuerter Arbeitslosigkeit, funktioniert, begann ich zu kapieren. War zwar kein glänzender Schüler, schaffte aber, was Mutter mir abverlangt hatte, das Abitur.
Auch sonst war ich bei allem, was nebenbei mit Mädchen ablief, ziemlich gut drauf und nicht einmal knapp bei Kasse, denn Mutter hatte mir, als ich mit ihrem Segen zum Klassenfeind wechselte, noch eine andere Westadresse zugesteckt: »Das is dain Vater, nähm ech an. Is ain Kusäng von mir. Der hat miä, kurz bevor er zum Barras mußte, dickjemacht. Jedenfalls globt der das. Schraib ihm mal, wie’s dir jeht, wenn de drieben bist…«
Man soll nicht vergleichen. Doch was das Pekuniäre betraf, ging es mir bald wie David Frankfurter in Bern, dem der ferne Vater monatlich ein Sümmchen aufs Schweizer Konto legte. Mutters Cousin — hab ihn selig — hieß Harry Liebenau, war Sohn des Tischlermeisters in der einstigen Elsenstraße, lebte seit Ende der fünfziger Jahre in Baden-Baden und machte als Kulturredakteur für den Südwestfunk das Nachtprogramm: Lyrik gegen Mitternacht, wenn nur noch die Schwarzwaldtannen zuhörten.
Da ich Mutters Schulfreundin nicht dauerhaft auf der Tasche liegen wollte, habe ich in einem an sich netten Brief, gleich nach der Schlußfloskel »Dein Dir unbekannter Sohn«, schön leserlich meine Kontonummer zur Kenntnis gebracht. Weil offenbar zu gut verheiratet, schrieb er zwar nicht zurück, hat aber jeden Monat pünktlich weit mehr als den niedrigsten Alimentesatz berappt, runde zweihundert Märker, was damals eine Stange Geld gewesen ist. Davon wußte Tante Jenny nichts, doch will sie Mutters Cousin Harry gekannt haben, wenn auch nur flüchtig, wie sie mir mit einem Anflug von Röte in ihrem Puppengesicht mehr gestanden als gesagt hat.
Anfang siebenundsechzig, bald nachdem ich mich in der Karlsbader Straße abgeseilt hatte, nach Kreuzberg gezogen war, darauf mein Studium schmiß und bei Springers »Morgenpost« als Volontär einstieg, hörte der Geldsegen auf. Habe danach meinem Zahlvater nie wieder, höchstens mal eine Weihnachtspostkarte geschrieben, mehr nicht. Warum auch. Auf Umwegen hatte mir Mutter auf einem Kassiber zu verstehen gegeben: »Dem mußte nicht groß Dankeschön sagen. Der weiß schon, wieso er blechen muß…«
Offen konnte sie mir damals nicht schreiben, weil sie inzwischen in einem volkseigenen Großbetrieb eine Tischlereibrigade leitete, die nach Plan Schlafzimmermöbel produzierte. Als Genossin durfte sie keine Westkontakte haben, bestimmt nicht mit ihrem republikflüchtigen Sohn, der in der kapitalistischen Kampfpresse zuerst kurze, dann längere Artikel gegen den Mauer- und Stacheldrahtkommunismus schrieb, was ihr Schwierigkeiten genug gemacht hat.
Nahm an, daß Mutters Cousin nicht mehr zahlen wollte, weil ich, statt zu studieren, für Springers Hetzblätter geschrieben habe. Irgendwie hat er ja recht gehabt auf seine scheißliberale Weise. Bin dann auch bald nach dem Anschlag auf Rudi Dutschke von Springer weg. War seitdem ziemlich links eingestellt. Habe, weil damals viel los war, für einen Haufen halbwegs progressiver Blätter geschrieben und mich ganz gut über Wasser gehalten, auch ohne dreimal mehr als den niedrigsten Alimentesatz. Dieser Herr Liebenau ist sowieso nicht mein Vater gewesen. Den hat Mutter nur vorgeschoben. Von ihr weiß ich, daß der Nachtprogrammredakteur gegen Ende der Siebziger, noch bevor ich geheiratet habe, an Herzversagen gestorben ist. War in Mutters Alter, etwas über fünfzig.
Von ihr bekam ich ersatzweise die Vornamen anderer Männer geliefert, die, wie sie sagte, als Väter in Frage gekommen wären. Einen, der verschollen ist, soll man Joachim oder Jochen, einen schon älteren, der angeblich den Hofhund Harras vergiftet hatte, Walter gerufen haben.
Nein, ich habe keinen richtigen Vater gehabt, nur austauschbare Phantome. Da waren die drei Helden, die mir jetzt wichtig sein müssen, besser dran. Jedenfalls hat Mutter selbst nicht gewußt, wer sie geschwängert hatte, als sie mit ihren Eltern am Vormittag des 30.Januar fünfundvierzig vom Kai Gotenhafen-Oxhöft weg als Siebentausendsoundsovielte eingeschifft wurde. Derjenige, nach dem das Schiff getauft worden war, konnte einen Kaufmann, Hermann Gustloff, als Vater nachweisen. Und derjenige, dem es gelang, das überladene Schiff zu versenken, ist in Odessa, weil er als Junge einer Diebesbande angehörte, die »Blatnye« geheißen haben soll, vom Vater Marinesko ziemlich oft verprügelt worden, was eine spürbar väterliche Zuwendung gewesen sein wird. Und David Frankfurter, der von Bern nach Davos reisend dafür gesorgt hat, daß das Schiff nach einem Blutzeugen benannt werden konnte, hat sogar einen richtigen Rabbi zum Vater gehabt. Aber auch ich, der Vaterlose, bin schließlich Vater geworden.
Was wird er geraucht haben? Juno, die sprichwörtlich runde Zigarette? Oder flache Orient? Womöglich, der Mode folgend, solche mit Goldmundstück? Es gibt von ihm als Raucher kein Foto außer einer späten Zeitungsabbildung, die ihn Ende der sechziger Jahre während des endlich erlaubten Kurzaufenthaltes in der Schweiz mit Glimmstengel als älteren Herren vorstellt, der seine Beamtenkarriere bald hinter sich haben wird. Jedenfalls hat er, wie ich, pausenlos gepafft und deshalb in einem Raucherabteil der Schweizerischen Bundesbahn Platz genommen.
Beide reisten per Bahn. Um die Zeit, als David Frankfurter von Bern nach Davos unterwegs war, befand sich Wilhelm Gustloff auf Organisationsreise. In deren Verlauf hat er mehrere Ortsgruppen der Auslands-NSDAP besucht und neue Stützpunkte der Hitlerjugend und des Bundes Deutscher Mädel, kurz BDM, gegründet. Weil seine Reise Ende Januar ihren Weg nahm, wird er in Bern und Zürich, Glarus und Zug vor Reichsdeutschen und Österreichern zum dritten Jahrestag der Machtergreifung eine jeweils mitreißende Rede gehalten haben. Da ihm bereits im Vorjahr von seinem Arbeitgeber, dem Observatorium, auf drängendes Verlangen sozialdemokratischer Abgeordneter gekündigt worden war, konnte er über seine Zeit frei verfügen. Zwar gab es, der agitatorischen Aktivitäten wegen, immer wieder innerschweizer Proteste — in linken Zeitungen hieß er »Der Diktator von Davos«, und der Nationalrat Bringolf forderte seine Ausweisung —, aber im Kanton Graubünden wie im gesamten Bund fand er genügend Politiker und Beamte, die ihn nicht nur finanziell stützten. Von der Kurverwaltung Davos wurden ihm regelmäßig die Namenslisten angereister Kurgäste zugespielt, worauf er die Reichsdeutschen unter ihnen, solange die Kur lief, zu Parteiveranstaltungen nicht etwa nur einlud, sondern aufforderte; unentschuldigtes Nichterscheinen wurde namentlich vermerkt und den zuständigen Stellen im Reich gemeldet.
Um die Zeit der Eisenbahnreise des rauchenden Studenten, der in Bern eine einfache, keine Hin- und Rückfahrkarte verlangt hatte, und während sich der spätere Blutzeuge im Dienst seiner Partei bewährte, hatte der Schiffsmaat Alexander Marinesko bereits von der Handelsmarine zur Schwarzmeer-Rotbannerflotte gewechselt, in deren Lehrdivision er an einem Navigationskurs teilnahm und dann zum U-Bootfahrer ausgebildet wurde. Zugleich war er Mitglied der Jugendorganisation Komsomol und bewies sich — was er im Dienst durch Leistung wettmachte — als außerdienstlicher Trinker; an Bord eines Schiffes hat er niemals die Flasche am Hals gehabt. Bald wurde Marinesko als Navigationsoffizier einem U-Boot zugeteilt, dem Sch 306 Pische; diese kurz zuvor in Dienst gestellte Schiffseinheit lief nach Kriegsbeginn, als Marinesko schon an Bord eines anderen U-Bootes Offizier war, auf eine Mine und sank mit der gesamten Mannschaft.
Von Bern über Zürich, dann an diversen Seen vorbei. Der Parteigenosse Diewerge hat sich in seiner Schrift, die den Weg des reisenden Medizinstudenten nachzeichnet, nicht mit Landschaftsbeschreibungen aufgehalten. Und auch der Kettenraucher im dreizehnten Semester wird nur wenig von den entgegenkommenden, schließlich den Horizont verengenden Gebirgszügen wahrgenommen haben, allenfalls Haus, Baum und Berg deckenden Schnee und den von Tunneldurchfahrten bestimmten Lichtwechsel.
David Frankfurter reiste am 31.Januar 1936. Er las Zeitung und rauchte. Unter der Rubrik »Vermischtes« stand einiges über die Aktivitäten des Landesgruppenleiters Gustloff zu lesen. Die Tageszeitungen, unter ihnen die »Neue Zürcher« und die »Basler Nationalzeitung«, wiesen das Datum aus und berichteten über alles, was gleichzeitig geschah oder sich als zukünftiges Geschehen ankündigte. Zu Beginn des Jahres, das als Jahr der Berliner Olympiade in die Geschichte eingehen sollte, hatte das faschistische Italien das ferne Reich des Negus, Abessinien, noch nicht besiegt und zeichnete sich in Spanien Kriegsgefahr ab. Im Reich machte der Bau der Reichsautobahn Fortschritte, und in Langfuhr zählte Mutter achteinhalb. Zwei Sommer zuvor war ihr Bruder Konrad, das taubstumme Lockenköpfchen, beim Baden in der Ostsee ertrunken. Er ist ihr Lieblingsbruder gewesen. Deshalb mußte sechsundvierzig Jahre nach seinem Tod mein Sohn auf den Namen Konrad getauft werden; doch wird er allgemein Konny gerufen und in Briefen von seiner Freundin Rosi als »Conny« angeschrieben.
Bei Diewerge steht, der Landesgruppenleiter sei am 3.Februar, müde von der erfolgreichen Reise durch die Kantone, zurückgekehrt. Frankfurter wußte, daß er am dritten in Davos eintreffen würde. Außer den Tageszeitungen las er regelmäßig das von Gustloff herausgegebene Parteiblatt »Der Reichsdeutsche«, in dem die Termine vorgemerkt standen. David war beinahe alles über sein Zielobjekt bekannt. Er hatte sich inhalierend vollgesogen mit ihm. Aber wußte er auch, daß sich im Jahr zuvor das Ehepaar Gustloff vom Ersparten ein Klinkerhaus in Schwerin hatte bauen lassen, vorsorglich möbliert für die geplante Rückkehr ins Reich? Und daß sich beide innig einen Sohn wünschten?
Als der Medizinstudent in Davos eintraf, war Neuschnee gefallen. Auf den Schnee schien die Sonne, und der Kurort sah wie auf Postkarten aus. Er war ohne Gepäck, doch mit fester Absicht gereist. Aus der »Basler Nationalzeitung« hatte er eine fotografische Abbildung Gustloffs in Uniform herausgerissen: ein hochgewachsener Mann, der angestrengt entschlossen guckte und dem Haarausfall zu einer hohen Stirn verhalf.
Frankfurter quartierte sich im »Löwen« ein. Er mußte bis zum Dienstag, dem 4.Februar, warten. Dieser Wochentag heißt bei den Juden »Ki Tow« und gilt als Glückstag; eine Information, die ich mir aus dem Internet gefischt habe. Auf nun vertrauter Homepage wurde unter diesem Datum des Blutzeugen gedacht.
Bei Sonnenschein rauchend auf harschem Schnee. Jeder Schritt knirschte. Am Montag fand die Stadtbesichtigung statt. Wiederholt die Kurpromenade auf und ab. Als Zuschauer zwischen Zuschauern unauffällig bei einem Eishockeyspiel. Zwanglose Gespräche mit Kurgästen. Weiß stand der Atem vorm Mund. Keinen Verdacht erregen. Kein Wort zuviel. Keine Eile. Alles war vorbereitet. Mit einem umstandslos gekauften Revolver hatte er in der Nähe von Bern auf dem Schießplatz Ostermundingen geübt, was erlaubt war. Sosehr er kränkelte, seine Hand hatte sich als ruhig erwiesen.
Am Dienstag wurde ihm, nun vor Ort, ein wetterfest beschrifteter Wegweiser — »Wilhelm Gustloff NSDAP« — behilflich: von der Kurpromenade zweigte die Straße »Am Kurpark« ab und führte zum Haus Nummer drei. Ein waschblau verputztes Gebäude mit Flachdach, an dessen Regenrinne Eiszapfen hingen. Wenige Straßenlaternen standen gegen die abendliche Dunkelheit. Kein Schneefall.
Soweit die Außenansicht. Weitere Einzelheiten blieben ohne Bedeutung. Über den Ablauf der Tat konnten später nur der Täter und die Witwe aussagen. Mir ist das Innere des betreffenden Teils der Wohnung auf einem Foto einsehbar geworden, das auf besagter Homepage den eingerückten Text illustrieren sollte. Das Foto wurde offenbar nach der Tat gemacht, denn drei frische Blumensträuße auf Tischen und einer Kommode, zudem ein blühender Blumentopf geben dem Raum das Aussehen eines Gedenkzimmers.
Nach dem Klingeln öffnete Hedwig Gustloff. Ein junger Mann, über den sie später ausgesagt hat, er habe gute Augen gehabt, bat um ein Gespräch mit dem Landesgruppenleiter. Der stand im Korridor und telefonierte mit dem Parteigenossen Dr. Habermann vom Stützpunkt Thun. Im Vorbeigehen will Frankfurter das Wort »Schweinejuden« aufgeschnappt haben, was Frau Gustloff später bestritten hat: Diese Wortwahl sei ihrem Gatten fremd gewesen, wenngleich er die Lösung der Judenfrage als unaufschiebbar angesehen habe.
Sie führte den Besucher in das Arbeitszimmer ihres Mannes und bat ihn, Platz zu nehmen. Kein Verdacht. Oft kamen unangemeldet Bittsteller, unter ihnen Gesinnungsgenossen, die in Not geraten waren.
Vom Sessel aus sah der Medizinstudent, der im Mantel mit dem Hut auf den Knien saß, den Schreibtisch, darauf die Uhr im leichtgeschwungenen Holzgehäuse, darüber den Ehrendolch der SA hängen. Oberhalb und seitlich des Dolches waren in lockerer Anordnung mehrere Abbildungen des Führers und Reichskanzlers schwarzweißer und farbiger Zimmerschmuck. Kein Bild des vor zwei Jahren ermordeten Mentors Gregor Strasser war auszumachen. Seitlich das Modell eines Segelschiffes, wahrscheinlich der Gorch Fock.
Ferner hätte der wartende Besucher, der sich das Rauchen versagte, auf einer neben dem Schreibtisch stehenden Kommode den Radioapparat sehen können, daneben des Führers Büste, entweder als Bronzeguß oder in Gips, dessen Bemalung Bronze vortäuschen sollte. Die fotografierten Schnittblumen auf dem Schreibtisch können schon vor der Tatzeit eine Vase gefüllt haben, liebevoll von Frau Gustloff arrangiert zur Begrüßung ihres Mannes nach anstrengender Reise, zudem als später Geburtstagsgruß.