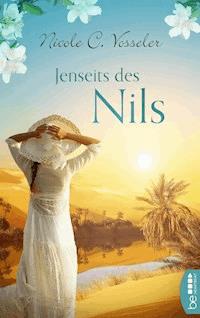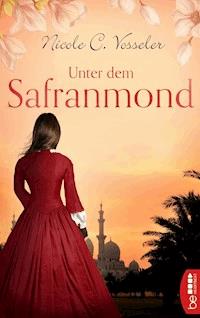4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Duft von Tee und Lilien … 1843 gilt Tee in London als das »grüne Gold«. Deshalb erhält der englische Botaniker Robert Fortune den Auftrag, ihn für die Horticultural Society aus China in die westliche Welt zu bringen. Niemals hätte der verschlossene Wissenschaftler damit gerechnet, im Reich der Mitte noch einmal sein Herz zu verlieren: an das ebenso mutige und kämpferische wie zerbrechliche Schwertmädchen Lian, das ihn lehrt, Pflanzen und Tee zu kategorisieren. Doch es ist eine Liebe, die nicht sein darf, denn nicht nur trennen die beiden Welten voneinander – auf den Botaniker warten zuhause auch Ehefrau und Kinder … »Mit akribischer Genauigkeit und atmosphärischer Dichte entführt Nicole C. Vosseler ihre Leser in eine ebenso exotische wie faszinierende Welt. Eine Menge historisches Wissen fügt sich nahtlos ein in einen mit überzeugendem Geschick entfalteten Handlungsbogen.« Rheinische Post - London, China, 19. Jahrhundert - Ein Love-and-Landscape-Roman über einen Botaniker, der in der exotischen Farbenpracht Chinas der Stimme seines Herzens folgt - Für Fans von Tara Haigh und Linda Holeman »Ein unvergleichliches, tiefgründiges Buch von hoher Qualität!« Amazon-Leserin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
1843 gilt Tee in London als das »grüne Gold«. Deshalb erhält der englische Botaniker Robert Fortune den Auftrag, ihn für die Horticultural Society aus China in die westliche Welt zu bringen. Niemals hätte der verschlossene Wissenschaftler damit gerechnet, im Reich der Mitte noch einmal sein Herz zu verlieren: an das ebenso mutige und kämpferische wie zerbrechliche Schwertmädchen Lian, das ihn lehrt, Pflanzen und Tee zu kategorisieren. Doch es ist eine Liebe, die nicht sein darf, denn nicht nur trennen die beiden Welten voneinander – auf den Botaniker warten zuhause auch Ehefrau und Kinder …
Über die Autorin:
Nicole C. Vosseler, geboren 1972 am Rand des Schwarzwalds, finanzierte sich ihr Studium der Literaturwissenschaften und der Psychologie mit einer Reihe von Nebenjobs. Bereits früh für ihre Kurzprosa, für Essays und Lyrik ausgezeichnet, wandte sie sich später dem Schreiben von Romanen zu. Nicole C. Vosseler lebt in Konstanz, in einem Stadtteil, der ganz offiziell Paradies heißt. Wenn sie nicht an einem ihrer Romane arbeitet, reist sie mit der Kamera um die Welt, wo sie sich als selbsternannte Food-Ethnologin betätigt, trotz ihrer Höhenangst auch mal einen Vulkan besteigt und auch sonst das Abenteuer sucht.
Die Website der Autorin: nicole-vosseler.de
Die Autorin bei Facebook: facebook.com/Nicole-C-Vosseler
Die Autorin auf Instagram: instagram.com/nicolecvosseler/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin »Das Geheimnis des Perlenohrrings«, »Im Land der Teegärten« und »Die Hüterin der verlorenen Dinge«.
***
eBook-Neuausgabe März 2025
Dieses Buch erschien bereits 2016 unter dem Titel »Der englische Botaniker« bei Harper Collins
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Nicole C. Vosseler
Copyright © für die deutsche Ausgabe 2016 by HarperCollins
in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-653-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Nicole C. Vosseler
Im Land der Teegärten
Roman
dotbooks.
Motto
Für alle Suchenden.
Für die Träumer.
Und für die Abenteurer des Geistes,
denen kein Meer zu weit,
kein Berg zu hoch und kein Weg zu lang ist.
Historie
(Substantiv, f.; gr. ἱστορία; lat. historia; fr. histoire)
1.Sammlung von Fakten und Ereignissen aus der Vergangenheit
2.Geschichtswissenschaft
3.Zeitspanne in der Vergangenheit
4.Abenteuerliche oder erdichtete Erzählung
Arthur Waldegrave-Fernsby,
An Essential Dictionary of the English Language, London, 1852
... aber Poeten waren auch noch nie Botaniker.
Charlotte Turner Smith, Beachy Head, 1807
Prolog
Geschichten keimen aus Körnchen von Tatsachen.
Geschichten wachsen und gedeihen unter den Elementen der Möglichkeit, im weiten Feld grenzenloser Vorstellungskraft. Treiben fantastisch anmutende Blüten und tragen Früchte von eigener Wahrhaftigkeit.
Wie diese Geschichte, die sich zugetragen und doch nicht zugetragen hat.
Damals.
Queen Victoria ist eine noch junge Königin, und die Daguerreotypie hat es gerade erst möglich gemacht, die Zeit in Grautönen und Sepia einzufrieren.
Eine Zeit, in der die bunten Flächen auf den Weltkarten noch weiß gefleckt sind.
Alexander Gordon Laing hat als erster Europäer die sagenhafte Stadt Timbuktu erreicht; zwei Jahre später ist René Caillié der erste Europäer, der lebend von dort zurückkehrt. Schon bald wird Johannes Rebmann der erste Weiße sein, der den Kilimanjaro erblickt, und nach David Livingstone werden sich auch Richard Francis Burton und John Hanning Speke aufmachen, die Quellen des Nils zu finden.
Terra incognita.
In Afrika. Amerika. Asien.
Unterdessen schwärmen die Untertanen Queen Victorias in die Wälder und Wiesen aus und fangen Schmetterlinge und Käfer; pressen Gräser und Blumen, um sie in ein Herbarium zu kleben. An den Küsten klauben sie Muscheln und Fossilien auf und versammeln sich abends im heimeligen Wohnzimmer um ein Mikroskop, das für wenig Geld zu haben ist.
Die Londoner Royal Botanical Gardens in Kew sind soeben erst für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden und werden innerhalb kurzer Zeit Hunderttausende Besucher im Jahr anlocken, mehr als Windsor Castle oder der Tower of London.
Es ist die große Stunde der Leidenschaft für die Natur, der unterhaltsamen und lehrreichen Lobpreisung ihres Schöpfers.
Während Charles Darwin in der Grafschaft Kent noch an seiner Theorie der Entstehung der Arten schreibt, ziehen Pflanzenjäger in die Welt hinaus, um die Sehnsüchte dieser Ära zu stillen und gleichzeitig neu zu entfachen.
Das Orchideendelirium und den Rosenwahn. Die Päonienmanie, das Palmenfieber und die Pteridomania – die Besessenheit von Farnen jedweder Gestalt.
Die Botanik ist zur Schatzsuche geworden.
Als im Namen zweier Pflanzen sogar Imperien in den Krieg ziehen, werden die Karten der Welt neu gezeichnet. Eine Tür öffnet sich, nur einen Spalt breit, doch weit genug, um einen Fuß hineinzusetzen.
In ein fernes, verbotenes Reich.
Irgendwo zwischen Legende und Wirklichkeit.
***
Hier sterben.
Im Bauch dieses Schiffs.
Ein Treibhaus, nicht aus Eisen und Glas und Sonnenlicht, sondern aus feuchtem Holz und Dunkelheit. In dem der Geruch von Bilgewasser und verrottendem Fisch wucherte. Das Fieberschweiß gären ließ und Atemdampf zu klebrigem Harz verdickte.
Dieser Lastkahn war ein elender Ort, um zu sterben. Als Fremder in einem noch fremderen Land, sechstausend Meilen fern von zu Hause.
Seine langen Beine hatten keinen Platz mehr in der Koje gefunden, die für Männer von niedrigerem Wuchs gebaut worden war. Nicht für einen Körper wie seinen, der von schottisch schroffer Grobknochigkeit war. Robust wie Unkraut nach einer Kindheit auf dem offenen Feld, der Lehrzeit in herrschaftlichen Gärten. Unter freiem Himmel und der Sonne, in frischer Luft, Wind und Regen abgehärtet, war er in dreißig Jahren nicht einen Tag krank gewesen.
Bis das Fieber kam.
Die Saat dafür musste er in Hongkong aufgelesen haben, in dieser kochenden Hitze, die aus der Luft zähes Gelee machte. An manchen Tagen hatte sein Thermometer vierundneunzig Grad Fahrenheit angezeigt, und nie war das Quecksilber unter die Marke von achtzig Grad gefallen, selbst in den Nächten nicht.
Ein Paradies für Fäulnis und Verfall, Fieber und Cholera.
Erst vor zweieinhalb Jahren, während des Krieges, war Hongkong für die Krone beschlagnahmt worden, und schon war der kleine englische Friedhof überfüllt, die Erde rot und frisch nach den jüngsten Begräbnissen: Major Pottinger. The Honourable J. R. Morrison. Mr Dyer, der lange in den Tropen, in Penang und Malacca, gelebt hatte, und Mr Stronach, die beide in Singapur an Bord der Emu gekommen waren.
Fremde hier wie er selbst und allzu flüchtige Bekanntschaften: heute gesund, morgen vom Fieber ergriffen und innerhalb weniger Tage dahingerafft. Hastig beerdigt unter einer Sonne, deren Gewalt von keinem noch so schmalen Schatten gemildert wurde.
Die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass es ihm genauso erging.
Nur würde sein Grab das Südchinesische Meer sein, irgendwo zwischen Hongkong und Amoy.
Ein Narr war er gewesen, in dieses Abenteuer aufzubrechen.
Er war kein Abenteurer. Nur ein einfacher Gärtner, der das Gleichmaß seiner Tage schätzte und den langsamen, ruhigen Fluss der Jahreszeiten. Der noch nie über die britische Insel hinausgekommen war.
Wenigstens war für Jane und die Kinder – der Junge war noch ein ganz kleines Würmchen – gesorgt; dafür hatte er Vorkehrungen getroffen.
Er hatte um die Gefahr gewusst.
John Forbes konnte noch afrikanische Orchideen nach England schicken, bevor er am Ufer des Sambesi starb. Und als John Potts aus Indien zurückkehrte, hatte er nicht nur Primelsamen im Gepäck, sondern auch den Keim eines tödlichen Fiebers im Leib.
Trotzdem war er hierher aufgebrochen, kaum dass die Tinte unter dem Vertrag von Nanking getrocknet war, angelockt von der Aussicht auf unermesslichen Reichtum an Pflanzen.
China hatte der Welt den Pfirsich geschenkt und die Aprikose, verschiedene Zitrusfrüchte und den Rhabarber. Tigerlilien, Chrysanthemen und Hortensien.
Wie viel mehr mochte es noch zu entdecken geben in diesem monumentalen, dem Westen seit Jahrhunderten verschlossenen Reich?
Allein der Hafen von Canton war zugänglich gewesen, Umschlagplatz für Opium aus Indien, für Tee und die anderen Kostbarkeiten Chinas. Die Händler, die von dort zurückkehrten, versicherten, dass es die opulenten Päonien, mit denen das importierte Porzellan bemalt war, wirklich gab. Mit eigenen Augen hatten sie sie gesehen, die Kamelien und Magnolien, die prächtigen Rosen, die man zu Hause von den kunstvoll verzierten Fächern kannte, von Seidenstoffen und Tapeten, und sie berichteten von Gärten voller Wunder.
Ein Lebenstraum für jeden Botaniker.
Eine unglaubliche Chance für einen Gärtner wie ihn.
So erdverhaftet und nüchtern er auch war – als er, noch an Bord der Emu, nach den langen Wochen auf See die Berge und Täler Javas gesehen hatte, war er ins Schwelgen geraten. Nur von Deck aus, nur aus der Ferne. Üppig grüne Landschaften, über denen die Luft vibrierte vor Saftigkeit und die ahnen ließen, wie viele Nuancen dieses Grüns es dort geben musste. Wie viele Formen von Blättern. Welche Fülle an Blüten.
Was ihn dann erst in China, dem legendären Reich der Blumen, erwarten mochte!
Der Schock folgte jedoch wenige Tage später, als er den ersten Blick auf die chinesische Küste warf. Auf sonnenverbrannte Hügel, nackten roten Lehm und Granitbrocken. Eine Mondlandschaft, tot und leer bis auf ein paar verkrüppelte Kiefern, die um ihre kümmerliche Existenz rangen.
Dies konnte nicht das blühende Land sein, das man ihm versprochen hatte.
Er durfte hier nicht sterben.
Nicht bevor er wieder nach Hause zurückgekehrt war. Zu seiner Frau. Seinem kleinen Mädchen. Seinem Sohn, den er noch kaum kennengelernt hatte.
Nicht auf diesem elenden Kahn, der ihn mit seinem Schaukeln und Rollen noch kränker machte. An diesem Fieber, in dem er siedete wie ein Stück Fleisch im Topf. Das Muskeln, Sehnen und Knochen weichkochte. Seinen Verstand zerfaserte.
Er versuchte, die Namen der wenigen Pflanzen zu memorieren, die er in Hongkong gesammelt hatte, kaum ein Dutzend. Und scheiterte; dem Chaos des Fiebers hatten auch Systematik und Logik nichts entgegenzusetzen.
Er begann von tausend an rückwärts zu zählen. Seit Kindertagen seine Methode, Ordnung zu schaffen. Klarheit zu gewinnen, wenn botanische Namen und Fakten wie Bienen in seinem Kopf herumsurrten. Wenn er sich in einem Dickicht aus Gedanken und Fragen verfangen hatte und deshalb nicht schlafen konnte.
Aber er bekam die Zahlen, seine treuen Freunde, nicht zu fassen. Ausweichend und launisch zeigten sie sich; wie irrlichternde Glühwürmchen in seinem sich verdunkelnden Verstand.
Haltsuchend klammerte er sich an den Gedanken an seine Familie.
Jane. Helen. John.
Gesichter, die zu Schatten verflachten. Sich ihm entzogen, ihn leer und ausgehöhlt zurückließen.
Sein Körper schien gewichtslos.
Ein dürres Blatt, das durch die Luft kreiselte und sich in der Finsternis verlor.
Er wanderte durch dichten Nebel.
Wie in einem Traum.
Nicht der reine Nebel über den Felsen und Wiesen seiner Heimat Berwickshire. Zäh und schwül fühlte es sich an; ein fauliger, geradezu giftiger Brodem, kaum zu durchdringen und sogar die Sonne verdunkelnd. Dann riss die Nebelwand auf, und für einen Moment war Fortune beinahe geblendet.
Er glaubte Blüten über Blüten zu sehen, in allen Farben des Regenbogens und purem Weiß. Paläste aus Rhododendren vor dem Hintergrund eines tropischen Waldes. Fontänen aus Lilien und Päonien, Kaskaden von Kletterrosen und Orchideen wie exotische Schmetterlinge. Die Luft war klar, sie roch süß mit einer fremdartigen Würze darin, und bei jedem seiner Schritte über den weichen Boden stieg der Duft von frischem Gras und von Kräutern auf.
Das hier musste ein Traum sein, eine Fata Morgana in der Hitze des Fiebers. Eine Fantasie, die ihm wirklicher schien als alles, was er zuvor je gesehen hatte, überwältigend intensiv und betörend.
Er wollte nicht, dass es ein Traum blieb, und streckte die Hand nach den Blütenzweigen aus. Zum Greifen nah waren sie, er konnte den Pollen auf den Staubblättern erkennen, jede Verästelung der Blattadern, und dennoch konnte er sie nicht erreichen.
Seine Knie gaben nach, und er fiel, tiefer als der Boden unter ihm.
In einem Boot schaukelte er über einen Fluss, unter einem Gewölbe aus Baumkronen, schattig und kühl.
Er horchte auf, wandte sich um; hatte ihn jemand gerufen? Eine körperlose Stimme, silberhell und lockend, irgendwo hinter dem grünen Wasserfall einer Trauerweide.
Sehnsucht zerrte an ihm, aber er konnte nicht anhalten, nicht umkehren. Unaufhaltsam glitt das Boot vorwärts über den Fluss, auf die Mündung zu und hinaus auf das Meer.
Ein Gefühl wie Heimkehr und Verlust zugleich.
Von irgendwoher strömte frische Luft in die Koje und kühlte seine glühende, schweißnasse Haut. Frisch roch dieser Luftzug, nach Salz und Hoffnung, und ließ ihn leichter atmen.
Es gab keinen Weg zurück.
Nur vorwärts. Vorwärts.
Er würde nicht sterben. Nicht auf diesem Kahn.
Nicht bevor er wenigstens einen Blick in dieses legendäre Reich der Kamelien geworfen hatte, der Rosen und der Azaleen.
Herbstanemone
(Anemone hupehensis)
Anemone. Einsam. Verlassen.
Flora Greensleeves, The Language of Flowers, London, 1837
Es kann getrost behauptet werden, dass nirgendwo sonst auf der Welt innerhalb der Grenzen eines einzigen Königreiches solch eine Vielfalt an Pflanzen und Tieren zu finden ist.
Aus den Tagebüchern des Jesuitenpaters Matteo Ricci, um 1610
Aus den Instruktionen der Horticultural Society of London, 21 Regent Street, für Mr Robert Fortune, Leiter der Treibhäuser in Chiswick Gardens.
Datiert vom 23. Februar 1843
Sie werden an Bord der Emu reisen, auf der eine Koje für Sie reserviert ist. Für die Dauer der Überfahrt werden Sie am Tisch des Kapitäns speisen.
Ihr Salär wird einhundert Pfund Sterling betragen, beginnend mit dem Zeitpunkt, an dem Sie die Verantwortung für die Treibhäuser abgeben, und befristet bis zu dem Tag, an dem Sie diese nach Ihrer Rückkehr aus China wieder übernehmen – ohne jegliche Abzüge und ausschließlich der Kosten für Ihre Kleidung oder Ausgaben, die erforderlich sein werden, um die Ziele der Society zu erreichen.
Die allgemeinen Ziele dieser Mission sind:
Samen und lebende Pflanzen dekorativer oder nützlicher Art, die noch nicht in Großbritannien kultiviert sind, zu sammeln. Kenntnisse über Gartenbau und Landwirtschaft in China sowie über die Beschaffenheit des Klimas und seines Einflusses auf die Vegetation zu erlangen.
Da die Beziehungen zwischen China und England derzeit sehr angespannt sind, sieht sich die Society aktuell nicht in der Lage festzulegen, welche Häfen Sie besuchen oder in welche Regionen sich Ihre Forschungen erstrecken sollen.
Ebenso wenig kann die Society absehen, was Sie während Ihres Aufenthalts in China erwarten wird, der nach gegenwärtigem Stand auf ein Jahr begrenzt ist. Dementsprechend bleibt es Ihrer eigenen Einschätzung überlassen, wie Sie dabei vorgehen, wenn Sie das Land betreten oder Kontakte zu knüpfen versuchen.
Es ist angeraten, gegen ein kleines Entgelt Chinesen anzuwerben, die Ihnen Pflanzen aus dem Landesinneren beschaffen, aus Gegenden, die für Sie selbst schwierig zu erreichen oder nur unter Gefahr zugänglich sind. Ungeachtet dessen werden Sie während dieser Reise gänzlich auf sich allein gestellt sein, wobei den oben genannten Zielen der Society stets allerhöchste Priorität einzuräumen ist.
Gez.
John Lindley
(Sekretär)
Kapitel 1
Dienstag, 12. September 1843
Wetter sonnig, bei einem Maximum von 86 Grad Fahrenheit. Minimum: 68 Grad.
Von Amoy nach Chimoo übergesetzt, gut 50 Meilen nördlich. Dem Hörensagen nach einige Jahre lang Anlaufstelle für Opiumschiffe, sogar während des Krieges, ungeachtet der Gesetze der Mandarine.
Ein Menschenleben ist in einigen Teilen dieses Landes ohnehin nicht viel wert, aber gerade diese Küstenregion hat keinen guten Ruf. Die Einheimischen hier sind ein eigenständiger und gesetzesloser Menschenschlag.
Zuweilen komme ich mir vor wie in einem Nest von Dieben und Räubern.
Aus den Notizen von Robert Fortune
Robert Fortune marschierte durch die Salzgärten: Wasserflächen wie Spiegelscherben, auf denen die Sonne blinkte und an deren Rändern sich das weiße Gold des Meeres häufte.
Mit langen Schritten durchmaß er die Felder dahinter, ein Flickwerk aus Süßkartoffeln und Erdnusspflanzen.
Dutzende, vielleicht Hunderte von Augenpaaren hatten sich an ihm festgesaugt. Jede Hacke, jeder Rechen und jeder Spaten verharrte bewegungslos. Kein Finger wurde mehr gerührt.
Nur ein kleiner Junge war in Bewegung und äffte ihn nach, indem er umherstelzte wie ein Graureiher.
So viele Gesichter, kaum voneinander zu unterscheiden, die ihm folgten wie Sonnenblumen dem Licht, jedes Mal, wenn er irgendwo auftauchte, seinen Beutel mit Gartengerät über der Schulter und die Botanisiertrommel quer umgehängt. Selbst wenn er nicht bis auf die Haut durchnässt war und Wasser vom Rand seines Huts tropfte wie heute, nachdem vor der Felsenküste gischtsprühende Wellen über die Nussschale von Boot hereingebrochen waren.
Neugier schwang in diesem stummen Starren mit. Argwohn. Manchmal fast so etwas wie Hass.
Die Erinnerung war noch zu frisch. An den Krieg um Opium und Tee, in dem Großbritannien mit seiner modernen Militärmaschinerie China in die Knie zwang.
China mochte eines der größten Reiche sein, das die Welt je gesehen hatte, ein Drittel der Menschheit beherbergen und mehr Reichtümer besitzen als alle anderen Länder. Doch Großbritannien war nun tatsächlich das Empire, in dem die Sonne niemals unterging. Dem weder die Natur noch andere Völker Grenzen zu setzen vermochten.
Eine ungeheure Schmach für das stolze Reich der Mitte.
fan-kwai war einer der ersten Begriffe, die Robert Fortune hier gelernt hatte.
Fremder Teufel.
Erst ein Stück bergan konnte er die Blicke abschütteln, hinter den kegelförmigen Grabhügeln, denen er überall an der Küste begegnete.
Eine Mahnung, wie zerbrechlich das Leben war.
Eine Erinnerung daran, wie nahe er selbst vier Wochen zuvor noch dem Tod gewesen war, auf dem Lastkahn zwischen Hongkong und Amoy. Obwohl seiner Physis nichts mehr anzumerken war; wie ein Phoenix war er aus dem Fieber hervorgegangen, nur ein paar Tage schwach auf den Beinen gewesen und danach schnell wieder zu Kräften gekommen.
Entstehen, Wachsen und Vergehen – das war der verlässliche Kreislauf der Natur. Die Ordnung der Welt.
In das knöcherne Gesicht des Todes geblickt zu haben, saß ihm trotzdem immer noch im Genick. Die Erfahrung, dass er nur um Haaresbreite mit dem Leben davongekommen war.
Dieses kleine, einfache Leben, das bisher so unaufgeregt und stets aufgeräumt gewesen war. Ein gutes Leben war es; er konnte sich nicht beklagen. Besser als das seines Vaters und seines Großvaters.
Zum Leiter der Treibhäuser der Horticultural Society hatte er es gebracht, obwohl er nie eine andere Schule besucht hatte als die Pfarrschule von Edrom. Und trotz seiner Unbeholfenheit im Umgang mit dem anderen Geschlecht, dieser schönen und fremden Spezies, hatte er eine Frau gefunden, die ihn zum Ehemann und Vater machte.
Seit mittlerweile fünf Jahren flickte Jane seine Jacke, wenn er wieder einmal an Dornen hängen geblieben war, und seine Hemden; stopfte seine Socken und strickte von Zeit zu Zeit neue. Sie sorgte dafür, dass abends eine warme Mahlzeit auf ihn wartete und ein jede Woche frisch bezogenes Bett.
Jane hatte seine Behausung in ein Heim verwandelt. In ein behagliches Nest für seine eigene kleine Familie.
Genug Gründe, um dankbar zu sein. Zufrieden, ja geradezu glücklich. Und trotzdem hatte er seine Siebensachen gepackt, gegen Janes Willen. Aber letztlich mit ihrem Segen.
Keine Selbstverständlichkeit, das war ihm bewusst.
Eine fortschrittliche Ehe hatten sie gewollt – anders als ihre Eltern, ihre Großeltern und Janes Schwestern. Eine, in der es keinen Herrn gab, keine Herrin. In der jeder seinen Bereich hatte, der ihn ausfüllte, und den anderen daran teilhaben ließ.
Ein gemeinsames Leben wollten sie sich schaffen, in dem sie ihre Gedanken und Pläne teilten, ihre Freuden und Sorgen und zusammen Entscheidungen trafen. Ein Leben, das ihnen beiden behagte und in dem ihre Kinder zu glücklichen und selbstbestimmten Menschen heranwachsen konnten.
Er konnte Gott nicht genug danken, dass er ihm eine solche Frau geschenkt hatte. Die sogar verstand, dass er mehr von diesem Leben wollte.
Mehr Geld, um nicht jeden Shilling zweimal umdrehen zu müssen. Mehr Erfolg. Vielleicht sogar seine Spuren in der Welt der Botanik hinterlassen, mochten sie auch noch so schmal und nicht besonders tief sein.
Indem er die sagenhaften Blütenschätze Chinas fand.
Fortune betrachtete die filigranen Anemonen auf dem Grabhügel, die Blütenblätter reinweiß, der Kreis der Staubblätter golden wie eine kleine Sonne.
Anemone hupehensis.
Auf jedem Grabhügel, den er in China gesehen hatte, zitterten Anemonen im Wind.
In Hongkong. In Amoy und Namoa. Und jetzt hier, in der Bucht von Chimoo.
In England die Blume der Verlassenheit. Der einsamen Seelen.
Er hätte gern gewusst, welche Bedeutung sie hierzulande hatte.
Wang konnte er nicht fragen. Dessen Englisch war zwar ordentlich, ging aber nicht über das hinaus, was man sehen und greifen, zählen und verhandeln konnte. Während er selbst feststellen musste, dass das rudimentäre Wörterbuch, mit dem ihn die Society ausgestattet hatte, fehlerhaft und kaum brauchbar war. Zumal die Dinge in verschiedenen Landstrichen unterschiedliche Namen trugen.
Außerdem sprach Wang nicht mehr mit ihm. Gekränkt war er, immer noch. Nachdem die Pflanzen, um die Fortune ihn geschickt hatte, keine Gnade in dessen Augen gefunden hatten, waren sie doch welk und bis zur Unkenntlichkeit zerquetscht gewesen. Weil er Wangs Ausrede, weiter die Hügel hinauf sei es zu gefährlich, beiseite wischte. Sich kurzerhand ein Boot mietete, um von Amoy nach Chimoo überzusetzen und dort selbst auf die Suche zu gehen.
Jeder Schritt ein unausgesprochener Vorwurf und eine Verwünschung, stapfte Wang hinter ihm her. Wortlos. Zum ersten Mal, seitdem Wang ihn begleitete, als Fremdenführer und rechte Hand, Dolmetscher und Leibwächter.
Zu dem Kauderwelsch aus Englisch und Chinesisch, das Wang sonst pausenlos über ihn ergoss, allerdings eine erholsame und mehr als willkommene Abwechslung.
Während er in seinen festen Stiefeln bergan stieg, der Pagode auf dem höchsten Punkt der Hügel entgegen, vergaß Fortune beinahe, dass Wang hinter ihm ging.
Auf eigene Faust in der Natur umherzustreifen, behagte ihm. Weitaus mehr, als im Schlepptau eines Landsmanns eine Singsong-Veranstaltung zu besuchen oder die Gärten eines Mandarins zu besichtigen.
Die Engländer in Hongkong, in Namoa und Amoy waren Händler, Verwaltungsbeamte, Seeleute und Offiziere. Eine ruppige Gattung von Männern, die viel tranken und rauchten, auch einer Opiumpfeife nicht abgeneigt waren und sich mit handfesteren Dingen als Zierpflanzen beschäftigten.
Als Gärtner auf Forschungsreise war er unter seinen eigenen Landsleuten genauso ein Exot wie in den Augen der Chinesen.
Das Begehren, das eine Orchidee oder eine Päonie bei den Lords und Ladys zu Hause weckte, war hier keine gültige Währung.
Er marschierte auf das Grün zu, das sich in den Felsspalten festklammerte. Möglicherweise eine Art von Gesneriaceae?
Die Aussicht darauf, hier in Chimoo endlich einen der legendären Pflanzenschätze zu heben, beschleunigte seine Schritte, verlieh ihm Flügel.
So gründlich er die Insel von Hongkong auch abgegrast hatte, von den rauen Bergen bis hin zum blauen Wasser der Bucht, es war nichts darunter gewesen, was man in England nicht schon kannte.
Jasminum sambac. Olea fragrans. Chrysanthemen.
Nichts Besonderes. Aufregendes. Aufsehenerregendes.
Ein paar leidlich hübsche Rosen ohne Duft und Paederia foetida, eine zierlich blühende Rankpflanze, die jedoch nach Schwefel stank.
Nicht das, weswegen man ihn hierher geschickt und was er selbst sich erhofft hatte.
Die kleine gelbe Orchidee, von der er ganze Felder auf den höchsten Hügeln Hongkongs entdeckt hatte, ähnelte mehr einer Wiesenblume als den Prachtexemplaren, die man in England begehrte.
Für eine Spathoglottis fortunei würde niemand hundert Guineen ausgeben, so wie es der Duke of Devonshire unlängst für eine Phalaenopsis amabilis von den Philippinen getan hatte, die so weiß war wie frisch gefallener Schnee.
Spathoglottis fortunei war nicht gut genug. Nicht genug für Ruhm. Für Reichtum.
Kehrte er nicht oder auch nur mit leeren Händen nach England zurück, würde die Society jemand anderen schicken. Jemand, der diese Chance zu nutzen verstand. Dem es gelang, die ersehnten Blütenschätze nach Hause zu bringen und sich einen Namen zu machen.
Erst als er die Stimmen hinter sich nicht länger ausblenden konnte, blieb er stehen und drehte sich um.
Eine Menschentraube umringte Wang, der sich wichtigtuerisch aufplusterte und seine Worte mit großen Gesten unterstrich. Auf eine ungeduldige Bewegung von ihm stob die Menge auseinander und strömte den Hang hinunter.
»Was hast du zu ihnen gesagt?«
»Fu-Chung wichtiger Herr«, keuchte Wang ihm entgegen. »Erntet Gras und Blumen. Für viel Geld.«
»Du hast ihnen gesagt, ich hätte viel Geld?!«
Ärger wallte in Fortune auf. Diese Behauptung war nicht nur fahrlässig, sondern auch unwahr; neben seinem geringen Salär hatte ihn die Society nur mit bescheidenen finanziellen Mitteln für diese Expedition ausgestattet.
Wang sog den Atem ein, wie missbilligend; vielleicht war er auch nur außer Puste.
»Fu-Chung weiß nichts von China! Viel Geld gibt Fu-Chung viel Gesicht. Gut für Fu-Chung. Und gut für Wang!«
Ein kleines Grinsen entblößte seine vorstehenden Zähne und verlieh ihm das Aussehen eines boshaften Esels. Noch dazu mit den abstehenden Ohren, die die ausrasierte Stirn schonungslos preisgab.
Wang schien versöhnlicher gestimmt, trotzdem zögerte Fortune, eine Diskussion vom Zaun zu brechen. Nicht nur, weil er fürchtete, im Dickicht der Sprache misszuverstehen und missverstanden zu werden; vermutlich würde er bei Wang ohnehin den Kürzeren ziehen.
Fortune war nicht hier, um Freunde zu gewinnen. Aber dass das ursprünglich klare Dienstverhältnis zwischen ihnen schon jetzt auf tönernen Füßen stand, missfiel ihm. Und mehr noch missfiel ihm, wie viele Fallstricke sich darin durch Sprachbarrieren und unterschiedliche Gepflogenheiten ergaben.
Er beließ es bei einem ungehaltenen Knurren, von dem er hoffte, dass es autoritär genug klang, und eilte weiter die Steigung hinauf.
Den Pflanzen entgegen, die ihn aus der Ferne angelockt hatten.
Bei denen es für ihn keine Zweifel gab und keine Unsicherheiten.
Gesneriaceae, in der Tat: eine Chirita, die eleganten Blütenglöckchen in einem sanften Blaulila getönt.
Chirita sinensis würde er sie nennen, chinesische Chirita.
Ein veilchenähnliches und sehr schönes Pflänzchen. Mit den silberpelzigen Blättern wohl zu exotisch für einen Cottage-Garten. Falls es sich überhaupt als winterhart erwies. Feminin in Farbe und Form, würde es sich aber hervorragend als Topfpflanze für ein Boudoir eignen, vielleicht auch für einen Wintergarten.
Laute Rufe schreckten ihn auf, und eine aufgeregte Horde trampelte über die zarten Chirita hinweg, Männer, Frauen und Kinder.
Er brauchte die Worte nicht zu kennen, die sie ihm entgegenschleuderten, mit denen sie sich gegenseitig überschrien. Die Gestik, die Mimik waren unmissverständlich, selbst für einen Fremden vom anderen Ende der Welt.
Eine Chinesin, einen Säugling auf den Rücken gebunden, wedelte mit einem Büschel schlaffen Krauts vor seiner Nase herum. Eine andere schubste sie beiseite und hielt ihm fordernd eine Handvoll Erdnüsse hin. Die verschrumpelte Wurzel, die ihm in einer runzligen Faust entgegengereckt wurde, traf ihn beinahe am Auge, und gleich mehrere Männer winkten mit Bündeln von Chilischoten. Sogar eine Flasche Reisschnaps wurde ihm vor die Brust gestoßen, offenbar als Tauschgegenstand für das Halstuch aus Seide gedacht, das Jane ihm zum Abschied geschenkt hatte.
Seine abwehrenden Gesten wurden ignoriert, sein ablehnendes Gestammel überhört; auch Wangs erregter Redefluss ging im Geschrei einfach unter.
Als sich gierige Finger nach seinem Halstuch streckten, ihn am Ärmel zupften und am Gurt der Botanisiertrommel rissen, hatte er genug.
Er floh, den Hügel hinauf, wie vor den aufdringlichen Wespen eines Spätsommers.
Das zuvor auf der Haut getrocknete Hemd klebte wieder feucht an seinem Rücken, als er oben ankam, schwer atmend und mit brennenden Beinmuskeln, aber endlich allein.
Im Zickzack lief er durch das Ruinenfeld wie bei einem Versteckspiel und suchte Zuflucht in der Pagode.
Schäbig sah sie von Nahem aus; ein vergessenes Überbleibsel einer anderen Zeit. Durch Löcher in den geschwungenen Dächern heulte der Wind, und die Gesichter der Götzenbilder waren von den Elementen bis zur Unkenntlichkeit abgeschliffen.
Ein Ort der Stille. Der Kontemplation. Das war spürbar.
Aber so anders als alle Kirchen, die er bisher von innen gesehen hatte, dass er sich nicht vorstellen konnte, wie man hier betete.
Es stimmte zweifellos: Fortune wusste nicht das Geringste über China, und es verlangte ihn auch nicht danach.
So fern, so unerreichbar war China, dass in der Vorstellung des Westens ein Märchenland daraus geworden war. Seit den alten Tagen der Seidenstraße eine Legende, an der beständig weitergesponnen wurde, mit Seemannsgarn und Händlerlatein.
Die einzige Karte, die es von China gab, war mehr als hundert Jahre alt, angefertigt nach den Aufzeichnungen der letzten Jesuiten in China. Wie das Fell eines englisches Langhornrinds mehr weiß als farbig, beruhte sie hauptsächlich auf grobem Augenmaß und Hörensagen; an manchen Stellen war sie sogar mit Vermerken versehen wie Hier soll es Drachen geben.
Allein schon die geografischen Namen auf dieser Karte klangen im Englischen nach einem Fabelreich.
Insel der duftenden Ströme. Glückliches Tal.
Perlfluss. Goldstaubfluss.
Stadt auf dem Meer.
Wüste der verlassenen Orte.
Fluss, der durch den Himmel fließt.
Jadeberg. Lotosinsel.
Fluss der Neun Drachen.
Das Reich des sprichwörtlichen Kaisers von China. Des Himmelssohns, der über Reisbauern und Mandarine herrschte. Über Bettlerkönige, fliegende Mönche und überirdisch schöne Damen, die ihre Porzellangesichter halb hinter bemalten Fächern verbargen. Wo blutrünstige Tiger umherstreiften, Nashörner stoisch ihrer Wege gingen und schwarz-weiße Bären in Bambushainen faulenzten.
Ein Land der verbotenen Städte, der Paläste und Tempel aus Gold. Mit der größten Mauer, die die Welt je gekannt hatte und die bestimmt noch vom Mond aus zu sehen war.
Wie Xanadu, die Sommerresidenz des Kublai Khan, ein paradiesischer Ort der Pracht und Herrlichkeit. Über dem die Magie des Fernen Ostens schwebte.
Eine gewisse Art von Märchenzauber.
Fortune war kein Freund von Märchen, er war ein Mann der Wissenschaft.
Natürlich gab es keine Drachen. Keine Magie. Nirgendwo.
China war ein Land wie jedes andere.
Allerdings bevölkert von seltsamen Menschen, bei denen die Männer geflochtene Zöpfe trugen wie junge Mädchen.
Ein Land mit merkwürdigem Essen und dünnem Tee ohne Milch und Zucker.
Hier oben, auf dem höchsten Hügel weit und breit, hatte Fortune in alle Himmelsrichtungen freie Sicht auf felsiges Land und blaues Meer, meilenweit und herrlich menschenleer.
Dreißig Meilen. Das war die unsichtbare Grenze. Dreißig Meilen hinter den durch den Vertrag von Nanking geöffneten Hafenstädten Amoy, Ning-po, Fouchou, Canton und Shanghai – weiter ins Landesinnere durfte sich kein Ausländer bewegen.
Fortune hatte keine Ambitionen, unbedingt in die Regionen vorzudringen, in denen vor ihm noch kein Weißer gewesen war. Er musste nicht in die Fußstapfen von Marco Polo treten. Nicht in die der Jesuiten, die in früheren Zeiten frei im Land umherstreifen durften, bis man ihnen nach und nach immer größere Steine in den Weg legte und sie schließlich hinauswarf.
Alles, was er wollte, war, innerhalb dieser dreißig Meilen die schönsten, die kostbarsten Pflanzen zu finden und sie nach Hause zu bringen.
Sein Glück wollte er hier machen, ohne auch nur eine einzige unsichtbare Grenze zu verletzen, und danach heimkehren.
In sein eigenes kleines Leben. In sein Land, in dem er sich auskannte und dessen Sprache er beherrschte.
Falls sich Heimweh so definierte – dann litt er soeben daran.
Kapitel 2
In meiner Nische hoch oben lauschte ich auf die Schritte weit unten, auf dem Grund des Turms. Schwere Schritte waren es, vom steinernen Leib der Pagode hallend zurückgeworfen. So laut, dass sie sogar noch im Tosen des Windes zu hören waren.
Aus dem Augenwinkel hatte ich die Gestalt bemerkt, die sich durch die Ruinen näherte, schnell und wie auf der Flucht. Jedoch aufmerksam genug, um zielstrebig einen Weg zwischen den Trümmern hindurch zu finden, ohne dabei zu stolpern.
Ein Mann mit Hut, eine Tasche und so etwas wie eine schlanke Trommel umgehängt. Ein sehr großer Mann, gemessen an der Höhe der Steinblöcke.
Sogar aus meiner Perspektive wirkte er noch groß, wie er da unten stand, den Kopf in den Nacken legte und die Pagode betrachtete, bevor er darin verschwand.
Ein fremder Teufel.
Hier.
Was erstaunlich genug gewesen wäre.
Aber das Auf und Ab seiner Schritte jetzt und ihr ungleichmäßiger Takt verrieten mir, dass er das Innere der Pagode gründlich in Augenschein nahm.
Wozu?
Man musste schon sehr genau hinsehen und seiner Fantasie freien Lauf lassen, um den einstigen Glanz des Tempels erahnen zu können.
Dies hier war längst keine heilige Stätte mehr. Die Menschen von Shenhu beteten jetzt an den Schreinen in ihren Dörfern. Sofern sie überhaupt je beteten.
Deshalb kam ich hierher.
Um meine Finger in den porösen Stein zu krallen und die Wände der Pagode zu erklimmen. Um in Schattenkämpfen auf schmalen, abbröckelnden Vorsprüngen zu balancieren. Über die gähnenden Lücken in der verfallenen Wendeltreppe hinwegzusetzen, geschmeidig wie ein Wolkenleopard, ebenso flink, ebenso lautlos. Mal mit dem Wind zu tanzen, der durch die Fensternischen hereinflog und durch Ritzen im Stein wirbelte, mal mit ihm zu ringen.
Immer mit einem Zucken im Bauch, dass ich das Gleichgewicht verlieren und in die Tiefe stürzen könnte.
Nur ein Narr kennt keine Angst.
Angst lehrt einen zu unterscheiden: zwischen den Grenzen, die es zu überwinden gilt, und denen, die man respektieren muss, schneller als ein Wimpernschlag.
An dieser Angst schärfte ich meine Sinne, meinen Willen, wenn ich in der verlassenen Pagode von Shenhu meinen Körper stark und biegsam hielt.
Und nichts kam dem gleich, danach mit ausgewrungenen Muskeln hier oben in einer der Fensternischen zu sitzen. Meinem Atem zu lauschen, der sich langsam beruhigte, meinem Herzschlag. Das Gesicht der Sonne zugewandt, dem vielstimmigen Wind zuzuhören, der meinen Schweiß trocknete. Den Vögeln so nahe, dass ich nur den Arm auszustrecken brauchte, um beinahe ihre Schwingen im Flug zu berühren.
Jedes Mal war mir hier oben, als fehlte nicht viel, um mit hochgereckter Hand den Himmel streifen zu können.
Das war meine Art zu beten.
Zu einem Gott, der kein Gesicht besaß und sich doch in tausend Gestalten widerspiegelte. Dessen Gesetze nirgendwo niedergeschrieben waren und die doch jedermann kannte. Der keinen Namen hatte und doch bei immer demselben genannt wurde: Gerechtigkeit.
Wie meine Meister es mich gelehrt hatten.
Die Schritte waren verstummt, und ich spähte die Fassade hinunter.
Der fremde Teufel hatte sich auf einer der abgewetzten Stufen niedergelassen, halb im Schatten einer schlanken Säule. Er zog den Hut vom Kopf und wischte sich mit dem Jackenärmel über Gesicht und Stirn.
Wie er den Hut in den Händen drehte und dabei auf die Ruinen blickte, wirkte er gedankenverloren. Fast melancholisch.
Eine zweite Gestalt kämpfte sich durch die Mauerreste. Noch ein Mann, am baumelnden Zopf unschwer als ein Landsmann von mir zu erkennen. Kleiner als der fremde Teufel, aber recht groß für jemanden von der Küste. Zu groß für einen Mann aus Shenhu. Der Wind trug seine Stimme, die fragend etwas rief, zu mir herauf, zerpflückte dabei jedoch die Worte zu undeutlichen Lautfetzchen.
Es schien, als suchte er nach dem fremden Teufel.
Zwei Fremde, allein hier oben.
Ich witterte Ärger.
Kapitel 3
»Fu-Chung! Fu-Chung!«
Wang schnaufte wie eine Lokomotive, während er über die Ruinen hinwegkletterte.
Fortune drückte sich den Hut wieder auf den Kopf und stand auf.
»Fu-Chung kann nicht einfach weglaufen! Ist er Mann oder Mädchen? Ich mach alles, um Gesindel zu verjagen – und dann ist Fu-Chung weg! Weg! Allein! Muss Wang ihn erst suchen gehen! Wie soll Wang da Schutz geben, hng?!«
Schweigend schlug Fortune den Weg bergab ein. Einen anderen als den, den er aufwärts genommen hatte – für den Fall, dass die geschäftstüchtige Meute auf der anderen Seite des Hügels sich noch nicht zerstreut hatte.
Hin und wieder beschlichen ihn Zweifel, ob er bei Wang wirklich in guten Händen war.
Letzten Endes gab es jedoch nicht allzu viele Chinesen, die sowohl ein bisschen Englisch als auch mehrere der chinesischen Dialekte beherrschten. Und die dazu noch bereit waren, für mehrere Monate einen fan-kwai unter ihre Fittiche zu nehmen.
Ein Umstand, der Wang ebenfalls bewusst zu sein schien.
Seine Beschwerden, Klagen, Ermahnungen perlten an Fortune ab wie das Wasser am Gefieder einer Ente.
Er hatte sie nicht kommen sehen.
Sie waren auf einmal da, auf dem schmalen Pfad zwischen den Felsen.
Ein halbes Dutzend Männer, bewaffnet mit Bambusstöcken.
Jetzt wünschte Fortune sich, er hätte auf Wang gehört. Auf die Warnungen der Fischer unten an der Küste und auf den Fährmann, der sich als Geleitschutz angeboten hatte. Er verfluchte sich dafür, die Flinte und die Pistole, um die er so hart mit der Society gefeilscht hatte, in seiner Unterkunft zurückgelassen zu haben, weil sie ihm hinderlich waren, wenn er Blumen pflückte und Pflanzen samt der Wurzel ausgrub.
Vermutlich hätten sie ihm ohnehin nichts genutzt. Er war schon immer ein lausiger Jäger gewesen, der ein Karnickel nur dann traf, wenn es gerade stillsaß, und froh sein konnte, wenn er sich dabei nicht selbst in den Fuß schoss.
Wie eine Brandungswelle stürzten die Männer vorwärts und warfen sich auf ihn.
Mit der Botanisiertrommel schlug er um sich, nutzte sie mal als Prügel, mal als Schild. Er war größer und stärker, aber sie waren zu viele. Zu entschlossen.
Zu viele Stöcke, die auf ihn eindroschen; zu viele Füße, die nach ihm traten.
»Hilfe!«, hörte er hinter sich. »Wang holt Hilfe! Fu-Chung, haltet durch!«
Dann gab es nur noch dumpfe Schläge. Heiser gebellte Beschimpfungen und Forderungen. Sein eigenes zorniges, hilfloses Gebrüll, das ihm jedoch im Hals stecken blieb, als sie ihm die Beine wegkickten und er hart aufschlug. Der Hut flog ihm vom Kopf, und die ersten Finger wühlten sich in seine Tasche, seine Kleider, gierig nach etwas von Wert.
Eine Stimme schnitt durch die Luft, scharf und glatt, und eine Klinge blitzte auf, dahinter ein grimmig verzogenes Gesicht.
Er riss die Arme hoch, um Kopf und Hals zu schützen, kniff die Augen zusammen; er wollte es nicht sehen, wenn die Klinge ihn traf.
Die Stimmen überschlugen sich, laut und giftig, durchsetzt von hässlichem Gelächter. Geräusche von Hieben, von Tritten. Hastig ausgestoßene Rufe, die über ihm zerfaserten, und er konnte plötzlich wieder atmen.
Langsam hob er den Kopf und blinzelte.
Bergab rannten sie davon, als wäre ein Teufel hinter ihnen her; einer humpelte, stolperte mehr, als dass er lief, und hielt seinen Arm; ein zweiter ließ in der Eile seinen Stock fallen und hob ihn ungeschickt wieder auf.
Fortune rappelte sich hoch, betastete Arme und Beine und Rippen. Der Saum seiner Jacke war ausgerissen, in seiner Hose klaffte ein Loch. Überall pochte und brannte es, aber mehr als blaue Flecken und Schürfwunden hatte er wohl nicht davongetragen.
Fahrig klaubte er die Münzen aus Kupfer und Silber vom Boden, sah sich währenddessen vorsichtig um, immer noch auf der Hut.
Ein Schatten zeichnete sich gegen die Sonne ab. Kraftvoll und leichtfüßig tänzelte er über die Felsen, zur Pagode hinauf, den Umriss eines Schwerts auf dem Rücken wie der schmale Flügel eines zerrauften Engels.
Scham durchglühte ihn, mischte sich mit Erleichterung. Mit Dankbarkeit.
mh goi. Danke.
Beim nächsten Sprung peitschte der geflochtene Zopf durch die Luft, und das Sonnenlicht flackerte für einen kurzen, flüchtigen Augenblick über die Züge des Schwertkämpfers. Weich sahen sie aus, fast feminin.
Wie das Gesicht eines Mädchens.
***
Tagsüber vergisst Jane oft, dass er nicht hier ist.
An diesen Tagen, die kürzer und kürzer werden.
Noch sind diese Tage kupferfarben und golden. Aber unter dem Nebel, der sich immer häufiger niederlässt, breitet sich schon stumpfes Braun aus.
Mehr und mehr muss sie sich beeilen, kein kostbares Tageslicht zu verschwenden. Wenn sie im Gärtchen werkelt, das zum gemieteten Haus gehört, Obst und Gemüse einkocht. Im Haus putzt und wischt und die Wäsche macht. Kleidchen und kleine Mäntel für den kommenden Winter näht.
Es sind die Abende, an denen er fehlt.
In der Küche, wenn sie nur für sich und Helen Essen macht und nicht für drei. Sobald Helen endlich neben ihrem Brüderchen eingeschlafen ist, das morgens und abends noch die Brust bekommt, und Jane dann am Kamin sitzt.
Während ihre Finger im Schein des Feuers und einer Lampe damit beschäftigt sind, ein neues Jäckchen für John zu stricken, ist sie sich des leeren zweiten Sessels bewusst.
Kein Robert, der die Beine von sich streckt und über einer Tasse Tee gedankenverloren in die Flammen schaut. In einem Buch liest. Ihr leise von Blumen mit fremdartigen Namen erzählt. Blumen, die sie sich nur vage vorstellen kann, wenn er sie beschreibt. In sorgsam abgewogenen Worten, immer noch mit dem dunklen, vollmundigen Akzent der schottischen Heimat. War der Arbeitstag besonders hart, nickt er irgendwann ein.
Eine stille, starke Präsenz ging immer von ihm aus. Ein Kraftfeld, fast zu groß für das kleine Cottage, das in Schieflage zu geraten scheint, seit er fort ist, die Proportionen der Räume, der Möbel wie verschoben.
Manchmal holt sie die Kinder zu sich ins Bett, wenn sie sich schlafen legt.
In dieser Zeit bei ihren Eltern unterkommen, wie es üblich gewesen wäre und vielleicht auch einfacher – das wollte sie nicht. Sie wollte nicht zurück in die ärmliche Enge mit den verrußten Wänden und dem Kohlgeruch.
Sie ist froh, es dort heraus geschafft zu haben. Von der Tochter eines Knechts zum Dienstmädchen in Edinburgh, und schließlich hierher, in dieses hübsche Häuschen in Chiswick.
Mehr, als ihre beiden Schwestern erreicht haben. Mehr als die anderen Mädchen im Dorf.
Jane kettelt die letzte Reihe des Halsbündchens ab und wandert mit den Gedanken in die Ferne.
China.
Genauso gut hätten sie ihn zum Mond schicken können.
Und alles nur wegen ein paar Pflanzen. Die keinen weiteren Zweck erfüllen, als hübsch auszusehen. Die sicher schwierig zu halten sind.
Männer sind es, die neue Pflanzen entdecken und züchten, kategorisieren und benennen. Ein Männerberuf ist es, Gärten anzulegen, die die noble Eleganz von Herrenhäusern noch unterstreichen. Die das Auge erfreuen und die Seele beflügeln.
Unpraktische und nutzlose Allüren, typisch für Männer und feine Ladys, die sonst nichts zu tun haben. Die sich keine Gedanken machen müssen, wovon ihre Kinder satt werden.
Mit einem energischen Schnippen schneidet sie den Faden ab.
Trotzdem ist Jane stolz, einen Mann mit diesem Beruf geheiratet zu haben. Einen Künstler, der leeren Raum gestaltet, indem er aus vergänglichen Materialien lebendige Werke erschafft. Der Bücher liest und Latein und Griechisch beherrscht. Ihr gemeinsames Brot mit ehrlicher Arbeit verdient. In einem Beruf der mehr Ansehen genießt als der eines Knechts, eines Heckengärtners. In dem mehr Geld zu machen ist.
Genauso stolz ist sie auf ihr eigenes Gärtchen. In dem sie im Frühsommer ihre eigenen Erdbeeren ernten kann und später im Jahr Brombeeren und grüne Bohnen und in der Zeit dazwischen Radieschen. Ein Frauengarten mit Veilchen und Ringelblumen, Löwenmäulchen und Flieder, Salbei, Kamille und Petersilie. Robuste Pflanzen, die wenig Arbeit machen und nützlich sind.
Männer erkunden und gestalten die Welt. Frauen nähren und kleiden.
Das ist die gottgewollte Ordnung.
Sie streicht das fertige Rückenteil glatt; dämpfen und zum Jäckchen zusammennähen wird sie die gestrickten Teile morgen, im Tageslicht.
Jane träumt von einem größeren Garten. Mit einem Apfel- und einem Birnbaum, vielleicht sogar einem Kirschbaum. Von eigenen Karotten und Gurken, ein paar Hühnern. Und von einem größeren Haus.
Unter der wärmenden Aussicht darauf ist schließlich ihr Widerstand gegen diese Reise geschmolzen.
Es ist ja nur für ein Jahr, sagt sie sich immer wieder.
Sie greift zu einem frischen Wollknäuel und schlägt mit dem Nadelspiel Maschen für eine Socke an.
Robert wird neue brauchen, wenn er erst wieder hier ist.
Kapitel 4
Sonntag, 8. Oktober 1843
Morgens dunstig bis neblig, gegen Mittag aufklarend. Maximum: 73 Grad Fahrenheit. Minimum: 66 Grad.
Ankunft in Chusan, nach 10 Tagen auf dem Schiff – und hoch erfreut über die Veränderung der Landschaft. Der erste Blick auf die Vegetation hat mich überzeugt: Hier befindet sich mein zukünftiges Betätigungsfeld! Keine kahlen, öden Hügel wie in Hongkong oder Chimoo, sondern entweder kultiviert oder von kräftigem Gras, Bäumen und Sträuchern bewachsen.
Würde unsere Insel von Hongkong die naturgegebenen Vorzüge und Schönheiten Chusans besitzen – welch prächtigen Ort könnten unsere geschäftstüchtigen englischen Händler in nur wenigen Jahren daraus machen!
Ich hege keine Zweifel, dass meine Mission sich hier in Chusan zum Erfolg führen lässt.
Aus den Notizen von Robert Fortune
Chusan war nicht der Garten Eden. Aber fast.
Schön. Robert Fortune fiel kein besseres, kein originelleres Wort dafür ein; wieder und wieder kam es ihm in den Sinn.
Schön war der Ausblick auf die vielen Inseln des Archipels im leuchtend blauen Meer. Auf die rauchblauen Silhouetten der Bergketten in der Ferne. Die fruchtbaren Täler, die sich zum Ozean hinab entrollten und in denen klare Bäche sprudelten, waren schön. Das Gras, das die Hügel bekleidete, die Bäume und das Unterholz. Die Reisfelder.
Zwanzig Meilen lang und etwas über zehn Meilen breit, war Chusan ein Schatzkästchen der Natur. In dem wilde Rosen wuchsen und Geißblatt, Palmen, Zypressen und Wacholder. Myrten- und Heidekrautgewächse, der Kampferlorbeer und Thea viridis, der Strauch des grünen Tees.
Wenn er durch die Täler Chusans wanderte, über Hügel und Bergpässe und durch Schluchten, die ihn an die schottischen Highlands erinnerten, kam Fortune sich vor wie im Paradies.
Wenn auch kein gänzlich unberührtes: Englische Soldaten hatten während des Krieges hier ihre Fußabdrücke hinterlassen. Englische Einsprengsel würzten das Stimmengewirr genauso selbstverständlich wie die im Lauf der Zeit angespülten Körnchen von Portugiesisch, Malaiisch, Bengalisch und Hindustani. Die Geschäfte im Hafenstädtchen Tinghae wurden nicht in Käsch oder Tael gemacht: In der internationalen Währung des Dollars wurden die Preise kreuz und quer durch die Gassen gebrüllt, um ein Schaf (drei Dollar) oder einen Ochsen (acht bis zehn Dollar) an den Mann zu bringen. Sogar das Brot in den Läden war nach englischem Rezept gebacken.
Englisch war das Gütesiegel in Tinghae und versprach hohes Ansehen und wirtschaftlichen Erfolg.
Wer auf sich hielt und ehrgeizig war, gab sich englisch – und pinselte sich ein fantasievolles Schild dazu.
Dominie Dobbs – Königlicher Gemischtwarenhändler.
Squire Sam – Porzellanhändler und Hoflieferant der Queen.
BUKCMASTER – Schneider Ihrer Allergnädigsten Durchlauchtesten Majestät Queen Victoria und Seiner Königlichen Hoheit Prinz Albert. Uniformenallerartundform.
Zehn Tagesreisen mit dem Schiff von Chimoo entfernt, erlebte Fortune ein vollkommen anderes China.
»Wang wartet hier?«
Der Chinese deutete auf die Stelle, an der sich der Weg gabelte.
Unsicherheit schwang in seiner Stimme mit. Immer noch.
Obwohl ihre Tage hier in Chusan inzwischen einer eingespielten Routine folgten.
»Ja, warte hier.«
Als hätte er eine Last von seinen Schultern geworfen, ließ sich der Chinese mit einem Stoßseufzer in die Hocke fallen; selbst kürzere Fußmärsche schienen ihm enorme Kraft abzuverlangen.
Ein zähes diplomatisches Ringen war es gewesen, nach dem Vorfall unter der Pagode von Chimoo. Um Wangs Feigheit. Fortunes Starrsinn. Darum, dass sie beide in diesem Überfall das Gesicht verloren hätten. Ein Konzept, das Fortune an die Regeln von Anstand und gesellschaftlicher Anerkennung zu Hause in England erinnerte. Nur schien ihm dieses hier in China ungleich komplizierter und lebensnotwendiger, mit Feinheiten, die er nicht kannte und auch nicht nachvollziehen konnte.
Ein Streitgespräch nach dem anderen hatte Wang angezettelt. An den letzten Tagen in und um Amoy. Während der Schiffspassage nach Norden, durch die strudelnden Schwarzen Wasser der Meerenge von Formosa.
Bis sie diesen Kompromiss aushandelten und jeden Morgen gemeinsam in Tinghae aufbrachen, Fortune jedoch allein weiterzog, sobald sie die Hafenstadt hinter sich gelassen hatten.
»Fu-Chung aufpassen, ja?«, gab Wang sich gönnerhaft.
Fortune klopfte gegen die Ausbuchtung an seiner Hüfte.
Die Pistole war nicht geladen; er traute diesen Feuerwaffen nicht. Schon gar nicht, wenn er sie am Körper trug, während er zwischen Felsen herumkletterte, sich nach Gräsern bückte oder auf dem Boden kauerte, um in der Erde zu wühlen.
Trotzdem würde sie vielleicht zur Abschreckung taugen, beim nächsten Mal; vor allem diente sie jedoch dazu, Wang zu beruhigen. Dessen Gesicht zu wahren.
Fortune zögerte noch, sich auf den Weg zu machen.
Dies war einer der seltenen Momente, in denen Wang nicht in der Herberge von Tinghae nahtlos von herzhaftem Gähnen zu Schnarchen überging – aber auch keinen seiner endlosen Monologe über Gesehenes, Gehörtes, Erlebtes anstimmte. Durchsetzt mit alten Weisheiten, die – halb auf Englisch, halb auf Chinesisch – für Fortune nie einen Sinn ergaben.
Er wusste einfach nicht, was er sagen sollte.
Es war eine Sache, die meteorologischen Gegebenheiten zu untersuchen und in seinen Notizen zu dokumentieren. Sich mit anderen Gärtnern über den späten Frühling, Dauerregen und Nachtfrost zu unterhalten. Das war ihr Metier. Ihre gemeinsame Sprache, die selbst der einsiedlerischste, wortkargste Gärtner gerne sprach.
Aber mit Wang eine Unterhaltung über das Wetter anzustrengen, nur damit irgendetwas gesagt war? Zumal der Blick, den Wang über seine Schulter warf, verriet, dass er mit seinen Gedanken in Tinghae war.
»Also dann«, murmelte Fortune halbherzig, eine plötzliche Ungeduld in den Beinen, und marschierte bergan.
Jeden Morgen, an dem er sich aufmachte, Chusan zu erkunden, überkam ihn Bedauern, dass er erst so spät im Jahreslauf hierhergefunden hatte.
Im Frühling musste es hier atemberaubend sein, das verhießen die dichten Laubwolken der Azaleen an den Berghängen. Sobald ihre Knospen in den ersten warmen Monaten des Jahres aufbrachen, würde die Insel wie mit den Farben des Regenbogens übergossen sein – wahrhaftig das blühende Land, das er sich erhofft hatte.
Ihm graute vor dem Winter, in dem wohl auch hier kaum etwas grünte oder gar blühte. Vielleicht würde er in Shanghai überwintern. Seine leeren Tage damit verbringen, alle Gärtner der Stadt abzuklappern und jedes feine Haus. In der Hoffnung, auch die Chinesen holten sich in der kalten Jahreszeit den Sommer mit Topfpflanzen in ihr Heim.
Er musste ganz einfach im Frühjahr noch einmal herkommen.
Bis dahin dehnte er seine Streifzüge über die Insel von Chusan so weit aus, wie er nur konnte, um aus der noch warmen und hellen Jahreszeit alles herauszuholen.
Auf diese Weise war er zuletzt als Junge durch die Natur gewandert; manchmal hatte er dafür sogar die Schule geschwänzt. Ein zielloses Umherstromern, allein, in einem Gefühl unendlicher Freiheit. Nicht auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Sondern mit offenen Sinnen nach dem Ausschau haltend, was sich finden ließ. Als ob der Sinn des Lebens in dieser Art des Suchens, des Findens lag.
Seitdem er hier in Chusan unterwegs war, konnte Fortune die allgemeine Euphorie nicht mehr nachvollziehen, mit der man Hongkong eine glänzende Zukunft als Handelsplatz prophezeite; zu unsicher erschien ihm die Lage, zu mörderisch das Klima.
Aber schließlich war er nur ein Gärtner. Der sich lieber Gedanken darüber machte, wie sich jenes feindselige Eiland zu einem besseren Ort umgestalten ließe.
In Gedanken überzog er die kargen Berghänge Hongkongs mit dichtem Buschwerk. Vielleicht mit den scharlachroten Blütenbällen der Ixora coccinea, die steinigen Untergrund liebte, oder mit der immergrünen und weißblühenden Polyspora axillaris. Den noch provisorischen Straßen würde er mit den ausladenden Kronen des Ficus nitida Schatten verschaffen und den Häusern mit schnell wachsendem Bambus ...
Irgendwo unter ihm leuchtete etwas auf. Er blieb stehen und reckte sich, spähte zu dem kleinen Flusslauf hinunter.
Azurblau strahlten ihm tausende von Blütensternen entgegen. Ein dichter Saum entlang des Flussbetts, dessen Wasser daneben zu einem faden Grau verblasste.
Fortune kämpfte sich durch das Dickicht aus Brennnesseln, konnte nicht schnell genug die Böschung hinabschlittern. Um sich dann langsam hinzuknien. Fast andächtig und wie zum Gebet.
»Hallo, meine Schöne«, murmelte er.
Eine Staudenclematis. Mit anmutig gewellten Blütenblättern in diesem vibrierenden Blau, das filigrane Staubgefäß weiß und gelb und purpur.
Er zog Maßband und Notizbuch hervor.
Clematis lanuginosa. Max. Wuchshöhe 4 Fuß. Ranken holzig, Zweige undeutlich 6-eckig mit flachgedrücktem Flaumhaar. Blattstiele 1-3 Inch. Blätter: schmales Oval bis herzförmig und Apex zugespitzt, 2-4 Inch x 1-2 Inch, papierartig, abaxial mit dichtem grauem Flaum, adaxial spärlich behaart. Einzelblüten, 3-5 Inch Durchmesser, Pedicellus dicht behaart. Kelchblätter ...
Die Atmosphäre über dem Flüsschen war umgeschlagen. Eine Spannung knisterte in der Luft und ließ ihn aufblicken.
Jemand beobachtete ihn. Jemand, der sich zwischen den Clematis am anderen Ufer zusammenkauerte.
Ein Mädchen.
Soweit er dies durch Blätter und Blüten hindurch einschätzen konnte.
Er fuhr zusammen, als das Mädchen aufsprang, durch die Clematis stolperte und davonrannte.
Es war nicht die Art, wie ihr Zopf durch die Luft fegte oder wie das Schwert auf ihrem Rücken dabei tanzte. Es war ihr Gesicht. Nicht vertraut, nicht unbekannt.
Wo doch alle chinesischen Gesichter für ihn so ähnlich aussahen, dass er wohl nicht einmal Wang erkannt hätte, würde er ihm unerwartet auf der Straße begegnen.
Er erinnerte sich an dieses Gesicht, aus dem Tumult unter der Pagode von Chimoo. Das Gesicht über der gezückten Klinge. Auf den Felsen, im Schlaglicht der Sonne, eine seltsame Mischung aus Aufruhr und innerem Frieden auf den Zügen.
Mit einer Falte über der Nasenwurzel starrte Robert Fortune verwirrt auf die Stelle zwischen den Clematisblüten.
Noch lange, nachdem das Mädchen verschwunden war.
Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, welche Bedeutung man der Clematis zu Hause in England zuschrieb.
Beim besten Willen wollte es ihm nicht einfallen.
Kapitel 5
Schon von Weitem hatte ich ihn gesehen, hoch aufragend wie ein Turm in der leeren Landschaft. Seine Schritte waren unüberhörbar, wie das Stampfen eines Ochsen.
Ich hatte gehofft, er würde vorbeigehen. Geduckt hatte ich mich und den Atem angehalten, als könnte ich zwischen den blauen Blumen verschwinden.
Bis er am Fluss seinen Durst gestillt oder seine Notdurft verrichtet hätte und dann seinen Weg fortsetzte.
Mich in ein Kampfgetümmel zu stürzen, mich mit Kerlen anzulegen, die größer und breiter waren und in Überzahl – davor fürchtete ich mich nicht. Ich fand es auch nicht besonders mutig: Dafür war ich ausgebildet worden, hatte mich jahrelang darin geübt.
Begegnete ich anderen Menschen auf meinem Weg, überfiel mich Scheu, umso mehr, je verlassener die Gegend war. Die Scheu eines Menschen, der das Alleinsein liebt. Dessen Zuhause die Einsamkeit ist.
Er war nicht der erste fremde Teufel, den ich gesehen hatte. Die Küste war voll von ihnen.
In Xiamen, das die Leute dort auch Amoy nannten. In Shanghai. In Ningbo und Fuzhou und Guangzhou, von dem fast jeder nur als Canton sprach. Hongkong hatten sie gleich an sich gerissen. Wie die dunkelhaarigen, braunhäutigen Männer aus pu tao ya, dem tiefsten Südosten der westlichen Welt, es zuvor schon mit Macao getan hatten.
Nur in Dinghai waren die Fremden weniger geworden, seit die Soldaten fort waren.
Überall machten sie sich breit und griffen nach allen Schätzen, derer sie habhaft werden konnten. Und meine Landsleute drängten sich dazwischen, um ihr eigenes Stück vom Kuchen des schnellen Geldes abzubeißen.
Vielleicht war es eine gute Sache, dass unsere Welt dabei war, sich zu verändern. Unser altes, stolzes, himmlisches Reich zu spüren bekam, dass es nicht unbesiegbar war. Nicht dem Rest der Welt überlegen. Vor allem nicht den verachteten, verspotteten Barbaren aus dem Westen.
Obwohl die Wellen, die diese Fremden an der Küste schlugen, wohl nie den Rest des Landes erreichen würden. Dafür war es zu groß. So groß, dass man Jahre darin umherwandern konnte, ohne jemals alles davon zu sehen, wie es früher bei uns im Dorf hieß. Und vermutlich würden diejenigen die wenigsten Veränderungen erleben, die sie am nötigsten brauchten.
Die Armen. Die Kinder. Wir Frauen.
Die fremden Teufel waren allesamt Männer, deren Stimmen durch die Gassen und über die Häfen donnerten. Große, ungeschlachte Männer. Die stanken, ranzig wie altes Schweinefett und nach Schnaps. Mit hässlichen, unförmigen Gesichtern und unheimlichen Augen, hart und kalt wie Glas.
In den Hafenstädten gewöhnte ich mir schnell an, breitbeinig zu schlendern wie ein Mann und den Kopf gesenkt zu halten. Für die fremden Teufel war ich leichte Beute.
Ja, selbst ich. Das Mädchen mit dem Schwert.
Weil ich ihre Regeln nicht kannte. Ihre Gesetze.
Sicher würde mich nichts Gutes erwarten, schlitzte ich einem von ihnen die Kehle auf, um mich selbst zu verteidigen. Schließlich war ich in ihren Augen nur ein Chinesenmädchen. Meine Landsleute wussten immer sofort, was ich war. Wo ich hingehörte.
In die Schatten. Die dunklen Winkel.
Dort, wo man mich brauchte, in diesen unsicheren Zeiten.
Deshalb verstanden sie es nicht, die Männer von Shenhu. Warum ich mich auf dem Pfad unter der Pagode nicht auf ihre Seite schlug. Sondern den fremden Teufel verteidigte und aus ihrem Zugriff befreite. Diesen hilflosen Riesen am Boden.
Ich hatte noch nie einen Weißen gesehen, der sich verprügeln ließ wie ein schwächlicher Junge.
Die Männer von Shenhu lachten und höhnten erst. Dann richtete sich ihr Zorn gegen mich. Als ob sie mir gewachsen gewesen wären. Diese Bauerntölpel, die nichts anderes konnten als schwerfällig mit ihren Stöcken auszuholen.
Ich hatte es getan, weil es das Richtige gewesen war. Nicht einmal so sehr, weil ich so erzogen worden war. Sondern weil ich daran glaubte.
Wenn ich ehrlich sein soll ... Vielleicht hatte ich es auch getan, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Diesen Raubeinen ohne einen Funken Verstand, die ihren Nachbarn jedes Körnchen Reis mehr neideten und grob mit ihren Frauen und Kindern umgingen. Denen ich ein Dorn im Auge war, weil ich mich nicht auf dem Platz vor dem Feuer zusammenkauerte, der für mein Geschlecht vorgesehen war. Und deren Glitzern im Blick mir verriet, was sie am liebsten mit einer wie mir angestellt hätten.
Hätten sie nicht so viel Angst vor mir gehabt.
Die Aura meines Schwertes machte mich unantastbar. Selbst in Shenhu.
Trotzdem, es war höchste Zeit gewesen, Shenhu den Rücken zu kehren, gleich am nächsten Tag.
Zeit, weiterzuziehen, auf einem Kahn voller Pflaumen und Orangen.
Frauen an Bord bringen Unheil, das glaubt jeder Seemann aus dem Norden zu wissen. Mein Schwert jedoch machte aus mir einen Glücksbringer, den man stets bereitwillig mitfahren ließ.
Dieses Mal nach Zhoushan, wo die Menschen freundlich waren und freigiebig.
In Zhoushan musste ich nie Mangel leiden. Überall bekam ich eine Schüssel Gemüse und reichlich Reis dazu und ein Lager für die Nacht. Oft baten mich die Bauern, mit ihnen zusammen zu essen und von meinen Wanderungen zu erzählen, von meinen Abenteuern. Und nicht selten steckte mir eine Bauersfrau heimlich ein paar Kupfermünzen zu oder ein abgelegtes Hemd, damit mein Besuch Glück brachte und Segen.
Manchmal mit Mitleid in den Augen. Manchmal mit der Sehnsucht, an meiner Stelle zu sein.
Wenn es mir zu viel wurde, zog ich mich in die Berge zurück. Wo ich genug Beeren und Früchte fand, die mich nährten, sogar noch im Herbst. In dieser Stille, dieser Einsamkeit, die mich die Freiheit atmen ließ, für die ich mein altes Leben aufgegeben hatte.
Kaum jemand verirrte sich hierher. Höchstens im Frühsommer, wenn die Wälder voll waren von den süßen, purpurroten Beeren der yangmei.
Schon gar kein fremder Teufel.
Noch viel weniger derselbe fremde Teufel, den ich unter der Pagode von Shenhu aus den Klauen der räuberischen Gesellen befreit hatte.
Natürlich war er mir nicht gefolgt, wie auch, das war unmöglich.
Nie kreuzte sich mein Weg ein zweites Mal mit jemandem, dem ich geholfen hatte. Weil die Menschen sich zwar an die gute Tat erinnerten, nicht aber an die Hand, die dabei das Schwert geführt hatte. Während ich allein auf die Situation konzentriert war. Auf Arme und Beine des Gegners; auf Blicke, Geräusche, Atemzüge. Auf das Zucken eines Muskels, einen Lidschlag.
Und nie blieb ich lange genug für Dank oder einen Lohn.
Wir waren wie Schatten. Manche sagten auch: wie Dämonen.
Das war das Los von uns jianghu.
Ich glaubte nicht an Schicksal. Aber was sonst konnte es sein, ihm noch einmal zu begegnen, zehn Tagesreisen zu Wasser von Shenhu entfernt?
Diese zufällige Fügung gefiel mir nicht.
Als sich der Blick dieses fremden Teufels auf mich richtete, lief ich fort.
Kapitel 6
Sie war wieder da.
Am nächsten Tag, ein Stück weiter den Fluss hinauf.
Fortune fragte sich, ob sie wohl irgendeinen Dank oder Lohn von ihm erwartete, dafür, dass sie ihm in Chimoo aus seiner Notlage herausgeholfen hatte.
Doch sie machte keine Anstalten, sich ihm zu nähern. Eine Forderung zu stellen oder auch nur eine Bitte.
Er wusste nicht, wie er von sich aus seinen Dank anbieten konnte. Die Stolpersteine der fremden Sprache hemmten ihn; es entsprach ihm auch nicht, zusammenhanglose Wortbrocken über die Wiese zu brüllen. Er suchte ihren Blick, um eine Verbindung herzustellen. Nickte ihr kurz zu. Blickte fragend drein.
Sie saß einfach nur da und beobachtete ihn.
Reglos.
Auch am Tag darauf ließ sie ihn nicht aus den Augen, während er sich mit Clerodendrum indicum beschäftigte.
Der kalte Schweiß brach ihm aus bei dem Gedanken, sie könnte ihn aus den Händen der geldgierigen Raufbolde befreit haben, um danach selbst zuzuschlagen und die Beute für sich allein zu beanspruchen.
Er erinnerte sich gut daran, wie schnell sie gewesen und wie geschickt sie mit der Klinge des Schwerts umgegangen war. So schnell, dass er vermutlich keine Chance hätte, auch nur nach seiner Pistole zu tasten, geladen oder nicht.
Er hätte Wang bitten sollen, mitzukommen. Und sei es nur als Dolmetscher, der herausfand, was das Mädchen von ihm wollte.
Dieses Mädchen, dessen Haltung Wachsamkeit ausstrahlte. Fast misstrauisch wirkte sie; womöglich hatte er sie in ihrem Schlupfwinkel aufgestört, und sie traute ihm genauso wenig wie er ihr.