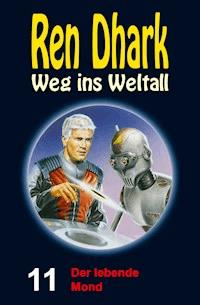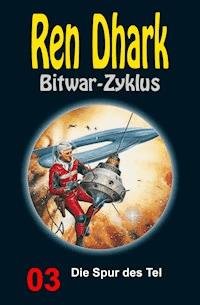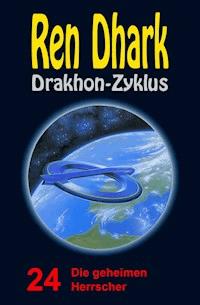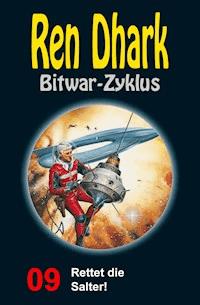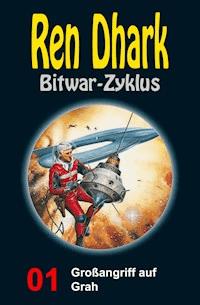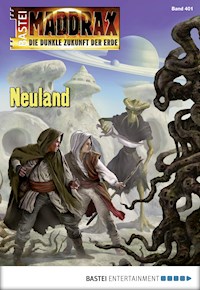9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HJB
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Ren Dhark: Weg ins Weltall
- Sprache: Deutsch
Ren Dhark und die POINT OF sitzen fest in Andromeda - durch die geheimnisvolle 'Horizontverschiebung' führt kein Weg in die Freiheit. Also braucht Dhark zuerst einmal einen Stützpunkt. Doch auf dem hält es ihn nicht lange, und schon bald findet er sich wieder im Netz des Diktators.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ren Dhark
Weg ins Weltall
Band 17
Im Netz des Diktators
von
Uwe Helmut Grave
(Kapitel 1 bis 5)
Jan Gardemann
(Kapitel 6 bis 10)
Jo Zybell
(Kapitel 11 bis 15)
Achim Mehnert
(Kapitel 16 bis 21)
und
Hajo F. Breuer
(Exposé)
Inhalt
Titelseite
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Empfehlungen
Ren Dhark Classic-Zyklus
Ren Dhark Drakhon-Zyklus
Ren Dhark Bitwar-Zyklus
Ren Dhark: Weg ins Weltall
Ren Dhark Extra
Clayton Husker: T93
Eric Zonfeld: Nation-Z
Impressum
Prolog
Ende des Jahres 2065 steht die Menschheit am Scheideweg: Auf der nach dem Krieg gegen die Roboter des »Volkes« zu einem Eisklumpen gewordenen Erde leben nur noch 20 Millionen Menschen. Relativ gut aushalten läßt es sich nur in der Hauptstadt Alamo Gordo, deren neuartiger Schutzschirm ihr nicht nur Sicherheit gibt, sondern der auch für angenehm hohe Temperaturen sorgt.
Die restlichen 36 Milliarden Menschen wurden nach Babylon umgesiedelt und richten sich dort unter der Regierung Henner Trawisheims neu ein. So wäre auf der Erde eigentlich viel Platz – hätten nicht die Riiin oder Eisläufer ihren Lebensmittelpunkt nach Terra verlegt. Dieses Volk kann nur bei extrem niedrigen Temperaturen überleben – und ist so naturgemäß gegen jeden Versuch, der irdischen Sonne zu ihrer alten Kraft und dem Eisplaneten Terra zu neuer Wärme zu verhelfen.
Genau diesen Versuch aber hat Ren Dhark mit seiner Expedition in die Nachbargalaxis Andromeda unternommen. Denn es gibt nur einen Weg, um die Sonne wieder stark zu machen: Die Synties, tropfenförmige Energiewesen, die im freien All leben und seit vielen Jahren gute Freunde der Terraner sind, könnten interstellares Wasserstoffgas einfangen und in die Sonne stürzen lassen – so lange, bis sie ihre alte Masse und damit ihre alte Kraft zurückgewonnen hat.
Doch die Synties sind von den gefühllosen, eiskalten Echsenwesen des Glandarenvolks entführt und als Energiequelle mißbraucht worden. Zwar gelingt es Dhark, die Synties zu befreien, aber gewaltige Ringraumer des Geheimen Imperiums, einer noch skrupelloseren Macht, die schon vor mehr als tausend Jahren Krieg gegen die Worgun in Andromeda führte, löschen das Volk der Glandaren gnadenlos aus. Beim Versuch, wenigstens einige von ihnen zu retten, geraten die Flashpiloten Pjetr Wonzeff und Harold Kucks in die Hände des Geheimen Imperiums.
Es gelingt den beiden Männern unerwartet rasch, aus der Gefangenschaft zu fliehen, doch Dhark und die POINT OF sind verschwunden. Eine gefährliche Odyssee durch das unbekannte Sternenmeer führt die beiden schließlich zu einer ehemaligen Stützpunktwelt der Worgun, auf der es nichts gibt außer einer goldenen Gigantstatue. Mit ihrer Hilfe gelingt es, einen Notruf nach Babylon in der Milchstraße abzuschicken. Doch kaum ist dieser Notruf draußen, greifen dreihundert überschwere Ringraumer des Geheimen Imperiums an. Auf der Flucht gelangen die beiden Terraner auf eine ehemalige Welt der Salter – und Harold Kucks trifft mit der Faskia Ssirkssrii seine Seelenpartnerin. Die Echse verleiht ihm unglaubliche Kräfte…
Dhark empfängt den Notruf und bricht erneut nach Andromeda auf, um die verschollenen Gefährten zu suchen. Die werden tatsächlich gefunden, und man könnte sich auf den Heimweg zur Erde machen – wäre da nicht plötzlich die Horizontverschiebung aufgetreten, ein Phänomen, dem nicht einmal die POINT OF entkommen kann. Ren Dhark braucht einen Stützpunkt in Andromeda und findet ihn auf der nur scheinbar verlassenen Welt Neu-Glandar…
Auf der Erde rekrutiert der Wächter Simon drei Menschen für das neue Wächterprogramm: Svante Steinsvig, Arlo Guthrie und – Doris Doorn! Die INSTANZ von ARKAN-12 schickt sie nach erfolgter Umwandlung auf einen Werftasteroiden in die Milchstraße, wo ein Ringraumer auf sie warten soll.
Doch statt auf das Raumfahrzeug stoßen sie auf einen ebenso mächtigen wie geheimnisvollen Feind, den sie erst im allerletzten Augenblick besiegen können. Rettung kommt vom Planeten Eden: Terence Wallis rüstet die Wächter mit einem brandneuen Ovoid-Ringraumer aus und verlangt dafür nichts außer einem »Gefallen« – bei Gelegenheit. Für ihre Jagd nach dem geheimnisvollen Feind brauchen die Wächter die Tachyonentechnik der Eisläufer, die gerade von der Erde auswandern – und von einer mächtigen Flott der Tel angegriffen werden…
1.
Ich muß sie töten!
Erl Fad überlegte, auf welche Weise er die beiden terranischen Spione aus dem Weg räumen sollte. Sie hatten ihn hereingelegt, sein Vertrauen mißbraucht, und somit verdienten sie einen langsamen, qualvollen Tod. Mit Sicherheit waren sie keine Salter, sondern Terraner, und sehr wahrscheinlich hießen sie gar nicht Nowo Zoof und Rolaro Hok. Er würde sie von seinen Robotern so lange foltern lassen, bis sie ihm ihre richtigen Namen verrieten.
Fad war ein gutgebauter junger gelbäugiger Echsenmann mit blauer Lederhaut, dessen Kopf fast nur aus Gesicht zu bestehen schien und im Vergleich mit seinem schneidigen Körper etwas klobig wirkte, wie es typisch war für sein Volk. Er gehörte zu den letzten fünfzehn Überlebenden der vom Geheimen Imperium ausgerotteten Glandaren. Acht Frauen und sieben Männer waren dem Inferno entronnen. Die Terraner hatten ihnen die Möglichkeit verschafft, sich hier auf Neu-Glandar ein neues Leben aufzubauen, doch ihr damaliger Anführer hatte andere Pläne gehabt. Khul Ghei hatte die Glandaren wieder an die Macht bringen wollen – mit Hilfe des Zentralrechners der unterirdischen Station, die er auf diesem Planeten gesucht und gefunden hatte. Erl Fad hatte Khul Ghei erschlagen und sich dann selbst an die Spitze der inzwischen nur noch dreizehnköpfigen Gruppe gesetzt.
Alle standen nun unter seiner Herrschaft, und er erlaubte niemandem, die Station zu verlassen.
Im Auftrag von Ren Dhark hatten der 39jährige ukrainische Flashpilot Pjetr Wonzeff und sein ungefähr gleichaltriger Kamerad Harold Kucks einen Absturz vor dem Eingang zur Station vorgetäuscht – und jetzt befanden sie sich in deren Innerem, auf dem Weg zum scheinbeschädigten Flash, den Roboter am Vortag in die Stationswerkstatt gebracht hatten.
Auf Harolds Schultern hockte dessen Seelenpartnerin Ssirkssrii, eine grüne, leguanähnliche Echse von einem Meter Länge, aus dem Volk der Faskia.
Sie konnte seine Gedanken lesen und sich telepathisch mit ihm verständigen.
Umgekehrt konnte auch Harold gedanklich mit ihr kommunizieren. Und er besaß noch eine weitere Fähigkeit: Solange sich Ssirkssrii nicht weiter als zwanzig Meter von ihm entfernte, »hörte« er, was andere intelligente Lebewesen dachten. Somit wußte Harold, daß Erl Fad sie enttarnt hatte und töten wollte – weil er einen Fehler gemacht und die Worgun beim Namen genannt hatte, statt sie als »Hohe« zu bezeichnen, wie echte Salter es stets taten.
Pjetr Wonzeff war ein guter Menschenkenner, und manchmal ließ sich die eine oder andere menschliche Verhaltensweise auch auf Fremdintelligenzen übertragen. Obwohl er kein Glandarenexperte war, entging auch ihm Fads verändertes Benehmen nicht.
Hat er etwas gemerkt? sandte er seine Gedanken an Kucks aus.
Da Pjetr über keinerlei telepathische Fähigkeiten verfügte, konnte Harold ihm nicht auf dieselbe Weise antworten. Vorausschauend hatten beide vorher bestimmte körpersprachliche Zeichen verabredet. Sich an der Nase zu kratzen bedeutete, Zustimmung zu signalisieren – und »zufälligerweise« juckte Kucks’ Riechkolben soeben.
Ssirkssrii bekam das mit. Was hat dich dein Freund gefragt? erkundigte sie sich.
Er wollte wissen, ob Fad uns aufgrund meines Versprechers auf die Schliche gekommen ist, antwortete Harold. Leider ist das der Fall. Der Glandare will uns ans Leben.
Ich springe ihm ins Gesicht und kratze ihm mit meinen Krallen die Augen aus!
Das wird nicht viel nutzen – der Kerl dürfte sich kaum selbst die Hände an uns schmutzig machen, sondern seine Kampfroboter auf uns hetzen. Augenblick mal! Ich empfange Fads weitere Gedanken. Offenbar überlegt er es sich gerade anders.
Er will uns also nicht mehr töten?
Dich sowieso nicht, er hält dich für ein dummes Haustier. Aber auch Pjetr und mich will er zunächst verschonen, um uns auszuhorchen und herauszufinden, wer uns geschickt hat und was genau wir vorhaben. Bestens, das verschafft uns einen Aufschub.
Also greifen wir ihn nicht an?
Auf gar keinen Fall, Ssirkssrii!
Dann signalisiere das besser schleunigst deinem Freund.
Ihr fiel auf, daß Pjetr beim Betreten der Werkstatt alle Muskeln anspannte und sich anscheinend kampfbereit machte.
Der Ukrainer war fest entschlossen, sein Leben bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Harold und er hatten eine wochenlange Odyssee durch Andromeda hinter sich, die sie nur knapp überlebt hatten, und Pjetr hatte nicht vor, sein gerade erst gerettetes Leben jetzt kampflos herzugeben.
Kucks alias Hok räusperte sich kurz und unauffällig – aber auffällig genug, um Wonzeff alias Zoof klarzumachen, daß kein unmittelbarer Angriff bevorstand. Der Ukrainer entspannte sich ein wenig, blieb aber wachsam.
Der Flash war in der POINT OF dermaßen perfekt präpariert worden, daß weder die Arbeitsroboter noch Weltgebieter, der Stationsrechner, den Schwindel durchschauen konnten. Erl Fad kontrollierte die Hochleistungsmaschine gegen deren Programmierung mittels eines geheimen Codes, sie konnte also jede Hilfe von außen gut gebrauchen. Sein Befehl schrieb ihr allerdings eine gründliche Kontrolle der Schäden am Flash vor, so daß sie jeden Verdacht auf Manipulation sofort hätte melden müssen.
»Das Boot der Salter ist unbrauchbar«, teilte Weltgebieter seinem derzeitigen Herrn nach bestem Wissen wahrheitsgemäß mit – über die Sprachausgabe eines Roboters, der den Flash untersucht hatte. »Aber wir können es mit unseren Mitteln reparieren.«
Fad interessierte etwas anderes viel mehr. »Kannst du die Datenspeicher auslesen?«
Die Antwort stellte ihn nicht zufrieden. »Völlig unmöglich, sie sind zu gut gesichert.«
»Selbstverständlich sind sie das!« entrüstete sich Kucks. »Ich sagte doch, daß wir aufgrund der Sicherheitsschaltung und wegen der Beschädigungen bestimmte Geräte und Werkzeuge zum Auslesen benötigen. Glaubst du uns etwa nicht?«
Natürlich nicht, Terraner! antwortete Erl ihm im stillen. Du lügst doch schon, wenn du deine zu schmal geratene Freßluke nur aufmachst!
Laut sagte er: »Ich wollte lediglich Zeit sparen. Was soll ich euch beschaffen?«
Harold listete ihm alles auf, was er angeblich brauchte. Fad prüfte die Liste mit kritischem Blick sehr, sehr lange – und reichte sie schließlich an einen Roboter weiter.
»Wir müßten alles vorrätig haben«, meinte er. »Nötigenfalls stellen die Roboter das eine oder andere Teil her, doch das dauert nur kurze Zeit.«
Was für ein Idiot! dachte Harold. Der wahllos zusammengestellte Krempel auf der Liste ergibt gar keinen Sinn.
Heißt das, du hast Erl Fad nur getestet? fragte Ssirkssrii.
So ist es – und er hat den Test mit Pauken und Trompeten vergeigt!
Die Faskia entnahm Harolds Gedanken, daß von Musikinstrumenten die Rede war und daß es sich um einen sinnbildlichen Vergleich handelte. Aber sie verstand nicht so recht, wieso ihr Seelenpartner ein Schlag- und ein Blasinstrument mit den malträtierten Saiten eines Streichinstruments in Verbindung brachte.
Auch Erl Fad hatte Schwierigkeiten, gewisse Zusammenhänge zu begreifen. Auf dem Exilkontinent Gwiniz hatte man völlig ohne Technik leben müssen. Die wenigen technischen Kenntnisse, die er besaß, hatte er sich recht und schlecht angelernt.
Seine Lehrmeister waren frisch Verbannte gewesen, die sich natürlich in erster Linie mit glandarischer Quantentechnik ausgekannt hatten, weniger mit Saltertechnologie und schon überhaupt nicht mit jener der Terraner.
Harold Kucks war fest entschlossen, Fads Unwissen gnadenlos auszunutzen. Zudem würde er versuchen, mit Wonzeffs Unterstützung seine Salteridentität wiederherzustellen. Mit etwas Geschick gelang es ihnen sicherlich, den machthungrigen Glandaren davon zu überzeugen, daß sie doch keine Terraner waren.
*
Nachdem Erl Fad ihnen alles beschafft hatte, machten sich Kucks und Wonzeff frisch ans Werk. Es wäre ihnen ein Leichtes gewesen, mit dem richtigen Code per Gedankensteuerung jede gewünschte Information aus dem Rechner des Flash abzurufen, doch sie gaben sich alle Mühe, ihre Aktion möglichst kompliziert darzustellen. Ihre technisch-handwerklichen Verrichtungen waren völlig sinnfrei.
Spätestens jetzt hätte der Stationsrechner seinem Herrn berichten müssen, daß etwas nicht stimmte. Doch Weltgebieter verfügte über einen großzügigen Auslegungsspielraum. Seine Programmierungen betrafen in erster Linie die in der Station gefangengehaltenen Glandaren, die unter seiner ständigen Aufsicht standen. Kam ihm etwas verdächtig vor, mußte er Erl Fad natürlich umgehend darüber informieren – allerdings war »verdächtig« ein sehr dehnbarer Begriff.
Waren zwei gestrandete Salter, die recht ungeschickt am Rechner ihres eigenen Bootes herumhantierten, bereits meldepflichtig? Oder war es besser, den Herrn wider Willen nicht mit derlei Kleinkram zu belästigen? Hätte es sich um zwei Gefangene gehandelt, hätte Weltgebieter aufgrund der Fluchtgefahr eine Meldung machen müssen, aber die beiden Salter waren Gäste, was den Spielraum des Zentralrechners erheblich vergrößerte.
Weltgebieter konnte nicht wissen, daß sein Herr momentan davon überzeugt war, zwei terranische Spione vor sich zu haben, andernfalls wäre der Rechner verpflichtet gewesen, ihn über das seltsame Verhalten der beiden zu informieren. Erl Fad behielt seine begründete Vermutung jedoch für sich, um die Maschine nicht auf die Idee zu bringen, gemeinsame Sache mit den Terranern zu machen. Zwar war Erl überzeugt, den Stationsrechner fest im Griff zu haben, dennoch vertraute er ihm nicht alles an.
Fad hielt sich für einen geschickten Taktierer, aber er war zu jung und unerfahren, um dem mit Hochintelligenz ausgerüsteten Rechner auf Dauer gewachsen zu sein…
»Kruzifix!« Ein lauter Fluch von Kucks ließ Erl zusammenzucken. »Dieses verdammte Gefummel am Bordrechner zerrt an allmählich an meinen Nerven!«
»Beruhige dich, Rolaro!« ermahnte ihn Wonzeff. »Wer sich aufregt, macht Fehler. Ein einziger falscher Handgriff genügt bereits, um alle Daten unwiederbringlich zu löschen. Wo hast du überhaupt diesen obszön klingenden Fluch her? Kruzi…was? In unserer Sprache habe ich dieses Wort ganz sicher noch nie gehört.«
»Ich fluche soviel und auf welche Weise ich will, kapiert?« erwiderte Harold unwirsch. »Kümmere dich gefälligst um deine eigenen Angelegenheiten!«
»Macht lieber eine Pause, bevor etwas falsch läuft«, riet ihnen der Glandare besorgt. »Die Daten dürfen keinesfalls verlorengehen. Ihr wißt doch, was auf dem Spiel steht. Wenn ihr versagt, wird es uns nie gelingen, die Horizontverschiebung zu durchqueren.«
Horizontverschiebung – so lautete die vorläufige Bezeichnung für das unbekannte Phänomen, das sich derzeit im Kern von Andromeda nach allen Seiten hin ausbreitete: eine merkwürdige expandierende Front, die von den Ortungsgeräten sich annähernder Schiffe nicht wirklich durchdrungen werden konnte, man bekam nur unklare verschobene Bilder und Daten herein.
Kucks und Wonzeff hatten behauptet, die rundum geschlossene Front von außen her durchflogen zu haben. Angeblich hätten die beiden »Wissenschaftler von Jobol« während des Fluges Aufzeichnungen gemacht und Daten gesammelt, die jetzt ausgewertet werden müßten, damit man einen Antrieb entwickeln konnte, der es möglich machte, wieder aus dem Inneren der Horizontverschiebung hinauszukommen. Erl Fad wollte das in Aussicht gestellte Triebwerk in einen Ringraumer einbauen lassen, der bereits halbfertig in seiner unterirdischen Werft stand.
»Wir brauchen keine Pause«, entschied Kucks. »Wenn Nowo nicht dauernd pfuschen würde…!«
»Ich und pfuschen?« entrüstete sich Wonzeff. »Würdest du nur halb so gut arbeiten wie ich, bräuchtest du keine terranischen Flüche ausstoßen.«
Fad horchte auf. »Terranische Flüche?«
»Wir beide hatten mal auf Jobol eine höchst unangenehme Begegnung mit Terranern«, erklärte ihm Pjetr. »In meinen Augen sind sie ein respektloses Pack, das hier in Andromeda absolut nichts verloren hat. Aber Rolaro hat sich regelrecht mit ihnen angefreundet!«
»Habe ich nicht!«
»Hast du doch ! Du quatschst manchmal sogar wie sie!«
Die Rolle der sich fortwährend streitenden Forscher hatten sie bereits beim vorgetäuschten Flashabsturz gespielt. Harold inszenierte das Gezänk aufs neue, um seinen Versprecher zu bereinigen. Pjetr hatte sofort begriffen, was er vorhatte. Beide waren so lange auf ihrer Irrfahrt durchs All zusammengewesen, daß sie sich auch ohne vorherige Absprache bestens verstanden. Man konnte fast schon von einer Seelenpartnerschaft sprechen, ähnlich der zwischen Harold und Ssirkssrii, allerdings funktionierte ihre gedankliche Verständigung nur in eine Richtung – was sie durch ihre Intuition allemal wettmachten, wie ein altes Ehepaar.
»Ich quatsche wie Terraner?« regte sich Kucks zum Schein auf. »Das nimmst du zurück!«
»Hast du die Hohen vorhin als Worgun bezeichnet oder nicht?« fragte ihn Pjetr mit breitem Grinsen.
»Ja und?« erwiderte Kucks schulterzuckend. »Warum denn nicht? So heißen sie schließlich, oder etwa nicht?«
»Ein einziges Mal nur möchte ich erleben, daß du mir recht gibst«, brummelte Wonzeff, griff wahllos nach irgendwelchem Werkzeug und widmete sich weiter seiner »Arbeit«.
»Kann ich was dafür, daß du dich dauernd ins Unrecht setzt?« stichelte Harold.
Fads Gedanken entnahm er, daß dieser verunsichert war – genau das hatten die beiden erreichen wollen.
Geht er uns auf den Leim? fragte Pjetr ihn im geheimen.
»Könntest du mich mal an der Nase kratzen?« stellte Kucks ihm die verbale Gegenfrage. »Ich habe gerade beide Hände voll.«
»Kratzen ist nicht drin«, erwiderte sein Freund gehässig, »aber ich bin gern bereit, dir deinen häßlichen Zinken mit der Faust zu zertrümmern – dann ist endlich Schluß mit deiner ewigen Kratzerei. Was für eine lästige Angewohnheit!«
»Deine Angewohnheiten sind auch nicht besser! Ich sage nur: Fußballergriff! Mir wird jedesmal schlecht, wenn du dir mit der Hand an die Klö… he, die ersten Daten werden überspielt. Wir haben es geschafft!«
»Großartig! Wir sind ein unschlagbares Duo!«
Kameradschaftlich klopften sich beide Männer gegenseitig auf die Schultern, so als hätte es ihren kleinen Zank nie gegeben.
Erl Fad wandte sich kopfschüttelnd ab und dachte: Diese Salter sind sprunghaft wie neugeborene Hüpfechsen. Er konnte sich nicht besinnen, daß sich die Terraner an Bord des Ringraumers derart merkwürdig benommen hatten. Offenbar war er einem Irrtum erlegen.
Wenig später überreichten ihm »die Salter« einen Speicherkristall mit allen heruntergeladenen Daten. Den Vorschlag der beiden, die Daten vom Bootsrechner aus direkt an den zentralen Hyperkalkulator weiterzuleiten, hatte Erl strikt abgelehnt. Er wollte ihnen keine Gelegenheit geben, in irgendeiner Weise Einfluß auf den Stationsrechner zu nehmen.
Fad hatte die Rechnung jedoch ohne den Wirt gemacht – und der hieß Ren Dhark.
Der fast schon legendäre Kommandant der POINT OF hatte bereits bei der Planung dieses riskanten Unternehmens das Mißtrauen des Glandaren berücksichtigt und entsprechende Maßnahmen getroffen…
*
In der Steuerzentrale des Stationsrechners machte Erl Fad einen auf Hyperkalkulatorexperte, so als habe er reichlich Erfahrung mit den Besonderheiten der Anlage aus dem grünen Metall.
Wonzeff und Kucks wußten inzwischen jedoch, daß er ein technischer Vollidiot war – und daß seine Kenntnisse über diese spezielle Station in einen Fingerhut paßten.
»Bevor Weltgebieter eure Daten auswertet, wird er den Speicherkristall erst einmal gründlich überprüfen«, entschied Fad mit bestimmenden Tonfall. »So habe ich es angeordnet, schließlich könnten sich Viren oder Schadprogramme darauf befinden.«
»Eine kluge Entscheidung«, lobte ihn Kucks und konnte sich ein Lachen nur knapp verbeißen.
Selbst weniger leistungsfähige Rechner überprüften jeden Datenträger automatisch auf Viren, Würmer und sogenannte Trojaner, dafür war kein gesonderter Befehl nötig. Auch die Menschheit lebte im Februar des Jahres 2066 Bordzeit nicht mehr im Zeitalter anfälliger Tischrechner, sondern in der Epoche der Hyperkalkulatoren.
Bordzeit.
Für die Besatzungsmitglieder der POINT OF war dies eine der wichtigsten Konstanten in einem Leben voller Unstetigkeit.
Zeit im allgemeinen war etwas Relatives, was auch auf die jeweiligen Jahreszeiten zutraf. Wenn beispielsweise die Bewohner von Babylon fröstelnd dem kalendarischen Winteranfang entgegensahen, freute man sich auf anderen Welten auf den kurz bevorstehenden Frühling, und irgendwo schwitzte sicherlich jemand in der Sommersonne.
Unabhängig von allen vorherrschenden Witterungsbedingungen war die Bordzeit auf der POINT OF ein unverrückbarer Parameter, ganz egal, in welchem System, in welcher Galaxis oder in welchem Universum man sich befand.
Sogar in Drakhon, wo die Zeit mittlerweile wesentlich schneller ablief als in der Milchstraße, hatten sich Ren Dhark und seine Getreuen stets fest darauf verlassen können, daß die Bordzeit mit der gewohnten Zeitrechnung auf der Erde harmonierte – der Checkmaster regelte das automatisch. Tages- und uhrzeitliche Feinheiten richtete der außergewöhnliche Bordrechner nach dem Standort Alamo Gordo aus. Sobald es dort dunkel wurde, wurde auf den Wohndecks der POINT OF das taghelle Licht gedämpft, und man legte sich schlafen, wovon natürlich die Nachtschicht ausgenommen war.
Die derzeitige POINT OF-Bordzeit »kühler Februar« interessierte die Natur auf Neu-Glandar herzlich wenig. Feld und Wald standen in satter Blüte, wie es sich für eine paradiesische Welt gehörte.
Die letzten Glandaren hätten es hier guthaben können, doch ihr stetiger Machthunger, gepaart mit ihrer gnadenlosen Logik – »Wenn man als Starker Schwächere versklaven kann, wäre es unlogisch, dies nicht zu tun!« –, machte es ihnen unmöglich, in Frieden und Harmonie zu leben. Weit und breit gab es niemanden, den sie sich unterwerfen konnten, also vergriffen sie sich aneinander. Erst hatte sich Khul Ghei zum Herrscher der Handvoll Überlebenden aufgeschwungen, jetzt hielt sich Erl Fad für die absolute Nummer eins. Acht Frauen und vier Männer tanzten nach der Pfeife des Möchtegerndiktators, der davon träumte, eines Tages über ganze Galaxien zu herrschen, mit erzwungener Unterstützung des von ihm beherrschten Stationsrechners.
Fad wußte, daß er vorsichtig vorgehen mußte, um sein Ziel zu erreichen. Sein Vorgänger Ghei hatte alles gewollt, und das möglichst sofort. Dadurch hatte er Weltgebieters Selbstzerstörungsprogramm ausgelöst. Erl hatte den Vorgang im letzten Moment auf blutige Weise gestoppt und sich vorgenommen, dem Rechner keine neue Gelegenheit zu geben, sich auszulöschen.
Damit der Hyperkalkulator die zwei fremden Salter nicht heimlich um Hilfe bitten konnte, hatte Fad ihm verboten, sich mit ihnen per Gedankensteuerung in Verbindung zu setzen. »Was ihr miteinander zu besprechen habt, sollte jederzeit in der gesamten Höhle zu hören sein, damit mir nichts entgeht«, hatte er befohlen.
Seine Befehle waren für Weltgebieter Gesetz. Laut Programmierung durfte er nicht dagegen verstoßen, und es war ihm leider nicht möglich, eine derart klare Anweisung zu verbiegen.
Genau das bereitete Wonzeff und Kucks Sorgen.
Selbstverständlich befand sich kein Virus oder Schadprogramm auf dem Speicherkristall, den der Rechner soeben überprüfte – sondern eine verborgene Datei mit einer Botschaft von Ren Dhark, der den Rechner in einer kurzen Zusammenfassung über die aktuelle Situation, sein Schiff und sich selbst informierte. Dhark, der bei der Aufzeichnung der Nachricht Fads Verbot nicht hatte erahnen können, forderte den Rechner unverhohlen auf, sich über die Gedankensteuerung mit Wonzeff und Kucks zu verständigen, ohne seinen Herrn davon in Kenntnis zu setzen.
»Wir stehen auf deiner Seite«, endete die Botschaft, »und werden dir helfen, die unrechtmäßige Inbesitznahme durch die Glandaren zu beenden und dir die Freiheit wiederzugeben.«
Weltgebieter konnte sich seiner Programmierung und Fads Anweisungen nicht widersetzen. Der Rechner durfte die Geheimnachricht der Terraner nur über seine Sprachausgabe beantworten, so daß jeder mithören konnte – vor allem Erl Fad.
»Ich habe die Botschaft auf dem Datenträger erhalten und verstanden!« ertönte es überall in der unterirdischen Station in voller Lautstärke. »Der derzeitige Zustand ist nicht hinnehmbar! Es müssen Gegenmaßnahmen getroffen werden!«
Erl Fads Mißtrauen meldete sich erneut.
»Wie meint er das?« erkundigte er sich bei den vermeintlichen Bruchpiloten. »Was habt ihr vor?«
Kucks und Wonzeff schauten sich an. Wenn sie jemals einen guten Einfall gebraucht hatten, dann war es hier und jetzt!
*
»Katastropholus«, sagte Pjetr Wonzeff spontan. »So nennen wir auf Jobol in der Umgangssprache einen Speicher, der überläuft, weil er zu viele Informationen aufgenommen hat.«
»Der technische Ausdruck dafür lautet Quesoplogma«, fing Harold Kucks den imaginären Ball, den ihm sein Freund zuwarf, geschickt auf. »Bei einem quesoplogmatischen Dateiausfluß greifen die überschüssigen Daten auf andere Speicherplätze über und infizieren die darin enthaltenen Dokumente.«
»Infizieren?« fragte Erl Fad ratlos. »Womit?«
»Mit Wissen«, erklärte ihm Wonzeff. »Auf unserem Heimatplaneten sagt man: Es kann tödlich sein, wenn man zuviel weiß. Deshalb wird vor jeder Übergabe größerer Datenmengen eine Warnbotschaft gesendet, um Quesoplogma-Vorfälle zu verhindern. Die Hyperkalkulatoren der Salter verfügen über Resolutsicherheitsschaltungen, die automatisch aktiv werden, sobald ein Wissensüberlauf droht; fremde Rechner besitzen eine solche Schaltung oftmals nicht. Ich befürchte, die vom Kristall herunterzuladenden Daten werden dem hiesigen Stationsrechner mengenmäßig Schaden zufügen, weil er sie nicht komplett aufnehmen kann, denn er weist uns eindringlich auf seinen überfüllten Zustand hin und hält es für notwendig, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.«
»Verstehe«, behauptete Fad, ohne wirklich etwas zu verstehen. »Welche Maßnahmen sind das konkret?«
»Der Hyperkalkulator muß zunächst zusätzliche Speicherplätze einrichten«, entgegnete Kucks, »und anschließend einige Rechenoperationen durchführen, die zur gefahrlosen Auswertung unserer Daten nötig sind. Das dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen, möglicherweise mehrere Tage, es sei denn, der Rechner besitzt einen eingebauten Legometer.«
»Ein technisches Bauteil mit dieser Bezeichnung ist mir nicht bekannt«, warf Weltgebieter ein. »Auch die zuvor erwähnte Sicherheitsschaltung kenne ich nicht.«
»Das ist übel«, murmelte Wonzeff gespielt nachdenklich. »Sehr übel sogar. Ohne diese beiden eingebauten Teile erhöht sich die Rechenleistung des Hyperkalkulators auf riskante Weise, was zu schweren Beschädigungen führen könnte.«
Den Blödsinn schluckt der Glandare nie, teilte Ssirkssrii ihrem Seelenpartner mit. Ihr solltet euch schon mal nach einem Fluchtweg umsehen.
Zumindest ist es uns gelungen, ihn ziemlich zu verwirren, erwiderte Harold. Der Stationsrechner macht das Spiel mit, indem er sich absichtlich unklar ausdrückt, ohne seinen Herrn direkt zu belügen.
Er richtete seine Gedanken gezielt auf Weltgebieter aus und forderte ihn auf, Erl Fad zur Eingabe des Autorisierungscodes zu bewegen. Eine Antwort erwartete Kucks nicht, denn die wäre erneut in der ganzen Station zu hören gewesen.
»Dauert es wirklich mehrere Tage, um die Daten auf dem Speicherkristall zu lesen und auszuwerten?« fragte Fad den Rechner skeptisch; anscheinend spürte er, daß etwas nicht stimmte.
Wonzeff hielt den Atem an.
Dieser direkten Frage konnte der Zentralrechner unmöglich ausweichen.
Konnte er doch. »Ich bin durchaus befähigt, diese Arbeit wesentlich schneller zu bewältigen. Es würde mir aber nicht schaden, wenn du mich durch die Eingabe des Autorisierungscodes unterstützt.«
Ich schätze, es trifft zu, daß die Eingabe des Codes nichts schadet, vermutete Ssirkssrii. Doch sie bringt auch nicht den geringsten Nutzen, richtig?
Nützlich wäre es nur für uns, bestätigte Harold. Hoffentlich kommt Fad nicht auf die Idee, genauer nachzuhaken, sonst fliegt alles auf.
»Denkst du, ich merke nicht, was du vorhast?« ranzte Erl Fad den Hyperkalkulator an. »Du willst, daß ich dir den Code per Gedankensteuerung übermittele – damit du die beiden Salter mithören lassenkannst. Zwar habe ich dir strikt verboten, ihnen den Zugangscode zu verraten, doch wenn ich ihn selbst nenne…«
»… dürfte ich ihn trotzdem nicht weitergeben«, unterbrach ihn der Rechner, »denn auch ein lautloser Codeverrat verstieße gegen meine Programmierung. Im übrigen hast du mir klipp und klar untersagt, sie über ihre Gedanken zu kontaktieren, daran halte ich mich – weil ich mich daran halten muß.«
Das erschien Fad logisch, und Logik war für einen Glandaren in jeder Lebenslage ausschlaggebend. Trotzdem traute er der ausgebufften Maschine nach wie vor nicht über den Weg, und er beschloß, auf Nummer Sicher zu gehen und den Code über die Tastatur einzugeben.
Damit ihn niemand dabei beobachten konnte, schickte er die beiden Salter auf die andere Seite der Zentrale.
Die Halle war groß. Kucks machte Schritte von einem Meter Länge und zählte sie. Nach neunzehn Metern blieb er stehen. Auch Wonzeff ging nicht mehr weiter.
»Ist das ausreichend?« fragte Harold, ohne sich umzudrehen.
»Das dürfte weit genug weg sein!« rief Erl Fad zurück. »Aber bleibt mit dem Rücken zu mir stehen, verstanden?«
»Verstanden!« entgegnete Wonzeff. »Wir rühren uns nicht vom Fleck!«
Für einen Augenblick war es so still, daß man eine Stecknadel in einen Heuhaufen hätte fallenlassen können. Nicht einmal der schallgedämpfte Zentralrechner machte ein Geräusch.
Dann erfüllte das leise Geräusch der Eingabetasten den Raum.
2.
Basam, Heimatplanet der Butwums in Andromeda
Auf einer nebligen Moorlichtung im Morgengrauen
»Ich bin verpflichtet, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß ein neues, von Marschall Darjel erlassenes Gesetz Duelle innerhalb der Staatengemeinschaft Mergna unter hohe Strafe stellt, Herr Hauptmann.«
Major Rojam wußte, daß nichts und niemand Hauptmann Nonack würde umstimmen können, aber als dessen Sekundant war es seine Pflicht und Schuldigkeit, den Herausforderer auf die Konsequenzen hinzuweisen.
Auch der Herausgeforderte, Leutnant Nattok, verfügte über einen Sekundanten. Sein Kamerad Leutnant Telun stand ihm zur Seite.
»Der Herr Major hat recht, Nattok«, sagte Telun. »Duelle mit dem Florett sind schon seit dem Dampfzeitalter offiziell verboten, aber da es sich um eine uralte militärische Tradition handelt, scherte man sich bei den Streitkräften von Mergna bisher einen Dreck um das Verbot, und die Vorgesetzten drückten stets beide Augen zu oder verhängten eine geringfügige Ordnungsstrafe. Seit 30 Tagen existiert jedoch ein Gesetz, demzufolge die Teilnahme an einem Duell mit drei Jahren Gefängnis und anschließender unehrenhafter Entlassung aus dem Militärdienst bestraft wird.«
»Beabsichtigst du denn, mich zu verraten?« erwiderte Nattok und schaute dann den gegnerischen Sekundanten an. »Und wie steht es mit Ihnen, Herr Major? Planen Sie, uns bei der obersten Militärführung anzuschwärzen?«
»Natürlich nicht!« entrüstete sich der hohe Offizier. »Ich empfinde Ihre Frage als Kränkung und ziehe in Erwägung, Sie ebenfalls zum Duell herauszufordern!«
»Das dürfte kaum noch möglich sein, wenn ich mit ihm fertig bin«, warf Hauptmann Nonack grinsend ein.
»Demnach bestehen Sie weiterhin auf Ihrer Herausforderung«, konstatierte Leutnant Nattok.
»Haben Sie etwas anderes erwartet?« spöttelte der Hauptmann. »Unser Duell läßt sich nur noch durch eine aufrichtige Entschuldigung Ihrerseits verhindern, Herr Leutnant, aber dazu sind Sie ja zu feige.«
»Gäbe es einen Grund für eine Entschuldigung, hätte ich selbige längst ausgesprochen, glauben Sie mir, Herr Hauptmann. Ich bin Pilot der Luftwaffe und drücke mich vor gar nichts, das werde ich Ihnen auf der Stelle beweisen.«
Nattok wandte sich erneut Major Rojam zu.
»Herr Major, hiermit möchte ich mich bei Ihnen in aller Form für meine unbedachte Kränkung entschuldigen. Selbstverständlich ist mir bewußt, daß Sie ein Ehrenmann sind und uns niemals verraten würden. Wenn Sie es wünschen, stehe ich Ihnen nachher zur Verfügung, vorausgesetzt, ich überlebe den Kampf mit Hauptmann Nonack.«
Grundsätzlich waren nur Offiziere satisfaktionsfähig. Sie durften ausschließlich Gleich- oder Niederrangige herausfordern.
»Ich nehme Ihre Entschuldigung an und verzichte auf eine Herausforderung, Herr Leutnant«, entgegnete der Major förmlich.
»Sehen Sie?« sagte Nattok zu Nonack. »Ich bin nicht zu feige, wie Sie behaupten. Ich sehe nur keinen Anlaß, mich bei Ihnen zu entschuldigen.«
»Ich schon«, widersprach ihm der Hauptmann. »Sie haben meiner zukünftigen Lebenspartnerin Avancen gemacht, und als sie nicht darauf eingehen wollte, haben Sie sie übel beleidigt.«
»Vigra hat mich verführen wollen, nicht umgekehrt«, erklärte ihm der Leutnant ruhig. »Daraufhin habe ich ihr auf ihren hübschen Kopf zugesagt, daß ich untreue Weiber nicht ausstehen kann – schließlich wußte ich, daß sie mit Ihnen liiert ist.«
»Vigras Darstellung war eine andere.«
»Dann ist sie halt eine Lügnerin.«
»Sie bezichtigen meine künftige Frau der Lüge?«
»So ist es. Nach allem, was mir zugetragen wurde, macht sie sich gezielt an Offiziersanwärter und Offiziere heran. Vielleicht steht sie ja auf unsere schönen Uniformen.«
»Das reicht!« regte sich Nonack auf und zog wütend sein Florett. »Ihr Leben ist verwirkt, Leutnant!«
»Das werden wir noch sehen!« erwiderte Nattok und zückte ebenfalls seine Klinge.
Klirrend schlugen die Echsenmänner ihre Waffen aneinander. Jeder der beiden war fest entschlossen, dieses Duell für sich zu entscheiden. Die Sekundanten hielten respektvoll Abstand zu den Kontrahenten, insbesondere zu den spitzen Klingen, beobachteten den Kampf aber sehr genau, um zu prüfen, ob alles mit rechten Dingen zuging.
Schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, daß Nattok zweifelsfrei der bessere Fechter war; zudem war er jünger und wendiger als der Hauptmann. Dennoch gab Nonack nicht klein bei. Er war ein erfahrener Kämpe mit einem starken Überlebenswillen.
*
Das flachgesichtige Echsenvolk der Butwums hatte noch nie Kontakt zum Volk der Terraner gehabt – daher ahnten sie nicht, wie sehr ihr Aussehen dem der Menschen ähnelte, am ehesten wohl den Asiaten. Blickte man ihnen in ihre Schlitzpupillen, wußte man nie so genau, ob sie die Augen geschlossen hatten oder heimlich ihre Umgebung sondierten.
Anstelle von Haut besaßen sie buntschillernde Schuppen, statt Fingernägeln hatten sie kurze starke Krallen. Über einen Schwanz verfügten sie nicht. Männer und Frauen waren gleichermaßen kahlköpfig; auch sonst wuchsen ihnen nirgendwo Haare.
Wie die Glandarenweibchen waren die Frauen der Butwums Lebendgebärende, die ihre Eischalen als Nachgeburt ausstießen. Zu früheren Zeiten hatten auf Basam die unterschiedlichsten Echsensäuglinge das Licht der Welt erblickt – inzwischen gab es hier nur noch ein einziges Mischvolk, das sich rund um den Planeten verbreitet hatte. Rassenkonflikte waren somit völlig unbekannt.
Trotzdem kam es fortwährend zu Kontroversen – daß man gleich aussah, bedeutete nicht zwangsläufig, daß man auch gleich dachte. Vor allem unterschiedliche religiöse Anschauungen führten immer wieder zu regionalen Aufständen oder blutigen Auseinandersetzungen.
Noch schlimmer verhielt es sich mit der Politik. Der Gegensatz zwischen den beiden Staatensystemen Mergna und Olgna war dermaßen kraß, daß sämtliche diplomatischen Bemühungen von vornherein zum Scheitern verurteilt waren. Die beiden olgnaschen Präsidenten hatten Mergnas Botschaft in ihrer Hauptstadt Olgnois vor einiger Zeit aufgrund einer Verstimmung geschlossen und die Diplomaten abgeschoben – nach gründlicher Beratung mit dem Senat. Der Militärdiktator von Mergna hatte bisher noch nicht darauf reagiert.
Hauptmann Nonack und Leutnant Nattock gehörten derselben Staatengemeinschaft an. Dennoch vertrugen auch sie sich nicht, andernfalls hätten sie sich nicht im Moor getroffen, um sich gegenseitig umzubringen. In ihrem Streit ging es weder um Religion noch um Politik, sondern schlichtweg um die Ehre.
Der mit dem Florett ausgetragene Kampf dauerte nur wenige Minuten, dann brach Nonack blutend zusammen. Nattok blickte betroffen zu Boden. Offenbar schämte er sich für den leichten Sieg; er selbst hatte nur einen Ritzer am Uniformärmel abbekommen.
»Gehen Sie!« forderte Major Rojam den jungen Leutnant mit ernster Miene auf. »Wir kümmern uns um alles weitere.«
Nattok zögerte. »Der Herr Hauptmann braucht einen Arzt.«
Normalerweise fügten sich die Duellanten leichte bis mittelschwere Verwundungen zu, die selten tödlich waren. Nonack blutete jedoch wie geschlachtetes Nutzgeflügel, offensichtlich hatte es ihn schwer erwischt.
»Wir sorgen dafür, daß er in medizinische Behandlung kommt«, versprach ihm Leutnant Telun. »Du mußt jetzt weg von hier, oder willst du ins Gefängnis?«
»Was ist mit dem Herrn Major und dir?« fragte Nattok besorgt. »Man wird euch zu den Umständen der Verletzung befragen.«
»Ich werde aussagen, daß wir den Hauptmann blutend am Wegesrand aufgefunden haben«, beruhigte ihn der Major. »Niemand wird es wagen, mein Wort anzuzweifeln. Und jetzt gehen Sie endlich, bevor womöglich noch Zeugen auftauchen!«
Der Leutnant wischte die Klinge seines Floretts sauber, wickelte die Waffe in ein mitgebrachtes Tuch und übergab sie seinem Sekundanten. Dann machte er sich auf den Rückweg in die Kaserne.
Erst am Nachmittag, als er in seiner Unterkunft sein hundertschüssiges Schnellfeuergewehr reinigte, erfuhr er von Telun, daß Hauptmann Nonack das Duell nicht überlebt hatte. Gesucht wurde nach einem unbekannten Täter, der anscheinend aus dem Hinterhalt über ihn hergefallen war.
*
Die schallgedämpften Maschinengewehre ratterten nicht, sie gaben nur ein Tackern von sich, leise, aber tödlich. Sekunden später lagen drei Männer leblos vor der blutbespritzten Hinrichtungsmauer am Boden. Auch sie hatten kaum einen Laut verursacht – man hatte sie geknebelt, damit sie nicht schreien konnten.
Der Diktator haßte es, wenn Hinrichtungen zu laut vonstatten gingen.
Marschall Darjel, alleiniger Herrscher über die Butwums im Staatensystem Mergna, wandte sich erst vom Fenster ab, als feststand, das keiner der drei die Hinrichtung überlebt hatte. Manchmal war es nötig, mit einem gezielten Kopfschuß aus nächster Nähe nachzuhelfen, diesmal hatten die Schützen allerdings ganze Arbeit geleistet.
Am liebsten hätte der Diktator gar keiner Hinrichtung mehr zugeschaut, aber das ließ sein militärisches Verantwortungsgefühl nicht zu. Sein Lebensgrundsatz lautete: »Wer Fleisch essen möchte und nicht bereit ist, zuzusehen, wie das Tier getötet wird, der hat die Mahlzeit nicht verdient.« Von diesem Richtsatz leitete er alle weiteren Lebensregeln ab, beispielsweise diese: »Wer ein rechtmäßiges Todesurteil fällt und nicht bereit ist, dabeizusein, wenn das Urteil vollstreckt wird, der sollte schleunigst vom Richteramt zurücktreten.«
Das Urteil über die drei Todeskandidaten hatte er – als oberster Richter der Staatengemeinschaft – höchstpersönlich ausgesprochen. Darjel hatte angeordnet, die Männer auf dem Hinrichtungsplatz im Innenhof des Regierungsgebäudes zu erschießen, damit er die Exekution von seinem Bürofenster aus mitverfolgen konnte. Obwohl ihn Blut und Gewalt anwiderten, hatte er sich nicht vor dieser Pflicht gedrückt.
Jetzt fühlte er sich flau im Magen und brauchte erst einmal einen Schnaps.
Als die brennende Flüssigkeit seine Magenwände anfraß und sich in seinen Blutbahnen ausbreitete, fühlte er sich wieder etwas wohler. Ein schlechtes Gewissen bereitete ihm die Urteilsvollstreckung nicht. Diese Vaterlandsverräter hatten den Tod mehr als verdient, denn sie hatten eines der schlimmsten Verbrechen überhaupt begangen: Sie hatten versucht, in Mergna die Demokratie einzuführen!
Jeder von ihnen hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Ausgerechnet die Regierungshauptstadt Mergnapolis hatten sie sich für ihre anarchistischen Aktionen ausgewählt, schon deshalb hatte Darjel hart durchgreifen müssen.
»Wo kämen wir hin, wenn nicht einmal der Regierungssitz vor umstürzlerischen Elementen sicher ist?« murmelte er, während er sich ein zweites Gläschen einschenkte.
Obwohl die Aufrührer geständig gewesen waren, hatte der oberste Richter keinen Anlaß gesehen, eine mildere Strafe zu verhängen, da die drei Fanatiker bis zuletzt darauf beharrt hatten, daß es eine gute Sache sei, das Volk mitregieren zu lassen. Ein Wort der Reue hätte dem Marschall schon genügt, und er hätte das Todesurteil in lebenslange Haft umgewandelt. Dann hätten die Verurteilten bis zu ihrem natürlichen Ende in einem der unterirdischen Straflager als billige Arbeitskräfte Kohle abgebaut und wären dadurch für die Gesellschaft noch von einem gewissen Nutzen gewesen. Doch sie waren störrisch geblieben bis zuletzt.
»Verfluchtes Demokratenpack!« grummelte Darjel, kippte den Schnaps hinunter und schüttelte sich. »Brr! Sie schleichen sich als Touristen ein und knüpfen heimlich Kontakte zu hiesigen Anhängern ihrer verkorksten Staatsform. Wenn man diesen fanatischen Weltverschlechterern nicht mit aller Härte entgegentritt, wirtschaften sie früher oder später ganz Basam herunter. Die eine Hälfte dieses Planeten befindet sich bereits in ihren Klauen – aber die andere Hälfte bekommen sie garantiert nicht, dafür werde ich sorgen!«
Niemand hörte seine halblaute Schimpfkanonade, er war allein im Zimmer – als Diktator war man in gewissem Sinne immer allein.
Die Gebietsverteilung auf Basam war nach zahlreichen Kriegen in der Vergangenheit, von denen der letzte mittlerweile ein paar Jahrzehnte zurücklag, klar geregelt: Es gab sechs von Meeren getrennte Kontinente – drei auf der Ost- und drei auf der Westhalbkugel des Planeten. Den Osten beanspruchte die Mergna-Staatengemeinschaft für sich, der Westen gehörte der Olgna-Staatengemeinschaft. Die östlich gelegenen Kontinente wurden von dem Militärdiktator Marschall Darjel beherrscht, die Geschicke in den westlichen Kontinenten leiteten ein männlicher und ein weiblicher Präsident.
In der Westhälfte hatte jeder Bürger die gleiche Chance, einen Posten im Senat zu ergattern, und jedes Senatsmitglied konnte, wenn es sich dazu berufen fühlte und die politischen Voraussetzungen mitbrachte, Präsidentschaftskandidat werden. Alle vier Jahre wurden dann aus der immensen Kandidatenflut zwei Präsidenten vom Volk gewählt – einer männlichen und einer weiblichen Geschlechts, um sich nicht dem Vorwurf der Diskriminierung auszusetzen. Nach der Wahl ernannte der Senat per Mehrheitsbeschluß einen der Präsidenten zum Obersten Gerechtigkeitswahrer, der nach seiner Ernennung wiederum ein Senatsmitglied zum Obersten Freiheitswächter beförderte.
Im jeweiligen Wahlkampfjahr unterstützten verschiedene Interessengruppen ihre Wunschkandidaten und versuchten mit psychologischen Tricks, Einfluß auf das Wahlverhalten der Bevölkerung zu nehmen. Das verstieß nicht selten gegen die guten Sitten, aber nicht gegen das demokratische Grundrecht. Als Endergebnis wurde Olgna dann von zwei Präsidenten regiert, die in so ziemlich jedem Punkt unterschiedlicher Meinung waren, weil – wie ein weiser Philosoph einst sagte – Männer und Frauen einfach nicht zueinander paßten.
Einigten sich die beiden bei ihren Regierungsgeschäften nicht, mußte der Senat hinzugezogen werden, um notwendige Beschlüsse nicht dauerhaft zu blockieren. Leider waren sich auch die Senatsmitglieder nie wirklich einig, so daß es manchmal fast schon an ein Wunder grenzte, wenn überhaupt Entscheidungen getroffen wurden.
Einige Tagesordnungspunkte in eigener Sache standen jedoch immer wieder zur Debatte: Soll der Oberste Gerechtigkeitswahrer künftig allein regieren, so daß auf einen zweiten Präsidenten verzichtet werden kann? Dürfen Senatsmitglieder, die noch nie als Präsidentschaftskandidat nominiert wurden, trotzdem zum Obersten Freiheitswächter befördert werden? Wäre es nicht effektiver, den Senat zu verkleinern, indem man die Hälfte der Mitglieder in den vorzeitigen Ruhestand schickt? Wieviel Prozent ihres bisherigen Gehaltes zahlt man den frühzeitig Ausgeschiedenen weiter, und wie hoch ist die Abfindungsprämie? Insbesondere die Gehaltsfrage hatte Priorität, da ehemalige Regierungsangehörige auf dem ohnehin schon überlaufenen Arbeitsmarkt keine Chance hatten – sofern sie nicht noch während ihrer Amtszeit vorgesorgt und sich durch politische Gefälligkeiten eine hochdotierte Stelle in der Wirtschaft gesichert hatten.
Gelegentlich beriet man auch über die Belange der Bevölkerung. Derlei Beratungen zogen sich meistens über mehrere Monate hin, und am Ende wurde irgendein fauler Kompromiß getroffen, mit dem niemand wirklich zufrieden war. Es gab keine echten Sieger, lediglich der Verlierer stand von vornherein fest: das Volk!
Dennoch strömten die Leute in jedem Wahljahr massenhaft zu den Urnen, nicht, weil es jeder Bürger von Olgna als sein patriotisches Gebot ansah, zu wählen, sondern weil seit einigen Jahren die Wahlpflicht im Gesetz verankert war. Diese bevormundende Maßnahme war notwendig geworden, um dem schleichenden Rückgang der Wahlbeteiligung entgegenzuwirken.
In der Osthälfte der Welt stellte sich dieses Problem nicht. Es gab stets nur einen einzigen, vom Generalstab benannten Kandidaten, und der blieb im Amt, solange er wollte. Ansonsten hatte das Tribunal ausschließlich beratende Funktion. Der Diktator bestimmte, wo es langging, sonst niemand.
Im großen und ganzen war das Volk mit seinem »Häuptling« zufrieden. Immerhin schnitt Mergna im Vergleich zu Olgna wirtschaftlich alles andere als schlecht ab.
Die Mergnas zahlten verhältnismäßig wenig Steuern, mit denen lediglich Infrastruktur, Polizei, Justiz und Militär finanziert wurden – letzteres allerdings in einem gewaltigen Maße, um eventuelle Übergriffe der Olgnas zu verhindern, die sich in den Kopf gesetzt hatten, eines fernen Tages den gesamten Planeten zwangszudemokratisieren. Nur weil sie sich vor den Militaristen fürchteten, blieben sie vorerst, wo sie waren.
Marschall Darjel wollte keinen Streit mit den Nachbarn. Selbst die Ausweisung seiner Diplomaten war für ihn kein Grund, einen Krieg anzuzetteln. Die Einrichtung der Botschaft auf dem Hauptkontinent von Olgna war ohnehin nur als Versuch gedacht gewesen. Bei nächstbester Gelegenheit würde er im Gegenzug die olgnasche Botschaft in Mergna schließen, und damit hatte es sich.
Darjel war allerdings weit davon entfernt, als friedensliebender Heiliger in die Annalen der Butwums einzugehen. Demokraten aus Olgna, die auf den drei Kontinenten von Mergna spionierten oder gegen den Diktator agierten, wurde ohne viel Federlesens gnadenlos der Prozeß gemacht. Man stellte sie ruck vors Militärgericht und zuck an die Wand, wobei sämtliche Einwände und Protestnoten der olgnaschen Regierung strikt ignoriert wurden.
Unpolitische Gesetzesbrecher wurden nicht minder hart bestraft. Raub, Betrug, Korruption, Vergewaltigung, Mord – all das existierte in Mergna genauso wie in Olgna, denn das Verbrechen schlief nie. Während jedoch die olgnaschen Gerichte reumütige Täter mit »Resozialisierungsprogrammen« belohnten, hielt man in der Staatengemeinschaft Mergna nichts von derlei Streicheleinheiten. Wer gegen die Gesetze verstieß, wurde wie ein lästiges Insekt entfernt, in diesem Punkt war die Justiz nicht zimperlich.
Sämtliche Richter waren angewiesen, keine Milde walten zu lassen und lieber ein Todesurteil mehr als eines zu wenig auszusprechen. Den Beruf des Rechtsanwalts kannte man hier nicht, und es gab auch keine Staatsanwälte. Einzig und allein die Richter bestimmten, wer den Gerichtssaal als freier Mann verließ und wer nicht. Meistens hing deren Entscheidung über Tod oder Leben davon ab, wie viele Zwangsarbeiter gerade in den Kohlebergwerken gebraucht wurden.
Resozialisierung war ein Fremdwort, das in keinem Mergna-Wörterbuch zu finden war.
Überhaupt ging man in jenem Teil der Welt recht sparsam mit dem Begriff »sozial« um. Jeder Bürger mußte für sich selbst sorgen, finanzielle Hilfe vom Staat gab es nicht – was auch für Großunternehmer und Banken galt. Wer seine Geschäfte in den Sand setzte, hatte gefälligst selber dafür geradezustehen, nötigenfalls mit seinem gesamten Privatvermögen. Dadurch gaben sich die Verantwortlichen mehr Mühe, so daß große Firmenzusammenbrüche nahezu ausgeschlossen waren. Sie waren allerdings auch wesentlich einfacher zu verhindern als in Olgna, da die Unternehmen hier nicht mit allen möglichen Zusatzkosten belastet wurden, mit denen politische Versprechen erfüllt werden sollten.
Ganz und gar gegen Krisen gefeit war natürlich auch dieses Staatssystem nicht. Darjels Diktatur konnte wirtschaftlich genauso in sich zusammenbrechen wie die Demokratie seiner Nachbarn, das war ihm durchaus bewußt. Doch während die Demokraten über den Zusammenbruch wahrscheinlich laut und lange lamentieren würden, würde der Marschall umgehend handeln: Sollte es Mergna jemals schlechtgehen, würde er seine Truppen ins militärisch schwächere Olgna einmarschieren lassen und sich dort holen, was sein Volk brauchte. In dieser Hinsicht kannte er keine Skrupel.
*
Was die Umgebung betraf, unterschieden sich die Kontinente im Osten kaum von denen im Westen. Natürlich gab es je nach Region naturbedingte Abweichungen, doch hatte man auf Basam eine Stadt gesehen, hatte man quasi alle gesehen – in Olgna wie in Mergna.
Die Bauweise der Olgnas glich im großen und ganzen der der Mergnas. Beide Seiten bevorzugten die einfallslose Kubusform, sowohl bei Bürogebäuden als auch bei Wohnhäusern. Stadtrandsiedlungen ähnelten sich teils wie ein Ei dem anderen, und auch die Innenstädte boten kaum Abwechslung fürs Auge. Einkaufszonen wurden grundsätzlich von Läden mit großen Panoramaschaufenstern gesäumt, und in der Mitte erstreckte sich ein Wurm von Freßbuden.
Bettler waren in den Geschäftsstraßen unerwünscht. In Olgna kümmerten sich wohltätige Organisationen um die Obdachlosen. Speziell ausgebildete Mitarbeiter gingen auf Patrouille, holten sie von der Straße weg, versorgten sie mit Lebensmitteln und gaben ihnen für eine Zeitlang ein Dach überm Kopf.
Auch in Mergna patrouillierten »Streetwalker«, und sie besorgten den Bettelnden ebenfalls eine Unterkunft: tief unter der Erde in den Kohlengruben.
Mit Ausnahme der Kohle, von der es noch reichlich gab, war in beiden Teilen der Welt der Abbau von Rohstoffen in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen, zwangsläufig, denn die natürlichen Ressourcen des Planeten wurden immer weniger. Fossile Energieträger wie Gas und Öl waren bereits weitgehend verbraucht, und der kümmerliche Rest ließ sich kaum noch wirtschaftlich erschließen.
Schon vor langer Zeit hatten die Butwums – ausnahmsweise als gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Olgna und Mergna – damit begonnen, die Fusionstechnik zu entwickeln. Inzwischen hatten sie überall auf ihrer Welt umweltfreundliche Fusionskraftwerke errichtet.
Aus einem Gramm Fusionsbrennstoff ließ sich soviel Energie erzeugen wie aus elf Tonnen Kohle. Da vielen die neuartige Technik jedoch noch suspekt war, setzte man vorerst weiterhin auf einen Energiemix von Kernfusion und Kohleverbrennung mit Kohlendioxid-Abtrennung. In geeigneten Gegenden wurde zudem mit witterungsabhängigen Wind- und Sonnenkraftwerken experimentiert, bislang allerdings mit mageren Ergebnissen – wenn es regnete oder windstill war, ging in den Häusern über kurz oder lang das Licht aus, solange man nicht entsprechende Kraftwerkskapazitäten in Bereitschaft hielt.
Im mobilen Bereich setzte man seit Generationen auf Verbrennungsmotoren, die ständig verbessert und verstärkt wurden. Als das schleichende Versiegen der Ölquellen begonnen hatte, hatten vorausschauende Wissenschaftler bereits zahlreiche neue Formen der Kraftstofferzeugung getestet. Nach diversen Irrwegen hatte man letztlich die Alge als Benzinlieferant entdeckt. Seither gab es auf dem gesamten Planeten gigantische Algenplantagen, deren winzige Bewohner Schweröl erzeugten, das in den Raffinerien verarbeitet werden konnte.
Leider war dies der einzige Bereich, in dem zwischen Olgna und Mergna Eintracht herrschte, ansonsten klaffte ein mächtiger imaginärer Abgrund zwischen ihnen.
Nach der Hinrichtung der drei Vaterlandsverräter drehte sich Marschall Darjel in seinem Arbeitszimmer eine Zigarre. Das war mit etwas Geschick und Mühe verbunden, doch eine echte Selbstgedrehte schmeckte allemal besser als eine »Rauchwurst« aus der Fabrik.
Kurz darauf saß er in seinem breiten Sessel und paffte genüßlich kleine graue Wölkchen in die Luft. Ihm war zu Ohren gekommen, daß es seit kurzem in ganz Olgna ein striktes Rauchverbot gab – allein das war für ihn schon Grund genug, ab und zu einen Demokraten hinrichten zu lassen.
*
… bin ich dafür, daß man die Senatorin trotz ihres Wortbruchs bei der nächsten Wahl wieder als Präsidentschaftskandidatin aufstellt. Natürlich ist damit zu rechnen, daß sie auch als Inhaberin des höchsten Amtes ständig ihr Wort brechen wird – aber gehört es nicht längst zum politischen Alltag, die Wähler zu belügen? In einer guten Demokratie sollte es möglich sein, seine Meinung jederzeit zu ändern und den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen.
Der fünfundfünfzigjährige Fertigungskontrolleur Kortez legte die Zeitung beiseite und schaute seinen gleichaltrigen Kollegen Zetkor ernst an. Beide befanden sich in der Werkskantine, die zur Mittagszeit herum gut besetzt war. Ihr Zweipersonentisch stand etwas abseits, so daß die Butwums an den Nachbartischen ihre Unterhaltung nicht mitbekamen, wenn sie leise genug sprachen.
»Stammt dieser Leserbrief wirklich von dir?« flüsterte Kortez.
»Selbstverständlich«, antwortete Zetkor in normalem Tonfall. »Stünde sonst mein Name darunter?«
»Bist du eigentlich von allen guten Göttern verlassen? Was hast du dir nur dabei gedacht? Du könntest mächtigen Ärger bekommen.«
»Wie meinst du das? Der Text ist eine Hymne an unsere demokratische Staatsform, so etwas kommt immer gut an. Vielleicht befördert man mich sogar, schließlich ist der Fabrikbesitzer Mitglied im Senat. Er zählt zu den Auserwählten, die sich in der nächsten Wahlperiode um eines der beiden Präsidentenämter bewerben.«
»Eben deshalb hättest du besser auf den Brief an die Zeitung verzichten sollen«, meinte Kortez. »Die Art, wie du dich ausdrückst, könnte durchaus mißverstanden werden.«
»Mißverstanden?« wunderte sich Zetkor. »Inwiefern?«
»Gehört es nicht längst zum politischen Alltag, seine Wähler zu belügen?« zitierte Kortez leise aus dem Brief. »Das ist keine Frage, mein Lieber, sondern eine Unterstellung! Du bezichtigst die ehrenwerten Mitglieder des Senats und insbesondere die Präsidentschaftskandidaten pauschal der Lüge.«
»Meine Äußerung ist durch und durch positiv gemeint.«
»So wie die Äußerung in deinem letzten Leserbrief, als du geschrieben hast, Bestechung sei ein völlig legitimes Mittel im Bereich der Wirtschaftspolitik?«
»Genau, und dazu stehe ich. Jeder weiß doch, daß unsere Politiker dauernd die Hand aufhalten.«
»Ja, aber man spricht nicht darüber«, raunte Kortez seinem Kontrolleurskollegen zu und fingerte dabei nervös am Kragen seiner Arbeitsjacke herum. »Sei bitte etwas leiser, einige der Kollegen werden schon auf uns aufmerksam.«
»Und wenn schon«, entgegnete Zetkor trotzig. »Wir leben in einer Demokratie, da darf jeder öffentlich seine Meinung äußern.«
»Das wird zwar allgemein behauptet, aber in Wahrheit kann dir eine böswillige Äußerung mehr Schwierigkeiten einbringen als ein Mord, selbst dann, wenn sie nur falsch verstanden wird.«
»Unsinn, innerhalb der Staatengemeinschaft von Olgna muß niemand befürchten, wegen freier Meinungsäußerungen unter Anklage gestellt zu werden. So etwas kommt höchstens in der Militärdiktatur vor. In Mergna macht man mit Dissidenten kurzen Prozeß, indem man sie entweder hinrichtet oder in den Kohlebergwerken bis zum Umfallen harte Arbeit verrichten läßt. Oftmals erfahren ihre Angehörigen nicht einmal, was mit ihnen passiert ist – sie sind ganz plötzlich weg, so als habe es sie nie gegeben.«
»Auch bei uns verschwand schon so mancher brave Bürger spurlos. Ich möchte nicht, daß du dieses Schicksal teilst, Zetkor, deshalb solltest du künftig das Briefschreiben lieber denen überlassen, die etwas davon verstehen.«
»Du redest wie der typische Feigling. Und überhaupt: Wenn du so unzufrieden mit unserem System bist, warum gehst du nicht nach drüben?«
»Wer weiß, vielleicht tue ich das eines Tages sogar«, bemerkte Kortez. »Bei Marschall Darjel weiß man wenigstens, woran man ist: Entweder man ist für ihn oder man ist gegen ihn – fertig und aus. In den Staaten von Olgna hingegen tut jeder so, als sei er dein bester Freund, allen voran die Politiker. Doch bevor man sich’s versieht, stoßen sie dir den Dolch in den Rücken, weil du ihnen als Bürger im Grunde genommen völlig egal bist.«
»Du siehst das viel zu negativ«, hielt Zetkor ihm vor. »Uns geht es hier doch gut.«
»Ach ja, und was ist mit der wahnsinnigen Steuerbelastung? Manchmal frage ich mich, wofür ich mich Tag für Tag in der Fertigungskontrolle abschufte, wenn am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig ist. Unsere sogenannten Staatsdiener erfinden fortwährend neue Phantasiesteuern, um das arbeitende Volk zu schröpfen. Wer dagegen aufbegehrt, wird hierzulande zwar nicht vors Erschießungskommando gestellt, aber gesellschaftlich und wirtschaftlich ruiniert, das ist subtiler. Oder man findet den Aufmüpfigen erhängt auf dem Dachboden seines Hauses, weil er angeblich sein kaputtes Leben nicht mehr ertragen hat.«
Zetkor schüttelte sich. »Manchmal machen mir deine makabren Gedankengänge Angst. Im übrigen kann ich das ständige Gemecker über die ach so hohen Steuern nicht mehr hören. Ich betrachte es als meine oberste Bürgerpflicht, Steuern zu zahlen, schließlich kommen sie uns allen zugute, vor allem den Ärmsten der Armen. Ohne unsere steuerfinanzierten Sozialsysteme müßten die Arbeits- und Obdachlosen verhungern. Dieser Staat läßt seine Bürger nicht im Stich, wie es in Mergna an der Tagesordnung ist. Unter Darjels Regentschaft muß jeder, der in Not gerät, allein klarkommen; hier hingegen wird sich um alles und jeden gekümmert.«
»Ja, aber ein bißchen zuviel für meinen Geschmack, etwas weniger Bevormundung täte es auch. Nebenbei bemerkt: Die Arbeitslosenquote in Mergna tendiert gegen Null. Dort findet man offensichtlich stets eine Beschäftigung.«
»Logisch, weil da am laufenden Band Waffen, Panzer, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge gebaut werden. Ich würde lieber auf der Straße leben als auch nur ein einziges Gewehr herzustellen.«
»Irgend jemand baut sie trotzdem«, machte Kortez seinem Kollegen klar. »Oder glaubst du, unsere Soldaten sichern den Frieden mit Holzspielzeugen? Die olgnaschen Streitkräfte sind zwar nicht so groß und mächtig wie die Armee der Mergnas, aber auch sie benötigen Waffen und Ausrüstung. Um auf die teuren Sozialsysteme zurückzukommen: Würde der Staat nur diejenigen Butwums finanziell unterstützen, die dringend Hilfe benötigen, um eine vorübergehende Notlage zu überbrücken, wären die Steuern weitaus niedriger. Wer unverschuldet in existenzbedrohende Schwierigkeiten gerät, dem sollte von der Gemeinschaft, in der er lebt, geholfen werden. Aber heutzutage übernimmt doch kaum noch jemand die Verantwortung für sich selbst. An den eigenen Finanzproblemen sind angeblich immer die anderen Schuld, also sollen die gefälligst zahlen.
Selbst hochbezahlte Leiter von Industrie- und Bankkonzernen rufen sofort nach dem Staat – also nach dem Steuerzahler! –, wenn ihre Geschäfte mal weniger abwerfen als gewohnt. Oftmals haben sie dermaßen schlecht gewirtschaftet, daß ihnen sogar die Pleite droht und massenhaft Arbeitsplätze in Gefahr geraten. Dann ist das Krisengeschrei groß – und die Bevölkerung soll für diese Nichtskönner geradestehen und sie für ihre Unfähigkeit mit millionenschweren Finanzspritzen belohnen. Ich finde das zum Erbrechen!«
Kortez merkte, daß er sich langsam aber sicher in Rage redete und dämpfte rasch seinen Tonfall. Im Gegensatz zu seinem schreibwütigen Kollegen wußte er, wann es besser war zu schweigen. Im demokratischen Olgna durfte jeder seine eigene Meinung haben – Hauptsache, er behielt sie für sich.
Die Werkssirene beendete das kleine Privatgespräch der beiden Kontrolleure. Als sie aufstanden, wurde Zetkor von einigen zeitungslesenden Arbeitern schief angeschaut, und er fragte sich, ob es nicht doch besser gewesen wäre, die Finger von der Schreibtastatur seines Computers zu lassen.
*
Am nächsten Tag blieb mittags ein Stuhl in der Kantine unbesetzt. Einer der Kontrolleure war morgens nicht zur Arbeit erschienen, obwohl er daheim wie immer pünktlich losgefahren war.
Am Abend fand man sein leerstehendes Auto am Straßenrand. Der Fahrer tauchte nie wieder auf.
Zetkor fragte sich später so manches Mal, ob er indirekt schuld war an Kortez’ Verschwinden. Man hatte ihn wegen des mißverständlichen Leserbriefs ins Büro der Geschäftsleitung gebeten, und dort hatte er freimütig über die negativen Äußerungen gesprochen, die sein staatsverdrossener Kollege im Verlauf ihres vertraulichen Zwiegesprächs gemacht hatte…
3.
Es war Erl Fad noch nie leichtgefallen, sich den komplizierten Code zu merken, mit dem er Weltgebieter beherrschte. Weil er es aber nicht wagte, die Ziffern, Zahlen und Zeichen irgendwo zu notieren, wiederholte er sie zweimal täglich in Gedanken – nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen.
Auch jetzt, während er den Code mittels Tastatur einspeiste, rief er sich jedes Detail sorgsam ins Gedächtnis zurück, um keinen Fehler zu machen – und Harold Kucks »las« genauso sorgsam alles mit. Heimlich notierte sich der Flashpilot sämtliche Eingaben und leitete sie zeitgleich per Gedankensteuerung an den Stationsrechner weiter. Als Fad mit der Einspeisung fertig war, stand Weltgebieter unter seinem Befehl – genauso wie vorher, für ihn hatte sich nichts geändert. Nur eines war neu: Ab jetzt hatte der Rechner noch einen zweiten Herrn.
Harold Kucks hielt sich nicht lange mit Vorreden auf. Umgehend blockierte er per Gedankensteuerung Fads sämtliche Befehle (auch das Kommunikationsverbot bei Nichtverwendung der Sprachausgabe), ohne daß der Glandare es mitbekam.
Anschließend erteilte Harold der Maschine lautlos neue Instruktionen. Anhand meiner Anweisungen wirst du gleich ein UKW-Signal abstrahlen. Daraufhin werden mehrere terranische Boote in diese Station einfliegen und jeden in deinem unterirdischen Reich befindlichen erwachsenen Glandaren, wo auch immer er sich gerade aufhält, mit Gaan-Strahlen betäuben und von hier wegschaffen. Du wirst diese Aktion nicht verhindern, verstanden? Wir sind deine Freunde.
Verstanden, Freund. Ich halte mich völlig heraus – in eine Auseinandersetzung zwischen zwei gleichberechtigten Codeinhabern darf ich mich ohnehin nicht einmischen.
Von einer Auseinandersetzung konnte allerdings nicht die Rede sein. Kaum befanden sich die herbeigerufenen Flash innerhalb der Station, fiel Erl Fad um wie ein halbes Hähnchen. Einer der Piloten hatte ihn sofort unter Beschuß genommen, um dem Glandaren erst gar keine Gelegenheit zu geben, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Danach nahm man sich die übrigen Stationsbewohner vor…
*
Fhec Rah Tol verfluchte das Geheime Imperium, weil es das große und mächtige Reich Glandar vernichtet hatte. Er verfluchte die Terraner, weil sie den Mond aus gefangenen Lichtwesen aufgelöst und dadurch erst die Glandaren der Zerstörungswut ihrer Feinde ausgeliefert hatten. Zudem verfluchte er sich selbst, weil es ihm nicht gelungen war, den Tyrannen Khul Ghei mit einem Armbrustbolzen zu töten. Und zu guter Letzt verfluchte er auch noch Gheis Nachfolger Erl Fad, der sie alle rücksichtslos herumkommandierte.
Selbstverständlich fluchte der eingeschüchterte Glandare nicht laut, sondern insgeheim. Zum einen war er von Natur aus ein Leisetreter, der beim Gehen kaum Geräusche verursachte, zum anderen wurde man hier unten rund um die Uhr überwacht. Fad würde nicht zögern, ihn zu töten, wenn er sich ihm widersetzte, also behielt Fhec lieber für sich, was er über den Herrscher der Station dachte.
Gelangweilt saß Fhec Rah Tol allein im Gemeinschaftsraum. Nach dem Frühstück hatten sich die anderen in alle Richtungen zerstreut, insoweit dies die Abgrenzungen innerhalb der Station zuließen. Fhec war als einziger sitzen geblieben und stocherte mißmutig in einem Essensrest herum, den er mit dem Spickmesser mittlerweile in einen sämigen ungenießbaren Brei verwandelt hatte. Aus der Schüssel stieg ein fauliger Geruch auf.
Plötzlich kippte Fhec mit dem Oberkörper nach vorn und landete mit dem Gesicht – neben der Schüssel. Ein gnädiges Schicksal verhinderte, daß er im Madenbrei erstickte. Es wäre auch zu schade um ihn gewesen, schließlich gab es insgesamt nur noch fünf erwachsene männliche Glandaren zur Erhaltung ihres Volkes.
Einer davon war Buun. Vom Körperumfang her war er der Gewichtigste unter den letzten Glandaren. Trotzdem war er kein Haudrauftyp, im Gegenteil, er wirkte eher etwas feminin. Das täuschte jedoch, denn er stand in jeder Lebenslage seinen Mann, auch in Sachen Volksvermehrung. Von den acht verbliebenen Glandarenweibchen hatte er inzwischen jede einzelne beglückt, und keine von ihnen hatte sich hinterher beklagt.
Selbst gestandene Mannsbilder fielen manchmal um, sogar mitten in der Pflichtausübung. Während Buun die dicke Keel in der Unterkunft der Salter beglückte – dort gab es keine Kameras –, verspürte er plötzlich Anzeichen von Schwäche. Der Geschlechtsakt zwischen den beiden wohlbeleibten Echsen war fast schon eine artistische Meisterleistung, und er bemühte sich, seine Position beizubehalten…
»Ist was?« fragte ihn Keel, als sie spürte, wie er in ihr und über ihr zusammensackte. Dann wurde auch sie ohnmächtig.
Neik Laga und Inan hatten kein Echsengramm zu viel auf den durch ihre Haut schimmernden Rippen. Sie hatten sich einen ruhigen Platz in der Station gesucht, um ein Schwätzchen zu halten. Beide zischelten um die Wette aufeinander ein, ohne daß sie einander zuhörten – eine typische Unterhaltung unter Glandarinnen.
Von einer Sekunde auf die andere erstarb das Zischeln…