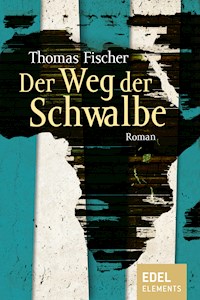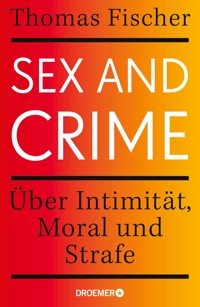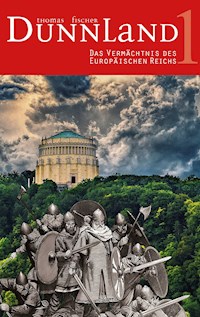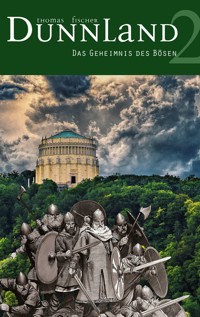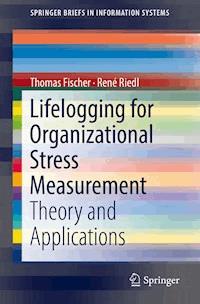17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ob Germanwings-Absturz, lebenslange Freiheitsstrafe oder die Verfolgung der letzten NS-Verbrecher, Thomas Fischer hat keine Scheu, in den großen aktuellen Debatten Position zu beziehen. Er ist der Meinung, gerade als Bundesrichter muss man sich der politischen Öffentlichkeit stellen. In seinen Einlassungen rechnet er mit Politikern, seinen Kollegen in der Justiz und den in der Gesellschaft herrschenden Mehrheitsmeinungen ab. Indem er erklärt, wie um Gesetze gerungen und gefeilscht wird, zeigt er, wie der Rechtsstaat heute im Innersten funktioniert und wo er an seine Grenzen stößt. Dabei gelingt ihm eine hochspannende und brillante Rechtsphilosophie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Thomas Fischer
Im Recht
Einlassungen von Deutschlands bekanntestem Strafrichter
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ist Deutschland ein gerechtes Land? Kommt darauf an. Zumindest ein rechtsstaatliches? Weitgehend. Wie es aber im politischen und juristischen Alltag um Recht und Gesetz bestellt ist, davon berichtet Thomas Fischer. Der Bundesrichter mischt sich in die aktuellen Debatten ein und bezieht klar Stellung: Sind wir wirklich im Krieg gegen den Terror? Wie soll Deutschland mit den Flüchtlingsströmen umgehen? Und was sagen eigentlich unsere Gesetze zum Thema Sterbehilfe?
Thomas Fischer rechnet ab, mit Politikern, seinen Kollegen und landläufigen Mehrheitsmeinungen. Er erklärt, wie der Rechtstaat heute im Innersten funktioniert und wo er an seine Grenzen stößt. En passant gelingt ihm eine hochspannende und brillante Rechtsphilosophie.
Inhaltsübersicht
Vorwort
I. Recht und Politik
Was hat der Kampf gegen den Terror mit Krieg zu tun?
Was wir gegen den Terrorismus tun können oder sollten
Ist der NSU-Prozess eine Farce?
Warum der Staat seine Bürger nicht töten darf
Was uns die Rechtsdogmatik über Flüchtlinge lehrt
II. Recht und Freiheit
Der schmale Grat zwischen Zufall und Schuld
Blasphemie kann kein Straftatbestand sein
Habe die Ehre!
NS-Verbrecher und die Beihilfe
Im Zweifel gegen die Freiheit?
III. Recht und Gesetz(gebung)
Über die Schwierigkeit, einen Raub zu begehen
Woher das Recht kommt
Lasst endlich das Sexualstrafrecht in Ruhe!
IV. Recht und Richter
Ein kurzer Lehrgang zur Aufzucht von Strafrichtern
Ist Jura schwierig oder leicht?
Der Richter und sein Selbstbild
Über die Befangenheit von Richtern
Über die Wahrheit
Der Beweis und die Überzeugung
Was Beweise heute wert sind
Veröffentlichungsnachweis
Vorwort
Unter dem Titel »Fischer im Recht« erscheinen seit Januar 2015 wöchentliche Kolumnen auf zeit-online.de. Dieses Buch enthält eine Auswahl aus diesen Texten, die nicht in zeitlicher Reihenfolge abgedruckt, sondern nach Themengebieten gegliedert sind.
Die Texte befassen sich mit dem Recht, ganz überwiegend dem Strafrecht. Gemeint ist das in einem breiten Sinn: Die Themenspanne umfasst Voraussetzungen und Bedingungen, Formen und Begründungen, Bedeutungen und Ziele, Wege und Wirkungen des Rechts. Strafrecht ist ein steter Prozess der Kommunikation. Er umfasst die ganze gesellschaftliche Wirklichkeit. Man kann es nicht abschaffen oder durch bloße Namensänderung verschwinden lassen. Seit es Menschen gibt, strafen ihre Gemeinschaften die Abweichenden – mal um der angeblich göttlichen Ordnung, mal um der angeblichen Anerkennung der Persönlichkeit willen.
Dieses Buch soll kein Ort sein für die Rechthabereien des Alltags und für das übliche Räsonieren über angebliche Sensationen. Denn diese verschwinden für gewöhnlich auf Nimmerwiedersehen zur Nacht – auf dass der nächste Tag eine noch unerhörtere Ungerechtigkeit enthülle. So mag, wer will, die Welt des Rechts verstehen: als Folge von Skurrilitäten oder Sensationen, unendliche Abfolge von Witzen über Gurkenkrümmung, Mietpreisverordnung und abwegige Steuergesetze. Wer damit zufrieden ist, hat gewiss auch seine Überzeugungen. Sie laufen meistens darauf hinaus, dass die anderen ungerechtfertigt bevorzugt und man selbst ungerecht benachteiligt sei. Das kann unmöglich die ganze Wahrheit sein, denn die Wahrheit ist meist vielgestaltig, kennt ein »einerseits« und »andererseits« und muss oft mit nur mittelmäßigen Lösungen auskommen.
Sachkunde hilft, Schwierigkeiten zu verstehen und unter Umständen auch auszuhalten. Dieses Buch bemüht sich daher, zuallererst, um Vermittlung von Sachkenntnis. Es ist nicht als (weiterer) Pranger für Fehler, Skandale, Zumutungen, Unzulänglichkeiten des Rechts gedacht, dargeboten von einem, der es wissen müsste.
Viele Menschen, die einen Rechtsstreit verloren haben – oft nach Regeln, die ihnen bis dahin unbekannt waren –, zweifeln an der Kraft des Rechts, manchmal mit gutem Grund, manchmal aus Rechthaberei. Sie wünschen sich Gerechtigkeit. Sie vergessen, dass die andere Seite genau dasselbe verlangt und dass man über Regeln und ihre Voraussetzungen nur dann mit Aussicht auf Verständnis schimpfen sollte, wenn man sich zuvor Mühe gibt, ihren Sinn zu verstehen.
Recht und Justiz sind derzeit oft nur Objekt einer wenig zielgerichteten, dumpfen Empörung oder zumindest von Vorbehalten: Mag sie die eigene Ohnmacht zum Gegenstand haben oder das Unrecht des Alltags, das »Die da oben«, die den Weltlauf bestimmen, und das »Die da unten«, die uns Angst machen. Immer wieder erscheinen die Regeln falsch oder diejenigen, die sie anwenden, als unwissend oder unwillig.
Der Bürger weiß heutzutage viel über Grundregeln der Technik, der Gesundheit oder der Wirtschaft. Die Grundregeln des Rechts versteht er dagegen häufig nicht, obgleich sie doch das Leben weithin bestimmen. Zahlreiche TV-Formate und die gedruckte Presse, vor allem aber auch die abundante Masse von vorgeblich wichtigen Internet-Meldungen aus allzu häufig zweifelhaften Quellen und von geringer journalistischer Qualität konfrontieren ihre Konsumenten täglich mit dem angeblichen oder tatsächlichen Versagen wichtiger Ordnungssysteme. Zwar funktioniert unser Alltag aus unerklärlichen Gründen gleichwohl fast perfekt, doch scheint in der Wahrnehmung vieler über allem stets eine dunkle Wolke zu liegen. Und vor allem ein Versagen scheint allgegenwärtig: das des Rechts und der Justiz vor den Anforderungen der Gerechtigkeit. Hier besteht erheblicher Informations- und Aufklärungsbedarf.
Frage: Darf ein Bundesrichter öffentlich über die Bedeutung und die praktische Verwirklichung des Rechts schreiben? Gegenfrage: Warum nicht? Wer sonst? Frage: Muss man nicht Angst haben um die Würde, die Unparteilichkeit und die Reputation der Justiz? Antwort: Die sogenannte Würde der Justiz wird erstaunlich oft gerade von Personen beschworen, die sich hinter diesem Wort gar keinen weiteren Inhalt vorstellen. Für sie erschöpft sich »Würde« im bloßen So-Sein des Justiz-Systems und in einer unendlichen Selbstbestätigung. Das ist, als behaupte man, die Würde des Menschen folge aus der Schönheit seiner Kleider.
»Würde des Gerichts« ist aber nicht das Bildnis der Richter im Fernsehen, nicht die herrische Geste des »In meinem Saal bestimme ich«, nicht die Teilung der Welt in Rechtsanwender und Rechtsunterworfene. Solcher Bilder, die aus vergangenen Jahrhunderten stammen, haben keinen Wert, wenn sie das Leben nicht erklären und ordnen können.
Den Versuch der Gerechtigkeit kann nur eine Justiz leisten, die wirklich unabhängig und sich ihrer Würde jenseits von Interessen, Einflussnahmen und (Partei-)Politik bewusst ist. Eine solche Justiz muss gefordert, gefördert und erstritten werden. Sie muss in Schutz genommen werden gegen einseitige Angriffe von außen und gegen Verteidiger einer bräsigen Selbstgenügsamkeit von innen.
Das Ansehen der Justiz leidet gewiss nicht, wenn die Auseinandersetzung mit ihr zu kritischen Stellungnahmen führt. Denn wir sprechen ja über eine rechtsstaatliche Justiz in einer demokratischen Republik, in welcher der Täter so viel Würde hat wie das Opfer, der Dummkopf so viel wie der Alleswisser, der Richter so viel wie der Antragsteller. Die Mitglieder der Justiz sind keine der Kritik enthobene Elite. Es kommt darauf an, die Rolle des Rechts und die Verantwortung derjenigen zu verstehen, denen es, nach den Worten des Grundgesetzes, »anvertraut« ist.
Es scheint mir also evident, dass ein Richter seine Meinungen über das Recht in Aktion, also auch über Rechtspolitik, soziale Voraussetzungen und Folgen des Rechts, öffentlich und außerhalb kanonischer Bühnen sagen darf. Denn dort – in den Zirkeln des Fachwesens, den Zeitschriften und Sammelbänden, Symposien und Festschriften der Wissenschaft – tun das die sogenannten Praktiker des Rechtswesens, namentlich auch Richter, ja seit eh und je. Die Schmerzgrenze gilt als touchiert, wenn einer sich nicht an Bibliotheks-Besitzer oder -Nutzer, sondern an diejenigen wendet, die es angehen könnte: also die Bürger, deren Leben das (Straf-)Recht bestimmen soll und oft genug auf äußerst eindringliche Weise bestimmt.
Das scheint mir aus verschiedenen Gründen merkwürdig und unklar. Zum einen gibt es keinerlei Grund oder Legitimation dafür, dass Recht, speziell Strafrecht, sich in eine hoheitsvoll-elegante Nische der professionellen Unverständlichkeit zurückziehen und das Feld einem Markt von laienhaften Darstellern überlassen sollte, deren Wirken beim Kundigen allzu oft nichts als Depression und Verzweiflung verursacht.
Zum anderen gibt es keine überzeugende sachliche Begründung dafür, dass Richter nach außen den Eindruck erwecken sollten, die von ihnen vertretenen Meinungen über das Leben, das Recht oder die Politik spielten für ihre Entscheidungen keine Rolle. Die Zurückhaltung in der öffentlichen Äußerung, die ihnen abverlangt wird, hat daher mehrere Aspekte:
Zum Gegenstand von Verfahren, die er selbst aktuell führt oder absehbar demnächst führen wird, sollte sich ein Richter nicht öffentlich äußern, weil dies den Eindruck von Befangenheit in der Sache erzeugen kann. Ob er sich zu vergangenen Entscheidungen äußert, an denen er selbst mitgewirkt hat, mag eine Frage des Geschmacks sein. Eher albern wären Veröffentlichungen, welche die eigene Entscheidung loben; eher peinlich solche, die sie verdammen. Es bleibt ein Bereich wissenschaftlicher Befassung, der mit beidem spielt, ohne es explizit zu sagen. Rechts-Wissenschaft ist aber keine Natur-Wissenschaft neutraler Erkenntnis.
Der interessanteste Aspekt ist die – streitige – Frage der Selbstdarstellung. Richter, die in öffentlichen, nicht als wissenschaftlich geltenden Medien auftauchen, stehen unter einem hohen Rechtfertigungsdruck. Sie werden doch wohl nicht etwa wollen, was alle wollen: Aufmerksamkeit, Popularität, Ruhm? Kollegen sind pikiert, Laien irritiert: Dürfen Richter Meinungen nicht nur haben, sondern auch sagen?
Ich denke: Ja. Denn das Bedürfnis oder die Forderung, die hinter der Pikiertheit stehen, haben ja ihrerseits keinen soliden Boden: Sie können denknotwendig nicht fordern, dass der Richter keine Meinung habe; daher verlangen sie, dass er sie verschweige, um das Publikum nicht zu beunruhigen. Und eben hierin offenbart sich ein in sich widersprüchliches Regime der Verschlossenheit um der Täuschung willen. Jeder Richter und jede Richterin, die ich kenne, hat rechtpolitische Meinungen, persönliche Vorurteile, individuelle Erfahrungen, Vorlieben, Abneigungen. Zu behaupten, man könne solche Voraussetzungen der Welt-Erkenntnis ausschlachten, wenn man »Ermessen ausübt« oder entscheidet, ob ein Verhalten »angemessen«, ein Eingriff »verhältnismäßig«, ein Irrtum »vermeidbar« gewesen ist, ist überaus unplausibel. Warum auch sollte es so sein? Richter lernen so etwas nicht; und es wäre auch nicht erstrebenswert.
Richter sind keine Automaten, die von den Lehrern des Rechts oder den Repetitoren zu Sprechpuppen eines gesetzgeberischen Willens ausgebildet (wie es sich die Justizbürokratie und die Abgeordneten der Parlamente erträumen) und in ihrer praktischen Tätigkeit oben mit höchstrichterlichen Leitsätzen gefüttert werden (wie es sich BGH-Richter erträumen), auf dass sie unten die Gerechtigkeit ausscheiden (wie es sich die Bürger erträumen). Sie sind, nach einer abgedroschenen und wahren Floskel, Menschen wie alle anderen, also nicht weiser und nicht besser und nicht vorurteilsloser. Ihre Legitimation zur Entscheidung und daher zur Macht-Anwendung bis zur puren Gewalt beruht nicht auf ihrer (fiktiven) Neutralität, sondern auf einer politischen Übereinkunft über das Verfahren ihrer Ernennung und ihrer Entscheidung.
Deshalb muss man, nach meiner Ansicht, die noch immer verbreiteten Märchen stören, um zum Kern der Rechts-Legitimität zu gelangen. Es scheint mir nachgerade unerträglich, wie das Rechtssystem sich von der Zivilgesellschaft abschottet und sich für seine Machtsprüche auf vorgeblich neutrale Positionen bezieht, die in Wahrheit oft nicht mehr sind als begriffliche Zirkelschlüsse und aufgeblasen verklausulierte Interessen.
Die Kolumnen und dieses Buch »Im Recht« versuchen, die Wirklichkeit des Rechts als Teil gesellschaftlicher Kommunikation und politischen Verhaltens darzustellen. Nicht systematisch: Dies ist kein Volkshochschulkurs über Strafrecht. Sondern schlaglichtartig, assoziativ und subjektiv.
Was das gedruckte Buch gegenüber der Online-Kolumne will (und vielleicht kann), liegt auf der Hand: Wiederholbarkeit nach uralt eingeübten Mustern haptischer Gedankenergreifung. Konzentration nach Sachgebieten. Die Möglichkeit assoziativen Stehenbleibens im Nachdenken, das die ewig flimmernden Bildschirme als Relikt einer angeblich vorkommunikativen Zeit zu verachten suchen.
Was das Buch nicht anders will als die Kolumne: Aufklärung über Recht und Gesellschaft, induktiv. Ich möchte nicht »Fälle« mit Ihnen lösen, schon gar nicht Ihre Fälle. Ich beginne einfach da, wo sich mir die Reflexion über Strafrecht und Gesellschaft darbietet, von der Großbuchstaben-Zeitung bis zur staatstragenden Ansprache, mit einer Assoziationskette, die, wenn sie gelingt, zur Einsicht in das Komplizierte durch Verständnis für das Einfache führen kann. Denn darum geht es: Menschen die Regeln zu erklären, nach denen sie leben.
Das ist leichter gesagt als getan. Denn das Recht und seine Regeln, vor allem auch das Strafrecht, verbergen sich hinter Nebelwänden von Unklarheit, Furcht, Sprache, Banalität. Strafrecht wird »gemacht« – nicht allein im Deutschen Bundestag, der die Gesetze beschließt. Auch die Gerichte »machen« Strafrecht. Auch die Medien. Auch die Zivilgesellschaft, also unsere scheinbar private Kommunikation. Strafrecht ist symbolisierte Gewalt, Herrschaft durch Sprache, Verheißung von Ordnung und Kommentierung von Chaos zugleich.
Dies ist kein Buch über Missstände. Es ist auch kein Empörungsbuch. Denn ich bin gar nicht empört: weder über den Zustand Deutschlands noch den des Lesers oder des Universums. Daher ist dies auch kein Wutbuch. Ich finde, dass das Leben schön ist und dass, wenn das nicht klappt, meistens mich selbst die Verantwortung dafür trifft. Ich habe keine Rezepte dafür anzubieten, wie Sie reich, schön und mächtig werden könnten. Erst recht keine Angebote, wer dafür verantwortlich sein könnte, wenn Sie denken, Sie seien es nicht.
Der Anspruch ist also klein und groß zugleich. Es ist ein solcher der Aufklärung, der Erhellung, der überraschenden Zusammenhänge. Das Strafrecht kommt den meisten Menschen heute daher wie ein Rätsel der Gewalt: von oben. Mal schlägt es zu, mal versteht es nichts; fast nie erfüllt es die Träume nach Frieden, die doch der Einzelne stets hat.
Kinder zum Beispiel haben ein wunderbares Verständnis vom Strafen. Es ist nicht Rache und trifft den anderen nicht als Fremden. Fast immer ist es kompatibel mit einem Einschlafen ohne Angst, das Versöhnung ist, Ordnung und Verständnis. Gewiss will ich nicht anregen, dass wir wie Kinder miteinander umgehen. Aber der erwachsene Umgang sollte die kindliche Frage nicht ganz vergessen. Ob das gelingt – und hier gelungen ist –, habe ich nicht zu entscheiden. Bevor Sie es für sich entscheiden, folgen Sie mir bitte ein paar Schritte auf das Meer hinaus.
I. Recht und Politik
Was hat der Kampf gegen den Terror mit Krieg zu tun?
Am Abend des 11. September 2001 betrat ich eine Tankstelle. Dort standen etwa zehn Bürger und betrachteten schweigend die Live-Übertragung der Angriffe auf die Türme von New York. Ein schmächtiger Mann, Mitte dreißig, Blue Jeans, schwarzes T-Shirt, lange Haare, trat schließlich aus der Gruppe und bewegte sich Richtung Ausgang. »Morgen«, sagte er in triumphierendem Ton, an niemanden speziell gewendet, »existiert Afghanistan nicht mehr.« Er sagte es stolz und erwartungsfroh. Er winkte, ging hinaus und fuhr weg. Ich weiß nicht, ob der Satz das Ende eines Gesprächs bildete, das vor meiner Ankunft stattgefunden hatte. Aber darauf kam es nicht an.
Seither habe ich oft an den Mann gedacht, für den sich so offenkundig alles vermischte: das frohe Staunen über den Eintritt von Star Wars ins wirkliche Leben, der Restbestand von Entsetzen, der auch dem abgebrühtesten Kinogänger beim Anblick wirklicher Toter bleibt, der Stolz auf die Erbarmungslosigkeit des D-Day, also die Freude an der Überwältigung, und sei es der eigenen, durch eine unbezwingbare, alles beherrschende Gewalt.
Natürlich wusste er nicht, wie viele uns überlegene Krieger in Afghanistan leben. Er träumte, wahrscheinlich, von irgendeiner unvorstellbaren Vernichtung, von Granaten aus meterdicken Rohren, von einem alles verschlingenden Racheschlag des Großen Bruders, von Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis.
Heute wissen wir: So ist es nicht gekommen. Alles ist anders gekommen. Die sogenannten Taliban haben den Krieg gegen uns gewonnen. Den abrückenden Truppen der uneingeschränkten Solidarität werfen sie derzeit noch ein bisschen Kamelmist nach; danach werden sie sich die von uns im Stich gelassenen Hilfstruppen vorknöpfen. Bevor wir unseren lieben Freund Herrn Hamid Karzai und seine Amigos und all die Mädchen befreiten, betrug der Anteil der Opium-Produktion am Bruttosozialprodukt zwei Prozent. Heute sind es vier. Afghanistan produziert heute achtzig Prozent des weltweit hergestellten Opiums.
Im Dezember 2008 wurden in einer Kirche in Uganda 45 Menschen mit Macheten zerhackt. Bei Überfällen auf weitere Kirchen starben im selben Zeitraum weitere 200 bis 500 Menschen. Im Dezember 2009 und Januar 2010 töteten die Täter etwa 600 Menschen und entführten mindestens 160 Kinder. Zwischen Weihnachten und Neujahr 2010 töteten sie mehr als 1000 Menschen. Das Vorgehen ist meist ähnlich: Bei Überfällen auf Bauerndörfer und Kirchen werden die Opfer zusammengetrieben und gefesselt. Erwachsene Männer und ältere Frauen werden mit Äxten und Macheten in Stücke gehackt. Jüngere Frauen und Mädchen werden vergewaltigt und als Sklavinnen verkauft, minderjährige Jungen als Kindersoldaten rekrutiert oder getötet. Seit 1987 soll die für diese Verbrechen verantwortliche Miliz in Uganda, der Zentralafrikanischen Republik, dem Südsudan und Kongo etwa 100000 Menschen ermordet, mehr als eine Million Menschen vertrieben, Zehntausende Frauen versklavt und Zehntausende Kinder entführt und unter Einsatz von Drogen und unvorstellbarerer Gewalt zu sogenannten Kindersoldaten abgerichtet haben. Der Stellvertretende Generalsekretär der OCHA, der Unterorganisation der UNO für humanitäre Angelegenheiten, hat sie als »die wohl brutalste Rebellengruppe der Welt« bezeichnet.
Die Organisation, von der die Rede ist, heißt »Lord’s Resistance Army« (LRA) und verfolgt das Ziel, einen christlichen Gottesstaat unter der Herrschaft der Zehn Gebote zu errichten: zunächst in Zentralafrika, später in der ganzen Welt. Ihr Gründer und Anführer heißt Joseph Kony. Er wird vom Internationalen Strafgerichtshof in den Haag per Haftbefehl gesucht – seit zehn Jahren leider vergebens.
Aufmärsche von Repräsentanten und Mitgliedern des Christentums gegen die Gräuel der LRA sind nicht bekannt. Ein Einmarsch der Bundeswehr zur Verteidigung Deutschlands am Kongo wurde nicht erwogen. Die Bundeskanzlerin hat nicht mitgeteilt, sie würde sich sehr freuen, wenn es gelingen würde, nach Herrn Osama bin Laden möglichst bald auch Herrn Joseph Kony zu töten.
Es gibt Milizen, Armeen, Verbrecherbanden auf dieser Welt, die im Namen jener »christlichen« Kultur, der sich in Deutschland ein jeder verpflichtet fühlt, grauenhafte Verbrechen begehen. Es gibt auch solche, die den wahren Hinduismus oder den wahren Islam oder irgendwelche anderen angeblich allerhöchsten Werte verwirklichen wollen. In Amerika, dem Land der besonders Freien, gibt es aggressive Sekten, die dem intellektuellen Niveau afghanischer Bauern deutlich unterlegen sind. Sie wollen das Reich irgendeines Herrn errichten. Sie haben Feuer und Schwert dazu, ganze Lagerhallen voll von Pumpguns und Schnellfeuergewehren. Ihre jungen Männer und Frauen trainieren wöchentlich. Wenn der Feind kommt, führt sie ihr Gott persönlich in den Kampf.
In den letzten zwanzig Jahren hat der Bonner Strafrechtsprofessor Günther Jakobs, einer der scharfsinnigsten, gnadenlosesten und gründlichsten Denker seiner Zunft in der europäischen Nachkriegszeit, das Bild eines sogenannten Feindstrafrechts entworfen – zunächst vorsichtig, kritisch, distanziert; später auf irritierende Weise bestätigend und fordernd.
Jakobs geht davon aus, dass es zunächst ein Bürgerstrafrecht gibt (und geben muss), also ein Strafrecht des Staates, das für all diejenigen gemacht und auf diejenigen angewandt wird, die innerhalb der (jeweiligen) staatlichen Gemeinschaft – im Sinne einer gemeinsamen Kultur – leben, leben wollen und als solche anerkannt werden. So ein Strafrecht für seine Bürger entwickelt jede staatlich verfasste Gemeinschaft zur Regulation und Verfolgung von abweichendem Verhalten in ihrem Inneren.
Daneben aber gibt es (oder sollte es nach Jakobs geben) ein Strafrecht für Feinde, also für Personen, die nicht bloß einzelne Gesetze übertreten, deren Geltung sie im Grunde anerkennen (auch der Dieb möchte durch das Bürgerstrafrecht geschützt und nicht bestohlen, der Vergewaltiger nicht vergewaltigt werden), und die daher auch wir als Mitbürger anerkennen. Sondern für Personen, die die jeweilige Rechtsordnung als solche im Grunde und im Ganzen verwerfen und deshalb zerstören wollen. Nach Ansicht von Jakobs muss der Rechtsstaat, will er sich nicht in pure Vernichtung flüchten, rechtzeitig Prinzipien und Grenzen des Umgangs mit solchen Feinden entwickeln, um sich selbst nicht aufzugeben. Denn: Einerseits darf er die Rechtsgüter gegenüber einem zerstörerischen Angriff nicht preisgeben, den er mit den Mitteln der »Bürgerstrafrechts« nicht aufhalten kann; andererseits darf er Prinzipien einer zivilisierten Gesellschaft nicht opfern, welche für seine eigene Legitimität unabdingbar sind.
Man hat Herrn Jakobs viele Vorwürfe gemacht wegen der »Erfindung« des Feindstrafrechts – obgleich er es nicht erfunden, sondern nur beschrieben hat. Viele halten ihn für eine Wiedergeburt des Staatsrechtlers und politischen Philosophen Carl Schmitt – eines erbarmungslosen Zu-Ende-Denkers von Ideen, die in den 1930er Jahren zur Affirmation der schrecklichsten Gewalt des NS-Staates führte und keine Grenzen mehr anerkannte hinter der bloßen Funktionalität von Legitimation: Recht als willkürliches Instrument von Gewalt.
Anders gesagt: Wenn soziale und politische Herrschaft keine inhaltliche, materielle Grenze und Bestimmung hat, sondern allein aus den Funktionen ihrer eigenen Bestätigung besteht, die Aufgabe des Rechts also nicht mehr die tatsächliche Verwirklichung von Gerechtigkeit und Glück ist, sondern nur mehr die Erzeugung von Imaginationen solcher Zustände, dann gibt es nichts mehr, was unsere moderne Gesellschaft noch zusammenhält. Die Angst davor nimmt man denen übel, die sie beschreiben.
Was bedeutet das? Was hat die verschreckte Rechtswissenschaft dem Jakobs’schen Gedanken entgegenzuhalten? Nicht viel, muss man leider sagen. Nach allem, was wir wissen, hat sich unser Staat im »Krieg gegen den Terror« wissentlich an Aktivitäten beteiligt, die in unserem Recht nur schwerlich eine Rechtfertigung finden: an Entführungen, an Folterungen, an Ermordungen. Wir, die wir doch vor siebzig Jahren geschworen haben, dass niemals mehr Schweigen herrschen dürfe über staatliches Unrecht: Was sagen wir nun, nachdem wir die verflossene DDR empörungsmäßig abgearbeitet haben, zu unserem eigenen Unrecht? »Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten.« Ein großer Satz, ein Satz für die Ewigkeit und die Geschichtsbücher. Die deutsche Bundeskanzlerin sagte ihn über das Recht und die Gerechtigkeit.
Deutschland führt seit dreizehn Jahren »Krieg«. Die öffentliche Meinung über all die Jahre war schwankend, die Helden der Meinungsfreiheit rätselten mit zitternden Händen über der Tastatur: Darf man das Wort verwenden? Was wird der Chefredakteur sagen? Wird mein Vertrag verlängert? Hat schon eine Partei angerufen? Welche Worte sind zurzeit erlaubt, welche üblich und erwünscht, und welche wären, unter Freunden, ganz unklug? Die Kriegsberichterstattung der deutschen Presse seit 2001 ist ein Thema für sich.
Und: Was bedeutete uns dieser »Krieg« überhaupt? Handelte es sich nicht vielleicht doch eher um ein »Phänomen«? Irgendetwas in den entfernten Formen des Krieges, aber ohne dessen Folgen? Eine Art von Kolonialkrieg vielleicht? Auch vor 120 Jahren freilich wollte man wenig wissen in Potsdam und Tübingen vom schwarzen Mann und vom Muselmann und vom Schlitzäugigen und seinem Leid. Man sprach über Gold, Rohstoffe, Holz, Kaffee.
Der Grund für das Schwanken der herrschenden veröffentlichten Meinung war kein intellektueller: Mir ist keine Redaktion bekannt, die der Frage »Krieg oder kein Krieg?« seit 2001 ernsthaft und offen nachgegangen wäre.
Stets ging es – wie immer im Krieg – um die eigene Haut. Darf man das sagen? Sechs Jahre lang vibrierten die hochgerüsteten freien deutschen Redaktionen, bis ein Adeliger mit Gel-Frisur sie erlöste: Karl-Theodor zu Guttenberg, Showmaster, Schlawiner. Er sagte: Nun sind wir im Krieg. Vielen Dank, lieber Freiherr, für die Magie des erlösenden Wortes, auf der großen Bühne der Geschichte. Herzlichen Dank, du freie Presse, für den Titanenkampf um dieses freie Wort!
Deutschland führt seit geraumer Zeit geträumte oder wirkliche Kriege: gegen den Terror ganz allgemein, besonders gern auch gegen den Drogenhandel, gegen die Geldwäsche, die Korruption, den Menschenhandel und so fort. Ein deutscher Bundeskanzler hat vor 15 Jahren mit ernster Miene geschworen, man wolle die Geldwäsche ausmerzen, wo immer sie sich zeigt (ihr Umfang ist seither um ein Mehrfaches gestiegen). Sehr gern kämpft der Deutsche auch gegen Wirtschafts- und Bandenkriminalität, vom sexuellen Missbrauch ganz zu schweigen. Der Krieg gegen die Kinderschänder hat die ganze Gesellschaft erfasst, er ist schon beinahe total.
Die martialischen Formulierungen täuschen: Es gibt keinen allgemeinen »Sicherheitskrieg«. Gäbe es ihn, ginge es dem Bürger schlecht. Denn er ist es ja, der im Krieg um die Sicherheit stets zugleich potenzielles Opfer wie potenzieller Täter sein kann. Beide Rollen verbinden sich dann in der Rolle des Verdächtigen: Jeder ist irgendwann involviert in kommunikative Vorgänge, derer sich der Sicherheitsapparat bemächtigen muss, um das Schlimmste zu verhindern.
Im Krieg ist vieles erlaubt, was uns hier und heute unvorstellbar erscheint: das Zerstören fremden Eigentums. Die Tötung von Feinden. Die Opferung der eigenen Zivilbevölkerung, wenn es denn nicht anders geht. Die Tötung fremder Zivilbevölkerung, unter bestimmten Umständen. Im Krieg darf man entführte Flugzeuge abschießen, auch wenn unschuldige Geiseln darin sitzen. Man darf vorsätzlich Menschen töten, um größeren Schaden zu verhindern. Man darf die feindlichen Kombattanten von hinten erschießen, im Schlaf töten, in Hinterhalte locken. Man darf sich auch einmal irren. Man wird auch dann zum Brigadegeneral befördert, wenn man aus Versehenen – shit happens! – hundert afghanische Bauern in die Luft gesprengt hat, die Benzin klauen wollten, in der tragischen Annahme, es handle sich um hundert Feinde.
In den 1970er-Jahren, als in Deutschland die sogenannte Rote Armee Fraktion Menschen ermordete, die sie als angebliche Feinde identifiziert hatte, und als eine Welle hysterischer Furcht, initiiert und instrumentalisiert von reaktionären Kräften, das ganze Land in einen Ausnahmezustand versetzte, verlangten die Täter, nachdem sie festgenommen und inhaftiert waren, ihre Anerkennung als »Bürgerkriegspartei«: Sie wollten gern nach der Haager Landkriegsordnung und der Genfer Konvention behandelt werden.
Ein damals berühmter Strafverteidiger, der wenig später – nach einer im Einzelnen unerforscht gebliebenen Wiedergeburt – der noch viel berühmtere Sicherheitsminister Otto Schily wurde, beantragte damals noch im großen RAF-Prozess in Stuttgart-Stammheim die Anwendung von Kriegsrecht auf die Angeklagten.
Das war eine in der Rückschau fast rührende Vorwegnahme der Probleme, die sich heute stellen. Selbstverständlich waren hundert zum Umsturz entschlossene RAF-Anhänger keine »Kriegspartei«, auch wenn sie Millionen Unterdrückte der ganzen Welt hinter sich wähnten.
Die kleine Bundesrepublik träumte sich damals, zwischen 1968 und 1977, in einen Krieg ums Große und Ganze. In den Taten wie in der Verfolgung der Terroristen spielte sie im Kleinen nach, was im Großen so grauenhaft misslungen war: Die ersten sechs Generalbundesanwälte unserer Republik waren frühere Mitglieder der NSDAP. Auch Bundespräsidenten und Bundeskanzler. Auch oberste Richter. Sie erzählten uns, was das Recht sei.
Was hat der mörderische »Islamische Staat« damit zu tun? Er ist mitnichten nur eine Bande bluttriefender Krimineller: Er überfällt keine Banken mehr, sondern betreibt den Aufbau einer Zentralbank. Er errichtet staatliche Strukturen, wo er die Herrschaft hat. Er hat 50000 Mann unter Waffen und kämpft in offener Feldschlacht auf einem Gebiet, das halb so groß ist wie die Bundesrepublik. Demnächst wird er uns im Fernsehen vielleicht einen Außenminister und einen Arbeits- und Sozialminister vorstellen. Später wird vielleicht ein deutscher Außenminister – distanziert, tapfer – die Lieferung von zwanzig Minenräumfahrzeugen an den jungen Staat diplomatisch begleiten und im Deutschlandfunk seiner »Hoffnung Ausdruck geben, dass die intensive Diskussion über die gesamte Palette der Themen zum besseren Verständnis beitragen« werde.
Am 7. Januar 2015 töteten in Paris außer sich geratene junge Männer eine Vielzahl von Personen, die sie für ihre Feinde hielten. Ob das »Terrorismus« war, hängt davon ab, wie man das Wort versteht. »Terror« und »Terrorismus« sind Begriffe aus einer Fachsprache der politischen Theorie über Einsatz, Ziel und Auswirkungen von Gewalt. »Terroristen« sind in dieser Sprache stets »die anderen«, also diejenigen, die Gewalt anwenden, ohne eine Legitimation dazu zu haben.
Eine Legitimation zur unbeschränkten Anwendung von Gewalt kann sich nur aus dem Kriegsrecht ergeben, einem Recht also, das sich mit der Bewertung von Gewalthandlungen zwischen gleich legitimierten Subjekten befasst: Solange nur Raubritter auf ihren Burgen saßen und ihre Söldnerhaufen gegeneinander sandten, war jeder der Terrorist des anderen. Wenn einer gewonnen hatte, war er mit einem Mal der Staat und die anderen waren die Verbrecher.
Dies ist der Stand der Dinge in Somalia, Syrien und Afghanistan und an vielen anderen Orten der Welt. Über diese schlichte Rechtsregel ist das moderne Völkerrecht noch nicht wesentlich hinaus gelangt. Deshalb streben die großen Mörder der Welt nach der Herrschaft über die Sprache: Sie wollen »Kriegs«-Partei sein. Gelegentlich haben sie dafür sogar ein gutes Argument: Ihre Gegner sind oft auf demselben Wege groß geworden wie sie selbst.
Die Medien sind voll von Bekenntnissen des Schreckens, der Ablehnung, der »Entschlossenheit zum Kampf«. Seite an Seite schritten die Protagonisten der uneingeschränkten Solidarität über die Champs-Élysées, eingehakt die Helden von Gaza mit den Verteidigern des freien Worts aus der Türkei.
Die Täter von Paris töteten nicht »wahllos«. Ihre Opfer waren Menschen, die – nach ihrer Ansicht – einer der Verdammnis anheimgegebenen Gruppe von Verworfenen angehörten. Ob diese einen Bleistift gespitzt oder sich auf andere Weise gegen das angeblich Heilige versündigt hatten, war den selbsternannten Engeln der Rache gleichgültig. In ihrer engen Welt unterscheidet man nicht nach solchen Einzelheiten. Das eint sie mit den Fanatikern aller Zeiten, allen Glaubens, aller Ziele. Die Menschen glauben an Zeichen: an Fahnen, Farben, Namen, Worte. Sie schneiden sich und anderen die Zunge heraus für die Jungfrau Maria oder den Propheten, sie verbrennen sich in der Hoffnung auf eine alles umfassende Liebe in der Ewigkeit. Sie massakrieren sich in der Verzweiflung über sich selbst. Wir kennen das doch! Und wir wissen, dass wir selbst in der Gefahr stehen, jederzeit, wie die, deren Wahnsinn wir erleiden müssen. Warum fallen wir immer wieder auf sie herein?
Die Täter von Paris unterscheiden zwischen Guten (Wir) und Bösen (Ihr). Das ist einfach und übersichtlich. Wer zerstören, verletzen und töten will, muss so und darf nicht anders denken. Die sie ermordeten, hatten das Heiligste, das Wichtigste und Reinste beleidigt, das die Täter sich vorstellen konnten. Normalerweise ist ein solches Tatmotiv dem Strafrecht und den Strafrichtern des christlichen Abendlands großes Mitgefühl und tiefes Verständnis wert: Täter, die aus solchem Antrieb handeln, können vor deutschen Gerichten auf die Anwendung des Strafrahmens für minder schwere Fälle hoffen. Bei Feinden gilt diese Regel nicht.
Sind die Terroristen nun also Feinde oder Bürger? Wollen wir sie vernichten? Oder sie in der Psychiatrie von ihrem Wahn »heilen«? Oder sie in Justizvollzugsanstalten zu anständigen Hauptschülern ausbilden? Werden wir ihnen im Knast eine ordentliche Handwerker-Ausbildung angedeihen lassen, oder werden wir mit der Bundeskanzlerin froh sein, dass es gelungen ist, sie zu töten? Diese Frage mag fremd klingen, doch sie enthält die Quintessenz des vorhin Gesagten:
Befinden wir uns wirklich im Krieg mit dem sogenannten Islamismus? Wenn ja: Befinden wir uns auch im Krieg mit dem Christianismus? In den offenen Kriegen in Afghanistan und Irak und in den versteckten Kriegen in einem sehr großen – den meisten Deutschen unbekannten – Raum dieser Welt werden seit vielen Jahren Millionen von Menschen in uns unvorstellbarerer Weise ungerecht behandelt. Die Drohnen, die in Afghanistan oder im Irak Familienfeiern und Hochzeiten in Stücke gerissen haben, weil sich – vielleicht, vielleicht aber auch nicht – ein Mitglied von Al-Kaida unter den Gästen befand, sind ja in unserem Namen, für die Verteidigung der von uns definierten Menschenrechte eingesetzt worden. Niemand in Deutschland hat je eine Träne vergossen über die Verzweifelten und sprachlos Überlebenden jener Feiern, die ganz gewiss keine Schuld hatten. Ein Showmaster im Fernsehen zeigte uns dann bei Gelegenheit, wie deutsche Rollstühle und Prothesen den Kindern ohne Beine zu neuem Lebensmut verhelfen. Danke, liebes Publikum!
Können wir ernstlich erwarten, uns das ganze Elend aus zwei Dritteln der Welt mithilfe sechs Meter hoher Mauern und eines sogenannten Kriegs gegen den Terror vom Leibe zu halten, ohne dass ein paar zum Letzten Entschlossene von da draußen in unsere Welt eindringen und Rache üben? Und können wir ernstlich erwarten, dass sie das auf eine Weise tun, die nicht besonders schmerzlich ist?
Warum nennen wir diejenigen, die uns angreifen, »feige« und »hinterhältig«? Sie sind es nicht. Sie sind Mörder, aber das steht auf einem anderen Blatt. Feige sind sie nicht. Feige ist vielleicht jemand, der eine satellitengelenkte Bombe in eine Hochzeit steuert und dabei in Ramstein sitzt und einen Dreifach-Burger mit den Fingern frisst. Feige ist vielleicht, wer den Führerbunker rechtzeitig vor der Explosion der Aktentasche verlässt.
Aber ist Mut überhaupt eine sinnvolle Kategorie? Ist es nicht vielmehr ein hilfloser Versuch, Form und Inhalt, Verantwortung und Versagen in eins zu bringen? Mut und Tapferkeit sind Eigenschaften, die von den Inhalten der Taten unabhängig sind.
Wenn wir also mit denen, die uns angreifen, als gehe es um die Rettung der Welt, tatsächlich reden und sie nicht nur vernichten wollen wie Ungeziefer, müssen wir ihren Mut anerkennen – einen Mut, der uns selber längst abhandengekommen ist. Träumt Euch, Ihr Steuerberater und Wirtschaftsstrategen, Ihr Halbmarathonläufer und Porsche-Besteller, Vertriebsberater und Servicekräfte, einen einzigen Tag lang hinein in die Unendlichkeit eines Lebens als Dreck. Und sagt mir dann, was mutig ist.
Damit ist gar nichts relativiert oder entschuldigt. Es geht nur um dieses Wort Mut und um unsere furchtbare Gleichgültigkeit. Solange wir uns die Hungrigen und Rachsüchtigen und Verlorenen dieser Welt mithilfe von Fernlenkwaffen und Drohnen vom Leibe halten können, benötigen wir keinerlei Mut. Das muss man, verehrte Sigmund Gottliebs des Fernsehplaneten, schlicht anerkennen: Die Kerle, von denen wir sprechen, sind wesentlich jünger, schneller, schöner und hundertmal mutiger als wir alten Säcke, die aus den Sternerestaurants Europas und Amerikas in die Hunger leidende restliche Welt hinausrülpsen, dass Bescheidenheit eine Tugend sei. Chanté!
Was wir gegen den Terrorismus tun können oder sollten
Zurzeit möchte jeder den Terrorismus verhindern. Wie ich im vorigen Kapitel ausgeführt habe, ist die Definition von »Terrorismus« gar nicht so einfach. Im Strafgesetzbuch sind die Paragrafen 129a und 129b zuständig: also »Bildung terroristischer Vereinigungen/im Ausland«. Die Regelungen sind unübersichtlich und schwer verständlich. Sie knüpfen am »Zweck einer Vereinigung« an, bestimmte Straftaten zu begehen (zum Beispiel: Mord, Umweltvergiftung, Brandstiftungen). Mit »Zweck« ist allerdings das Mittel, nicht das Endziel der Vereinigung gemeint: Es gibt vermutlich nur wenige »Vereine zur Förderung der Brandstiftung e.V.« in Deutschland.
Die Regelungen über »terroristische Vereinigungen« versuchen mehr oder weniger geschickt an äußeren Erscheinungsformen »terroristischer« Tätigkeit anzuknüpfen. Politische oder gesellschaftliche Zielsetzungen, Ideologien und Bewertungen kommen in ihnen nicht vor. Deshalb sind die Straftatbestände für die Bürger nur schwer zu verstehen und für die Fachleute nur schwer anzuwenden.
Ihre Hauptbedeutung gewinnen sie auf vertrackte und bedenkliche Weise: Der Verdacht gegen jemanden, Mitglied oder Unterstützer einer terroristischen Vereinigung zu sein, ist Voraussetzung für die am weitesten reichenden (polizeilichen) Maßnahmen zur Ermittlung, die unsere Rechtsordnung erlaubt. Ob sich der Verdacht später wirklich bestätigt, ist oft gleichgültig.
In der Sache entpuppt sich der Vorwurf der »Mitgliedschaft« oder der »Unterstützung« aber oft als fast belanglos und wird im weiteren Verfahrensverlauf eingestellt. Denn die Strafe für eine tatsächliche Beteiligung an einer konkreten Tat, die einer »Vereinigung« zuzurechnen ist, ist meist höher als die Strafe für die »Mitgliedschaft«, obwohl es gerade dieser Vorwurf war, der viele Ermittlungseingriffe oder etwa die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts überhaupt erst möglich machte. Wegen bloßer Mitgliedschaft oder Unterstützung werden daher in der Regel eher kleine Würstchen verurteilt – solche, denen man die Beteiligung an konkreten Taten nicht nachweisen kann. Dass sie im Fernsehen von schwer bewaffneten, vermummten Polizisten per Hubschrauber auf die Wiese des Bundesgerichtshofs geflogen und zur Vernehmung gebracht werden, die häufig schon nach zwei Minuten und der Auskunft, nichts sagen zu wollen, beendet ist, steht auf einem anderen Blatt. Es trägt die Überschrift: Wichtig! Weltpolitik! Kosten spielen keine Rolle! Wer die Jammergestalten sieht, die da vorgeführt werden, den mögen gewisse Zweifel beschleichen.
Das heißt natürlich nicht, dass nicht Jammergestalten (Stichwort: »Sauerland-Gruppe«) furchtbare Taten begehen oder planen. Mir persönlich freilich erscheinen die meisten der fusselbärtigen, bleichen Welteroberer in der konkreten Begegnung immer noch weniger bedrohlich als mancher tätowierte original deutsche Outlaw, dem nur noch exzessive Gewalt als zuverlässiger Beweis der Potenz erscheint.
Seit 2009 gibt es in Deutschland die Straftatbestände der »Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat« (§ 89a StGB), der »Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat« (§ 89b StGB) und der »Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat« (§ 91 StGB). Auch diese Vorschriften, mit denen insbesondere die Beziehungen inländischer Sympathisanten mit terroristischen Gruppen im Ausland verhindert (oder wie es immer heißt: »bekämpft«) werden sollen, sind dem Laien praktisch unbekannt und unverständlich. In den fünf Jahren seit ihrem Inkrafttreten sind sie so gut wie nie angewandt worden. Ob irgendein Anhänger des »Heiligen Krieges« sich von der Strafdrohung (fünf Tagessätze Geldstrafe, bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe) hat beeindrucken lassen und deshalb statt in den Gotteskrieg doch lieber wieder zur Arbeit bei der Müllabfuhr Wuppertal gefahren ist, bleibt ein Geheimnis der Kriminologie und der Rechtspolitik. Hauptsache, irgendjemand glaubt daran.
Es gibt natürlich ein paar äußerst Entschlossene. Ihre Rezepte reichen bis zu kindlichen Vernichtungsfantasien. Im Januar 2015 hat Michael Wolffsohn, früher Professor für Neuere Geschichte an der Bundeswehr-Hochschule München, in der FAZ eine immerhin denkbare Antwort auf einige Fragen gegeben. Sein Text ist lesenswert, weil er wahrhaft befremdend ist.
Du sollst nicht töten – dieses (angeblich) göttliche Gebot unterzieht Wolffsohn einem »wissenschaftlichen« Test. Er benutzt dazu die Form des Dreisprungs, einer in Ehren ergrauten olympischen Sportart (für Nichtkenner der Leichtathletik: Der Dreisprung besteht aus drei nacheinander ausgeführten Sprüngen – »Hop«, »Step« und »Jump«), die gekennzeichnet ist durch die Attribute: flach und weit.
Zunächst der Hop: Du sollst nicht töten. Das angeblich göttliche fünfte Gebot untersucht Wolffsohn in etymologischer, anthropologischer und irgendwie biologischer Konnotation. Das Ergebnis: Genaues weiß man nicht.
Dann der Step: Es folgt die wunderbare Hinwendung des Forschers zur Welt. Töten kann man nur (aber auch alles), was lebt. Auf diesem Planeten sind das: Menschen, Tiere, Pflanzen. Wenn nun Gott, liebe Kinder, tatsächlich gewollt hätte, dass wir nicht töten sollen, dann hätte er uns Menschen zum Verhungern verdammt. Das kann aber nicht sein Ernst gewesen sein! Denn bekanntlich liebt er ja durch einen glücklichen Zufall unter all den Billionen Spezies seines Kosmos ausgerechnet uns dermaßen, dass wir ihm sogar ähnlich sehen dürfen. Da ärgert sich der Wurm.
Im Namen dieser weltumspannenden Liebe essen wir Rinderfilets, Garnelen, Kalbsfüße, Seeteufel und sogar den ahnungslosen Rosenkohl. Irgendwo fressen sogenannte Gourmets selbst die Hände unserer Brüder, der Gorillas.
Schließlich der Jump (und jetzt wird es spannend): »Du sollst nicht töten« heißt also gerade nicht: Du sollst kein Lebewesen töten. Und deshalb heißt es – um der Gleichberechtigung alles Lebendigen willen – auch nicht, dass man keinen Menschen töten soll. Wenn aber, so Wolffsohn, das Töten nun doch erlaubt ist: Dann sollte »der menschliche Teil der Menschheit«, von dem der Forscher spricht, insoweit einen Vertrauensvorschuss genießen gegenüber dem »nichtmenschlichen« Teil.
Letzteren müssen wir uns vermutlich als eine Art Tolkien’schen Ork vorstellen: eine sprachunfähige Kreatur im Niemandsland zwischen Affe, Schwein und Nordkoreaner, die in unermesslichen Scharen aus den dunklen Ritzen der Zivilisation quillt wie der gefiederte Wurm aus der Wunde des Landarztes bei Franz Kafka oder die Kakerlake aus den Tiefen unserer Lebensmittelindustrie. Sie kommt nicht aus uns, sie kommt aus der Hölle. Wir sprechen nicht mit ihr. Wir töten sie, weil nichts sonst ihrem Wesen gerecht wird.
So viel zum »nichtmenschlichen Teil« der Menschheit, zum Unmenschen: ir sollten ihn einfach töten. Quod erat demonstrandum. Vielen Dank für so viel Wissenschaft, Professor Wolffsohn!
Selbst wenn Wolffsohn recht hätte: Was soll uns das bedeuten? Unsere Gesellschaft könnte schwerlich überleben, wenn wir prophylaktisch alle massakrieren, die wir als »Nichtmenschen« definieren. Vorbeugende Notwehr gegen Bevölkerungsgruppen möchten wir doch nicht.
Auch das Feindstrafrecht ist keine Lösung. Denn die Dick Cheneys dieser Welt bevorzugen die »dark side«. Die Etablierung eines derart fegefeuerartigen Zwischenreichs der eingeschränkten Menschenrechte befriedigt sie nicht. Sie wollen dem Feind alle Rechte nehmen. Uns, die bürgerliche Gesellschaft, würde andererseits die Einrichtung einer Verwaltung für die Identifikation und Behandlung von Feinden moralisch zerstören.
Wie wäre es stattdessen mit folgender Alternative: Nehmen wir, gegen die dunklen Schatten der Vernichtungs-Fantasien, an, dass unsere Versprechungen an uns selbst zutreffen. Dass wir in einer – im Weltmaßstab – unermesslich reichen Gesellschaft leben. Dass wir in einer befriedeten, weithin sicheren, von der ganz großen Mehrheit der Bürger getragenen Verfassungsordnung leben. Dass unsere Rechtsordnung – wie auch immer man sie im Einzelnen verstehen und definieren und erfühlen mag – den Einwohnern der Bundesrepublik ein außerordentlich hohes Maß an persönlicher Freiheit und Entfaltungsmöglichkeit erlaubt. Dass es also keine Qual ist, hier zu leben, sondern eine Freude.
Und nehmen wir an, unser Gefühl für die Wirklichkeit sei nicht vollkommen verrückt geworden und die Vorzüge einer freien, gleichberechtigten Gesellschaft seien ein Wert und eine Errungenschaft, denen auch die Fusselbärte einiges abgewinnen können. Dann könnten wir doch einfach zuversichtlich sein und müssten uns nicht so schrecklich fürchten vor den düsteren Schatten unseres eigenen Tuns und Unterlassens.
Wenn wir, wie wir es könnten, den Zehntausenden Menschen helfen würden, die an Ebola erkranken oder konkret von Infektion bedroht sind, anstatt Dramen um fiktive »Schutzlücken« an deutschen Kreiskrankenhäusern zu veranstalten: Wäre dann nicht alles gut?
Welche Sicherheit können wir gegen terroristische Anschläge erhalten?
Die Antwort ist: keine.
Es gibt keine Möglichkeit, Anschläge, Morde und demonstrative Gewalttaten von Fanatikern zu verhindern.
Sicherheit unseres Lebens erreichen wir, indem wir es bejahen und indem wir keine Angst haben vor den Brutalitäten der Dummheit. Indem wir Mitleid und Verständnis für die haben, denen es in der von uns beherrschten Welt schlecht ergeht.
Welche Straftatbestände sollen wir verschärfen?
Die Antwort ist: keine.
Ich habe Verständnis für Bürger, die meinen, da das Recht zu ihrem Schutze da sei, müsse es nun jeweils die Gestalt annehmen, die einen solchen Schutz garantiert. Ich habe auch Verständnis für Politiker, die unter dem Druck solcher Forderungen so tun, als könnten ein paar weitere Paragrafen im Ausländerrecht oder im Strafgesetzbuch die Welt daran hindern, in unser Auenland hereinzubrechen mit Chaos und Blut, Widerspruch und Unversöhnlichkeit, Dummheit und Gier.
Ich habe Mitleid mit denen, die das erleiden, und mit denen, die meinen, ihr eigenes Leid rechtfertige solche Taten.
Von uns aus gesehen, ist es freilich bisher ganz überwiegend das Blut der anderen, das vergossen wird. Das rechtfertigt natürlich keinen Mordanschlag und tröstet keinen Hinterbliebenen oder Verletzten. Aber, entgegen allen Behauptungen: Es relativiert die Betrachtung, so schrecklich das auch sein mag. In Paris sind im Januar 2015 17 Menschen ermordet worden: Journalisten und Polizisten um ihres Berufs willen und Juden um ihres Glaubens willen. Allein in der Woche danach wurden in Afrika und Asien ein Dutzend Mal mehr Menschen ermordet – um ihres Seins willen. Sie waren nicht weniger wert.
Was sollen wir mit »Rückkehrern« machen?
Die Antwort: Es gibt kaum Möglichkeiten, sie zuverlässig zu identifizieren. Wenn Personen, die mit dem Ziel, den »Heiligen Krieg« zu unterstützen, in den Nahen Osten gezogen sind und nun nach Deutschland zurückkehren, weil sie Deutsche sind oder hier ein Aufenthaltsrecht haben, müssen wir sie (und uns) zunächst fragen, warum sie zurückkehren: aus Angst? Aus Enttäuschung? Mit dem Ziel, hier Straftaten zu begehen?
Rückkehrer sind nicht per se eine Bedrohung. Sie können auch wertvolle Multiplikatoren der Aufklärung sein. Haben wir in unsere gesellschaftlichen Eliten nicht in den vergangenen Jahrzehnten viele Tausende Heimkehrer aus der SS, aus den Reichen Enver Hoxhas und Pol Pots, dem Paradies von Baghwan und sogar aus der Geborgenheit der garantiert ausländerfreien internationalistischen DDR integriert? Viele dieser Menschen sprachen seltsame Sprachen, sie hatten eigenartige Erinnerungen und jammerten unter unerklärlichen Bedrückungen. Der große Schmelztiegel der Freiheit und Toleranz hat sie zu schwäbischen Werkzeugmachern, Frankfurter Bankern und Kölner Ford-Arbeitern gemacht. Wenn wir ostpreußische Gutsbesitzer und westdeutsche Kriegsverbrecher und alle anderen integrieren konnten: Warum sollten wir uns fürchten vor den Vertretern einer Kultur der Furcht?
Wo finden wir Sicherheit?