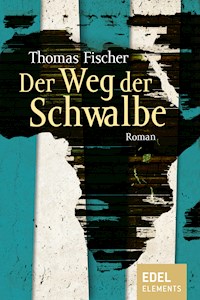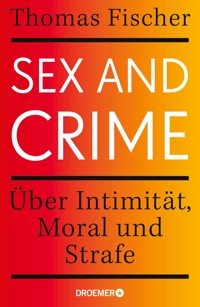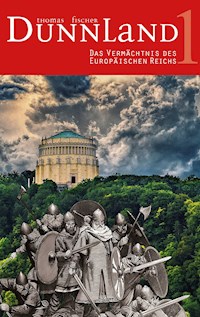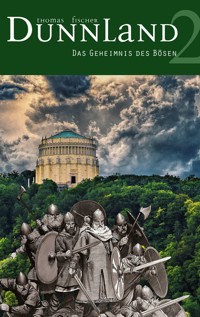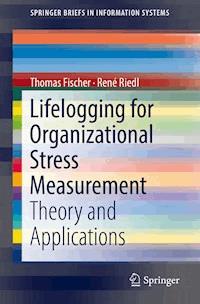18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Was ist eine gerechte Strafe? Gibt es sie überhaupt? Für den leidenschaftlichen und wortmächtigen Strafjuristen Thomas Fischer geht es um das, was unsere Gesellschaft zusammenhält: Ein selbstgegebenes Regelwerk, unser Rechtssystem, das von vielen Bedingungen abhängt und in ständiger Bewegung ist. Wie kein anderes Rechtsgebiet steht das Strafrecht im Focus öffentlichen Interesses. Als Grundlage staatlichen Handelns verspricht es Sicherheit; aber es ist auch ein Ort, an dem grundlegende Fragen des gesellschaftlichen Lebens, der Freiheitsspielräume und der Verantwortung verhandelt und besprochen werden. Fischers These: Strafrecht ist Kommunikation und Gewalt. Keiner kennt seine Entwicklung besser als der weit über seine Fachkreise hinaus bekannte frühere Bundesrichter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Thomas Fischer
Über das Strafen
Recht und Sicherheit in derdemokratischen Gesellschaft
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Was ist eine gerechte Strafe? Gibt es sie überhaupt? Für den leidenschaftlichen und wortmächtigen Strafjuristen Thomas Fischer geht es um das, was unsere Gesellschaft zusammenhält: Ein selbstgegebenes Regelwerk, unser Rechtssystem, das von vielen Bedingungen abhängt und in ständiger Bewegung ist. Wie kein anderes Rechtsgebiet steht das Strafrecht im Fokus öffentlichen Interesses. Als Grundlage staatlichen Handelns verspricht es Sicherheit; aber es ist auch ein Ort, an dem grundlegende Fragen des gesellschaftlichen Lebens, der Freiheitsspielräume und der Verantwortung verhandelt und besprochen werden. Fischers These: Strafrecht ist Kommunikation und Gewalt. Keiner kennt seine Entwicklung besser als der weit über seine Fachkreise hinaus bekannte frühere Bundesrichter.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Einleitung: Das Bedürfnis nach Strafrecht
I. Natur, Gesellschaft, Strafrecht
1. Handlungen – Über die Abgrenzung von Agieren und sinnhaftem Verhalten
2. Der freie Wille – Setzt Verantwortung Selbstbestimmung voraus?
3. Normativität – Der Zusammenhang von Wahrscheinlichkeit und Zumutung
4. Moral – Verbindung von Sinn und Empathie
5. Kausalität – Was reicht als Ursache für Verantwortung?
6. Herrschaft – Die Übersetzung von Sinn und Gewalt in Macht und Gesellschaft
7. Recht – Regelhaftigkeit von Erwartungen, Methoden und Legitimationen
8. Sanktionen – Machtvolle Handlungskonzepte zwischen Erwartung, Enttäuschung und Beharren
II. Strafrecht und Kommunikation
1. Wahrheit – Eine angeblich eindeutige, notorisch verkannte, sozial entscheidende Erfindung
2. Massenmedien – Agenturen zwischen Wirklichkeit und Wahrheit
3. Grenzüberschreitungen – Risiken der Selbstüberschätzung
4. Berichte über das Strafen – Welche Wirklichkeit wird rekonstruiert?
5. Berichte über Sicherheit – Verständigungen über Wahrheit nach unerklärten Regeln
5.1. Sachkunde – Wissen Journalisten, was sie über Strafrecht schreiben?
5.2. Sicherheitslage – Soziale Wirklichkeit zwischen Hype, Fake und Weltuntergang
5.3. Polizei, Justiz – Helden, Versager, Besserwisser?
6. Schuld und Presse – Verantwortung in kleinem Karo
7. Vermittlungen
III. Strafrecht und Gerechtigkeit
1. Wahrheit – Was soll der Strafprozess über die Vergangenheit sagen – und warum?
1.1. Wirklichkeit und Wahrheit – Ist Facebook wahr, die Bibel oder der Koran?
1.2. Erkenntnisanspruch – Die Grundlagen von Wahrheit
1.3. Verdichtung – Zusammenhang von Wirklichkeit und Wahrheit, Ich und Wir
1.4. »Prozessuale Wahrheit« – Produzieren Strafprozesse lauter Lügen?
1.5. Beispiele
2. Gerechtigkeit – Ewiges Konzept oder veränderliche Konvention?
3. Integration und Prävention – Welche Zwecke verfolgt Strafrecht?
IV. Strafrecht in Deutschland heute
1. Strafrechtssystem – Was ist das Systematische am Konkreten?
2. Rechtsgüter – Was soll das Strafrecht eigentlich beschützen?
3. Straf-Tatbestände – Puzzleteile des Gesetzes
3.1. Äußere Merkmale – Handeln, Begrenzungen, Erfolge
3.2. Bestimmtheit und Lücken – Strafrecht als Schutzwall
3.3. Vorsatz und Fahrlässigkeit – Der »Tatbestand« in der Reflexion des Subjekts, und umgekehrt
4. Versuche und Erfolge, Verletzungen und Gefährdungen – Das Eingemachte der Strafrechtsdogmatik
5. Täter und Teilnehmer – Die handelnden Personen
5.1. Täter – Die »Begeher« einer Tat
5.2. Gehilfen – Mitwirkende ohne Tatherrschaft
5.3. Anstifter und Hinterleute – Steuerung aus der Ferne
6. Rechtswidrigkeit – Die Einheit der Rechtsordnung
6.1. Die Indizwirkung des Tatbestands
6.2. Notwehr und Nothilfe – Ein »Rechtfertigungsgrund«
7. Schuld – Zumessungsmaßstab persönlicher Verantwortung
7.1. Verantwortung »vor dem Gesetz«
7.2. Schuldfähigkeit – Die Berücksichtigung der höchstpersönlichen Konstitution
7.3. Psychiatrie und Psychologie – Die besseren Strafrechtswissenschaften?
V. Strafrechtspolitik
1. Kompetenzen – Von wem und wie wird Strafrecht gemacht?
1.1. Das Verfahren der Strafgesetzgebung
1.2. Strafrecht als »lebendes« Recht
2. Aktualitätsbezogene Strafrechtsproduktion – Rechtspolitik nach Regeln der Talkshow
3. »Geldwäsche« – Ein Beispiel misslungener Strafrechtspolitik
4. »Bekämpfungs«-Gesetze – Politische Versprechungen mittels Wortakrobatik
5. Strafrechtspolitik und Wissenschaft – Ein interessenüberwuchertes Verhältnis
6. Fehlerkorrektur – Das kurze Gedächtnis der Strafrechtspolitik
7. Steuerung durch Strafrecht – Kann man Moral durch Strafrecht lenken?
VI. Strafrechtspraxis
1. Strafjustiz – Die Organe der Rechtsverwirklichung
1.1. Richter – Die Entscheider
1.2. Richter im Strafverfahren
1.3. Staatsanwälte – Herren des Verfahrens
2. Strafverfahren – Vom Wert der Form
3. Strafverteidigung – Die andere Perspektive
3.1. Rechtslage
3.2. Was ist »gute« Strafverteidigung?
3.3. Missbrauch von Verteidigern
3.4. Missbrauch von Verfahrensrechten
4. Privatisierung von Strafverfolgung
5. Strafvollzug
VII. Perspektiven
1. Abschaffung des Strafrechts?
2. Fortschritt durch Strafrecht?
3. Strafrecht, Demokratie, Rechtsstaat
VIII. Schlussbemerkung
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
Dies ist ein Buch über Strafrecht. Das ist ein Teil des öffentlichen Rechts, das Rechtsverhältnisse zwischen Staat und Bürgern, also im Über- und Unterordnungsverhältnis, regelt, im Gegensatz zum Zivilrecht, das für die Rechtsverhältnisse zwischen Privaten, Gleichgeordneten gilt. Auch der Staat kann »privat« handeln, etwa wenn er Kauf- oder Werkverträge schließt. Im Strafrecht geht es nicht um freiwillige Verträge, sondern um hoheitliche Eingriffe in die Freiheitsrechte von Bürgern. Strafrecht ist, von dem präventiven Einsatz von Gewalt abgesehen (die ja sogar eine Tötung rechtfertigen kann), das »schärfste« Mittel des Staats gegen Personen, die seiner Strafgewalt unterworfen sind. Andere Begriffe und Zusammenhänge des »Strafens«, also etwa private Vertragsstrafen, Strafen der Verbandsgerichtsbarkeit usw., sind nicht Gegenstand des Buches.
Sein Thema ist das Funktionieren des Strafrechts in der Gesellschaft und daher das Funktionieren der Gesellschaft als Rechtssystem. Dass beides auf das Engste miteinander verbunden ist, ist eine eher banale Erkenntnis; trotzdem ist sie in ihren vielfältigen Voraussetzungen, Formen und Folgen nicht allgemein bekannt.
Der Autor ist Strafrechtler und war viele Jahre lang Richter. Deshalb sieht er die Welt aus dieser Perspektive. Das hat Vorzüge in mancher Hinsicht, führt aber auch zu Beschränkungen. Die eigene Sicht ist immer nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Das ist nicht beklagenswert und sollte einen nicht daran hindern, den eigenen Blickwinkel so gut wie möglich auszuleuchten. Die Erkenntnis der Relativität mag eine Annäherung an das erlauben, was Max Weber »Idealtypus« nannte: ein Blick auf die Welt aus einer Perspektive, im Wissen, dass es derer unendlich viele gibt. Das Strafrecht ist ein Filter im »unermesslichen Strom des Geschehens« (Weber). Es ist nicht nur äußeres Werkzeug, sondern Resultat, Träger und Erzeuger von »Sinn« und damit ein sehr voraussetzungsvolles und mächtiges Element der sozialen Wirklichkeit.
Da es nicht um das schlechthin und naturwüchsig Richtige oder Falsche, Gute oder Böse geht, also bei der Erkenntnis von Wahrheit nicht ums unreflektiert »persönliche« Glauben – wenn dies denn ginge –, sondern um Herstellung von Wirklichkeit zwischen Menschen, muss man sich mit diesem Verhältnis beschäftigen: innen und außen, vertraut und fremd, Zuhause und Fremde, Vertrauen und Misstrauen. Eine solche Zweiteilung der Welt wurzelt tief im Menschen; viele Wissenschaften, Erklärungsversuche und Gestaltungskonzepte unserer Realität beschäftigen sich damit.
Erstaunlich ist, in welchem Maß solche Versuche von Erklärungen heute wieder Gegenstand von Misstrauen und Abwertung sind. Vereinfachung gilt auch im Strafrecht als das Mittel der Wahl. Die Wirklichkeit einer Gesellschaft ist aber nicht einfach. Sie muss kommunikativ erschlossen werden, in einer Weise, an der sich alle auf einer gemeinsamen Grundlage von Anerkennung und Methode beteiligen können. Es ist kein Geheimnis, dass diese Gemeinsamkeit heute, insbesondere aufgrund der Auswirkungen der Globalisierung und der Revolution der Kommunikation, vielfach bezweifelt, auch bekämpft wird und in großer Gefahr scheint. Das vorliegende Buch ist ein Versuch, der Furcht davor ein paar Gedanken entgegenzusetzen.
Einleitung: Das Bedürfnis nach Strafrecht
Kein Tag vergeht, an dem nicht in der öffentlichen Kommunikation vom Strafen und vom Strafrecht die Rede ist. Das Strafrecht erscheint oft wie eine eigene Wirklichkeit, als eine mögliche, häufig sogar naheliegende Lösungsinstanz, die man aus der Unübersichtlichkeit der Lebenswelt und der gesellschaftlichen Problemlagen anrufen kann. In einem vor einigen Jahrzehnten kaum für möglich gehaltenen Maß ist es ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt und hat sich von einem Spielfeld für Randständiges, Gruseliges und eine verachtete Minderheit zum bedeutenden Gestalter von Politik emanzipiert. Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung ist im Jahr 2018 bereit, selbst das Wirken der deutschen Bundesregierung an strafrechtlichen Maßstäben zu messen, und kaum eine Woche vergeht, in welcher nicht neue Vorschläge diskutiert werden, wie man das Strafen in Deutschland »effektivieren«, »beschleunigen« oder schlicht ausweiten kann, um mal den einen, mal den anderen gesellschaftlichen Missstand zu bessern, letzten Endes aber vor allem das Strafrecht an sich voranzubringen, warum auch immer.
Kein anderes Rechtsgebiet erfährt solche Zuwendung an Aufmerksamkeit, öffentlichem Wollen, Meinen, Kommentieren und Kritisieren wie das Strafrecht. Das Leben der allermeisten Menschen wird durch Vertragsrecht, Kaufrecht, Erbrecht oder Umweltrecht viel mehr beeinflusst als durch Fragen nach der Grenze des Raubtatbestands oder der Strafbarkeit von Werbung für Abtreibung. Trotzdem begnügt man sich weithin damit, dass die Presse in immer gleichem Auf und Ab berichtet, der Bundesgerichtshof habe »die Rechte der Mieter gestärkt«, sodann »die Rechte der Verbraucher gemindert«, alsdann die Rechte der Vermieter gemindert und die der Unternehmenserben gestärkt. Wie viel und welche Rechte von Arbeitnehmern, Patienten, Krankenpflegern, Mietern, Hundeeigentümern, Autofahrern und Steuerzahlern im letzten Halbjahr gestärkt oder geschwächt wurden und welche unbeachtet blieben, weiß von den solcherart informierten Bürgern niemand; man kann und will es angesichts der Trostlosigkeit der Informationsdarbietung auch gar nicht wissen.
Im Strafrecht ist das anders: Hier schaffen es sogar komplizierte Gesetzgebungsvorhaben oder dogmatisch anspruchsvolle Urteilsbegründungen auf die Titelseiten, wenngleich auch meist in stark verkürzter, missverständlicher oder schlicht desinformierender Form. Das Interesse an öffentlicher Kommunikation über das staatliche Strafen ist groß; es weitet sich bis in den Bereich privater Sanktionen etwa im Unternehmensbereich, in Verbänden und Institutionen wie Schulen, Hochschulen und Kirchen aus. Kennzeichnend für eine Verschiebung des Interesses ist, dass strafrechtliche Themen deutlich häufiger als früher als politische Themen aufgefasst werden. Dass Strafrecht per se »politisch« sei, auch wenn es nicht um Hochverrat und Spionage geht, ist eine (Wieder-)Entdeckung der späten Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts gewesen, die das scheinbar naturhaft festgefügte, aus dem 19. Jahrhundert stammende Strafrechtssystem der alten Bundesrepublik als spezifischen Teil der Gesellschaftsordnung identifizierte. Terrorismus-Strafrecht, Abtreibungsstrafrecht, Demonstrationsstrafrecht waren Kristallisationspunkte, anhand derer das Strafrecht insgesamt in den Siebziger- und Achtzigerjahren ins allgemeine »politische« Bewusstsein rückte.
Woher kommt das? Was »bietet« das Strafrecht dem öffentlichen Bewusstsein und dem individuellen Interesse? Warum befassen sich zahllose Menschen, die von Verbrechen, Strafprozessen und Justizvollzugsanstalten denkbar weit entfernt sind, hoch engagiert mit Beweisfragen aus Verfahren, die sie nur aus den Medien kennen, oder mit strafrechtspolitischen Fragen, die sie selbst vermutlich niemals betreffen werden? Antworten auf diese Fragen finden sich sowohl in allgemeinen, überdauernden Gründen als auch in zeitspezifischen Konstellationen und Entwicklungen.
An der Oberfläche ist zunächst festzustellen, dass das Strafrechts-»System« ein in sich einigermaßen geschlossenes Begriffsinstrumentarium anbietet, mit dem sich die Welt auf relativ schlichte, überschaubare Weise einteilen und deuten lässt: Gut und Böse, Täter und Opfer, Straftat und Leiden, Fliehen und Verfolgen, Schuld und Strafe – lauter einfach erscheinende Zweiteilungen, die »Komplexität reduzieren«, also Unübersichtliches übersichtlich machen können und dadurch auch die überaus unterschiedlichen Welten, die sich in der sozialen Wirklichkeit überschneiden, mischen, abgrenzen, miteinander verbinden können: Ein Begriff wie »Schuld« kann den Fußball ebenso erklären wie eine Ehescheidung, eine Unternehmensinsolvenz wie einen tödlichen Unfall. »Strafe« ist allenthalben das, was dem Schuldigen gebührt, und die ausgesprochenen wie unausgesprochenen Ansprüche an die »Wirksamkeit« des Strafens können sowohl individuell als auch in verallgemeinerter Form als allgemeine Anforderung an die enttäuschende, gefährliche oder unberechenbare Lebenswirklichkeit gerichtet werden. Je mehr nicht passt, desto mehr muss, vereinfacht gesagt, passend gemacht werden, und das Strafen erscheint als eine Möglichkeit, die rundum in Unpassendes zerfallende Welt zu ordnen.
Zugleich ist der Appell ans Strafrecht ein solcher an den Staat, also an eine abstrakte, zerstörerische Gewalt, und insoweit ambivalent: Wer besonders laut nach dem strafenden Staat ruft, macht sich selbst besonders klein. Der allmächtige Leviathan ist auch dann kein Kuscheltier, wenn seine Funktionäre lächelnd Homestorys in Illustrierten und Talkshows darbieten. Selbst der überzeugteste Nachplapperer von »Wer nichts zu verbergen hat, muss auch nichts befürchten« ahnt, dass diese Parole von Polizeigewerkschaften auch in China, Nordkorea oder Afghanistan über den Gesetzesbegründungen und Gefängnistoren steht. Selbst der schlichteste Rechtsfreund muss, wenn er in Internetforen oder bei Versammlungen »besorgter Bürger« gnadenlose Härte der Strafjustiz, rigoroses Durchgreifen der Polizei oder bedenkenlose Anordnung von Untersuchungshaft fordert, damit rechnen, dass all dies auch seine eigenen, gern »Sünden« genannten Taten betreffen kann. In der Bitte, die Gewalt möge andere möglichst hart schlagen, steckt daher zugleich stets ein Anteil von Sehnsucht, durch eigene Bestrafung Vergebung zu erlangen und in der Hand der Gewalt aufgehoben zu sein.
Dass »alles immer schlimmer« werde hinsichtlich der Sicherheitslage, ist ein verbreiteter Eindruck, der von Massenmedien geschürt und verstärkt, aber nicht verursacht wird. Strafrechtspolitik muss nicht allein mit realen, sondern auch mit »gefühlten« Gefahren umgehen. Das begünstigt symbolische Maßnahmen ohne positiven Effekt oder, schlimmer, mit negativen Verstärkungseffekten. Jedes hastige Füllen vorgeblicher »Strafrechtslücken«, kaum dass ein Missstand einen gewissen Skandalisierungsgrad erreicht hat, fördert weitere Abläufe derselben Art und beschleunigt eine Dynamik, die durchaus irrational werden kann.
Die Furcht, die heute vielfach thematisiert wird, kann aber nicht einfach als Einbildung oder Lüge abgetan werden; sie ist tatsächlich vorhanden. Sie hat verschiedene Quellen, die zu unterscheiden sind. Kriminalität wird immer dann als besonders bedrohlich empfunden, wenn sie als anonyme, von außen eindringende Gefahr gesehen wird. Die Kriminalität von »Fremden«, welcher Definition auch immer, erscheint als unberechenbar, da sie in das Gewohnte und Vertraute in besonderem Maß eindringt. Daher ist die Furcht vor einer fremden und anonymen Bedrohung stets stärker als die Angst, durch vertraute Personen oder in vertrauter Lage zu Schaden zu kommen. Das gilt selbst dann, wenn rationale Erwägungen entgegenstehen. Die Vorstellung eines plötzlichen gewalttätigen Zugriffs eines Räubers oder Vergewaltigers in dunkler Nacht und an einsamer Stelle ist hochgradig furchterregend; ebenso die Vorstellung, innerhalb des intimen Rückzugsraums, etwa der Wohnung, Opfer eines unberechenbaren fremden Eindringens zu werden. Der bloße Hinweis auf die empirisch geringe Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse reicht nicht aus, um das existenzielle Bedrohungsgefühl deutlich zu verringern.
Aus diesem Grund ist die allgemeine Bereitschaft und Neigung zur Kriminalitätsfurcht und zur Annahme eines hohen Gefahrenpotenzials umso höher, je größer das Maß der »Fremdheit« ist, das in einer gegebenen Gesellschaft herrscht und als solches subjektiv empfunden wird. Es ist möglich, dass Gemeinschaften (z.B. Dörfer, Kleinstädte) mit einem hohen Gewalt- und Kriminalitätspegel relativ unbesorgt leben, wenn die Bedrohung als Teil des Üblichen und Gewohnten wahrgenommen wird und in das gewöhnliche Lebensrisiko eingerechnet werden kann.
Dieselbe Gesellschaft kann aber in irrationale Furcht verfallen, sobald eine objektiv deutlich geringere Gefahr hinzutritt, die als fremd und von außen kommend empfunden wird. Aus demselben Grund ist regelmäßig auch die Furcht vor »wahnsinnigen«, geisteskranken Personen höher als die vor (nur) »bösen« Personen, also Verbrechern, denn der »Verrückte« erscheint eben nicht als Teil der Welt, in der die gewohnten Wahrscheinlichkeiten und Regeln des Vertrauens gelten. In der Figur des »wahnsinnigen Gewalttäters«, die in den Angstbewältigungsformen der populären Kultur aller Zeiten eine prominente Rolle einnimmt (»Serienkiller«, »Monster« hinter der Fassade der Harmlosigkeit usw.), findet beides zusammen; reale Fälle, die dieses Bild bestätigen, werden daher mit höchster, lang anhaltender Aufmerksamkeit verfolgt und so zu Mythen überhöht (Beispiele sind die Fälle Kürten, Haarmann, Bartsch, Dutroux).
Schon aus diesem Grund muss der allgemeine Zustand einer Gesellschaft für eine ernsthafte Betrachtung des Strafens und des Strafbedürfnisses von großer Bedeutung sein. Selbstverständlich ist er es darüber hinaus auch auf einer empirischen Ebene, als Wirklichkeit, welche für die Kriminalitätsneigung, -gelegenheit, -form und -häufigkeit entscheidend ist. Hier spielen alle Themen eine Rolle, die Gegenstand der Kriminologie sind: Kriminalsoziologie, Kriminalpsychologie, empirische Forschung, Prognose, Prävention.
Auf allgemeiner Ebene wird man sagen können, dass sich im Bild der aktuellen öffentlichen Strafrechtsdiskussion recht genau widerspiegelt und bestätigt findet, was oben ausgeführt ist: Die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere der Globalisierung und ihrer Folgen einerseits, die Entwicklung einer vollständig neuen Kommunikationsstruktur durch das Internet andererseits haben zu einer tief greifenden Veränderung der Gesellschaft geführt.
Alte Bindungen und Vertrautheiten früherer Jahrzehnte sind in hohem Maß aufgelöst oder zerstört; die einzelne Person findet sich weniger denn je in sozial stabilen Rollen und Gemeinschaften (Familie, Betrieb, Verein, Religionsgemeinschaften, Parteien, Wohnumgebung), vielmehr in einem hochgradig veränderlichen Umfeld, das sich durch Vereinzelung auszeichnet. Sowohl empirisch (»Agenda 2010«; »Sozialreformen«; soziale Veränderungen wie Auflösung von dauerhaften Familienstrukturen auch im kleinen Bereich) als auch normativ (»Neoliberalismus«, »Eigenverantwortung«, Frauen-»Bewegung«) definiert sich die Moderne im Jahr 2018 weithin als Vergesellschaftung von Individuen, deren Bild ihres Platzes in der Welt fast vollständig zurückgeworfen ist auf das Ich, auf Selbstverwirklichung, Selbstverantwortung und Selbst-»Optimierung«. Weder auf örtliche noch persönliche, noch berufliche Bindungen kann und soll langfristig vertraut werden; schon früh werden Kinder und Jugendliche darauf hingewiesen, dass jedes Vertrauen auf Familie, Ehe, Kinder, Eltern, Ausbildung und soziale Sicherungssysteme ein extrem hohes Risiko beinhalte, das sich jederzeit verwirklichen kann, im Lebenslängsschnitt aber mit Sicherheit verwirklichen wird.
Die Aufgabe der Selbstoptimierung, von der Frühförderung über Körpergestaltung, Partnerwahl und -wechsel, berufliche »Karriere« bis zur Konzeption der Sterbephase im Pflegeheim, ist allgegenwärtig. Sie kann von Personen unterer sozialer Schichten nur sehr eingeschränkt erfüllt werden, weil ihnen die wirtschaftlichen, bildungsmäßigen und mentalen Voraussetzungen vielfach fehlen. Das Unverständnis, mit welchem die »Verbraucher«-Schützer und Parteistrategen auf die Planlosigkeit der »sozialen Brennpunkte« schauen, ist wenig überzeugend, denn aus der Sicht der Randständigen mag es durchaus rational sein, die Erhöhung des ALG II um 20 Euro in einer Flasche Whisky statt in einem privaten Rentensparvertrag anzulegen.
Objektiv und subjektiv überfordert sind aber auch die sogenannten Mittelschichten. Hinzu kommen dramatische globale Strukturwandel, die außerhalb jedes Einflusses der Individuen stehen, die Lebenswirklichkeit aber prägen: Dauerkriege, Massenmigration, Erschöpfung oder Neuverteilung von Ressourcen. In Deutschland treten die gravierenden Probleme der Wiedervereinigung verstärkend hinzu. Dabei geht es im Kern nicht um die öffentlich verhandelten Fragen nach »Angleichung« von Autobahnen oder Nettolöhnen. Es geht um »Angleichung« der Geschwindigkeit, mit welcher sich der Verfall von sozialer Sicherheit und sozialem Vertrauen vollzieht.
Die Bevölkerung der DDR befand sich, was den »kulturellen«, sozialpsychologischen Stand der oben beschriebenen Modernisierung betrifft, allenfalls auf dem Stand der westdeutschen Gesellschaft zu Beginn der Sechzigerjahre. In vielerlei Hinsicht waren Vertrauen garantierende Strukturen erhalten (Betrieb, Wohnbereich); in anderen Bereich waren sie zwar planmäßig geschwächt (Familien), aber durch flächendeckend wirksame »Solidar«-Gemeinschaften ersetzt oder ergänzt worden. Der »Beitritt« im Jahr 1990, von den meisten als schlichte Ausdehnung des Konsumparadieses erträumt, entpuppte sich als eine Aufgabe gänzlich ungeahnter Dimension: als habe man die Einwohner einer westdeutschen Kleinstadt des Jahres 1960 über Nacht ins Las Vegas von 1990 verfrachtet, ihnen zur Begrüßung 100 Dollar in die Hand gedrückt und viel Erfolg gewünscht.
Menschen, die sich permanent allein fühlen und aufgefordert werden, sich darauf einzustellen, dass dies nicht nur ihr ganzes restliches Leben lang so bleiben, sondern sich noch verstärken wird, fürchten sich. Je weniger Hoffnung sie haben, gegen den Lauf der Welt etwas unternehmen zu können, desto mehr fürchten sie sich vor dem »fahrenden Volk« und den Räubern im dunklen Wald.
Aber auch andere Veränderungen haben den Blick auf das Strafrecht verändert. Dazu zählen insbesondere eine Abwendung vom reinen »Unterschichtenstrafrecht« früherer Jahrzehnte, die Ende der Sechzigerjahre eingesetzt hat und zur zunehmenden Einbeziehung von wirtschaftlichen Sachverhalten in den Bereich des strafrechtlich zu Regelnden geführt hat. Auch dies ist durch die Globalisierung der Wirtschaft extrem beschleunigt worden, insbesondere weil Standards und Strukturen US-amerikanischer Wirtschaftssteuerung und supranationaler Organisationen (EU) in die Bedingungen deutscher Rechtsetzung massiv eingreifen.
Damit verbunden ist zugleich, was man »Materialisierung« des Strafrechts genannt hat: Eine Zurückwendung des Strafens zu moralischen Begründungen und zu einer innengeleiteten Sozialkontrolle. Vor allem das Sexualstrafrecht (im weiteren Sinn) ist hier zu nennen. Schließlich ist bereits an dieser Stelle auf eine wichtige Veränderung in der Anforderungs- und Erwartungsqualität hinzuweisen, die mit dem Begriff der Sicherheit zusammenhängt. Dass das Strafrecht nicht um seiner selbst willen da ist, ist selbstverständlich; in der Regel wird seine Funktion so beschrieben, dass es der »Sicherheit der Rechtsgüter« dienen solle. Allerdings findet sich diese Aufgabenbestimmung auch in allen Polizeigesetzen und schon in deren Ursprung:
»Die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit, und Ordnung, und zur Abwendung der dem Publico, oder einzelnen Mitgliedern desselben, bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizey«, lautete Paragraf 10 des Zweiten Teils, Siebzehnter Titel des »Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten« aus dem Jahr 1794, eines gewaltigen Gesetzeswerks des aufgeklärten Absolutismus, in dem das gesamte damals geltende Recht mit akribischen, bis in Details der Lebensgestaltung reichenden Vorschriften zusammengefasst war.
»Sicherheit« ist danach Aufgabe der Polizei, also von Verwaltungsbehörden; die Begriffe »Sicherheitsbehörde« und »Polizeibehörde« werden vielfach synonym verwendet. Gemeint ist präventive Sicherheitsvorsorge: Gefahrenabwehr. »Polizeiliches« Denken und polizeiliche Arbeit in diesem Sinn richten sich auf die Verhinderung zukünftiger Schäden. Das Strafen hingegen ist seiner Natur nach rückwärtsgerichtet; es betrachtet Zukunft allenfalls mittelbar und sekundär im Hinblick auf »Wirkungen« des Strafens, denn im Mittelpunkt steht die Sanktionierung vergangenen Verhaltens. Diese »repressive« Aufgabenstellung des Strafens ist von der »präventiven« Aufgabenstellung der (»Schutz«-)Polizei zu unterscheiden. Auf Einzelheiten und Folgen dieser Unterscheidung, die zu den Grundlagen rechtsstaatlicher Verfasstheit gehört, ist später zurückzukommen.
In der heutigen rechtspolitischen Diskussion spielt die Trennung zwischen Sicherheit und Strafen, Repression und Prävention, Polizei und Justiz oft keine Rolle mehr. Die professionelle Rechtspolitik legt in der Darstellung häufig fast keinen Wert auf eine Unterscheidung; die Justizminister des Bundes und der Länder erscheinen wie Erfüllungsgehilfen oder Untergebene der mächtigen Innenminister, von denen die »Sicherheitspolitik« gesteuert und vertreten wird. In Presse und Öffentlichkeit ist die Unterscheidung vielfach gar nicht bekannt, sodass an Strafrechtspolitik und Justiz wahllos Forderungen und Ansprüche gestellt werden, quasi präventiv-polizeiliche Aufgaben zu erfüllen.
Das zeigt sich auf banale Weise etwa in den notorischen Forderungen, es solle »zur Abschreckung« häufiger, längere (!) und härtere Untersuchungshaft angeordnet werden. Diese Forderung ist unsinnig, denn Untersuchungshaft darf aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht zur »vorläufigen Bestrafung« angeordnet werden. Eine Anordnung zur Vorbeugung (Haftgrund der Wiederholungsgefahr) ist bei Verdacht bestimmter Delikte ausnahmsweise zulässig (§ 112a StPO). Das Bundesverfassungsgericht hat diese Vermischung von Strafverfolgung und Prävention als verfassungsgemäß angesehen; unproblematisch ist sie aber nicht.
Nicht so deutlich, aber in der Sache wirksamer ist die Vermischung auf rechtspolitischer Ebene. Sie beginnt schon mit der unseligen Angewohnheit des Gesetzgebers, neuen Strafgesetzen vielfach den Titel »Gesetz zur Bekämpfung von …« zu geben. »Bekämpfung« ist ein typisch präventiver, polizeilicher Begriff, der im Strafrecht eigentlich nichts zu suchen hat. Seine alltägliche, meist nicht mehr hinterfragte Verwendung im Alltag der öffentlichen Kommunikation zeigt, dass die für die liberal-rechtsstaatliche Tradition selbstverständliche Trennung zwischen Polizei und Justiz zunehmend unklarer und unwichtiger wird.
Ob diese Entwicklung zur Freude oder zur Sorge Anlass gibt, soll hier vorerst dahinstehen. Sie führt jedenfalls, neben den anderen genannten Gründen, dazu, dass das »Bedürfnis nach Strafrecht« in der Gesellschaft heute besonders groß ist und besonders lautstark geäußert wird. Das steht teilweise im Widerspruch zu objektiven Gegebenheiten, etwa einer rückläufigen Kriminalitätshäufigkeit in manchen Bereichen. Das Bedürfnis kann aber nicht einfach in den Bereich des Irrationalen oder gar Belanglosen verwiesen werden. Wenn man über das Strafen sprechen und diskutieren will, muss man es ernst nehmen.
I. Natur, Gesellschaft, Strafrecht
Unter »Recht« stellen wir uns ein besonderes System von Regelungsmechanismen vor. Recht beschreibt nicht Gegebenheiten oder Kausalabläufe, sondern Forderungen und Zumutungen. Das Strafrecht als spezieller Regelungsbereich ist durch Voraussetzungen und Bedingungen geprägt, die nicht allein den Zusammenhang des Rechtssystems insgesamt berühren, sondern weitere Fragen nach den Grundlagen des Rechts als soziales Steuerungssystem aufwerfen. Es ist in den modernen Gesellschaften heute klar und gedanklich vorausgesetzt, dass Strafrecht in der Gesellschaft »gemacht« wird und ihr nicht von außen vorgegeben ist. Ausnahmen in kleineren fundamentalistischen Gemeinschaften spielen praktisch keine Rolle.
Damit ist die Frage aufgeworfen, auf welche Weise und aus welchen Quellen das Strafen und das Strafrecht entstehen. Denn nur wenn man das im Blick hat, kann man sinnvoll diskutieren, was vom Strafrecht erwartet werden kann oder muss. Gemeint sind hier nicht die technischen Entstehungsbedingungen von Strafrecht auf der Grundlage einer gegebenen Rechtsverfassung, sondern die Grundlagen des Strafens als soziales Phänomen. Damit stellt sich auch die Frage, ob und inwieweit das Strafen eine natürliche Grundlage hat. Das mag zunächst überraschen, da auf der Grundlage der Erkenntnis von der Gemachtheit des Strafrechts in der Regel die Frage nach Verbindungen von Natur und Gesellschaft gar nicht mehr gestellt wird oder gar im Verdacht steht, auf »biologistische« Begründungen für konkrete gesellschaftliche Umstände abzuzielen. Eine solche Absicht besteht nicht. Wie sich aber das Strafen nicht ohne Gesellschaft denken lässt, so die Gesellschaft nicht ohne die Menschen und damit nicht ohne die Natur.
1. Handlungen – Über die Abgrenzung von Agieren und sinnhaftem Verhalten
Das Strafrecht befasst sich mit einer speziellen Form der Reaktion auf menschliches Verhalten, das als »Straftat« bezeichnet wird. Obgleich zu einer gegebenen Zeit die meisten Menschen meinen, dass es einfach sei, nicht nur ein paar der wirklich existierenden Straftaten zu nennen, sondern zu sagen, was auf jeden Fall eine solche ist, stimmt das meistens nicht. In der Regel wird damit nämlich, genauer betrachtet, nur darüber gesprochen, was eine Straftat sein soll. Wie das zustande kommt, ist Gegenstand dieses Buches. Wichtig ist zunächst einmal festzustellen, was der Begriff »Straftat« überhaupt zum Inhalt hat.
Das Leben ist, das sagt die Erfahrung, auch durch eine Vielzahl von Enttäuschungen geprägt. Damit sind an dieser Stelle nicht bittere persönliche Kränkungen gemeint, sondern die Tatsache, dass dem Bedürfnis nach vollendeter Zufriedenheit ein unendlich scheinender Strom von Ereignissen entgegenwirkt, die den Eintritt dieses Glücks verhindern: Das Wetter ist schlecht, wenn es gut sein sollte, das Essen fliegt uns nicht mühelos in den Mund, und andere Menschen tun Dinge, die sie nicht tun sollten, oder tun Dinge nicht, die sie tun sollten. Diese ständigen Enttäuschungen können auf grundsätzlich zwei verschiedene Weisen verarbeitet werden: indem man sie akzeptiert oder indem man sie zu verhindern versucht. Sie zu »bestrafen« ist für sich gesehen eigentlich sinnlos, denn dadurch verschwinden sie ja nicht nachträglich aus der Wirklichkeit; im Gegenteil kann die Mühe des Bestrafens wieder neue Enttäuschungen hervorbringen. Andererseits kann selbst der tiefenentspannteste Mensch die Dinge nicht einfach so hinnehmen: Auch buddhistische Mönche ärgern sich, wenn man ihnen das Essen wegnimmt oder sie schlägt.
Auf einer sehr allgemeinen Ebene muss man also zunächst einmal klären, wie man die Enttäuschungen, die einem widerfahren, so unterscheiden kann, dass man gegen ihre Wiederholung einigermaßen sinnvoll etwas unternehmen kann. Wenn ein Maisfeld in einem Jahr nicht genug Ernte gebracht hat, sodass der Bauer hungern musste, hat es keinen Zweck, das Maisfeld zu »bestrafen«, indem man es vernichtet. Man kann das versuchen; aber die Erfahrung zeigt, dass diese Methode nicht zur besseren Sättigung im nächsten Jahr führt. Das zeigt, dass es erforderlich ist, zwischen Enttäuschungsursachen zu unterscheiden, die man beeinflussen kann, und solchen, bei denen das nicht geht; weiterhin, dass man eine Ebene finden muss, auf der man mit den Ursachen in einen zielgerichteten Kontakt tritt: Man muss das Feld düngen, darf das Wasser nicht vergiften, muss einen Zaun gegen die Wildschweine und die Maisdiebe bauen. Wenn die Schweine sich durchwühlen und den Mais fressen, kann man entweder den Schweinegott bitten, beruhigend auf sie einzuwirken, oder man kann ein besonders dickes Schwein zur Abschreckung töten, oder man kann den Zaun weiter befestigen. Alle drei Methoden wurden in der Geschichte lange erprobt; die ersten beiden haben sich als nutzlos erwiesen.
Das Strafrecht interessiert sich – unter anderem – für die zweite Methode: das »Bestrafen« zwecks Abschrecken. Der moderne Mensch weiß intuitiv, dass »Strafe« nicht das Mittel der Wahl gegen Wildschweine ist, weil die Tiere zwar die Gewalt spüren, aber nicht auf ihr vergangenes Tun beziehen, sondern allenfalls auf das unmittelbar bevorstehend neue. Wenn der Bauer also seinen Schweinezaun mit Strom lädt, tut er das nicht, um die Schweine an ihre vergangenen Untaten zu erinnern und zu besseren Menschen zu erziehen, sondern um ihnen durch Schmerz und Angst den Appetit zu verderben.
Ganz anders ist es, wenn sich herausstellt, dass hinter den Schweine-Attacken ein anderer Bauer steckt, der die Wildschweine nachts heimlich auf das Feld seines Nachbarn treibt. In diesem Fall wird der geschädigte Bauer zunächst ein Bedürfnis nach »Rache« empfinden; im Übrigen wird er vermutlich nicht den Zaun verstärken, sondern seinen Nachbarn versuchen zu »bestrafen« (oder bestrafen zu lassen). Der Grund liegt auf der Hand: Der Geschädigte weiß, dass dem Schaden eine »Tat« zugrunde liegt, die sein Nachbar »begangen« hat; und er weiß zudem, dass man auf dieses Tun in einer speziellen Weise reagieren kann, die bei Schweinen nutzlos ist.
Strafrecht richtet sich nicht gegen Schadenserfolge, sondern gegen Handlungen, welche die Schäden hervorgerufen haben. Wenn ein Baum auf ein Haus gefallen ist, hat es keinen Sinn, den Baum zu bestrafen oder den Sturm, sondern man muss den Baumfäller suchen, der vielleicht ein Objekt von »Strafe« werden könnte. Die Pflicht, Strafe auf sich zu nehmen, kann man ihm aber nur auferlegen, wenn er auf irgendeine Weise »Verantwortung« trägt und wenn man das auch »mit Recht« behaupten kann. Bestrafen von Menschen, denen von vornherein keine Verantwortung für einen Schaden zugewiesen werden kann, hat weder individuell noch sozial eine rationale Wirkung; es bleibt eine reine Ersatzhandlung und dient bestenfalls zum Abreagieren von Wut.
Verantwortung, wie auch immer, setzt eine Handlung voraus. Handeln ist, nach der üblichen juristischen Definition, »positives Tun oder Unterlassen«. Der Begriff »positiv« meint hier keine Wertung, sondern beschreibt die Form einer Handlung: »Positives Tun« ist danach jede aktive Einflussnahme auf Zustände oder Ereignisse der Außenwelt. Das können schlichte körperliche Einwirkungen sein: Schlagen, Nehmen, Werfen usw., also Handlungen, die unmittelbar auf ein Objekt einwirken. Es können auch mittelbar wirkende körperliche Handlungen sein: Zuschließen einer Tür, Absenden eines Briefs. Auch Sprechen ist Handeln: Wer eine andere Person mittels Lügen »betrügt«, tut nicht nichts, sondern handelt durch positives Tun. Schwieriger ist die Frage, ob auch noch weniger ausreichen kann: »Hexen«, Geister-Herbeirufen, Verfluchen – alles positives Tun. Auch Denken? Also »Böse-Wünsche-Haben«? Es gab Zeiten, da hätte daran niemand Zweifel gehabt. Die Mehrheit ist heute anderer Ansicht; aber eine durchaus nicht ganz kleine Minderheit denkt das noch immer. Für das Strafrecht ist das praktisch egal; theoretisch kann man durchaus darüber nachdenken: Vielleicht könnte das intensive Denken von bösen Wünschen ja eine Art »Versuch« sein.
Eine Tat »versuchen« ist (oft, nicht immer) auch strafbar; das steht in Paragraf 22 StGB. Daraus könnte man schließen, das Strafen setze eine Handlung doch nicht voraus, wenn schon das Versuchen des Handelns verfolgt wird. Aber das täuscht: »Der böse Wille allein schadet nicht«, ist eine Maxime des modernen Rechts. Man darf Böses wollen, so viel man will – solange man nichts Böses tut, kümmern sich darum vielleicht die Moral und die Religion, aber nicht die Justiz. Auch der strafbare Versuch setzt daher eine Handlung voraus, ein handelndes »Ansetzen« zur Verwirklichung des Taterfolgs.
Wirklich kompliziert wird es aber, wenn das »Handeln« darin besteht, nicht zu handeln. Das Strafrecht nennt das »Unterlassen«, aber dieser Begriff beschreibt schon eher die Lösung als das Problem, denn »etwas zu lassen« ist nicht dasselbe wie »nicht handeln«, sondern durch die Bezugnahme auf das »Etwas« ein spezifisches Nichthandeln: das Nicht-Tun von etwas, was getan werden könnte, müsste oder sollte. Wenn ein Mensch müßig in der Sonne liegt, wird man das in der Regel nicht so beschreiben, dass er »unterlässt«. Es ist auch nicht sinnvoll, jemanden dazu aufzufordern, bitte »zu unterlassen«, ohne hinzuzufügen, was er nicht tun soll.
Das »Unterlassen« des Strafrechts ist also ein Handeln, das von vornherein nicht aus bloßer Wirklichkeit besteht, aus einem Nichts, sondern aus einer Kombination von Wirklichkeit und »Gesolltem«. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir es im Strafrecht meist nicht mit »einfachen« beschreibenden, neutralen Wörtern und Beschreibungen objektiver Gegebenheiten zu tun haben, sondern mit Begriffen, durch welche die Wirklichkeit wertend gedeutet wird. Das soll in den folgenden Abschnitten noch ein wenig näher erklärt werden.
Man kann menschliches Handeln in verschiedener Weise beschreiben: physikalisch, sozial, systemtheoretisch als Abgrenzung des Einzelnen vom jeweils »anderen«, philosophisch als Betätigung von Ethik usw. Für die rechtliche Sicht der Dinge ist von Bedeutung, es als ein von Sinn bestimmtes Phänomen zu verstehen, als Gegensatz zum bloßen »Agieren«, somit als Verbindung von Mittel und Zweck.
Handeln ist »motiviertes Agieren«. Das ist nicht stets selbstverständlich oder offenbar. Strafen kann auch (scheinbar) ansetzen am bloßen »So-Sein«, etwa als Mitglied einer Gruppe (»Blutrache«), oder an unerklärlichen »Einflüssen« (Strafe wegen »bösen Blicks«) oder an zweckfreiem Agieren (Ersticken eines Säuglings durch die schlafende Mutter). In allen drei Fällen steckt dahinter aber eine – vielleicht nicht bewusste – Bezugnahme auf motiviertes Handeln: im ersten Fall die Verfehlung einer gruppenangehörigen dritten Person; im zweiten Fall das Böse-Sein als »Strafe« für religiöse Verfehlungen; im dritten Fall das Unterlassen von Vorsichtsmaßnahmen vor dem Einschlafen.
Der Blick des Strafens ist also auf »zweckgerichtetes Agieren« gerichtet. Daraus folgt aber noch nicht, an welcher Stelle dieses Ablaufs es ansetzt. Er lässt sich in drei Phasen unterscheiden: Idee/Plan; Ausführen des Plans; Erreichen des Ziels. Ob man schon die erste Phase bestrafen will oder erst die zweite oder dritte, ist von den Begriffen nicht vorgegeben; es unterliegt starken Wandlungen in Theorie und Praxis. Hinzu kommt das Problem, dass ein zweckgerichtetes Verhalten andere »Erfolge« haben kann, als die handelnde Person wollte: Der Kfz-Fahrer wollte betrunken, aber schadensfrei nach Hause fahren, überfuhr aber einen Fußgänger. In diesem Fall nur am »Zweck« anzuknüpfen, erschiene uns ungerecht: Es »kann nicht sein«, dass Trunkenheitsfahren mit und ohne Todesopfer gleichbehandelt werden. Die Anknüpfung am »Erfolg« (Tod des Fußgängers) nimmt also die fehlerhafte Steuerung des Handelns zum Grund der Bestrafung. Das ist eine Frage der Abgrenzung zwischen »Vorsatz« und »Fahrlässigkeit«; wir kommen darauf zurück.
2. Der freie Wille – Setzt Verantwortung Selbstbestimmung voraus?
Wenn nicht das schlichte Dasein von Übeln als Begründung für das »Strafen« ausreicht und wenn auch das Eintreten von Schäden im Zusammenhang mit Menschen ein ziemlich grobes und »ungerecht« erscheinendes Raster ist, muss man, wie auch immer, am Zweck der Handlungen anknüpfen und diesen ihrem Urheber irgendwie »zurechnen«. Mit anderen Worten: Man kann einer Person ihre Zwecke oder Motive nur dann zum Vorwurf machen, wenn es auch tatsächlich ihre sind oder man dies jedenfalls annimmt.
Das ist eine Überlegung, die einen schon recht entwickelten, »modernen« Begriff vom Strafen hat. Bis vor wenigen Hundert Jahren unterschied man in Europa noch nicht genau zwischen »Verbrechern« und »Irren«, denn das setzt voraus, dass man die Person als selbstbestimmten Urheber von Zwecken ansieht. In diesem Fall verändert sich das, was man als »Schuld« bezeichnet, auf eine spezifische Weise. Hier kommt es zunächst nur darauf an, dass die Vorstellung von Verantwortung, wie sie dem modernen Strafen zugrunde liegt, voraussetzt, dass eine Person, ein Ich, ihrem Agieren einen selbst bestimmten Zweck gesetzt hat, also »frei« war, sich für oder gegen das Handeln zu entscheiden. Das entspricht dem subjektiven Empfinden der meisten Menschen: Sie sind sicher, dass sie zwar nicht frei entscheiden können, ob ihr Herz schlagen soll oder ihre Lungen atmen sollen, wohl aber, ob sie sprechen, gehen, essen, schlagen sollen.
Die Hirnforschung der vergangenen 20 Jahre hat gegen den subjektiven Eindruck der Entscheidungsfreiheit erhebliche und plausible Einwände formuliert. Dies hat zu großer Aufregung in vielen Bereichen des Wissens und der Theorie über die Natur des Menschen und der Gesellschaften geführt. Man müsse, so hieß es oft, alle Schlussfolgerungen, die sich aus der Annahme der Selbstbestimmtheit des Menschen ergeben, infrage stellen.
Die Grundlage dafür ist, vereinfacht gesagt, die Erkenntnis, dass die biologisch-neurologische »Natur« und das sogenannte Bewusstsein der Menschen, also die interne Reflexion, die Betrachtung des eigenen »Selbst«, die Erkenntnis und Vorstellung vom »Ich« und seinen Entscheidungen in einer Umgebung scheinbar unendlicher Entscheidungsvarianten, offenbar auf frappierende Weise auseinanderklaffen. Vieles, am Ende vermutlich sogar alles, was der Mensch denkt, bewertet und entscheidet, stammt, so scheint die Hirnforschung zu belegen, nicht aus seinem »freien« Selbst, sondern aus biochemischen Abläufen, für welche die Regeln der naturwissenschaftlichen Kausalität gelten.
Das ist natürlich nur eine sehr oberflächliche Umschreibung, die allerdings auch der grundsätzlichen Banalität der Erkenntnisse entspricht: Von der Entdeckung, dass die Entscheidungen nicht einem körperlosen »Geist« entspringen, kann eigentlich nur überrascht oder gar schockiert sein, wer diese Annahme zur Grundlage seines Weltverständnisses gemacht hatte. Dies geht nur, wenn man der (menschlichen) Natur, die ja ganz ohne Zweifel körperlich ist, also aus dem Stoff unseres Planeten besteht, entsteht und vergeht wie seine übrigen organischen Wesen, eine weitere, übernatürliche, »rein« geistige Sphäre hinzufügt, oder jedenfalls eine, die von menschlichen Sinnen nicht (unmittelbar) wahrgenommen werden kann. Das können »Götter« sein oder »kosmische Prinzipien«, notfalls auch außerirdische Lebewesen mit einem Bewusstsein, das sich als Steuerungs-Interesse in unserem Sonnensystem zeigt.
Die Geschichte der Menschheit zeigt, dass eben solche Erklärungen der Dinge von Anfang an Teil der menschlichen Gesellschaften waren und bis heute sind, ihre Formen und Inhalte im Einzelnen jedoch seit jeher auf unüberschaubar vielfältige Weise geändert, entwickelt, angepasst, überarbeitet haben: ein unvorstellbar großer, in ständiger innerer und äußerer Bewegung befindlicher »Überbau« über den banalen Fakten des Lebens und Sterbens, der aus »Geist«, »Freiheit«, »Seele«, Bewusstsein zu bestehen scheint und in einem allgegenwärtigen Prozess scheinbar chaotischer Kommunikation ausgetauscht wird. Die Ewigkeitspostulate, die einzelnen Systemen dieser Kommunikation eigen sind – vor allem die der sogenannten Religionen –, sind ihrerseits Teile ihrer inneren Systematik, also »selbst-reflexiv«: Religionen, die sich selbst für endlich halten, gibt es nicht; ebenso wenig andere Narrative, die zugleich die Existenz eines über-menschlichen Geist-Bewusstseins und dessen Beschränktheit behaupten.
In dieser offenkundigen Zirkelhaftigkeit liegen die Versprechen, die all diese Orientierungssysteme hervorbringen, aber zugleich auch deren schmerzliche Beschränktheit, die in allerlei wunderlichen Formen in die Systeme einzubauen ist, um sie lebens- und orientierungsfähig zu halten: Stets muss ein »Geheimnis« bleiben zwischen der Wirklichkeit der Welt und der Wahrheit ihrer Steuerung. Das ist, im Grundsatz, der Inhalt religiöser Systeme.
Was hat das mit den Fragen der Hirnforschung zu tun? Manche erschreckte Philosophen haben behauptet, »die Hirnforscher« hätten die Seele oder den Sinn, die Freiheit des Menschen oder Gott »abgeschafft« oder strebten dies an. Solche etwas kindischen Vorstellungen ähneln der Behauptung, die Herzchirurgie habe die Liebe abgeschafft. Auch Juristen und unter ihnen besonders die Strafjuristen sind über die Hirnforscher sehr erschrocken. Sie befürchten, dass ihnen die »Schuld« verloren geht, die das wesentliche Kennzeichen der Vorwerfbarkeit sei, und der Boden, auf dem nach heutigem Verständnis allein »Strafe« gedeihen kann.
Aus dem Umstand also, dass den Folgen, die man an die Existenz eines freien Willens bindet, der Sinn entfiele, wenn es die Freiheit nicht gäbe, schließt man, dass die Hirnforscher einem grässlichen Irrtum und einer schrecklichen Selbstüberschätzung aufgesessen seien, da die Existenz der Strafe die des freien Willens beweise. Das ist natürlich ein Zirkelschluss, andererseits aber nicht ganz falsch.
Dies ergibt sich aber nicht aus der Notwendigkeit, zwischen all dem Gewebe und den Flüssigkeiten, den Neuronen, Drüsen, Blutgefäßen und Knochen auch noch einen »Geist« zu finden, der sich selbst für ein Ich, die Großhirnrinde aber zwar für die »eigene«, aber doch für etwas anderes, vom Ich Unterschiedenes hält. Denn letzten Endes ist man sich heute auf der Welt ziemlich einig, dass die Geister und die Seelen ohne lebendige Materie und diese ohne die tote nicht existieren und also eine Form derselben sind, nicht ihr Gegenteil. Je mehr man lernt über die Neurologie, desto unhaltbarer wird die Annahme, der Körper sei eine Art Aufbewahrungsgefäß für das zentrale Nervensystem und dieses eine Entwicklungsstätte für eine substanzfreie »Freiheit« des Denkens und Entscheidens. Denn unzweifelhaft denkt der Mensch mit seinem (ganzen) Körper und nicht in einer Sphäre jenseits von ihm: ohne Neuronen kein Input, keine Bewertung, kein Output. Und die Neuronen sind, wie sie sind: keine Rechenmaschinen oder Speicherchips, und keine Antennen für göttliche Funksprüche.
Damit kann man – als Mensch, Philosoph oder Strafrechtler – nicht nur leben, sondern muss es. Die Erkenntnis, dass das Ich, mit all seinen Entscheidungen, Geheimnissen und Bedingungen, im Körper und durch ihn entsteht, wohnt und existiert, verhindert die Annahme von »Freiheit« nicht, wenn es diese nicht als metaphysische Instanz voraussetzt, sondern als Funktion des biologischen Lebens begreift.
Nur »letzten Endes« scheint sich Entscheidungsfreiheit hier aufzuheben in einer – jedenfalls möglichen Kausalitätsbehauptung: Denn wenn, idealtypisch, alle individuellen Verschaltungsvorgänge des Gehirns verstanden, gemessen und bestimmt werden können und dem »freien Willen« daneben kein eigener Raum mehr verbleibt, stellt sich die Freiheit des individuellen Denkens und Entscheidens selbstverständlich als jeweils »zwangsläufige« Folge gegebener Bedingungen dar. Das ist überaus naheliegend und nicht schlimmer als die Erkenntnis, dass der menschliche Geist zu seinem Wirken Sauerstoff benötigt.
Das Entscheidende ist also nicht das Entstehen dessen, was der Mensch als »Freiheit« empfindet, aus der Geltung unfreier oder jedenfalls vom menschlichen Wollen unabhängiger Gesetzmäßigkeiten der Natur. Für die Betrachtung des Zusammenlebens viel wichtiger ist das Verständnis dessen, was man, auf jeder Ebene, als »Kausalität«, als Zusammenhang von Wirkung und Ursache ansieht. Chaostheorien und Theorien komplexer Systeme, die dynamisch, also grundsätzlich deterministisch sind, geben Anhaltspunkte dafür, dass zwar »Freiheit« des Willens eine Illusion sein mag, das Bewusstsein von ihr aber eine Wirklichkeit ist, die eine Grundbedingung menschlichen Lebens darstellt. Dabei kann es hier dahingestellt bleiben, ob und wie man das Bewusstsein als »Rätsel« versteht.
3. Normativität – Der Zusammenhang von Wahrscheinlichkeit und Zumutung
Nach diesen sehr allgemeinen Erwägungen führt der nächste Schritt näher ans Strafrecht. Am Grunde seiner Entstehung liegt das Phänomen, dass aus Selbst-Bewusstsein Normativität entsteht.
Menschliches Leben funktioniert »normativ«. Das heißt: Es ist von Regeln bestimmt, die nicht allein empirisch sind, also nicht nur aus Erfahrung und Bedingungen bestehen, sondern aus selbst gemachten Wertungen und Zumutungen. Die Frage, ob man dies in einem reflektierten, absichtsvollen Sinn »will« oder als richtig, angemessen, rational empfindet, stellt sich in der Wirklichkeit nicht, denn eine Alternative besteht nicht. Menschliches Leben ist von Anfang an ein gesellschaftliches gewesen und daher untrennbar mit Normativität verbunden. Anders als in den theoretischen Modellen des sogenannten »Gesellschaftsvertrags« beschrieben, entstanden menschliche Gesellschaften nicht als quasi vertragliche Zusammenschlüsse freier und geistig entwickelter Individuen aus rationalen Gründen, sondern immer und ausschließlich als Gemeinschaften, in einer kollektiven evolutionären Entwicklung aufeinander bezogenen bewussten Handelns.
Solche Strukturen findet man auch im Tierreich. Alles andere wäre verwunderlich, denn die Menschen gehören zur selben Natur wie die übrigen Lebewesen. Die gängige Trennung in »Pflanzen, Tiere und Menschen« ist eine ziemlich einfältige Verzerrung. Man kann davon ausgehen, dass intelligente Schimpansen die belebte Welt in »Pflanzen, Tiere und Schimpansen« aufteilen.
Menschenaffen gehören zu den Tieren, die ein Ich-Bewusstsein entwickeln, vermutlich auch ein Bewusstsein von der eigenen Sterblichkeit. Untrennbar damit verbunden ist die Fähigkeit zur Empathie, also eines Bewusstseins von einem dem Ich gegenüberstehenden »Anderen Ich« (Du), das eine fremde, eigene Sicht auf die Dinge, Umstände und Handlungen der Lebenswelt hat. Aus unbewussten, reflexhaften, »instinktiven« Reaktionserwartungen (zum Beispiel der Erwartung eines Angriffs beim Zeigen von Aggression) hat sich im Lauf der Evolution entwickelt, was man als empathisches »Gefühl« bezeichnen kann. Damit ist nicht, wie in der heutigen Alltagskommunikation zumeist, ein »Mitgefühl« im Sinn von Mitleid, Bedauern, Sympathie gemeint, sondern die schlichte Fähigkeit, sich Gefühle, Gedanken, Absichten einer anderen Person »vorstellen« zu können. Voraussetzung hierfür ist wiederum die Entwicklung einer dem Ich zugeschriebenen »Gefühls«-Sphäre, die mit der Sphäre des Erkenntnis-Inputs (Kognition) und der Sphäre der Erinnerung verbunden wird und – wie mangelhaft oder rudimentär auch immer – bewusst reflektiert werden kann.
Menschliche Gehirne funktionieren nicht wie Computer. Kommunikation zwischen Menschen findet nicht quantitativ statt, sondern »intelligent«, das heißt kreativ, gefühlsgestützt und qualitativ. Empathie ist also keine »Schnittstelle« zum Importieren fremder Daten, sondern eine komplizierte qualitative Deutung der fremden Umwelt auf der Grundlage einer Rekonstruktion der eigenen, die, während sie noch vollzogen wird, die Bedingungen ihrer selbst verändert. Anders gesagt: Der Mensch lernt, noch während er fremde Gefühle versteht oder Absichten erkennt, stets auch das eigene Ich neu und verändert es; das Ende eines kommunikativen Akts trifft insoweit stets schon eine andere Person als ihr Anfang. All diese und noch mehr Bedingungen ermöglichen und verlangen das Entstehen von Normativität. Die Fähigkeit zur Empathie ermöglicht ungleich höhere Erwartungs- und daher auch Orientierungssicherheit als bloß kognitives Registrieren. Sie hat allerdings auch einen hohen Preis: Sie rückt die empathische Kommunikation in das Zentrum der Welt-Orientierung, und sie erzeugt Erwartungsdruck.
Das Ergebnis ist offenkundig: Menschen existieren von Anfang an nur in Gemeinschaft oder in Bezug auf sie, da sie evolutionär auf Zusammenarbeit angewiesen sind. Ihre Gemeinschaft funktioniert aber nicht wie ein Heringsschwarm, sondern beruht auf individuellem Ich-Bewusstsein und Empathie. Dies setzt ununterbrochenes Beobachten, Prüfen und Deuten der jeweils anderen voraus. Das direkte oder indirekte, unmittelbare oder vorgestellte Betrachten der anderen und das Überprüfen, welche »Einstellungen«, Gefühle und Forderungen diese gegenüber dem Beobachtenden haben, nehmen einen außerordentlich breiten Raum des spezifisch menschlichen Lebens ein.
Es findet nicht allein im unmittelbaren Kontakt statt, sondern funktioniert auch »virtuell«: Daniel Defoes Romanfigur »Robinson Crusoe« hält sich 28 Jahre der karibischen Einsamkeit lang an die Benimmerwartungen der besseren englischen Gesellschaft des frühen 18. Jahrhunderts. Erst in Lagen hoher existenzieller Bedrohung (Hungersnot, Folter, Konzentrationslager) bricht das System empathischer Kommunikation zusammen. Das ist einer der Gründe, warum in der Ausbildung zum Krieg extrem hoher Wert auf eine formale Außenleitung (»Gehorsam«; Einübung von blinder »Kameradschaft«) gelegt wird: Sie soll sicherstellen, dass in der extremen Stresssituation des Kampfes und der Todesbedrohung die befohlene Sinnstruktur möglichst lange funktioniert.
Von entscheidender Bedeutung ist die Fähigkeit zur Kommunikation über abstrakte Zeichen, also über Sprache. Anders als der Alltagsjargon behauptet, enthält sprachliche Kommunikation ja nie »unmittelbaren« Ausdruck von Gefühlen oder Gedanken. Sie formt diese vielmehr in überaus komplexen Abstraktionen zu Zeichen, die zugleich allgemein und besonders sind, das Allgemein-Fremde wie das Individuell-Eigene symbolisieren. Sie verändern Innen- und Außenwelt des Sprechenden gleichermaßen. Sprache ist also, wie jedes Symbol, keineswegs (nur) ein äußeres »Werkzeug« des Bewusstseins, sondern enthält zahlreiche produktive Anteile, die von aktiven Verarbeitungen bewusster und unbewusster Art, Gefühlen, Erinnerungskonstruktionen, Intentionen und Motiven getragen werden und umgekehrt Einwirkungen derselben Art aufnehmen, deuten, verstehen und bewerten muss. Auch insoweit gilt also, dass der Prozess der Kommunikation selbst deren Inhalt mitbestimmt und die kommunizierenden Personen verändert.
Nehmen wir beispielhaft an, zwei einander ganz fremde »Wilde« begegnen sich eines Tages zufällig im Urwald der Frühgeschichte. Beide fürchten sich voreinander. Sie greifen einander nicht an, sondern gehen ihrer Wege. Nach einer Woche treffen sie sich wieder, und dasselbe passiert, und so geschieht es in den nächsten Wochen immer wieder. Jedes Mal wird die Angst ein wenig kleiner werden, denn beide werden es bei einem erneuten Treffen für »wahrscheinlich« halten, dass wieder nichts passiert. Das nennt man »kognitives Erwarten«. Es wird dadurch ergänzt, dass jeder der beiden auch eine Vorstellung davon entwickelt, was der jeweils andere wohl denken und erwarten mag. A erwartet also, dass B erwartet, dass A sich freundlich verhält, und umgekehrt. So entsteht »kognitives Vertrauen«: Aus Gewöhnung an die Friedlichkeit wird eine in die Zukunft gerichtete Prognose. Wenn A annimmt, dass B annimmt, A werde sich friedlich verhalten, und zugleich annimmt, dass B annimmt, A werde das annehmen – und umgekehrt –, entsteht ein kompliziertes Geflecht von Voraussagen und »Zumutungen«.
Wenn nun nach zehn friedlichen Begegnungen bei der elften Mensch A Anstalten macht, B anzugreifen, wird B nicht nur überrascht, sondern auch empört sein. Seine Erwartung eines quasi »natürlichen« Ablaufs hat sich in ein emotionales Vertrauen auf ein empathisches Zusammenwirken verändert. Das nennt man »normatives Erwarten«: Die Erwartung von B beschränkt sich nicht mehr auf Wahrscheinlichkeitserwägungen, sondern baut ein mentales »gefälligst« ein – eine moralische Pflicht von A, sich freundlich zu verhalten als Gegenleistung für die Freundlichkeit von B. Den Angriff des A wird der B also nicht wie ein Naturereignis oder einen Unfall wahrnehmen, wie es der Fall wäre, wenn ihn ein Raubtier angriffe. Sondern er wird es als Ungerechtigkeit empfinden, als Verstoß gegen eine gemeinsame – wenn auch unausgesprochene – Verhaltensanforderung.
So entsteht Normativität. Das geschieht natürlich nicht, wie im Beispiel, auf einer Experimentierbühne mit zwei isolierten Urmenschen, die beim Durchstreifen des Urwalds auf die Idee kommen, einen »Vertrag über den friedlichen Personenverkehr« zu schließen, und danach vielleicht einen nächsten über den Austausch von Früchten gegen Fleisch usw. Es ist vielmehr vom evolutionären »Entstehen« des Menschen und seiner Gemeinschaften gar nicht zu trennen: Normativität ist Natur und Gesellschaft zugleich, »Paradies« und »Jenseits von Eden« zur selben Zeit.
4. Moral – Verbindung von Sinn und Empathie
Moral ist, was bei der Normativität des Alltags herauskommt: ein mehr oder weniger buntes System von »Werten«, Anforderungen, Zumutungen, Erwartungen und Beurteilungen. Moral entspringt, soweit man das beurteilen kann, nicht einer »Seele« des Menschen (und erst recht nicht einer ewigen), sondern seinem wirklichen Leben. Sie spiegelt es wider und ändert sich mit ihm; ist daher auch weder zufällig noch inhaltlich vorherbestimmt, wenn man von wenigen Grundstrukturen absieht, die die gemeinsame Existenz betreffen und daher zumindest außerordentlich nah bei der »Natur« angesiedelt sind: Fürsorge, Mitleid, Zuneigung, Rache. Aus der Sicht des Strafrechts sind das Bedürfnis und die Fähigkeit zum Motiv der Rache besonders wichtig. Hunde, Katzen, Vögel, Delfine oder Tintenfische »rächen« sich nicht; Menschenaffen können es.
Moral ist keineswegs im Ursprung oder ihrer Natur nach konstruktiv, friedlich oder angenehm. Die disqualifizierende Beschreibung einer Handlung als »unmoralisch« ist eine alltagssprachliche Ungenauigkeit, die eigentlich meint, eine Handlung oder Einstellung zeuge von einer schlechten Moral. Es gibt praktisch keine Verhaltensweisen, Einstellungen oder Handlungen, die in verschiedenen Epochen, Situationen, Kulturen stets und übereinstimmend als moralisch begrüßenswert oder umgekehrt als moralisch minderwertig angesehen wurden.
Auch Handlungen, die man in intuitiver Betrachtung ohne Weiteres als überzeitlich »gut« oder »schlecht« bezeichnen würde, erfüllen diese Erwartung nicht: Töten, Verletzen, Rauben, Vergewaltigen, Verraten – all diese Handlungen wurden und werden zu Zeiten als moralisch hochstehend und vorbildlich angesehen. Die Piloten, die 1945 Atombomben über japanischen Großstädten abwarfen, hatten damit wenige moralische Probleme; und Völkermörder, Folterer und Terroristen jeder Art und Anschauung handelten nicht selten im Bewusstsein moralisch vorbildlichen Verhaltens. Eltern schicken ihre Kinder in Kriege; Freunde und Ehepartner verrieten einander an die GPU, die Gestapo oder die Stasi, Kinder lieferten ihre Eltern als »Konterrevolutionäre« aus – stets im Namen einer »richtigen« oder höheren Moral.
Moral besteht aus »Werten«, Sitten, Gebräuchen, Handlungsmaximen, praktischer Handhabung von Bewertungen. Als solche entsteht sie selbstverständlich aus den praktischen Lebensumständen selbst, wirkt aber auch vielfältig auf diese ein. Die moralischen Vorstellungen über die Anforderungen an Treue, Beständigkeit, Vertrauen, Tradition, Kritik und andere handlungsleitende Wertsysteme unterscheiden sich beispielsweise in bäuerlichen Dorfgemeinschaften eklatant von denen in einem großstädtischen »Start-up«-Milieu. »Treue« etwa ist in dem letztgenannten System keine Kategorie, nach der sich das Leben sinnvoll und erfolgreich gestalten lässt; »Untreue« (gegenüber Arbeitgebern, Kollegen, Ideen, »Unternehmens-Philosophien« usw.) ist vielmehr ein geradezu positiv bewertetes Kennzeichen des gesellschaftlich als wichtig angesehenen Willens zur Selbstoptimierung und umfassenden Flexibilität der Person. In einem traditionalen bäuerlichen System hingegen bewegt sich eine Orientierung von Personen am Ideal von »Flexibilität« am Rande des sozial Erträglichen und gilt als überaus kontraproduktiv, es kommt hier auf Beständigkeit, auf Treue »zum Land«, zum Althergebrachten und zu Personen an. Beide Varianten »moralischer« Systeme ergeben sich nicht aus (medialer) Beeinflussung, individueller Überredung oder reflektierter Überlegung, sondern aus den Notwendigkeiten der (wirtschaftlichen) Lebensgrundlage.
Es gibt also nicht eine Moral, sondern viele Moralen. In kleinen Gemeinschaften mit weitgehend einheitlicher Lebensgrundlage bildet sich stets eine »herrschende«, das heißt empirisch vorherrschende, sozial durchgesetzte, prägende Moral heraus: In einer Jäger- und Sammlerkultur wird das tendenziell eine Moral der Gleichheit und der gegenseitigen Unterstützungspflichten sein. Solche Gesellschaften haben kein Interesse an komplizierten »Strafen« und Ausgrenzungen von Abweichlern, denn dadurch wird das gemeinsame Handeln behindert oder zerstört, das für das Überleben aller notwendig ist. Eine nomadisch oder als Jäger und Sammler lebende Kultur würde nicht auf den Gedanken kommen, einen Teil der Mitglieder der Gesellschaft zur Strafe für abweichendes Verhalten »gefangen« zu halten, denn das wäre äußerst aufwendig und würde die Gemeinschaft schwächen.
Ganz anders stellt sich etwa eine Moral der Ungleichheit dar, wie sie in einer dörflichen Gesellschaft von Landeigentümern (Bauern) und Dienstboten (oder Sklaven oder Leibeigenen) herrscht: Hier muss »moralisch« die Herrschaft der einen und die Unterordnung der anderen geregelt werden; es muss moralisch zugelassene oder versperrte Wege der sozialen Bewegung geben: Aufstieg, Heirat, Erbe, Arbeitshierarchie. Ähnliches geschieht, wenn Eigentum an Tieren als wirtschaftliche Lebensgrundlage privatisiert und innerhalb einer sozialen Hierarchie verteilt wird. Bis in kleinste Verästelungen hinein werden soziales Handeln und persönliche Existenz von moralischen, normativen Erwartungen und Handlungsanleitungen durchdrungen.
Diese Beispiele sind gewählt, weil sie plakativ sind und durch ihre Eindeutigkeit und im Rückblick fremd erscheinende Distanz leicht dechiffriert werden können. Vergleicht man damit die Moralstruktur der deutschen Gesellschaft des Jahres 2018, erscheint diese zunächst weithin chaotisch, vielfach unverständlich. Sie zeigt zahlreiche offenkundige Widersprüchlichkeiten, deren Deutung wiederum Gegenstand zahlloser ihrerseits normativ geprägter Erklärungsansätze und weiterer Differenzierungen ist. Auffällig ist etwa der Widerspruch zwischen einer »Metamoral« der Freiheit und einer »Hypermoral« der Unfreiheit.
Vereinfacht gesagt: Die »Metamoral«, also eine moral-gestützte Auffassung über Rolle, Funktion, Begrenzung und Bedeutung von Moralen, stellt die Figur einer rundum »freien« Person in den Mittelpunkt, die in größtmöglichem Maß von traditionellen Bindungen frei und »für sich selbst verantwortlich« ist, dabei weitgehend von Gemeinschaften isoliert und vor die Lebensaufgabe gestellt, die Persönlichkeit in einem stetigen Selektionsprozess zu »optimieren«. Das muss dazu führen, dass Moralen (nur) als sektorale, wandelbare »Angebote« erscheinen, also zum Bestandteil umfassender Veränderbarkeit werden: Es gibt vollkommen unterschiedliche Moralen gesellschaftlicher Gruppen, Produktions- oder Konsumsektoren, Rollenbilder usw., die nicht oder nicht mehr vorrangig in einem Wettbewerb um das »Vorherrschen« stehen, sondern von einer moralischen Ebene überwölbt werden, die gerade dies zum Inhalt von »guter« Moral macht: Vielfalt und Buntheit. »Volatilität« und Austauschbarkeit moralischer Systeme und Standards werden zum Kennzeichen von Modernität, weil nach deren ideologischer Konstruktion alles möglich sein soll.
Ein Überangebot an variablen Moralen ist nicht allein ein Resultat von Destabilisierung, sondern verstärkt und beschleunigt diese auch; sie ist für die Einzelnen auch schwer zu ertragen. Eine »Hypermoral« (ein Begriff, der vor 50 Jahren von dem Philosophen Arnold Gehlen eingeführt wurde) zieht die Konsequenz daraus, dass es für die »richtige« Moral in der modernen Gesellschaft nur noch wenige Ansätze im Äußeren des Handelns gibt. In einer Gesellschaft, in der – angeblich – alles Handeln gleich viel »wert« ist, wenn es nur der Selbstverwirklichung zum Erfolg verhilft und die Person irgendwie »identisch mit sich selbst« macht, richtet sich der Blick der Moral nicht mehr darauf, ob Kleidungs- oder Ehevorschriften befolgt, das Auto regelmäßig gewaschen oder der Rasen gepflegt wird.
Der Blick der moralischen Kultur richtet sich, wie auch der Blick des Individuums, ganz nach innen,