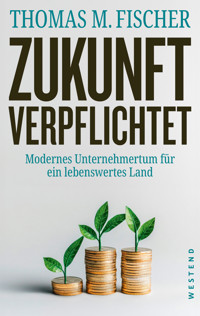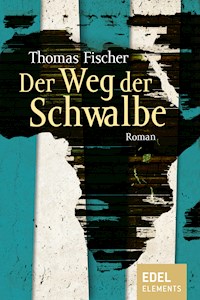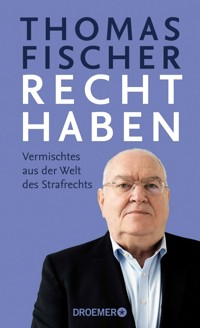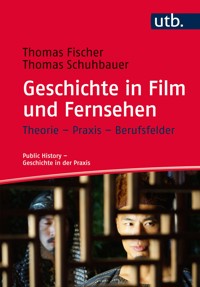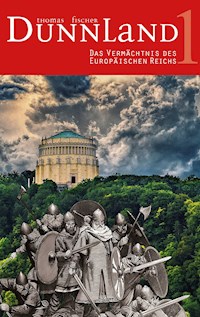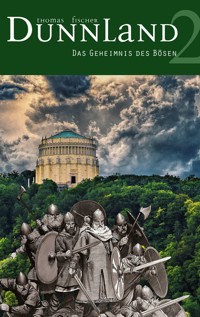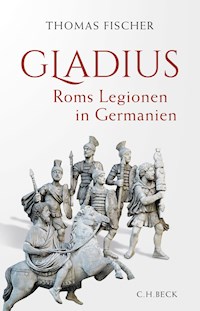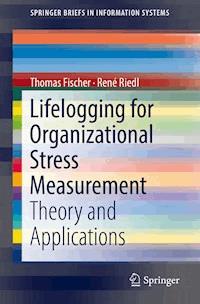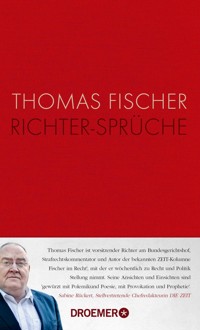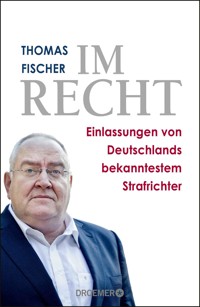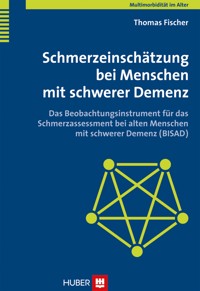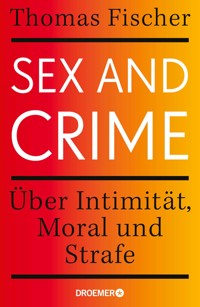
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sexualstrafrecht als Gradmesser unserer Gesellschaft: Der ehemalige Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof über Sexualität aus juristischer Perspektive Was ist "normales" Begehren, was ist strafbares Verhalten? Wann hat der Staat das Recht auf Kontrolle der Intimsphäre? Wann nicht? Wo braucht das Sexualstrafrecht Reformen? Das Strafrecht bestimmt, was "normales" und was "abweichendes", strafbares Sexualverhalten ist. Aber wo genau verläuft die Grenze zwischen Sex und Crime? In seinem neuen Buch zeigt der ehemalige Vorsitzende Richter des Bundesgerichtshofs, dass die Frage nach "Schuld" und "Krankheit" im Sexualstrafrecht viel komplexer ist, als es die politische und gesellschaftliche Diskussion vermuten lässt. Denn die strafrechtliche Definition etwa von Vergewaltigung und Missbrauch ist auch ein Spiegel moralischer, ökonomischer und politischer Machtverhältnisse. Und damit wird dieses Rechtsgebiet zum Verhandlungsort gesellschaftlicher Normen. Das Ergebnis von Fischers messerscharfen juristischen Analysen: Ein Rechtsstaat muss gerade im Sexualstrafrecht Komplexität nicht nur aushalten, sondern absichern - doch genau daran hapert es oft. "Der Mensch hat keine 'natürliche' Sexualität, die außerhalb von Kultur, Moral, Ordnung und Gesellschaft steht. Und trotzdem ist der Mensch immer auch ein Affe." Thomas Fischer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Thomas Fischer
Sex and Crime
Über Intimität, Moral und Strafe
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Das Sexualstrafrecht bestimmt, welche Handlungen erlaubt und verboten sind. Da wohl kein Bereich des Lebens emotional so aufgeladen ist wie die Sexualität, sind diese Regeln immer auch ein Spiegel gesellschaftlicher Moralvorstellungen. Was ist Verlangen und was ist Verbrechen? Wo ist die Grenze zwischen Intimsphäre und Öffentlichkeit? Wie unterscheiden sich Missbrauch, Zwang und Täuschung? Pointiert und anhand zahlreicher Beispiele erklärt der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer, wie das Sexualstrafrecht funktioniert. Seine Forderung: Auch und gerade hier muss der Rechtsstaat Ambivalenzen aushalten.
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorwort
Einleitung Über einige Regeln der Rechtssprache
Kapitel 1 Was ist Sexualität?
Moralische Affen oder triebgesteuerte Maschinen: die Trennung von Natur und Kultur
Sexualität als gesellschaftliche Form
Über Intimität sprechen: Sexualität und Kommunikation
Kontrolle und Sanktion: die Ordnung und Unordnung von Sexualität
Sexualität als gesellschaftliche Wirklichkeit
Werte im Wandel: Familien und Sexualmoral
Elite, Macht, Moral: Was Sexualität mit sozialen Klassen zu tun hat
Der lange Schatten der Romantik: Liebe und andere Kräfte
Das schöne Ich: Körpermoden
Eine individuelle Entwicklung? Sexualität im Lebensverlauf
Gender oder Geschlecht? Die Frage nach sexueller Identität
Kapitel 2 Norm und Abweichung
Sein braucht Sollen: die Notwendigkeit von Normen
Konformität und Abweichung: Devianz
Abweichung als begriffliches Problem
Regelverstoß oder Krankheit? Devianz aus strafrechtlicher Perspektive
Die Identität der Mehrheit: Ungleichzeitigkeiten in der Bewertung von Norm und Abweichung
Gefundene und gemachte Regeln: die Geschichtlichkeit des Sexualstrafrechts
Göttliche Normen: Sexualverfassung und Religion
Kapitel 3 Zwang, Missbrauch, Täuschung
Statt gefühlter Strafbarkeit: das Bestimmtheitsgebot
Freiheitseinschränkung und Fehlgebrauch: allgemeine Begriffsbedeutungen
Missbrauch als Kategorie im Sexualstrafrecht
Entscheidend ist der Widerwille: Zwang im Sexualstrafrecht
Zwangslagen und Missbrauchslagen
Die Situation des Opfers
Die Situation des Täters
Wie erkennt man einen Willen? Zustimmung, Widerstand und Grenzzustimmung
Der freie Wille im Spiegel von Neurologie und Psychologie
Der wirkliche Wille als strafrechtliches Kriterium
Die Gewissheit der Wirklichkeit: Ambivalenz und ihre Grenzen
Falsche Tatsachen: die Täuschung im Sexualstrafrecht
Kapitel 4 Aktuelle Rechtslage und Beispielsfälle
Fälle und ihre Behandlung
Beispielsfall 1: Sexueller Übergriff, Nötigung, Vergewaltigung
Einführung
Sachverhalt
Vorbemerkung: Was ist wirklich passiert? Die Feststellung des Sachverhalts und die Beweisaufnahme
Hat sich jemand strafbar gemacht? Die Subsumtion
Objektiver Tatbestand
Subjektiver Tatbestand: der Vorsatz des Täters
Wurde der erkennbare Widerwille aufgegeben? Die Handlung der Geschädigten B.
Handelt es sich um ein Vergehen oder um ein Verbrechen?
Was ist eine Vergewaltigung und liegt eine solche hier vor?
Verkennung und Irrtum des Täters
Ergebnis
Beispielsfall 2: Sexuelle Übergriffe durch das Ausnutzen von besonderen Lagen
Einführung
Sachverhalt
Überblick
Hat sich jemand strafbar gemacht? Die Subsumtion
Objektiver Tatbestand
Subjektiver Tatbestand und Ergebnis
Beispielsfall 3: Sexualdelikte gegen Kinder
Einführung
Sachverhalt
Objektiver Tatbestand
Was ist hier das geschützte Rechtsgut? Sexuelle Selbstbestimmung bei Kindern
Tatbestand im Beispielsfall
Subjektiver Tatbestand: der Vorsatz des Täters
Die Frage nach der Schuld des Täters
Ist der Täter überhaupt schuldfähig?
Was kommt nach einer Strafanzeige? Verfahren und Beweisaufnahme
Beweise und ihre Glaubwürdigkeit
Die Frage der Strafzumessung
Beispielsfall 4: Sexuelle Belästigungen
Einführung
Sachverhalt
Hat sich B. strafbar gemacht? Die Subsumtion
Sexueller Übergriff?
Freiheitsberaubung?
Nötigung?
Sexuelle Belästigung?
Liegt eine Straftat aus Gruppen (§ 184j StGB) vor?
Ergebnis
Beispielsfall 5: Verbreiten von kinderpornografischen Inhalten
Einführung
Sachverhalt
Was ist Pornografie? Eine Begriffsbestimmung
Kinderpornografie
Objektiver Tatbestand
Sich kinderpornografische Inhalte verschaffen
Anderen kinderpornografische Inhalte verschaffen
Liegt eine Bandentat vor?
Das Anbieten von Kindern
Wurde ein Verbrechen verabredet?
Hat sich H. strafbar gemacht?
Hat sich K. strafbar gemacht?
Verfahrensfragen: Untersuchungshaft und Außervollzugsetzung des Haftbefehls
Kapitel 5 Ausblick
Die Welt von innen steuern? Sexuelle Identität im Spiegel von Gesellschaft und Strafrecht
Sittliche Urteile? Strafrecht und sexuelle Präferenzen
Sex, Crime, Cybersex
Die Moral des Strafrechts in Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit
Anhang
Strafgesetzbuch in der Fassung vom 13.11.1998 (BGBl I S. 3322), Auszug
Allgemeiner Teil, 2. Abschnitt
Allgemeiner Teil, 3. Abschnitt, 2. Titel
Besonderer Teil, 12. Abschnitt: Straftaten gegen Ehe und Familie
Besonderer Teil, 13. Abschnitt: Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
Dokumente
Alte Fassungen des Strafgesetzbuchs und aufgehobene Vorschriften
Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. (Constitutio Criminalis Carolina) von 1532
Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794
Zweiter Theil: Zivilrecht
Ehe; Gemeinschaftliche Rechte und Pflichten der Eheleute.
Zwölfter Abschnitt. Von fleischlichen Verbrechen
Vorbeugungsmittel
Gemeine Hurerey
Verführung
Blutschande
Nothzucht
Ehebruch
Bigamie
Unnatürliche Sünden
Internationales Recht
Übereinkommen des Europarats vom 11. Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (»Istanbul-Konvention«), Gesetz vom 17. Juli 2017, BGBl II S.1026)
Art. 36 Sexuelle Gewalt, einschließlich Vergewaltigung
Für Yasmine
Vorwort
Populäre Darstellungen einzelner Rechtsgebiete, anschauliche Schilderungen von Rechtsfällen, insbesondere von Kriminalfällen, sowie Ratgeber jeder Art für die Orientierung im Dschungel des Rechts gibt es viele. Warum also ein Buch über »Sex and Crime«? Der Titel ironisiert ein wenig jene dokumentarische und fiktionale Literatur, in der diese beiden Ingredienzien als Spannungsgaranten schlechthin gelten. Der Untertitel »Über Intimität, Moral und Strafe« lässt aus dem Luftballon von »Sex and Crime« aber die Luft ein wenig heraus. So geht es in diesem Buch gerade nicht um das Spektakuläre der Form, der Abseitigkeit oder des Grusels, auch nicht um die Reize der Erotik und der Geschlechtlichkeit als solche. Andererseits muss eine populäre Darstellung über den Zusammenhang von sexuellem Verhalten und Verbrechen natürlich da ansetzen, wo die Leser sind, und dieser Ort sind nicht wissenschaftliche Abstraktionen der juristischen Dogmatik oder feinste Abgrenzungen in höchstrichterlichen Entscheidungen, sondern die Fälle des Alltags, die eigenen Ängste, Beurteilungen und Fragen.
Eine Fülle von Themen aus dem Bereich von Sexualität und Strafrecht steht fast ständig im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Nicht erst die MeToo-Debatte seit 2017 hat die Frage aufgeworfen, ob die Zahl der Angriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung in Deutschland tatsächlich höher oder ob vielleicht nur die Aufmerksamkeit für sie größer geworden ist. Stimmt es, dass die statistischen Zahlen der Sexualdelikte zurückgehen, oder treffen die Meldungen zu, dass in manchen Kriminalitätsbereichen die Dunkelziffern besonders hoch sind oder gar steigen? Trifft der Eindruck zu, dass die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte, insbesondere im Internet, immer mehr zunimmt? Gibt es mehr, kriminellere oder skrupellosere Banden von Tätern sexuellen Kindesmissbrauchs, wie es die Aufdeckung spektakulärer Fälle der letzten Jahre nahelegen könnte? Steigt die Zahl der sexuell motivierten Übergriffe im öffentlichen Raum? Sind Vorkommnisse wie die Kölner Silvesternacht 2015 an der Tagesordnung, haben sie zugenommen, oder sind sie eher ein mediales als ein tatsächliches Phänomen? Und anders, sind die Alarmmeldungen und Befürchtungen, die uns fast täglich erreichen, übertrieben und am Ende gar Ausdruck einer fast hysterischen Stimmungsmache, sind sie das Produkt einer überdrehten Sensationsmedienbranche? Ist das Leben wirklich so gefährlich geworden, wie in zahllosen Alarmberichten und Schockgeschichten behauptet wird?
Den Fragen nach den Straftaten schließen sich die Fragen nach der Strafverfolgung an. Stimmt es, dass Polizei und Justiz einer Flut von immer schwereren Sexualdelikten nicht Herr werden? Sind die Tatbestände des Strafgesetzes zu eng, die Strafen zu milde, die Richter zu unverständig, die Präventionsmaßnahmen zu unentschlossen? Hat die Gesellschaft wirklich kein Mitleid mit Opfern und stellt einseitig die Interessen von Tätern oder Beschuldigten in den Vordergrund? Oder ist das Sexualstrafrecht mit seiner hohen emotionalen Signalwirkung und seinem starken Einfluss auf die emotionale Verfassung der Bevölkerung nur ein trojanisches Pferd, mit dem ein polizeistaatliches Überwachungssystem sich – sei es planvoll oder auch nur aus unreflektierter, nicht genügend hinterfragter Sachlogik – in die letzten freien Räume der Privatheit und Intimität einschleicht?
Diese und viele andere Fragen werden gestellt. Man kann dazu intuitive, spontane Meinungen und Ansichten haben, die zu Hunderttausenden in Internetforen und Chaträumen geäußert werden, oft in der Form bloßer Gegenüberstellungen von begründungslosen Überzeugungen und Abwertungen der jeweiligen angeblichen Gegenseite. Wer mehr wissen und substanziell mitreden will, muss sich ein wenig anstrengen. Er oder sie muss zunächst verstehen, dass das Sexualstrafrecht und die Sicherheit der geschützten Rechtsgüter nicht Gegenstände oder Phänomene sind, die jeden Tag sozusagen neu erfunden werden und von spontanen Überzeugungen oder Intuitionen leben. Auch bloße Empörungen, Mitleid mit Opfern oder Versuche, die Täter in ihren Motivationen und ihrer Gefährlichkeit zu verstehen, reichen nicht aus, um den Überblick zu behalten. Sexualstrafrecht ist ein Teil des großen, ständig in Bewegung befindlichen sozialen Systems der Verhaltenskontrolle. Es hat tiefe Wurzeln in der Moral und der Ethik, und es verändert sich ständig, so wie sich auch die Struktur der Gesellschaft, in welcher es gilt, ständig wandelt. Rechtsgüter, die vor hundert oder vor fünfzig Jahren überragend wichtig schienen, zum Beispiel die »Sittlichkeit«, haben ihre Bedeutung verloren. Andere, etwa das Recht auf Selbstbestimmung, haben an Bedeutung und Präsenz im allgemeinen Bewusstsein außerordentlich zugenommen. Solche Bewegungen und Veränderungen sind kein Zufall, sondern haben Ursachen und Muster, deren Verständnis erlaubt, etwas differenzierter und ruhiger auf die Dinge zu schauen, als es möglich ist, wenn man nur von einem tagesaktuellen Verbrechen zum nächsten klickt, zappt oder blättert.
Am Grunde jeder rationalen Beurteilung muss ein Verständnis der tatsächlichen und normativen Bedingungen liegen. Wer das Strafgesetz nicht kennt oder kennen will, kann nicht sinnvoll darüber sprechen, ob es richtig, ausreichend und nützlich ist. Deshalb ist es das Ziel dieses Buchs vor allem auch, den Lesern einen ersten systematischen Einblick in die Zielsetzungen, die Systematik und die Inhalte des heute geltenden Sexualstrafrechts zu vermitteln. Dabei kann ein Blick auf die Entwicklung und auf frühere gesetzliche Regelungen derselben Fragen und Sachverhalte nützlich sein.
Das Verständnis und die Beurteilung des Strafrechts setzen voraus, dass man sich auch mit Einzelheiten näher befasst. Das ist für Nichtjuristen nicht immer einfach, weil die gesetzlichen Regelungen außerordentlich kompliziert und unübersichtlich sind und zudem ständig verändert werden. Außerdem sind stets zahlreiche allgemeine Regeln und Grundsätze zu beachten, die in den einzelnen Vorschriften nicht mehr gesondert aufgeführt sind, weil sie als bekannt vorausgesetzt werden oder im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs sozusagen vor die Klammer gezogen sind. Sie spielen auch in der journalistischen Darstellung meist keine Rolle, nicht selten deshalb, weil die damit befassten Journalisten sie nicht kennen oder die Systematik nicht verstanden haben, die dem Strafgesetz zugrunde liegt.
Strafrecht ist also nicht ganz leicht und auf den ersten Blick überschaubar. Es ist aber auch keine Geheimwissenschaft und darf nicht nur Fachleuten verständlich sein. Es muss zumindest im Grundsatz für die Bürgerinnen und Bürger transparent bleiben, die von ihm betroffen sind. Das gilt für die Regelungen der einzelnen Tatbestände, aber auch für die allgemeinen Grundsätze etwa über die Täterschaft, den Versuch, die Schuld oder die Strafzumessung. All das findet nicht willkürlich oder je nach Stimmung der Gerichte Anwendung, sondern aufgrund und nach Maßgabe von Rechtsregeln, die man verstehen kann und verstanden haben sollte, bevor man darüber urteilt, ob man sie richtig oder falsch, gut oder schlecht findet. Wenn aber das Sexualstrafrecht nur anhand weniger, öffentlich skandalisierter Fälle und Entscheidungen rezipiert wird, die dann eine Welle intuitiver Zustimmungen oder Ablehnungen mit dem Hinweis, der jeweilige Autor finde das Urteil entweder zu milde oder zu hart oder genau richtig, nach sich ziehen, dann bleibt der Erkenntnisgewinn auf Dauer gering. Auch die Forderung nach weniger Sexualstraftaten und einem besseren Schutz der Menschen vor ihnen ist sekundär für ein Verständnis des Strafrechts. Schließlich gibt es niemanden, der diese Ansicht nicht teilt, und es ist einfallslos, wenn sich unterschiedliche rechtspolitische Positionen gegenseitig vorwerfen, dieses Ziel nicht oder nicht genügend anzustreben. Die gesellschaftliche Kontrolle und Sanktionierung von abweichendem, rechtsgutsverletzendem und strafbarem Verhalten ist keine Frage des Glaubens und der Hoffnung, sondern eine komplizierte, aber verstehbare und rational steuerbare Aufgabe. Wie beinahe überall hilft auch hier Sachkenntnis.
Es soll den Lesern daher eine kleine Reise in die Systematik und Dogmatik des Strafgesetzbuchs (StGB) zugemutet werden, in der Hoffnung, manchen von ihnen ein paar neue und interessante Gegenden zeigen zu können. Damit die Darstellung nicht allzu lehrbuchmäßig und abstrakt bleibt, sind im zweiten Teil eine Reihe von fiktiven Beispielsfällen dargestellt und im Einzelnen besprochen, in denen die Tatbestände des Sexualstrafrechts, die praktischen und rechtlichen Probleme ihrer Anwendung gezeigt werden. Natürlich können nur einige Grundkonstellationen und häufige Fragen behandelt werden. Das wirkliche Leben ist außerordentlich vielgestaltig, und kein Fall ist genau wie andere. Dass es auf Einzelheiten, Differenzierungen und Grenzbereiche ankommt, ist eine der Botschaften, welche das Buch gern vermitteln würde.
Weder der allgemeine Anfangsteil noch die Darstellungen der geltenden Rechtslage und die Fallbesprechungen sind auf eine möglichst schnelle, praktisch-effektive Lösung von Fallfragen ausgerichtet. Sie schweifen ab, wo es sich nach Ansicht des Verfassers lohnen könnte, einen Seitenblick auf Grundlagen, Voraussetzungen, verwandte Probleme oder Weiterungen zu werfen. Damit soll auch gezeigt werden, dass Sexualität und der strafrechtliche Umgang mit ihr ein Feld sind, das an Weite und Vernetztheit in der Persönlichkeit, der Gesellschaft und der Lebenswelt kaum zu überbieten ist. Dieses Buch soll einen kleinen Einblick in den aktuellen Stand dieses Feldes geben, aber auch die Einsicht vermitteln, dass und wie sich die Dinge in einem stetigen Fluss befinden. Das Recht, gerade auch das Strafrecht, wirkt auf die Gesellschaft ein und beeinflusst das Verhalten. Aber das Recht bringt Gesellschaft nicht hervor. Es ist umgekehrt: Das soziale Leben bringt das Recht hervor, und beides ändert sich miteinander.
Die wichtigsten im Text genannten gesetzlichen Regelungen sind im Anhang abgedruckt. Die schlechte Verständlichkeit, ja der abschreckende, unübersichtliche Charakter vieler Gesetzestexte für Nichtjuristen ist ein Ärgernis. Wer aber rechtliche Regelungen und ihre Anwendung kritisieren will, muss ein gewisses Maß an eigener Bemühung und Einarbeitung in eine zunächst fremd erscheinende Materie aufwenden. Das genaue Lesen von gesetzlichen Texten ist Voraussetzung dafür, ihren Inhalt sowie die Fragen zu verstehen, die sich in der praktischen Anwendung stellen und von der Rechtsprechung und der Strafrechtswissenschaft erörtert und beantwortet werden. Im Buchtext wird daher, wenn gesetzliche Bestimmungen erklärt oder besprochen werden, auf den Anhang verwiesen. Über das Sachverzeichnis kann man sich einen ersten Zugriff auf spezielle Begriffe und Themen erschließen.
Einleitung Über einige Regeln der Rechtssprache
Über Sexualität ist unendlich viel geschrieben worden, und dasselbe gilt für Verbrechen. Die Genre-Bezeichnung scheint mit dem Titel »Sex and Crime« inhaltlich einigermaßen klar. Tatsächlich sind aber weder »die Sexualität« noch »das Verbrechen« ohne Weiteres verständliche Begriffe, und ihre scheinbar intuitive Evidenz täuscht. Das bemerkt man, sobald man sich einem der Begriffe mit der schlichten Frage annähert, was er eigentlich inhaltlich bedeute. Denn Sexualität kann etwa sowohl eine menschliche Eigenschaft, Fähigkeit und seelisch-körperliche Struktur bezeichnen als auch deren lebenspraktische Verwirklichung. Sie kann explizit und plakativ, aber auch verborgen und sozusagen sublimiert erscheinen. Und Verbrechen ist nicht allein ein rechtstechnischer Begriff für bestimmte Arten von gesetzlich mit Strafe bedrohten Handlungen, sondern auch eine im Alltagsumfeld angesiedelte, auf moralische und ethische Annahmen gestützte inhaltliche Qualifizierung.
Die große Faszination, die beide Lebensbereiche und vor allem auch ihre Kombination bestimmt, rührt zum einen aus ihrer Außeralltäglichkeit, zum anderen aus der untrennbaren Verbindung mit der individuellen und kollektiven Moral und daher mit den bewussten unbewussten Grundlagen jeder menschlichen Gesellschaft. Jedenfalls für die Sexualität kommt hinzu, dass sie in einem im Prinzip offenkundigen, aber vielfach vermittelten, unklaren und sich wandelnden Verhältnis zur Natur des Menschen als Säugetier, also namentlich zur arterhaltenden Fortpflanzung steht, von der sie zugleich auf vielfältige Weise entkoppelt ist. Die Verbindung von Natur, Gesellschaft, Moral, Konformität und Sanktionierung von Abweichungen macht daher die besondere Bedeutung und den besonderen thematischen Reiz von »Sex and Crime« aus.
Es gibt zahllose Fachpublikationen über Sexualität, Sexualverhalten, sexuelle Störungen, ihre Ursachen und Therapie. Und es gibt viele Fachpublikationen über das geltende Sexualstrafrecht, namentlich seine materiellrechtliche Dogmatik sowie die Besonderheiten, die für das Strafverfahren gelten. Zwischen dieser fachspezifischen Literatur und der gleichermaßen auf Sensationalität ausgerichteten belletristischen und Sachliteratur aus der Lebenswelt sexuell motivierter und sexualisierter Straftaten besteht eine Lücke. Sie mag dazu beitragen, dass trotz einer teilweise geradezu obsessiv anmutenden medialen Aufmerksamkeit für Themen sexuell auffälligen, abweichenden oder als strafwürdig angesehenen Verhaltens in weiten Teilen der Bevölkerung ein erstaunlich geringes Kenntnisniveau besteht. Hierauf beruht die Idee, eine nicht für Fachleute bestimmte Darstellung des in Deutschland aktuell geltenden Sexualstrafrechts, seiner Grundlagen, Geschichte, Entwicklungen und Probleme zu schreiben.
Gesprochen wird ständig über Sexualität – über ihre Bedeutung für das soziale Leben, die moralischen, informellen und formellen Grenzen ihrer Betätigung und über Notwendigkeit und Voraussetzungen, Ziele und Folgen ihrer Regulierung durch Strafe. Dies geschieht in vielerlei Formen auf allen Ebenen der Gesellschaft und häufig mit hoher emotionaler Beteiligung. In den letzten Jahrzehnten konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Bedeutung des Sexualstrafrechts, also einer formellen Verfolgung von abweichendem, verbotenem sexuell motivierten Verhalten, in der Gesellschaft deutlich zugenommen hat, während umgekehrt die Kommunikation über Sexualität und Sexualverhalten eher an öffentlicher Bedeutung verloren und sich auf eher allgemeine Themen des Verhältnisses von »Geschlecht« und »Gender« verschoben hat. Beides mag miteinander zusammenhängen.
Über strafrechtliche Regelungen kann man nur vernünftig sprechen, wenn man ihren Inhalt kennt und versteht. Was für Juristen selbstverständlich erscheint, stellt sich für viele Menschen, die weder Strafrecht gelernt haben noch einen juristischen Beruf ausüben, als erhebliche Hürde dar. Das hat mehrere Gründe, die zum Teil naheliegen und der Natur der Sache, also dem Recht an sich, geschuldet sind, zum Teil Kritik herausfordern. Der offensichtlichste Grund sind die Ungewohntheit, Sperrigkeit und geringe Alltäglichkeit der juristischen Fachsprache, insbesondere auch der Gesetzessprache. Wer probeweise einmal einen Blick in den Text des § 177 StGB wirft (s. Anhang), kann spontan verzweifeln. Die verschachtelten, in Absätze, Sätze, Ziffern und Varianten differenzierten Handlungsbeschreibungen, die Konstruktionen mit »und« und »oder«, die Verweisungen und Strafrahmen sind beim bloßen Durchlesen schon von erfahrenen Juristen kaum entwirrbar und für Laien vollkommen unverständlich. Sie sind zwar in deutscher Sprache verfasst, ihr Sinn erschließt sich aber auch dem Gutwilligen und Sprachkundigen nur mühsam.
Die Probe aufs Exempel kann man machen, indem man Juristen mit jahrelanger Leseroutine bittet, den Gesetzestext zu lesen und sodann anzugeben, wie viele unterschiedliche Tatvarianten schwerer Straftaten die Vorschrift eigentlich enthält. Die Antworten, die man hierauf erhält, variieren erfahrungsgemäß zwischen 10 und 50 und sind mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit durchweg falsch. Die Erwartung, die potenziell von den Strafdrohungen Betroffenen, also alle strafmündigen Bürger, könnten die ins Extrem gesteigerte Ansammlung von Schachtelsätzen verstehen, für sich übersetzen und auf dieser Grundlage sämtliche Regeln befolgen, erscheint annähernd absurd. Gleichwohl haben Beschuldigte, die sich auf einen sogenannten Verbotsirrtum (§ 17 StGB) berufen, also behaupten, sie hätten bei der Tatbegehung die Strafbarkeit ihres Handelns nicht gekannt, kaum eine Chance. Die Schuld ist beim Verbotsirrtum nämlich nur ausgeschlossen, wenn dieser »nicht vermeidbar« ist. Und die Rechtsprechung der Strafgerichte ist sich durchweg einig, dass praktisch jeder Irrtum vermeidbar wäre, wenn der Täter sich bei einer rechtsgelehrten Person erkundigt hätte.
Hier treffen sich also zwei ungünstige Bedingungen, einerseits eine Verselbstständigung professioneller Sprachformen, andererseits eine verbreitete Scheu und Abwehr weiter Teile der Bevölkerung gegen »Juristensprache«. Das Letztere liegt nur teilweise an der Sprache selbst. So sind andere Fachterminologien viel schwieriger, werden aber nicht abgelehnt, man denke etwa an die Sprache der Medizin und der Ingenieurwissenschaften, der Kunst oder Psychologie. Deren Benutzung gilt vielfach sogar als Demonstration einer sozial gehobenen Stellung und als erstrebenswerter Nachweis von Allgemeinbildung.
Die verbreitete Abneigung gegen die Juristensprache stammt aus der Sache selbst, um die es geht. Verbindliche, letztlich mit staatlicher Macht und Gewalt durchsetzbare Regeln müssen, um Anforderungen der Verfassung, aber auch der Lebenswirklichkeit zu genügen, meist sehr abstrakt gefasst sein. Die Denkstruktur, die ihnen zugrunde liegt, ist überwiegend deduktiv, das heißt, sie führt vom Allgemeinen ins Spezielle. Es gibt also eine möglichst klare Hierarchie von Ober- und Unterbegriffen und eine möglichst zwingende Systematik der Regelungsebenen. Ein Beispiel: In der Strafvorschrift gegen Diebstahl (§ 242 StGB) heißt es nicht: »Wer einem anderen einen Geldschein wegnimmt«, sondern: »Wer eine fremde bewegliche Sache wegnimmt«. In dieser kurzen Formulierung finden sich gleich vier Begriffe (nämlich »fremd«, »beweglich«, »Sache« und »wegnehmen«), über deren Bedeutung man nachdenken und lange diskutieren kann.
Die Lebenswirklichkeit ist unendlich vielgestaltig und kann sprachlich nicht einfach abgebildet, sondern muss in begrifflichen Abstraktionen beschrieben werden. Die Menschen, die in konkreten Situationen leben und betroffen sind, wollen aber keine Abstraktionen, sondern jeweils hochspezifische konkrete Auskünfte oder Anweisungen. Sie möchten nicht darüber nachdenken, ob ihr Dackel eine Sache ist oder ob »Wegnehmen« auch gegeben ist, wenn heimlich ein 20-Euro-Schein gegen zwei Zehner ausgetauscht wird. Wenn auf solche Fragen dann Juristen antworten, es »komme darauf an«, fühlen sich die meisten Laien in der Annahme bestätigt, dass man mit Menschen, die Jura studiert haben, nicht vernünftig reden kann. Sie vermuten oft, dass Juristen auch in ihrem privaten Lebensbereich ständig so sprechen und denken. Das stimmt ebenso wenig wie die Annahme, Zahnärzte würden beim Abendessen stets über das Kariesrisiko referieren, genauso wenig therapieren Psychologen zum Glück nicht rund um die Uhr ihre soziale Umgebung.
Leser, die strafrechtliche Fälle vor allem aus fiktiven oder medialen Darstellungen kennen, sich aber mit rechtlichen, speziell strafrechtlichen Fragen noch nicht näher befasst haben, müssen daher eine gewisse Schwelle überwinden, um dieses Buch mit Gewinn zu lesen. So gilt es, sowohl die Intuition, also die spontane, gefühlsgestützte Beurteilung, als auch die Sensation, also das emotionale Erlebnis spektakulärer, bedrückender, jedenfalls ganz konkreter Geschehnisse, beiseitezulassen, um zu einer distanzierteren und analytischen Betrachtung der Fälle zu kommen. Zugleich versuche ich, mich so »unjuristisch« und lebensnah auszudrücken, wie es geht, ohne dabei die notwendige begriffliche Schärfe zu vernachlässigen, die die Sache und mein Anliegen erfordern. Es kann also weder auf Fachbegriffe noch auf die Erläuterung systematischer Zusammenhänge verzichtet werden, auf denen die Gesetze und ihre Anwendung beruhen. Wenn man den Unterschied zwischen einem Motor und einem Getriebe, einer Kurbelwelle und einer Starrachse weder kennt noch kennenlernen möchte, könnte man auch ein Buch über die Geschichte der Automobiltechnik nicht sinnvoll lesen. Das Gleiche gilt für das Strafrecht: Wer ihre lebenspraktischen Folgen verstehen und kritisieren will, muss die dahinter liegende juristische Mechanik kennen.
Kapitel 1 Was ist Sexualität?
Moralische Affen oder triebgesteuerte Maschinen: die Trennung von Natur und Kultur
Dass der Mensch eine Sexualität hat, scheint selbstverständlich, jedenfalls zählt diese Feststellung zu den allgemein akzeptierten Grundlagen der Verständigung. Allerdings ist es so einfach nicht. Denn wenn man den Satz formulieren sollte: »Der Schimpanse hat eine Sexualität«, oder gar: »Der Hund hat eine Sexualität«, käme man wohl ins Grübeln darüber, was und wie die Sexualität von Tieren eigentlich beschaffen ist und was sie von der des Menschen unterscheidet. Gemeinhin sprechen wir, wenn es um tierisches Verhalten geht, nicht von Sexualität, sondern über Fortpflanzung. Denn mit dem Begriff Sexualität bezeichnen wir nicht die biologische Fortpflanzung einer Art durch Neukombination von Erbinformationen, sondern in der Regel ein Verhalten zwischen Geschlechtspartnern oder zumindest von Individuen in Bezug hierauf.
Dieses Buch handelt von menschlicher Sexualität, geschlechtlichem Empfinden, Verlangen und Verhalten von Menschen. Es ist nicht auf Fortpflanzung beschränkt und weit überwiegend auch nicht darauf bezogen. Daher ist auch nicht erforderlich, dass sexuelles Verhalten sich zwischen verschiedenen Personen ereignet. Auch Empfinden und Verhalten einzelner Menschen ist sexuell, wenn und soweit es sich auf geschlechtliche Betätigung und Befriedigung geschlechtlicher Bedürfnisse bezieht.
Für dieses Verhalten ist die Fortpflanzungsfähigkeit und -form nur eine allgemeine Grundlage, hat aber keine unmittelbare, zwangsläufige Verbindung zum sexuellen Verhalten, das vielmehr sozialen Zwecken dient. Zugleich setzt sexuelles Verhalten aber keine spezifisch sozialen Emotionen voraus. Der Begriff kann vielmehr unabhängig von einem Bezug auf soziale Bindungen, emotionale Nähe oder Partnerschaft verwendet werden für jede Art von Verhalten, das auf eine an die biologischen Voraussetzungen der Fortpflanzungsfähigkeit (nur) anknüpfende Erlangung von (»sexueller«) Lust gerichtet ist. Sogar das ist aber nicht zwingend erforderlich. Sexualitätsbezogen wird auch ein Verhalten genannt, das einen Lustgewinn nur formal vorspiegelt oder nur mittelbar, gegebenenfalls auch unbewusst anstrebt, oder das sich als sexuell geltender Formen bedient, um andere Motive zu verfolgen. Der erstmals 1820 von dem schlesischen Botaniker August Wilhelm Henschel geprägte Begriff der Sexualität hat sich damit von seiner ursprünglich rein biologischen Bedeutung weit getrennt und führt heute ein überaus vielgestaltiges, schwer eingrenzbares Eigenleben.
Durch diese Trennung wird Sexualität über die Körperfunktion hinaus zu einem Mittel der Selbstreflexion und Individualisierung und damit Teil einer spezifisch menschlichen sozialen Struktur. Dabei stehen Instinkt (»Trieb«), Fortpflanzung, Partnerwahl, Emotionalität und soziale Ordnung nicht unverbunden funktional nebeneinander, sondern untereinander in engster, vielfach auch unreflektierter und unbewusster Weise in Zusammenhang. Beeindruckende Beispiele finden sich an vielen Stellen, etwa bei empirischen Untersuchungen des Partnerwahlverhaltens, bei dem scheinbar hochindividuelle, kulturell stark formbare und wandelbare Merkmale der körperlichen Attraktivität, des Alters sowie des sozialen Rangs eine konstant signifikante und mit hoher Sicherheit vorhersehbare Rolle spielen. Abweichungen ergeben sich insoweit vor allem auf der Ebene der Erwünschtheit, auch von sogenannten Traumvorstellungen angeblich angestrebter Partner. In projektiven Tests und in der statistischen Breite setzen sich zuverlässig Standardvorstellungen durch.
Die Entkopplung von Fortpflanzung und sexuellem Verhalten im Sinne einer sozialen Funktion ist nicht Menschen vorbehalten. Das bekannteste nichtmenschliche Beispiel ist die Menschenaffenart Bonobo. Hier spielt geschlechtliche Zuwendung eine wichtige Rolle als Mittel sozialer Konfliktvermeidung und -regulierung und hat sich insoweit von den daneben existierenden Abläufen und Regelungen der Reproduktion getrennt. Bonobo-Gruppen sind matriarchal strukturiert, die Weibchen wechseln vor der Geschlechtsreife die Gruppe, während die Männchen lebenslang in der Geburtsgruppe bleiben und starke Bindungen an die dominante Mutter haben. Aber auch bei anderen Tierarten lässt sich eine von bloßer Fortpflanzung getrennte, auf Bindung und Sozialverhalten orientierte Funktion geschlechtlichen Verhaltens in vielerlei Entwicklungs- und Übergangsstufen beobachten. Die Vorstellung, es gebe eine strikte, kategorische Trennung zwischen menschlichem und nichtmenschlichem Geschlechtsleben und Sexualverhalten, ist daher unzutreffend. Das entspricht den Erkenntnissen zur evolutionären Entwicklung von Empathie, sozialer Bindung und allgemein zum instinktunabhängigen Verhalten und ist als solches nicht verwunderlich. Schließlich sind Menschen als spezielle Säugetiere entstanden, nicht als qualitativ-kategorialer Gegenentwurf zur Natur. Um ein Bild des Primatenforschers Frans de Waal zu zitieren: Der Mensch teilt die Welt ein in Pflanzen, Tiere und Menschen. Ein Schimpanse würde zwischen Pflanzen, Tieren und Schimpansen unterscheiden.
Daher wirken in allen menschlichen Gesellschaften die Anknüpfungen an die Fortpflanzung und damit evolutionäre Funktionen der Arterhaltung und die in langen Zeiträumen entwickelten und ausdifferenzierten Verbindungen zwischen biologisch-evolutionären Notwendigkeiten, allgemeinen intellektuellen Voraussetzungen und sozialen Bezügen in vielfältiger Weise fort und bestimmen das gesellschaftliche und individuelle Leben in hohem Maß.
Damit sind nicht spezifische Formen der Organisation von Geschlechtlichkeit gemeint, denn diese sind von vielerlei Umständen abhängig, wandelbar und aufgrund der Entstehung freier Entscheidungsabhängigkeit stark differenziert. Diese Differenzierung entwickelt sich nicht naturwüchsig und ist keine bloße Funktion sexueller Natur. Erst recht nicht ist sie entkoppelt von den wirtschaftlichen und politischen Bedingungen der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion. Die sexuelle Differenzierung ist aber auch nicht frei im Sinn einer vollständig bewussten, reflektierten Emanzipation intellektuell, emotional und moralisch gesteuerter Entscheidungsprozesse von der triebhaft-tierischen Natur. Die Vorstellung, das menschliche Empfinden und Verhalten stelle sich wie eine Art Schichtentorte dar, in der sich analog zur naturgeschichtlichen Entwicklung des zentralen Nervensystems über den »wilden«, vor- und unbewussten Schichten des Triebs die reflektierten Schichten moralischer Verfeinerung und kultureller Sublimierung türmen, wird der Komplexität der Verhältnisse nicht gerecht. Dennoch findet es sich bis heute so oder ähnlich in allerlei Persönlichkeitsvorstellungen wieder, die zumeist auf Sigmund Freuds Entdeckungen über das Unbewusste zurückgehen und an das ursprünglich von ihm vertretene Schichtenmodell anknüpfen. Die analytische Psychologie befasst sich bis heute, in mal mehr, mal weniger plausiblen Theorien und Analogien, mit der Aufdeckung, Reflexion und Rekonstruktion sexualitätsbezogener Verbindungen von Natur und Sozialverhalten.
Die hier zugrunde liegende Vorstellung, der Mensch trage in sich eine natürliche Palette von sogenannten Trieben, die sozusagen die animalische Grundlage der zivilisatorischen Kultur in Form von Moral, Ethik und Normen sowie deren Sanktionierung bilden, ist eine schematisierende Verzerrung. Seine Wurzeln hat dieses Denken in anthropologischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts, die den Menschen als eine Maschine konzipierten, in der soziale und individuelle Erscheinungen als strikt voneinander getrennte Funktionalitäten zusammenwirken. Nicht von ungefähr finden sich in der soziologischen und psychologischen Literatur bis nach dem Ersten Weltkrieg zahllose Metaphern von Motoren, Dampfkesseln oder Transmissionsriemen und von diesen in determinierte Bewegungen versetzten funktionalen Werkzeugen. Tatsächlich gibt es, wie wir heute wissen, keine natürlichen, nicht sozial geprägten und durch Erinnerung, Normativität, Empathie und Ich-Empfinden geformten Triebe. Dass der individuelle Mensch zum Überleben Wasser trinken oder schlafen muss, folgt nicht denselben Regeln wie das Bedürfnis nach Lust, Zärtlichkeit oder emotionaler Verbundenheit, noch weniger gilt dies für die sozialen Strukturierungen der Fortpflanzung. Auch Scham geht der Sozialität nicht voran, sondern ist ihr unterworfen. Das gilt auch dann, wenn die Robinson Crusoes der Weltliteratur allenthalben sich verhüllen, sei es aus Scham vor sich selbst oder vor fiktiven Zuschauern, die sie selbst in der menschenleeren Weite noch spüren. Denn sie sind ja, wie es Defoe beispielhaft zeigt, gerade nicht »zurückgekehrt in die Natur«.
Man kann also davon ausgehen, dass es neben oder im körperlichen Menschen samt seiner komplexen Funktionszusammenhänge nicht noch ein körperloses Etwas namens Seele gibt, das den Menschen anders als allen anderen Lebewesen eigen ist und ihr Wesen bestimmt. Bewusstsein und Reflexionsfähigkeit sind nicht Eigenschaften, die einem Naturwesen Mensch von außen hinzugefügt wurden und dadurch seinen Austritt aus der als Paradies gedachten Natur bewirkten. Sie sind vielmehr selbst Entwicklungsformen von Natur.
Sexualität und Sexualitätsempfinden ist somit stets auch Natur. Sie sind aber zugleich stets und von Anfang an auch spezifisch menschlich, das heißt sozial funktional, mit Zwecken und Gefühlen verbunden, reflektiert und normativiert. Eine freie Sexualität im Sinne einer im Wortsinn natürlichen, moralfreien, vorbewussten Spontanverbindung von Alltagsleben, sozialer Reproduktion, Sicherheit und Struktur und sexuellem Verhalten gibt es nicht und gab es nie – gewiss nicht in den im 17. bis 19. Jahrhundert als sogenannte Naturvölker romantisierten außereuropäischen Gesellschaften. Denn spätestens sobald in einer sozialen Gemeinschaft die Zuordnung von Kindern entweder über ihre Mütter (matrilinear) oder über ihre Väter (patrilinear) stattfindet und wichtig wird – beispielsweise für die Trennung von Familienclans zur Umsetzung exogamer Heiratsregeln und Installierung eines Inzest-Tabus –, muss der Sexualverkehr normativiert und Regeln unterworfen werden. Diese finden ihre Grundlagen zwangsläufig in zumeist religiös verstetigten Moralvorstellungen, ohne dass dem irgendeine überzeitlich-qualitative Bedeutung zukommt.
Es geht also nicht um richtige oder gute Moral, sondern um ihr Vorhandensein an sich. Die angeblich natürlichen und freien Gesellschaften, auf die die europäischen kolonialen Eroberer der vergangenen Jahrhunderte seit dem 15. Jahrhundert von Amerika bis Polynesien stießen, waren nicht natürlicher, sondern anders. Überdies aber waren die Kolonisierten in der Regel machtlos, sodass sie ihre Normen gegen die fremden Eindringlinge auf Dauer nicht aufrechterhalten und durchsetzen konnten.
Für die Zwecke dieses Buchs folgt aus dem Dargelegten die genauso fundamentale wie oft übersehene Feststellung, dass man die Sozialgeschichte und speziell die Geschichte der Normativierung von Fortpflanzung und Sexualität, das heißt die Frage nach dem historischen Grenzverlauf zwischen erwünschtem, erlaubtem, verachtetem und verbotenem sexuellen Verhalten, nicht nach Maßgabe von Moral darstellen oder bewerten kann. Vielmehr ist die jeweilige Moral ihrerseits wichtiger Gegenstand der Differenzierung und des Verständnisses.
Vereinfacht gesagt, es ist für eine im weitesten Sinne sozialhistorische Betrachtung des Sexualstrafrechts ohne Erkenntniswert, bäuerliche Familienstrukturen oder adelige Heiratsregeln vergangener Jahrhunderte nach dem Gesichtspunkt zu untersuchen und zu beurteilen, ob sie heute moralisch richtig und funktional erscheinen.
Sexualität als gesellschaftliche Form
Sexualität ist in Inhalt und Form individuell strukturiert und zugleich in hohem Maß sozial geprägt. Analog zu den Kategorien Natur und Kultur stehen auch diese Eigenschaften nicht einfach nebeneinander. Die Bedeutungen sind aufeinander bezogen und bedingt, sie befinden sich in einem Wechselverhältnis gegenseitiger Abhängigkeit und Beeinflussung. In zusammenfassender Form, wie sie für die Zwecke des Buchs hoffentlich ausreichend ist, sind im Folgenden insbesondere der kommunikative und der ordnungspolitische Aspekt dieses Verhältnisses zu nennen.
Über Intimität sprechen: Sexualität und Kommunikation
Menschliche Sexualität ist Gegenstand reflektierter Erwägungen und bewusster Entscheidungen. Sexuelles Verhalten ist nicht Reflex oder Exekution von Trieben. Das ist unabhängig davon, ob dem Trieb-Begriff überhaupt ein sinnvolles Konzept zugrunde liegt, nimmt er doch psychische Gegebenheiten vor allem als Eigenschaften und Wirkungskräfte einzelner Menschen wahr und vernachlässigt die Dimension der Kommunikation als Existenzbedingung menschlichen Lebens. Der Mensch war zu keiner Zeit ein Einzelwesen, wie es die sogenannten Vertragstheorien der Aufklärung konstruierten, sondern hat von Anfang an immer nur als gesellschaftliches Wesen gelebt. Das Alleinsein als existenzielle Erfahrung ist Funktion und Form eines Ich-Bewusstseins, das sich nur als Spiegelung von Empathie und Du-Bewusstsein entwickeln kann. Das bedeutet, die seit jeher als Fremdheit erlebte, Angst erzeugende Individualisierung ist eine direkte Folge sozial gesteuerter Evolution, und umgekehrt ist die soziale Kommunikation über die Integration von Interessen und Bedürfnissen eine unvermeidliche Folge der Individualisierung des Bewusstseins.
Tatsächlich gibt es keine von der Sozialität abzugrenzende psychische Eigenschaften des Menschen, wenn man von einigen biologisch-evolutionären Grundvoraussetzungen absieht. Die stammesgeschichtliche Entwicklung der Sprache als einer Verbindung von Zeichen mit Bedeutung ist offenkundig eine auf die soziale Natur des menschlichen Lebens ausgerichtete evolutionäre Errungenschaft, die von einer überragenden Bedeutung für die Integration psychischer Gegebenheiten ist und diese umgekehrt formt. Die Möglichkeit, Fortpflanzung zum Gegenstand bewusster Reflexion, Absprache und symbolischer Regelung zu machen, wird ergänzt durch die Abgrenzung zwischen dem Verhalten, das sich auf den biologischen Vorgang der Fortpflanzung bezieht, und dem sexuellen, das heißt auf soziale Aspekte geschlechtlichen Verhaltens bezogenen Handeln.
Diese Form der Kommunikation äußert sich zum Beispiel darin, dass sexuelles Begehren und emotionale Anziehung in symbolisierter Form dargestellt, in Begriffen abstrahiert und zu Gegenständen wie Kriterien sozialer Integration gemacht werden können. Gesichtspunkte und Emotionen wie Liebe werden in einem idealen Gesamtkonzept zusammengefasst sowie stark und dauerhaft an soziale Verhältnisse und deren symbolische Formen angepasst. Das hat vielerlei Vorzüge, weil es die Gemeinschaften dauerhaft stabilisiert und durch Regeln der Moral und der Ethik ordnet und symbolisch strukturiert. Eine solche Beschränkung der Sichtweise muss sich andererseits beim Verständnis sexuellen Verhaltens verzerrend auswirken, weil die symbolischen Formen häufig nicht nur die materiellen Grundlagen überlagern, sondern auch die Reflexion ersetzen – genau das ist ihre ordnungspolitische Funktion: Wer überzeugt davon ist, dass eine bestimmte Form der Partnerwahl moralisch »gut« und gottgewollt ist, muss nicht lange über Ursprung und Funktion dieser Regel sowie über mögliche Alternativen nachdenken.
Das fällt uns in der Regel vor allem dann auf, wenn wir auf Fremdes, vorgeblich Zurückgebliebenes, Überholtes, Überwundenes blicken. Die Faszination, mit welcher seit der europäischen Expansion die sogenannte zivilisierte Welt auf die sogenannten Naturvölker, die »Wilden« und angeblich Ursprünglichen blickt, ist ein Beispiel hierfür, das bildungsbürgerliche Interesse an Ethnologie und die bis heute andauernde Faszination, die etwa Dokumentationen über Partnerwahl, Initiations- oder Hochzeitsriten bei den »Naturvölkern in den letzten Urwäldern« der Welt bei zahllosen Menschen in den Metropolen auslösen, ein anderes. Erstaunlicherweise sind viele Menschen geneigt, in der Fremdartigkeit einer solchen quasi konservierten Vergangenheit eine Form reinerer Natur zu sehen und eine Erinnerung an vorhistorische Zustände unwillkürlichen Sexualverhaltens wahrzunehmen. Dabei wird wie erwähnt oft übersehen, dass die Regeln und Verhaltenskodizes, welche die eigene Zeit, Gesellschaft oder soziale Schicht prägen, ihrerseits weder voraussetzungslos noch durchweg rational oder stets funktional sind.
In vielerlei Hinsicht geraten die langlebigen, tief mit Moralvorstellungen und Persönlichkeitsbildern verwobenen Sitten und Gebräuche, Einstellungen und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit sexuellem Verhalten in konflikthaften Widerspruch zu rascher wechselnden Strukturen des Soziallebens, etwa sozialer und räumlicher Mobilität. Ein Beispiel hierfür sind etwa die dramatischen Veränderungen, die sich durch die außerordentlich rasche Industrialisierung Chinas in den letzten Jahrzehnten und die Zusammenballung vieler Millionen von ehemals auf dem Land lebenden jungen Menschen als Arbeiter in den Fabriken der Megacitys ergeben haben. Dadurch ist eine bei der ehemals bäuerlich geprägten Landbevölkerung noch in Traditionen und Moralvorstellungen stark verankerte Kultur des vorehelichen Lebens in den Familien, der Partnerwahl und Verheiratung binnen weniger Jahrzehnte komplett zerschlagen und verändert worden. Das chinesische Hukou-Verwaltungssystem registrierter Wohnsitze führt dazu, dass derzeit fast 300 Millionen sogenannte Wanderarbeiter außerhalb ihrer Heimatregionen arbeiten und dort oft langfristig ohne Partner auf engstem Raum in Wohnheimen leben. Eine spontane Partnerwahl sowie ein selbstbestimmtes Sexualleben sind ihnen nur sehr eingeschränkt möglich. Hinzu kommt hier eine für westeuropäische Verhältnisse schwer nachvollziehbare staatlich-öffentliche Kontrolle und Organisation des individuellen Verhaltens bis weit in den Privatbereich hinein, einschließlich rigide vertretener Regeln zur Familienplanung. Eine Heirat gilt als sozial üblich und wünschenswert, sie wird von 90 Prozent der Bevölkerung vor dem 30. Lebensjahr angestrebt. Andererseits ist der allgemeine Umgang mit sexuellem Verhalten relativ liberal, da religiöse Traditionen wenig Gewicht haben. Im Jahr 1992 wurde geschätzt, dass noch etwa 4,3 Prozent der Ehen in ländlichen Regionen Chinas von den Eltern arrangiert wurden1; inzwischen dürfte sich die Zahl weiter reduziert haben.
Vergleichbare soziale Umbrüche mit weitreichenden Auswirkungen auf Sexualverhalten und Partnerwahl hat es in Mitteleuropa seit Beginn der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts gegeben. Auch sie war geprägt von einem Wegzug großer Teile der armen ländlichen Bevölkerung in die Städte, die die Entstehung einer städtischen proletarischen Lebenskultur sowie einer mittellosen »Reservearmee« verelendeter subproletarischer Schichten zur Folge hatten. Damit zerbrachen relativ schnell auch die traditionellen Vorstellungen und informellen Regeln geschlechtlichen Verhaltens, denn die herkömmlichen Familienstrukturen verloren unter den Bedingungen der Fabrikarbeit von Frauen und Kindern einen erheblichen Teil ihrer wirtschaftlich und moralisch sichernden Funktion.
Die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen der »digitalen Revolution« und der sogenannten Globalisierung haben ebenso weitreichende Folgen, die schon jetzt sichtbar sind. Sie zeigen sich namentlich auch in der Individualisierung der Biografien und Lebenskonzepte und einer Orientierung auf personale Authentizität der sogenannten sexuellen Identität. Wir kommen darauf im abschließenden fünften Kapitel zurück.
Kontrolle und Sanktion: die Ordnung und Unordnung von Sexualität
Wenn man im Jahr 1900 in einem Bauerndorf irgendwo in Deutschland lebte, war man Teil einer Kultur mit – für heutige Verhältnisse – außerordentlich engen und festgefügten Regeln für jede Art sexualbezogenen Verhaltens. Das begann damit, dass es entscheidend darauf ankam, welcher gesellschaftlichen Schicht oder Klasse man angehörte: den Land besitzenden Bauern, diese wiederum unterschieden in höhergestellte Gutsbesitzer und Kleinbauern am Existenzminimum, der Klasse der land- und besitzlosen Knechte und Mägde und der Wanderarbeiter oder der schmalen Schicht der Obrigkeit, also dem Verwaltungs- und Polizeiapparat, der Kirche und der sozialen Berufe, etwa Ärzte oder Lehrer. Sexualität war nicht nur in der öffentlichen und privaten Kommunikation ein Tabu, sondern auch in ihren Formalisierungen und Symbolen strikt und mit äußerster Rigidität geregelt. Das bedeutete vor allem, dass sexuelles Verhalten außerhalb der Ehe streng verboten und gesellschaftlich geächtet war, soweit es nicht in verschwiegenen Handlungen privilegierter Kreise bestand, also etwa Bordellbesuchen wohlhabender Männer in der Stadt.
Die Ehe- und Sexualverfassung war strikt auf die ökonomischen Bedürfnisse der bäuerlichen Gesellschaft ausgerichtet. So wurden Heiraten weithin arrangiert und fanden ihre Bedeutung eher zwischen Familien als zwischen individuellen Menschen, denn es ging um Weitergabe von Höfen, Landbesitz und Erbschaften. Eine romantische Liebe war bestenfalls erwünscht, galt aber keineswegs als Voraussetzung erfolgreicher Ehen. Namentlich den Frauen widerfuhr sie nicht durch selbstbestimmte Partnerwahl, sondern durch glücklichen Zufall. Kennenlernen und Auswahl von Partnern waren streng reglementiert und fanden unter den Augen und unter Kontrolle der Öffentlichkeit statt. Potenzielle Partner waren nur in sehr begrenzter Anzahl überhaupt vorhanden und die Möglichkeiten eines tatsächlichen Kennenlernens extrem eingeschränkt, meist beschränkten sie sich auf distanziert-ritualisierte Gelegenheiten anlässlich dörflicher Feiertage. Verboten und geächtet war jede voreheliche Sexualität, namentlich von Mädchen und Frauen, mit Kriminalstrafe bedroht war der Ehebruch. Eine Scheidung war vonseiten der Frauen praktisch unmöglich, und verwitwete Frauen mussten lange, sozial streng überwachte Wartezeiten einhalten, bevor sie neue Partner wählen konnten. Ob sie diese fanden, hing weitgehend davon ab, ob sie Land besaßen oder als Bäuerin und damit als Arbeitskraft von einem Witwer gefreit wurden.
Die bäuerlichen Familien waren strikt patriarchalisch strukturiert. Selbstbestimmte Entscheidungen über Sexualität und Fortpflanzung waren Frauen fast unmöglich, während das männliche Verhalten in hohem Maß außengeleitet war durch religiöse, soziale und moralische Regeln und Überwachung. Eine Sexualerziehung oder -aufklärung fand nicht statt, und so waren auch Verhütung und Familienplanung tabuisiert. Das galt erst recht für Abtreibungen. Uneheliche Mutterschaft führte fast zwingend zur sozialen Ausgrenzung, die gegebenenfalls auf die ganze Familie der betroffenen Frau ausgedehnt war. Ledige Mütter, die »in Schande« lebten, hatten daher vielfach nur die Wahl zwischen einem Leben am sozialen Rand der Dorfgemeinschaft oder einem Wegziehen in die großen Städte, wo unter Umständen eine Existenz als Hausmädchen oder Fabrikarbeiterin möglich war; ansonsten blieb vielfach nur Prostitution.
Angehörige der landlosen Schichten hatten kaum Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs innerhalb der bäuerlichen Gemeinschaften. Mägde wurden von männlichen Familienangehörigen vielfach auch zu sexuellen Verhältnissen gebracht oder gezwungen. Ein Aufstieg zur Bäuerin durch Heirat aber war eine seltene Ausnahme, der auch langfristig der Ruch der Illegitimität anhaftete und daher auch für den Bauern ein hohes soziales Risiko darstellte. Uneheliche Kinder entsprangen oft stabilen Konkubinaten und wurden sozial diskriminiert. Knechte und Mägde blieben oft lebenslang partnerlos.
Die äußerste Enge dieser Verhältnisse, die in diesen Hinweisen nur angedeutet sind, ist den Menschen des 21. Jahrhunderts noch aus Romanen und sogenannten Heimatfilmen bekannt, wobei hier die Zahl der romantisierenden Verzerrungen weit überwiegt.
Das Beispiel bäuerlich-dörflicher Kultur am Anfang des 20. Jahrhunderts ist deshalb gewählt, weil es noch vergleichsweise nahe an der Aktualität liegt und Elemente enthält, die bis heute in veränderter und verkitschter Form fortwirken. Das hat auch zur Folge, dass die kulturelle Distanz noch deutlich als Ausdruck individuellen Lebens wahrgenommen wird, wohl kaum jemand möchte heute unter den geschilderten Verhältnissen leben. Diese werden vielmehr als bedrückend, eng und überlebt angesehen und abgelehnt. Erstaunlich erscheint es daher, dass dies bei noch weiter zurückliegenden oder noch fremderen Verhältnissen oft nicht mehr der Fall ist und diese vielmehr geradezu als natürlich oder naturnah angesehen und damit als Ausdruck erstrebenswerter Ursprünglichkeit betrachtet werden. Dem liegt zumeist schlichte Unkenntnis zugrunde, denn in der Regel ist davon auszugehen, dass gerade in sogenannten primitiven Gesellschaften das Maß unmittelbarer sozialer Kontrolle besonders hoch und die Räume individueller Entscheidungen über Partnerwahl und sexuelles Verhalten außerordentlich eng waren oder sind.
Selbstverständlich gibt es insoweit Ausnahmen, die in der bürgerlichen Gesellschaft der Neuzeit als paradiesisch konstruiert wurden, ein Beispiel etwa ist Polynesien. Aber auch im angeblichen Naturparadies zeigt sich die enge Bindung der Sexualverfassung an die wirtschaftlichen und politischen Grundstrukturen der Gesellschaft, auch dort ist sexuelles Verhalten reguliert, auch dort sind Partnerwahl und Ehe, Fortpflanzung und Familienplanung sowie sexuelle Freiräume hochgradig reglementiert, ritualisiert und symbolisch materialisiert. Trotzdem wird diese Wirklichkeit als eine individualisierte und bewusst gestaltete wahrgenommen, weil sie scheinbar an der jeweiligen Persönlichkeit, individuellen Moral und unmittelbaren Beziehungserfahrung orientiert ist. Somit wird sie zum projizierten Ausweg aus der eigenen konflikthaften Erfahrung im Austausch mit einer öffentlichen, allgemeinen Anforderungsstruktur.
Die europäische Sexualkultur ist entscheidend durch den Einfluss der christlichen Religion geprägt worden. Die Entwicklungen der bürgerlich-kapitalistischen, auf formale Gleichheit ausgerichteten Konkurrenzgesellschaft hat ihre Fortentwicklung in den letzten 250 Jahren bestimmt und überkommene Strukturen in steter Beschleunigung entwertet, aufgelöst, verändert und durch neue Formen und Ideen ersetzt. Dieser Prozess wird in den Jahrzehnten ab etwa 1960 als besonders schnell, teilweise chaotisch empfunden und hat zu neuen Fragestellungen und Problemen geführt, die durch Ungleichzeitigkeiten bestimmt sind. Hierauf kommen wir in den folgenden Kapiteln noch zurück.
Sexualität als gesellschaftliche Wirklichkeit
Werte im Wandel: Familien und Sexualmoral
Sexualmoral ist Familienmoral, auch wenn es konkret gar nicht um Familie im heute geläufigen Sinn geht. Denn weil (und solange) Fortpflanzung sich in zweigeschlechtlicher Form vollzieht, bezieht sich auch die geschlechtliche Betätigung auf die Möglichkeit der Fortpflanzung und die hierdurch begründeten zahlreichen Erfordernisse des Soziallebens. Das gilt in abstrahiert-negativer Bedeutung auch für gleichgeschlechtliche Sexualität, obgleich hier zumindest vorläufig eine Fortpflanzungsfunktion entfällt. Bezeichnend ist aber insoweit, dass sowohl normativ, namentlich im Adoptions-, Familien- und Erbrecht, als auch medizinisch-naturwissenschaftlich, und zwar in Bezug auf die Klonierung, jeweils ein enger Bezug zur sozialen Form der Familie hergestellt wird.
Ob es auf einer frühen Stufe menschlicher Sozialentwicklung Gemeinschaften gab, in denen die Zuordnung der Kinder vollkommen gleichgültig war, weil einerseits polygame Sexualbeziehungen vorherrschten und andererseits die Vaterschaft unsicher war, sei dahingestellt. Näher liegt es für matrilinear organisierte Gemeinschaften, in denen die Kinder aller Frauen sozusagen gemeinsame Kinder aller Männer sein können.
Eifersucht ist in diesem Zusammenhang kein Phänomen, das mit bestimmten Sozialstrukturen in die Welt gekommen ist. Als Vermischung von Machtanspruch über Sexualpartner und Konkurrenten einerseits mit emotionaler Furcht und Traurigkeit andererseits ist sie wohl ubiquitär und muss in allen menschlichen Gemeinschaften bewältigt, das heißt individuell und sozial verarbeitet und kompensiert werden. Das ist schon deshalb wichtig, weil sie ein außerordentlich machtvoller Impuls für Konflikt und Gewalt ist, der zu lang anhaltenden, für die Gemeinschaft zerstörerischen Fehden führen kann.
Spätestens wenn Ressourcen des Lebens, insbesondere Boden und Vorräte, zum Eigentum Einzelner werden, der erste Bauer also, bildlich gesprochen, den Zaun um sein Stück Land zieht und sagt: »Was hier wächst, ist meins!«, dann kommt auch die Frage des Erbrechts ins Spiel. Von da an geht es bei Sexualität immer auch um Anteile an der Welt, an Ressourcen, Chancen und Macht. Hieran hat sich bis heute nichts Grundlegendes geändert. Abstammungs- und Verwandtschaftsbeziehungen müssen geklärt sein, Nachfolge- und Erbenstellungen wollen bestimmt sowie Nähebeziehungen definiert werden. Weil Familien als mehr oder minder große Abstammungsgemeinschaften auch wirtschaftliche Einheiten sind oder sein sollen, können sexuelle Beziehungen innerhalb der Familien und von Mitgliedern der Familien nach außen in der Regel nicht ohne Bedeutung sein. Die durch sexuelle Beziehungen berührten vielfältigen emotionalen, wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen führen überdies dazu, dass sexuelles Verhalten nicht ohne Rücksicht auf die Familie möglich ist und nur in engen Grenzen toleriert wird.
Das betrifft zum einen die Partnerwahl mit Bezug auf die Familie, zum anderen sexuelle Kontakte und sexuelles Verhalten außerhalb oder am Rand dieser Gemeinschaft. Es ist offenkundig, dass etwa außereheliche Sexualkontakte regelmäßig ein hohes Risiko für den Bestand langfristiger familiärer Partnerschaften darstellen. Sie werden daher meist verheimlicht und sind auch in der allgemeinen gesellschaftlichen Kommunikation mit verschiedenen Tabus verbunden. Die Ausprägung dieser Tabus ist in hohem Maß abhängig von zeitlichen Umständen, verstanden als das herrschende soziale Klima, sowie von wirtschaftlichen, geschlechtsspezifischen und allgemein politischen Umständen. Fremdgehen, also außerpartnerschaftliche sexuelle Kontakte, gilt weithin als sozial abweichend, wird negativ bewertet und führt überwiegend zur sozialen Abwertung. Das gilt fast übereinstimmend in allen modernen Gesellschaften.
Ausnahmen sind vertraut im Zusammenhang mit der privilegierten Stellung von wirtschaftlich und politisch mächtigen Personen. In vorbürgerlichen Zeiten war eine Mätressen- und Liebhaberwirtschaft vor dem Hintergrund der standes- und klassenspezifischen Heiratsregeln und Familienstrukturen eher geläufig, da es hier nicht selten an jeglicher emotionaler Nähe innerhalb der formalen Familie fehlte und weder die Ehepartner zueinander noch die Abkömmlinge zu ihren Eltern nahe persönliche Beziehungen pflegten. Soweit in der bürgerlichen Welt der Individualität Beziehungsstrukturen ähnlicher Art gelebt und toleriert werden, beschränkt sich dies auf Minderheiten, die entweder durch exponierte wirtschaftliche oder exzentrische soziale Rollen gekennzeichnet sind. Sogenannte offene sexuelle Beziehungen, also etwa langfristige Partnerschaften mit der Freiheit zu äußeren sexuellen Kontakten, werden gelegentlich propagiert, sind aber weit entfernt davon, in der Mehrheitsgesellschaft toleriert und praktiziert zu werden. Allenfalls lässt sich in manchen Bereichen der Gesellschaft eine gewisse Toleranz gegenüber sogenannten Seitensprüngen feststellen, die als moralisch vertretbare Zugeständnisse an Bedürfnisse der Freiheit und der angeblichen sexuellen Natur angesehen werden. Dies gilt insbesondere für Männer, aber zumindest in Deutschland führen Seitensprünge anders als bis noch zum Zweiten Weltkrieg auch bei Frauen mittlerweile nicht mehr fast zwingend zur Auflösung der Ehe und zur sozialen Ächtung.
Die Sexualverfassung innerhalb von Familien wird auch durch öffentliche Regeln und durch Recht geformt und durchgesetzt, wichtig sind hier – neben dem Strafrecht – insbesondere das Familien-, Heirats-, Kindschafts- und Erbrecht. Die wichtigste praktische Quelle der Verhaltenssteuerung im Alltag ist jedoch die Moral. Sie formuliert normative Verhaltensregeln auf individueller Ebene und erscheint dem Einzelnen daher lebensweltlich weniger als eine von außen kommende Vorschrift als ein inneres Gebot, eine Frage von gut und schlecht. Moral wird überwiegend informell durchgesetzt und steuert individuelles Verhalten hocheffektiv. Sie überdauert positiv-formelle Regelungen unter Umständen langfristig, sodass sich etwa politisch verordnete rechtliche Modernisierungen gegen traditionell geprägte, ethnisch differenzierte Verhaltensnormen der Sexual- und Familienverfassung nicht dauerhaft durchsetzen lassen.
Ein gutes Beispiel für die Bedeutung moralischer Normen ist die Einführung der Antibabypille in den 1960er-Jahren. Die Verfügbarkeit eines wirksamen medikamentösen Kontrazeptivums mit den damit verbundenen erheblichen Ausweitungen der Freiheitssphäre von Frauen aufgrund des drastisch verringerten Risikos unerwünschter Schwangerschaften und der Möglichkeit funktionierender Planung von Fortpflanzung und Sexualverhalten führte einerseits zu rechtlichen Fragen und Problemen. Viel wichtiger war aber andererseits jene moralisch-normative, die ganze Gesellschaft erfassende Diskussion, die sich fast ohne Rücksicht auf formelle Regeln vollzog. Diese Diskussion führte unter anderem dazu, dass die christlichen Kirchen, und hier insbesondere die katholische, aufgrund ihres starren Festhaltens an überkommenen, zunehmend als dysfunktional und willkürlich angesehenen Regeln in großem Umfang Einfluss auf das reale Verhalten ihrer Mitglieder und schließlich der Gesellschaft im Ganzen verlor.
Es wurde damals unter Jugendlichen und Erwachsenen mit großem Engagement diskutiert, ob »die Pille« zu nehmen moralisch legitim und sozialpolitisch vertretbar sei. Die Mehrzahl der jungen Menschen bejahte diese Frage, große Teile der Gesellschaft aber lehnten ihre Anwendung ab. Diese Position wurde unabhängig von religiösen Überzeugungen mit Argumenten der Sexualmoral, der »sexuellen Gesundheit«, der sozialen Bedeutung der Familie und der angeblich natürlich determinierten Verteilung von Macht und Ohnmacht in Form tradierter sozialer Rollenbilder begründet. Man muss sich bei der rückschauenden Betrachtung klarmachen, dass dies zu einer Zeit geschah, als zum Beispiel auch die Frage, ob Frauen auf der Straße rauchen dürften, eine als für die soziale Reputation bedeutende angesehen wurde und in der bürgerlichen Mittelschicht eine Berufstätigkeit von verheirateten Frauen als moralisch zweifelhaft galt. Parallel entspannten sich in ihrer Leidenschaftlichkeit heute kaum noch vorstellbare Diskussionen über die Fragen, ob das Tragen von Miniröcken ein Beweis für sexuell-moralische Verkommenheit sei, ob das Austauschen von Küssen in der Öffentlichkeit gestattet oder polizeilich verfolgt werden solle und ob der sogenannte Sex vor der Ehe toleriert werden könne.
Das Aufbrechen solcher Diskussionen ist nicht, wie von konservativen Kreisen zumeist reflexhaft unterstellt, Ursache, sondern Auswirkung und Zeichen bereits bestehender tiefgreifender gesellschaftlicher Reibungen und Konflikte. Die Moral der Sexualverfassung und der Familienverfassung folgt nicht allgemeinen theoretischen Modellen oder zeitlosen Einsichten, sondern kann regelmäßig als mehr oder minder funktional angepasste Form der individuellen Innenleitung an die Erfordernisse der äußeren, insbesondere wirtschaftlichen Struktur verstanden werden. Mit anderen Worten, eine sich nach dem Zweiten Weltkrieg globalisierende Welt der Individualisierung von Leistung und Konsum, eine von der Ökonomisierung des Sozialen geprägte Welt war und ist auf Dauer nicht mehr mit einer Sexualverfassung vereinbar, die auf der modernisierungsfeindlichen Ideologie einer familiären Gemeinschaft mit einer unselbstständigen Position der Frauen gründete. Vergleichbar ist dieser sexualmoralische Wertewandel, der einerseits von den Trägern der neuen Moral induziert wird, andererseits aber ganz neue Anforderungen an sie heranträgt, mit dem Übergang von der agrarischen zur industriellen Gesellschaft: Arbeiter, die keine individuelle, unersetzbare Leistung mehr erbringen, sondern nur gleichartige Arbeitskraft in automatisierte Prozesse einbringen, können nicht mehr in den einstigen Abhängigkeitsverhältnissen der bäuerlichen Wirtschafts- und Lebensgemeinschaften samt ihrer Großfamilien gehalten werden. Sie individualisieren sich als Personen und werden zugleich Teile einer neuen sozialen Klasse von Menschen in gleicher Lage – und damit mit einer eigenen, neuen Moral, einer neuen Rollenverteilung in den Familien und grundlegend veränderten Aufgabenzuweisungen.
Neben der Funktion und Bewertung monogamer Sexualbeziehungen ist innerhalb der Familienstrukturen die Frage des Inzests von zentraler Bedeutung. Diese ist in hohem Maß moralisch-normativ aufgeladen. Das verwundert insofern etwas, als von kulturübergreifendem Inzestverbot kaum die Rede sein kann. Die Regeln, nach denen sich bestimmt, was überhaupt als Inzest – früher als »Blutschande« bezeichnet – angesehen wird, sind sehr unterschiedlich. In Deutschland ist strafrechtlich nur der vaginale Geschlechtsverkehr unter in gerader Linie Verwandten verboten (§ 173 StGB), wobei Personen unter 18 Jahren straffrei bleiben. In anderen Rechtsordnungen bestehen teilweise deutlich weitergehende, teilweise engere Verbote. So sind etwa in Korea, auf den Philippinen und osteuropäischen Ländern Heiraten zwischen Cousins und Cousinen verboten. In islamischen Ländern, etwa in Nordafrika, gelten sie teilweise noch als erstrebenswert und sind jedenfalls erlaubt. Der Inzest unter Erwachsenen ist etwa in Frankreich und Schweden, Russland und Indien nicht verboten, in Schweden ist grundsätzlich auch die inzestuöse Ehe erlaubt. In den Ländern Afrikas, Mittel- und Südamerikas bestehen meist gar keine Vorschriften.
Der Ursprung des Inzestverbots ist streitig. Zutreffend dürfte jedenfalls die Beschreibung des Ethnologen Claude Lévi-Strauss sein, wonach das Inzestverbot an der Schnittstelle zwischen Natur und Kultur verortet sei.2 Es spricht vieles dafür, dass jedenfalls eine Quelle des Verbots das Bemühen ist, das Risiko von Schädigungen des Nachwuchses zu mindern, also die sogenannte eugenische Begründung. Allerdings nimmt das Verbot vielfach symbolische Natur an, ohne dass eine konkrete Gefahr dieser Art vorausgesetzt ist. Eine über die Gefahr von Erbschäden hinausgehende Gefährdung von Rechtsgütern, die teilweise behauptet wird, ist hingegen schwer erkennbar. Das wird schon dadurch deutlich, dass sich das strafrechtliche Verbot in Deutschland auf den vaginalen Geschlechtsverkehr beschränkt, während alle anderen Formen sexueller Beziehungen unter Verwandten nicht verboten sind, wenn man vom besonderen Strafrechtsschutz für Kinder absieht.
Was unter dem Stichwort der Familie beschrieben worden ist, gilt auch für Formen der Großfamilie oder des Clans, die in manchen Kulturen, auch unter Einwanderern nach Deutschland, noch erhebliche Bedeutung für die informelle und auch formelle Regelung und Vermeidung von Konflikten haben. Clans geraten hierdurch in eine Konkurrenzsituation zu staatlichen Instanzen und werden von der Mehrheitsgesellschaft als Bedrohung wahrgenommen.
In traditionell strukturierten, meist patriarchalisch geführten Großfamilien vermischen sich dabei wirtschaftliche, personale und soziale Faktoren der Integration. Sie zeichnen sich oft durch rigide Sexualverfassungen aus, etwa indem die Partnerwahl namentlich von Mädchen und Frauen kontrolliert und fremdbestimmt geleitet wird. Sexuelle Kontakte werden streng überwacht und bei Frauen vor der Hochzeit nach Möglichkeit ganz unterbunden. Nicht selten spielen hier traditionell geprägte Vorstellungen von einer sogenannten Familienehre mit hinein. Sie ist die moralische Grundlage harter Beschränkungen der sexuellen Selbstbestimmung und legitimiert eine streng sanktionierte Pflichtenstellung der Familienmitglieder gegenüber einer kollektiven, auf den Funktionszusammenhang der gesamten Familie bezogenen Ehre unter der Drohung erheblicher Nachteile bis hin zur Gewaltanwendung und wirtschaftlichen Vernichtung.
Es liegt auf der Hand, dass eine solche an Kollektivwerten und staatsfernen Pflichtenstrukturen ausgerichtete Sexualverfassung in erheblichen Konflikt mit den rechtlichen und informellen Steuerungsmechanismen westlicher individualisierter Gesellschaften kommen muss.
Elite, Macht, Moral: Was Sexualität mit sozialen Klassen zu tun hat
Wie gezeigt wurde, ist sexuelles Verhalten Natur und Kultur zugleich. Es ist auf Fortpflanzung bezogen, davon aber nicht abhängig. Fortpflanzung wiederum ist eine biologische Notwendigkeit der Art, für die evolutionär vorgesorgt ist. Menschen sind zu keiner Zeit als Einzelwesen aufgetreten, die sich nur gelegentlich zum Zweck der Fortpflanzung mit anderen Individuen treffen, sondern stets in Gruppen und Gemeinschaften unterschiedlicher Größe und verschiedener Organisationsgrade. Es hat unterschiedlichste Formen der Vergemeinschaftungen gegeben: größere Gruppen mit matrilinearer Struktur, in denen Frauen mit mehreren Männern sexuelle Beziehungen hatten; patriarchale Gemeinschaften mit männlichen Abstammungslinien, in denen Frauen den führenden Männern zugeordnet waren; kleine Familiengemeinschaften mit nur einzelnen erwachsenen Männern; schließlich große Gruppen mit differenzierter Sozialstruktur. All diese Gruppen und Familien standen zudem meist im Austausch mit externen, anderen Gruppen, aus denen junge Frauen und junge Männer zuwanderten beziehungsweise zu denen sie abwanderten.