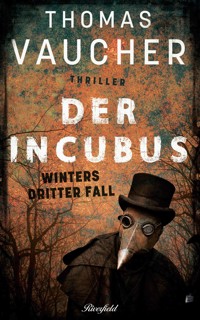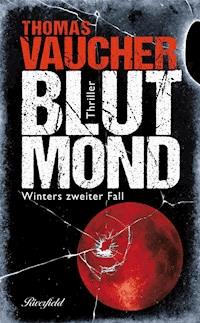Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Riverfield Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Zwillingsschwestern Sana und Worina wachsen fernab jeglicher Zivilisation in den Bergen auf. Sie teilen ein gefährliches Geheimnis: Sie sind Sehende, mit einem weißen Auge ausgestattet, das es ihnen erlaubt, das Lied der Macht zu wirken. Ihr Vater Merysan, ehemaliger Held der Armee von Korien, hält sie versteckt, denn der Dahun-Tempel im Silbergebirge zieht alle Sehenden ein, um sie für seine Zwecke auszubilden. Um diesen Tempel ranken sich wilde Gerüchte über unvorstellbare Schrecken, die in seiner Tiefe lauern sollen. Dieses eigenständige Spin-Off aus der grandiosen Trilogie »Das Lied der Macht« bietet alles was High-Fantasy ausmacht: Schlachten, Magie, Mut und Verrat - und zwei junge tollkühne Schwestern mit einer Gabe, die die Welt verändern kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© copyright byRiverfield Verlag GmbH, Vorderbergweg 14153 Reinach BL, [email protected]
GPSR verantwortliche Person in der EUPROLIT Verlagsauslieferung GmbHSiemensstraße 16, 35463 [email protected]
Korrektorat & Satzihleo verlagsbüro – Dr. Oliver Ihle, Husum (D)
KartenPascal ScheideggerIllustrationsstudio (CH)www.pascalscheidegger.ch
Umschlag und VignettenRiverfield Verlag (created with generative AI)
E-Book: Dr. Bernd Floßmann ihrtraumvombuch.de
ISBN 978-3-907459-27-0 (Print)
ISBN 978-3-907459-28-7 (E-Book)
Karte: Die bekannten Lande
Für Lara,wenn du dieses Buch eines Tages liest, wirst du wissen, warum.
Prolog
841 nach Thanar
Merysan hatte Angst.
Dabei hatte er schon viel erlebt, hatte Schlachten geschlagen, dem Tod ins Auge gesehen und war ihm mehrmals von der Schippe gesprungen. Doch nichts war vergleichbar mit dem, was sich da vor ihm abspielte. Das Schlimmste daran war, dass er nichts tun konnte. Sein Bogen würde ihn dieses Mal nicht retten, denn es gab keinen Feind zu erschießen. Sein Verstand war ebenso nutzlos, denn es gab keine Taktik oder Strategie der Welt, die ihm helfen würde, die anstehende Sache zu einem guten Ende zu bringen. Er war hilflos und musste darauf hoffen, dass alles gelingen würde.
Nur zu gut hatte er das Bild seines Nachbars Ohlard vor Augen. Der große, starke Mann war am Boden zerstört gewesen, als er ihm erzählt hatte, wie dessen Frau bei der Geburt ihres Kindes gestorben war. Hilflos sei er gewesen, machtlos. Ohlard hatte seiner Frau einst geschworen, sie zu beschützen, doch als es wirklich nötig gewesen wäre, hatte er versagt. Wie sollte man eine Frau auch vor sich selbst und dem Ungeborenen in ihrem Leib schützen?
Dahlya schrie auf, und Merysan zuckte zusammen. Ihre Hand klammerte sich um seine und drückte so stark, dass es schmerzte. Doch er wusste, dass diese Schmerzen nichts waren im Vergleich zu dem, was sie durchmachen musste.
»Du musst stärker pressen«, sagte Olma. Die alte Frau kniete vor Dahlya, eine Schale warmen Wassers neben sich, ein sauberes, weißes Tuch in der Hand.
»Ich kann … nicht stärker … pressen«, keuchte Dahlya. Ihre Stirn war schweißnass, ihre langen, braunen Haare klebten ihr im Gesicht. Die markanten Wangenknochen stachen deutlich hervor. »Es … zerreißt mich!«
»Nur einmal noch«, sagte Olma sanft, aber unnachgiebig. »Ich kann den Kopf bereits sehen.«
»Einmal noch«, versuchte Merysan sie zu beruhigen und streichelte ihr mit der freien Hand übers Haar. »Einmal noch.«
Dahlya nickte tapfer, kniff die Augen zusammen und presste. Ihre Finger krallten sich in Merysans Hand und ließen ihn schmerzhaft zusammenzucken.
Schreie erklangen. Die Schreie eines Neugeborenen.
»Es ist da«, sagte Olma erleichtert.
Merysan atmete einmal tief durch und schloss die Augen.
»Es ist ein Mädchen«, sagte die Geburtshelferin. Geschickt wickelte sie das Kind in das Tuch. »Moment …« Die alte Frau hielt inne. »Da … da kommt noch ein Zweites!«
Was?
Merysan und Dahlya sahen sich verwirrt an.
»Noch … eines?«, keuchte Dahlya entsetzt. »Ich … weiß nicht, ob ich … das nochmal … schaffe.«
»Du musst, mein Kind. Du musst.« Olma stand auf und drückte Merysan das Neugeborene in die Arme.
Er ließ Dahlyas Hand los, umfasste das Mädchen zärtlich und betrachtete es. Es hatte die Augen noch geschlossen, schrie immer noch und umklammerte mit seiner kleinen Hand Merysans Daumen.
»Sch…«, machte er und versuchte, es zu beruhigen, während neben ihm Dahlya ein weiteres Mal gequält aufschrie. »Alles ist gut.«
Das Neugeborene öffnete schwach die Augen, und Merysan erstarrte. Das linke Auge war von einem tiefen Braun, doch das rechte war völlig weiß. Merysan stolperte einen Schritt zurück. Beinahe hätte er das Kind fallen lassen.
»Es …«, keuchte er, »es ist … eine Sehende.«
»Was?« Die Geburtshelferin sah mit gerunzelter Stirn auf. Ihre Hände waren voller Blut.
»Es ist eine Sehende«, wiederholte Merysan entsetzt und deutete mit dem Kopf auf das Mädchen in seinen Armen.
»Eine … Sehende?«, keuchte Dahlya. »Das …«
»Das ist ein Geschenk«, unterbrach Olma Merysans Frau. »Ihr solltet Dahun für diese Gabe danken.«
»Danken?« Merysan lachte bitter auf, während Dahlya neben ihm ein weiteres Mal aufschrie.
»Unser … Mädchen … ist eine … Sehende?«, keuchte sie. Ihre Hand packte Merysans Handgelenk und drückte so hart zu, dass er ein Keuchen nicht unterdrücken konnte. »Die … Tempeldiener … dürfen es nicht … kriegen. Versprich es … mir, Mery.«
»Aber … es steht den Tempeldienern zu, Dahlya«, sagte die Geburtshelferin verwirrt. »Ihr dürft ihnen das Kind nicht vorenthalten. Jede Sehende steht ihnen zu.«
»Diese hier nicht«, sagte Merysan grimmig. »Die Tempeldiener werden sie nicht kriegen, Dahlya, das schwöre ich. Und du, Olma, wirst dieses Geheimnis hüten wie deinen Augapfel. Versprich es mir!«
»Ich weiß nicht …«, begann die Geburtshelferin, doch Merysans Frau schrie ein weiteres Mal gepeinigt auf, worauf Olma sich wieder zu Dahlyas Schoß hinabbeugte.
Merysan sah auf das Kind in seinen Armen und flüsterte: »Ich schwöre dir, sie werden dich nicht kriegen, Kleines. Ich werde dich mit meinem Leben beschützen.«
Keuchend stemmte sich Olma auf die Füße, ein weiteres Kind in den Armen.
»Noch ein Mädchen«, sagte die Alte müde. »Ihr solltet das Kind wirklich den Tempeldienern überlassen, Merysan«, sagte sie und deutete auf das kleine Häuflein in seinen Armen. Ihr habt ja noch ein Zweites.« Sie nickte zu dem Kind, das sie trug. »Das ist bestimmt …« Sie brach ab und gab einen erstickten Laut von sich.
»Was … ist, Olma?«, fragte Dahlya. »Was ist mit ihm?«
»Es ist auch eine Sehende«, hauchte die alte Frau.
Weißaugen
860 nach Thanar
1
Sana ging in die Hocke, schlug ihren braunen Wollmantel zurück und besah sich die Spur, die der Hirsch auf dem feuchten Waldboden hinterlassen hatte. Dazu schloss sie ihr rechtes Auge, da dessen Sichtweise sie nur verwirrt hätte: Mit ihrem rechten, weißen Auge nahm sie die Kraftstränge der Natur rund um sich herum wahr. Ein feines, beinahe durchsichtiges Geflecht, das sich durch Erde, Luft, Wasser und Feuer zog und mit dem die Sehenden das Lied der Macht wirkten. Dafür konnte sie mit diesem Auge nichts anderes wahrnehmen. Es war blind für alle anderen Dinge.
Zum Glück hatte es am Vortag ausgiebig geregnet, was ihr die Verfolgung des Wilds stark erleichterte. Der Hufabdruck war klar ersichtlich: die zwei länglichen, karottenförmigen Abdrücke und dahinter die beiden erbsenförmigen Punkte. Doch Sana hatte noch nie so große Hirschspuren gesehen. Das Tier musste gewaltige Ausmaße haben. Sie befühlte die Vertiefung im feuchten Waldboden mit den Fingern. Die Spur war noch nicht alt.
Sana richtete sich wieder auf und folgte ihr. Vater würde stolz auf sie sein, wenn sie diesen Hirsch erlegte. Zwar wusste sie noch nicht, ob sie ihn überhaupt nach Hause tragen konnte, wenn er wirklich so groß war. Doch sein Fleisch würden sie gut gebrauchen können. Die Vorräte waren in letzter Zeit knapp geworden.
Die Spur führte sie an einen kleinen Teich, an dem der Hirsch wohl seinen Durst gestillt hatte. Sana tat es ihm gleich, ließ sich auf ein Knie herab und schöpfte sich mit den Händen Wasser in den Mund. Es war ein warmer Herbsttag. Die Sonne stand mittlerweile tief am Himmel, doch die wenigen Strahlen, die durch das dichte Blätterdach fielen, reichten aus, um Sana zu wärmen.
Ihr Blick fiel auf das Spiegelbild im Wasser, auf den schlanken Körper, der in einem zweckmäßigen, hellen Leinenhemd steckte, auf das schmale Gesicht mit den leicht hervorstehenden Wangenknochen und den dichten Augenbrauen, die sie von ihrem Vater geerbt hatte, und blieb an dem rechten, weißen Auge hängen, das ihr junges Leben so sehr einschränkte. Sie hasste es. Ihre Lippen verhärteten sich, als ihr Blick der Narbe folgte, die sich quer darüber zog. Der schwache und vergebliche Versuch eines Kindes, sich das wegzuschneiden, was es am meisten hasste und verachtete. Sie schlug mit der Faust auf die Wasseroberfläche, so dass sich das Spiegelbild in einer Fontäne aufspritzenden Wassers auflöste. Sie atmete tief durch, fuhr sich mit den nassen Händen durch die langen, braunen Haare und strich sie sich hinter die Ohren. Dann richtete sie sich auf und ging weiter.
Ein Jucken an ihrem rechten Auge zeigte ihr an, dass ihre Zwillingsschwester Worina Kontakt mit ihr aufgenommen hatte und nun durch ihr rechtes Auge sah. Sana lächelte, beugte sich etwas herab und deutete mit dem Finger auf die Hirschspur, die sich zu ihren Füßen befand, so dass ihre Schwester sie durch ihr Auge hindurch sehen konnte.
Sana konzentrierte sich, schloss ihre Augen und nahm ihrerseits Kontakt mit Worinas Auge auf, indem sie sich das weiße Auge ihrer Schwester vorstellte. Als sie ihr rechtes Auge wieder öffnete, waren der Wald und die Hirschspur verschwunden und dem einzigen Zimmer ihrer ärmlichen Behausung gewichen. Sie sah das Feuer im Kamin lodern. Darüber hing an einem eisernen Gestell ein Kochtopf, der mit Wasser gefüllt war. Worinas Hände erschienen vor Sanas Auge und formten einige Zeichen: Erst schloss sich die linke Hand, dann streckten sich beide Hände. Langsam neigten sich nun Worinas Fingerspitzen gegeneinander, bis sie sich berührten und eine Art Dach bildeten. Dann klappte sie die Fingerspitzen noch mehr ein und formte damit ein Herz. Schließlich trennte sie ihre Hände wieder und bewegte die Finger rasch auf und ab. »Komm nach Hause. Mutter macht sich Sorgen«, entzifferte Sana die Zeichen mühelos.
Sie lächelte, brach den Kontakt ab, indem sie die Augen schloss. Dann öffnete sie sie erneut. Nun lag wieder der Wald vor ihr, genauso wie die Spur des Hirsches.
Sie erinnerte sich daran, wie sie das erste Mal durch das Auge ihrer Zwillingsschwester geblickt hatte und darüber erschrocken war. Sie war mit ihrem Vater unterwegs gewesen, hatte wie zuvor Wasser aus einem Teich getrunken, dabei ihr Spiegelbild angesehen und an ihre Schwester gedacht. Dabei war ihre Sicht plötzlich verschwommen und sie hatte ihre Mutter gesehen, die über eine Stunde entfernt bei ihrer Schwester gewesen war. Überrascht war sie zurückgetaumelt, hatte geblinzelt und da war ihre Sicht wieder normal gewesen. Dafür hatte sie ein Jucken an ihrem rechten Auge gefühlt. Später, als sie Worina alles erzählt hatte, hatte diese ihr mitgeteilt, dass sie durch Sanas Auge den Teich und ihren Vater hatte sehen können.
Mit der Zeit hatten sie gelernt, diese spezielle Kontaktaufnahme gezielt herbeizuführen und zu kontrollieren. Sie hatten eine Zeichensprache entwickelt, um sich gegenseitig Dinge mitzuteilen, wenn sie durch das Auge des anderen sahen.
Sana lächelte und setzte ihren Weg fort, immer der Spur im weichen Waldboden folgend, bis sie plötzlich abrupt innehielt. Der faulige Geruch von Blut und Verwesung drang an ihre Nase. Vorsichtig schlich sie weiter und sah den Hirsch schon nach wenigen Schritten. Er lag auf einer kleinen Lichtung, den Bauch aufgerissen, die Innereien herausquellend. Sana würgte, hielt sich die Hand vor die Nase und ging näher an den Kadaver heran. Das Tier lag mit verrenkten Gliedern da. Riesige Krallenspuren zogen sich quer über seinen Bauch, wo sie eine klaffende Wunde gerissen hatten. Große Teile des Rückens und der Beine fehlten. Offenbar hatte das Raubtier, das den Hirsch erlegt hatte, sich hier satt gefressen.
Oder vielleicht hast du es aufgeschreckt und es lauert immer noch hier in der Nähe – lauert dir auf?
Sie wischte die Gedanken beiseite und besah sich die Wunde im Bauch des Hirsches genauer. Die Krallenspuren waren riesig. Sana kannte kein Tier, das derart große Klauen besaß. Weder Bär noch Wolf konnte das gewesen sein, nicht einmal die Winterkatze, die einen Wolf um einiges überragte. Sie wandte sich um und suchte den Boden rund um den Kadaver nach Spuren ab. Einen Moment lang hielt sie verwirrt inne und zweifelte an ihrem Verstand. Die Spuren, die vom Hirsch wegführten, sahen aus wie Menschenfüße, aber Menschenfüße in einer Größe, wie es sie nicht geben konnte. Diese Abdrücke waren mehr als doppelt so groß wie ihre eigenen.
Was geht hier vor?
Vorsichtig folgte sie den Spuren einige Schritte weit, ehe sie innehielt.
Was machst du da? Willst du das Ding wirklich aufspüren? Hast du das Gefühl, dass du diesem Was-auch-immer gewachsen bist?
Sie lachte leise auf.
Natürlich bin ich das. Ich bin Sana, Tochter von Merysan dem Schwarzen. Selbst wenn ich dem Vieh nicht gewachsen bin, wäre ich mit Sicherheit schneller.
Schneller? Es hat einen Hirsch erlegt! Denkst du, du bist schneller als ein Hirsch?
Langsam machten sich nun doch Zweifel in Sana breit, doch sie wischte sie beiseite und folgte den Spuren. Diese führten tiefer in den Wald hinein. Sie sah, dass das Geschöpf eine Schneise durch das Unterholz gepflügt hatte. Offenbar war es in großer Hast vom Hirsch weggerannt, vermutlich hatte sie es aufgeschreckt.
Die Spur führte sie immer tiefer in den Wald, bis sie schließlich vor einer steilen Felswand abrupt endete. Sana runzelte die Stirn und besah sich den weichen Waldboden der Umgebung, doch es blieb dabei: Die letzte Spur befand sich direkt vor dem Felsen.
Ist die Kreatur tatsächlich hier hochgeklettert?
Sana legte den Kopf in den Nacken und sah hoch. Sie war eine gute Kletterin, doch der Fels vor ihr war fast senkrecht, wies nur wenige Vertiefungen auf und war gut und gerne fünfzehn Schritt hoch. Sie suchte nach einer geeigneten Stelle, an der sie Halt finden und hochklettern konnte, musste jedoch schon bald einsehen, dass sie diesen Felsen nicht bezwingen konnte. Also folgte sie ihm nach Norden und hoffte darauf, dass er irgendwann abflachen würde, so dass sie doch noch hinaufgelangen konnte. Doch auch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Sie überlegte einen Moment, ob sie dem Felsen auch noch nach Süden folgen sollte, verwarf diesen Gedanken aber rasch wieder, als sie sah, wie tief die Sonne schon stand. Wenn sie noch vor Einbruch der Dunkelheit wieder zuhause sein wollte, musste sie jetzt umkehren.
Enttäuscht machte sie sich auf den Rückweg.
2
Merysan seufzte erleichtert, als das Dorf endlich vor ihm auftauchte. Sein Rücken und seine Arme schmerzten vom Gewicht des großen Rucksacks und der Bündel, die er trug. Vielleicht hätte er doch auf Sana hören sollen, die ihm anerboten hatte, mitzukommen. Doch das Risiko war ihm zu groß gewesen. Wie immer.
Merysan wusste, dass Sana ihn dafür hasste, dass er sie und ihre Schwester in der Hütte in den Bergen oben vor der ganzen Welt versteckte. Und er wusste auch, dass er sie nicht ewig von anderen Leuten fernhalten konnte. Sie war neunzehn und wollte Menschen treffen – Männer, korrigierte er sich lächelnd. Er konnte es ihr nicht verwehren. Doch Männer zu treffen, bedeutete, ihr Geheimnis preiszugeben, und dies war gefährlich.
Eine Spur zog sich vor ihm durch das hohe Gras, und er hielt inne, um sie sich genauer anzusehen. Unwillkürlich musste er daran denken, was Sana vor drei Tagen in den Bergen entdeckt hatte. Die Abdrücke dort seien doppelt so groß wie Menschenfüße gewesen. Ihre Erzählung hatte ihn an etwas erinnert, was er lieber für immer vergessen hätte. Doch vermutlich gab es für Sanas Entdeckung eine logische Erklärung, die sich ihnen bis anhin nur noch nicht erschlossen hatte. Diese Spur hier stammte jedenfalls eindeutig von einem Reh: zwei längliche Abdrücke, die vorne spitz zuliefen.
Merysan beschleunigte seinen Schritt und erreichte die ersten ärmlichen Hütten von Thranhalla. Linker Hand die hölzerne Behausung von Meg, dem Fischer, rechts die Lehmhütte von Tronich, dem Bäcker. Dessen Frau hängte dahinter gerade Wäsche auf und nickte ihm freundlich zu, als er vorbeiging. Er erwiderte den stummen Gruß und ging weiter.
»Dahun zum Gruß, Merysan!«, rief ihm jemand von links zu. Er wandte den Kopf und erblickte Telor, den Schmied, der Pfeife rauchend vor seinem Haus stand.
»Möge er sein Licht über deinem Haupt erstrahlen lassen!«, erwiderte Merysan und winkte dem Schmied zu, ehe er weiterging. Auf dem Dorfplatz angekommen, lenkte er seine Schritte zuerst zum Haus des Gerbers, wo er einen Großteil seiner Waren – Tierhäute – ablud und veräußerte, ehe er dem Jäger Dalbin den Bogen brachte, den er für ihn hergestellt hatte.
»Ein schönes Stück«, meinte dieser bewundernd und drehte die Waffe in den Händen. »Vielleicht gelingt es mir damit endlich, den Thyrbolg zu erlegen.«
»Den Thyrbolg?« Merysan runzelte die Stirn. »Wer soll das sein?«
»Hast du’s noch nicht gehört?« Dalbin schüttelte den Kopf. »Bedald hat ihn gesehen. Er meinte, der Thyrbolg sei drei Schritt hoch und doppelt so breit wie ein kräftiger Mann. Er habe riesige, messerscharfe Klauen. Ich habe seine Spuren gesehen, sie waren fast doppelt so groß wie meine Füße.«
Merysan erschrak. Eine dunkle Erinnerung stieg in ihm auf, doch er wischte sie fort, ehe sie bis ganz nach vorne dringen konnte.
Es kann nicht sein.
»Meine Tochter hat mir auch von solchen Spuren erzählt«, meinte er nachdenklich. »Ich dachte, sie übertreibt, aber …«
»Sie hat nicht übertrieben, gewiss nicht«, ereiferte sich Dalbin. »Sarl wird seit gestern vermisst. Bestimmt hat ihn das Ungeheuer gefressen. Der arme Junge. Er war erst sieben Jahre alt.«
»Was ist passiert?«
»Seine Mutter erzählte, dass er im Wald spielen war, aber nicht mehr zurückgekehrt ist. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Wir haben seine Spuren verfolgt, doch im Schleierbach haben wir sie verloren.«
»Und die Spuren des Untiers haben seine gekreuzt?«, wollte Merysan wissen.
Dalbin schüttelte den Kopf. »Nein. Vermutlich hat sich der Junge verlaufen. Doch inzwischen hat die Bestie ihn bestimmt gefunden und gefressen.«
»Weshalb hast du es zuvor Thyrbolg genannt? Was ist das für eine Bezeichnung?«
Dalbin schmunzelte. »Ich vergesse stets, dass du nicht von hier stammst. Mir haben schon meine Eltern vom Thyrbolg erzählt. Der Thyrbolg ist eine Art … Riese, würdest du vielleicht sagen. Ein Riese mit langen Klauen und scharfen Fängen. Er hat zwei Köpfe, lebt in den Bergen und raubt den Menschen ihr Vieh und gelegentlich ihre Kinder.«
»Und du hast ihn schon einmal gesehen, diesen … Thyrbolg?«
Dalbin schüttelte den Kopf. »Sonst wäre ich wohl nicht mehr hier. Schau, bis vor Kurzem dachte ich auch, dass der Thyrbolg bloß eine erfundene Gestalt ist, um den Kindern Furcht einzujagen, doch seit man dieses Monster in den Bergen gesichtet hat, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Jedenfalls solltest du auf der Hut sein, Merysan, du, der du da oben abgeschieden von allen anderen lebst. Und sieh zu, dass sich deine Töchter nach Anbruch der Dunkelheit nicht mehr draußen herumtreiben.«
Merysan nickte und verabschiedete sich. Als Sana ihm von den großen Spuren erzählt hatte, hatte er es nicht wahrhaben wollen, doch nun regten sich in ihm auch langsam Zweifel, ob nicht tatsächlich ein gefährliches Ungeheuer sein Unwesen in den Bergen oben trieb. Ein Ungeheuer oder gar …
Nein, vertrieb er den Gedanken sofort wieder. Das ist unmöglich! Wir haben sie damals alle getötet. Alle bis auf … Unwillig schüttelte er den Kopf. Es muss eine andere Erklärung geben.
Von der Last seiner Waren befreit, lenkte er seine Schritte zur einzigen Taverne des Ortes – dem Weißen Schild. Schon von Weitem hörte er den Lärm. Etwas klirrte, jemand schrie schmerzerfüllt auf. Eine Stimme fluchte laut. Merysan kannte sie. Er ist also wieder da. Er seufzte und betrat die Taverne.
Hinter der Tür ragte ein riesiger, bloßer Rücken vor ihm auf. Gewaltige Muskelstränge zogen sich darüber und waren zum Zerreißen angespannt. Auf der anderen Seite des Raumes lagen zwei Männer inmitten von zerbrochenem Geschirr, Stühlen und Tischen ächzend am Boden. Rechts und links hatten sich die restlichen Gäste ängstlich an die Wände des Raumes zurückgezogen. Der Wirt, ein kahlköpfiger, dicker Mann namens Boldor, stand hinter seinem Tresen und sah ängstlich zwischen dem halbnackten Giganten und den beiden gestürzten Männern hin und her.
Der Riese machte einen drohenden Schritt auf die beiden liegenden Männer zu und fauchte: »Und jetz’ sagt nochmal, ich sei ein alt’r, dick’r Säuf’r, ihr räudig’n Hur’nfürze!«
Die beiden Männer rappelten sich mühsam auf. Dem Rechten lief Blut übers Gesicht, doch das hielt ihn nicht davon ab, ein Messer zu ziehen. Der andere ergriff den Arm des Ersten: »Lass das! Der alte Säufer ist es nicht wert, dass wir unser Leben riskieren.«
»Der alte Säuf’r? Habt ihr das gehört?«, wetterte der Riese mit schwerer Zunge. Man hörte seiner Stimme an, dass er Alkohol getrunken hatte. Und das vermutlich nicht wenig. »Ich werd’ euch zeig’n, wozu dies’r alte Säuf’r noch fähig is’, ihr Zieg’nschisse! Kommt nur! Ich fürchte eure Mess’r nich’. Ich hab’ beim Temp’l vierundzwanzig Krieg’r getöt’t. Zweiundzwanzig mit ’em Schwert un’ die letzt’n beid’n hab’ ich mit bloß’n Händ’n umgebracht.«
»Crohn, das reicht«, sagte Merysan leise und legte dem Riesen seine Hand auf den Unterarm. »Lass die Männer in Ruhe!«
Crohn drehte sich halb zu Merysan um und ein Lächeln erschien auf dem grobschlächtigen Gesicht.
»Mery!« Der Riese klopfte ihm auf die Schultern, so dass Merysan Mühe hatte, das Gleichgewicht zu halten und nicht vornüber zu fallen. »Du kommst gerade zur recht’n Zeit. Sag dies’n beid’n Stinkhund’n, was damals passiert is’, beim Temp’l. Damals, als ich in die Tiefe stieg.«
»Ein andermal vielleicht, Crohn«, sagte Merysan. Aus den Augenwinkeln sah er eine Bewegung. Etwas raste ungeheuer schnell auf Crohn zu.
Der Hüne wirbelte herum. Schneller, als Merysan es ihm aufgrund seines Zustandes zugetraut hätte. Statt der Messerattacke auszuweichen, packte er den Arm des Mannes mit der linken Hand und drückte so hart zu, dass der Angreifer vor Schmerz aufschrie und das Messer fallen ließ. Dann ergriff er den Mann mit der rechten Hand am Hals und hob ihn mühelos vom Boden hoch, so dass seine Füße in der Luft baumelten.
»Genau so hab’ ich damals beim Temp’l ein’n dies’r verflucht’n Nordheim’r gepackt und üb’r die Mau’r geworf’n, weiß’ du noch, Mery?«, polterte Crohn.
»Ja, ich weiß es noch«, sagte er. »Und jetzt lass den armen Kerl los. Er ist ja noch ein Junge.«
»Ein verdammt frech’r Junge«, grollte Crohn. »Und noch dazu ein’r mit ein’m Mess’r. Ich hätt’ nich’ üb’l Lust, es ihm in den Arsch zu stoß’n.«
»Crohn! Lass ihn los!«
Crohn seufzte und ließ den Mann zu Boden fallen. Ächzend schnappte dieser nach Luft und kroch von Crohn fort. Sein Kumpan ergriff ihn unter dem Arm, und dann humpelten sie aus der Taverne.
»Merysan.« Boldor kam auf ihn zu gelaufen. Er deutete auf das zerstörte Mobiliar. »Wer kommt denn nun für den ganzen Schaden auf?«
»Halte dich an die beid’n Eselspiss’r«, grollte Crohn. »Die hab’n mich schließlich provoziert.«
»Aber … das ist doch kein Grund, meine Sachen zu zerstören«, jammerte der Wirt.
Merysan nahm seinen Geldbeutel hervor, zählte daraus zehn Thanar ab und reichte sie Boldor. »Hier, das sollte den Verlust aufwiegen.«
Boldor nahm Merysan am Arm und trat mit ihm ein Stück zur Seite. »Das ist nicht der erste solche Zwischenfall, seit er zurück ist, Merysan. Letzte Woche hat er vier fahrende Händler zusammengeschlagen, mitsamt drei meiner Stühle, vier Bechern und zwei Tellern. Ich …«
»Na schön«, sagte Merysan und reichte dem Wirt seufzend zehn weitere Thanar. Ein Drittel seiner Einkünfte war damit bereits wieder weg. »Ich bitte dich, sei nachsichtig mit ihm. Er meint es nicht so.«
Boldor beäugte die zwanzig Thanar auf seinem Handteller und nickte. »Aber lange mache ich das nicht mehr mit. Vielleicht solltest du ihm sagen, dass es für ihn an der Zeit ist, sich zu benehmen – oder sich anderswo niederzulassen.«
»Warum sagst du ihm das nicht selbst?«
Der Wirt erbleichte, drehte sich um und begann, die Ecke mit den zertrümmerten Möbelstücken aufzuräumen. Die Gäste kehrten an ihre Tische zurück, nicht ohne Crohn noch einige ängstliche Blicke zuzuwerfen.
»Mery«, lallte der Riese, packte ihn am Arm und führte ihn zu einem Tisch, auf dem drei leere Humpen standen. »Schön, dich zu seh’n, alt’r Freund. Dachte schon, du würdest gar nich’ mehr von dein’m Berg runt’rkomm’n.«
Merysan setzte sich Crohn gegenüber hin und betrachtete seinen Freund. Er sah nicht gut aus. Der lange Schnurrbart, der sich an den Wangen zu einem Backenbart verbreiterte, war mehr grau als braun, die halblangen verbliebenen Haare, die sich an der Stirn stark zurückgezogen hatten, fettig und strähnig, das restliche Gesicht unrasiert und von ungesunder Farbe. Die grau-grünen, kleinen Augen waren blutunterlaufen, umgeben von tiefen Augenringen, die Nase stark gerötet. Der gewaltige, nackte Oberkörper war immer noch muskulös, doch um den Bauch herum hatte sich einiges an Fett angesetzt. Sechs große Narben zogen sich quer über seinen Brustkasten. Wie Merysan wusste, hatte er am Rücken keine. Crohn brüstete sich stets, keinem Feind je den Rücken zugewandt zu haben.
»Wieso hast du dein Hemd ausgezogen?«, wollte er schließlich wissen.
»Musste dies’n Aff’nschwänz’n meine Narb’n zeig’n, weil sie mir nich’ glaub’n wollt’n«, polterte er. »Sie hab’n mich ausgelacht, mich alt und fett genannt.«
»Du bist alt und fett«, sagte Merysan ruhig.
Crohn starrte ihn einen Moment lang mit zusammengekniffenen Augen an. Einen Augenblick lang dachte Merysan schon, er würde sich nun auch auf ihn stürzen, doch dann entspannten sich die grimmigen Gesichtszüge Crohns, und er begann schallend zu lachen.
»Du hast recht«, polterte er. »Natürlich bin ich alt und fett. Doch der Einzige, der mir das ins Gesicht sag’n darf, bis’ du und nich’ diese räudig’n Ratt’nschwänze ohne Bart.«
»Ich bin auch alt, Crohn«, sagte Merysan. »Ich sehe nicht mehr so gut wie früher und meine Hände sind längst nicht mehr so ruhig, wie ich es gerne hätte, im Gegenteil. Aber das ist noch lange kein Grund, hier alles kurz und klein zu schlagen. Wenn du dich weiter so benimmst, lässt dich Boldor bald nicht mehr in seine Taverne.«
Crohn lachte. »Dann soll er mal versuch’n, mir den Zutritt zu verwehr’n.«
»Ich meine es ernst, Crohn. Du kannst nicht jeden, der etwas sagt, das dir nicht passt, zusammenschlagen.«
»Natürlich kann ich es. Has’ du ja gerade geseh’n.«
»Ich meine es ernst, Crohn.«
»Ich auch. Aber lass uns nich’ mehr davon sprech’n. Hols’ du mir noch ein Bier?«
»Ich glaube, du hast genug gehabt.«
Crohns Gesicht rötete sich. Er stand auf, ballte die Hände zu Fäusten und knurrte: »Ich entscheide selbst, wann ich genug gehabt hab’, Freund.«
Merysan zuckte mit den Schultern und deutete zum Tresen. »Dann hol dir halt noch eins.«
Crohn verzog die Lippen zu einer Art Schmollen, ehe er sich wieder setzte. »Hab’ kein Geld mehr. Boldor wollte mir schon vorhin kein’s mehr geb’n. Has’ du mir Geld mitgebracht?«
Merysan seufzte. »Nicht zum Versaufen, Crohn.«
»Ich entscheide selbst, was ich damit mache. Krieg ich nun was, oder nich’? Aber lass dir gesagt sein: wenn nich’, dann geh’ mir aus den Aug’n. Ich brauche nich’ noch mehr scheinheilige Freunde. Davon gibt es genug.«
»Ich bin kein scheinheiliger Freund. Ich wünschte nur, du würdest mehr aus deinem Leben machen, als hier herumzusaufen und dir selbst leidzutun.«
»Ich tu mir nich’ leid. Warum auch? Ich bin ein Held. Ein’r der größt’n all’r Zeit’n und gewiss der größte, der noch lebt. Von dir vielleicht mal abgeseh’n.«
Merysan seufzte, stand auf und ging zur Theke. Er legte zwei Thanar auf den Tresen, bestellte zwei Bier und ging dann damit zu Crohn zurück.
»Danke«, nuschelte Crohn, nahm einen gewaltigen Schluck und wischte sich den Schaum vom Mund. »Wenn du nich’ willst, dass ich hier herumsaufe, muss’ du mich halt mit zu dir in die Berge nehm’n.«
Merysan schüttelte den Kopf. »Ich habe dir bereits mehr als einmal gesagt, dass das nicht möglich ist. Du kannst uns besuchen, aber nicht bleiben.«
»Ja und ich hab’ immer noch nich’ verstand’n, warum. Has’ du Angst, ich würde über deine Frau oder deine Töchter herfall’n? Ich bin ein ehrbar’r Mann. Ich hau’ nur Männ’r.«
»Ich weiß. Aber … es geht nicht.«
»Ja, das sags’ du imm’r, aber was soll ich denn hier tun? Hier hat niemand Verwendung für ein’n Held’n. Und was anderes als kämpf’n kann ich nun mal nich’ und in der Armee woll’n sie mich nich’ mehr.«
»Du wolltest zur Armee zurück?«, fragte Merysan überrascht. Das hatte er nicht gewusst.
»Hab’s versucht. Aber nachdem ich drei ander’n Soldat’n bei ein’r Keilerei ein paar Knoch’n gebroch’n hab’, hab’n sie mich wied’r weggeschickt. Vielleicht sollt’ ich in die Arena, wie Lohray.«
»Vielleicht solltest du das.«
»Willst mich wohl loswerd’n, was?«
Merysan schüttelte den Kopf. »Warum sollte ich? Du kostest mich ja nur den Großteil meines Einkommens.« Er lachte. Crohn fiel mit ein.
»Entschuldigung?«
Merysan sah auf. Ein junger Mann war an ihren Tisch getreten.
»Ja?«, machte Merysan.
»Ihr seid Merysan der Schwarze, oder?«
Merysan seufzte, nickte dann aber. »Der war ich mal, aber heute nicht mehr. Nur noch Merysan. Wieso? Was willst du?«
»Ich bin der Vater von Sarl, dem Jungen, der vermisst wird. Sicher habt Ihr schon von ihm gehört?«
Merysan nickte und sah Crohn an.
Dieser ergriff seinen Becher und leerte ihn in einem Zug. »Traurige Sache«, meinte er, sah den Becher stirnrunzelnd an und setzte ihn noch einmal an die Lippen, um auch noch die letzten Tropfen aus ihm herauszuholen. Sein Tonfall machte deutlich, dass er es viel trauriger fand, dass der Becher bereits wieder leer war, als dass der Junge verschwunden war.
»Ich habe mich gefragt, ob Ihr – als großer Held und Krieger – meinen Jungen nicht zurückbringen könntet?«
Merysan schüttelte traurig den Kopf. »Ich bin kein Held – und Krieger bin ich auch keiner mehr, tut mir leid.«
»Tu nich’ so bescheid’n«, grunzte Crohn und schlug Merysan auf die Schulter. »Natürlich is’ er ein Held, genau wie ich. Wills’ du das nich’ mehr?« Er deutete auf Merysans Bierkrug, der noch fast voll war. Merysan runzelte die Stirn und schob ihn dann Crohn hin, der ihn dankbar ergriff und an die Lippen führte.
»Ja«, sagte der Mann schüchtern, »ich meinte natürlich euch beide. Ich meine … ich habe gehört, Ihr wärt der beste Fährtenleser des Reiches. Vielleicht könntet Ihr versuchen, meinen Sohn aufzuspüren. Natürlich gegen Bezahlung, ich …«
Crohn setzte den Humpen krachend ab, packte den Mann am Ärmel und zog ihn auf einen Stuhl herab. »Geg’n Bezahlung? Warum sags’ du das nich’ gleich, Mann? Natürlich bin ich dabei. Und Merysan auch, nich’ wahr?«
Merysan schüttelte erneut den Kopf. »Was mit deinem Sohn passiert ist, tut mir leid, aber diese Zeiten liegen hinter mir. Ich bin 62 und meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich bin mir sicher, du findest fähigere Männer im Dorf.«
»Fähigere als Merysan den Schwarz’n, und Crohn den Amboss?« Crohn lachte dröhnend. »Da kanns’ du lange such’n, Bursche, und das weiß Mery auch. Hör nich’ auf ihn, er is’ imm’r so bescheid’n. Wie viel läss’ du denn spring’n, wenn wir dir dein Balg zurückbring’n?«
»Ich habe nein gesagt, Crohn«, sagte Merysan bestimmt.
»Dann mach ich’s eben allein.« Crohn stand schwankend auf. »Wie viel läss’ du denn nun spring’n, Klein’r?«
»Ich … also … wenn Ihr mir meinen Sohn zurückbringt, dann … ich habe leider nicht viel, aber ich kann zehn Thanar zusammenbringen, denke ich.«
»Zehn Thanar?« Crohn lachte. »Dafür wisch ich mir nich’ mal den Arsch ab, Freundchen. Mach fünfzig draus und wir sind im Geschäft.«
»Fünfzig Thanar?« Der Mann erbleichte und sah unglücklich zwischen Merysan und Crohn hin und her. »Ich … ich habe …«
»Dann is’ es abgemacht«, dröhnte Crohn und ging mit schwankenden Schritten Richtung Tür. »Ich geh’ piss’n und dann geht’s los. Komms’ du, Mery?«
Crohn verließ die Taverne und Merysan blieb kopfschüttelnd zurück. Der junge Mann sah verstört zwischen der Tür und Merysan hin und her. Schließlich erhob er sich, blieb dann aber stehen und sah unglücklich wieder zu Merysan hinab.
»Ich weiß, Ihr denkt, Ihr wärt zu alt dafür«, sagte er dann, »aber die Wahrheit ist, Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das ganze Dorf hat schon nach ihm gesucht, und Ihr lebt da oben in den Bergen. Niemand kennt die Gegend so gut wie Ihr. Nichts gegen den Amboss«, fügte er schnell hinzu, »ich weiß, er ist ein gefürchteter Kämpfer, aber …«
»Er wird deinen Sohn nicht finden. Und vermutlich stürzt er da draußen in einen Bach und ersäuft, wenn ich ihm nicht hinterhergehe.« Merysan seufzte und stand auf. »Na schön, ich seh’ mir die Spur einmal an. Aber ich will kein Geld dafür haben. Zeig mir, wo er zuletzt gesehen wurde.«
3
Worina betrat die Waldlichtung und warf die gesammelten Äste zu Boden. Dann ergriff sie eines der Holzscheite und legte es aufs Feuer, das Sana entzündet hatte. Diese ging unruhig daneben auf und ab. Immer wieder blickte sie zu den dicht stehenden, beinahe kahlen Bäumen.
Worina setzte sich, strich sich ihr langes Haar aus dem Gesicht und starrte sorgenvoll in die Flammen. Sie hasste dieses Warten. Wenn ihr Vater so lange weg war, hatte sie immer Angst, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Viel lieber wäre sie mit ihm nach Thranhalla gegangen, doch stattdessen hatte dieser ihr befohlen, hier, ein paar Steinwürfe vom Dorf entfernt, zusammen mit ihrer Schwester Sana auf ihn zu warten. Diese hatte sich noch stärker aufgeregt.
»Ich will aber mitkommen«, hatte Sana gemurrt.
»Es ist zu gefährlich«, hatte er wie immer geantwortet. »Wenn deine Augenklappe verrutscht, dann …«
»Das tut sie schon nicht. Ich pass auf«, flehte Sana. »Ich will auch wieder mal in die Taverne. Ich will ein Bier trinken und den Händlern zuhören, wie sie von ihren Reisen erzählen. Ich will die jungen Männer im Dorf sehen und den Kindern beim Spielen zuschauen und …«
»Ich habe gesagt, Nein.« Ihr Vater sah sie finster an. »Heute nicht. Ich habe euch schon einmal mitgenommen, und ich werde euch wieder mitnehmen, doch nicht heute.«
»Das letzte Mal ist Jahre her«, maulte Sana. »Bitte, Vater!«
Doch Merysan blieb hart. Er schüttelte den Kopf. »Je älter ihr werdet, desto gefährlicher wird es. Ihr seid schön. Ihr werdet die Blicke junger Männer auf euch ziehen. Wenn jemand hinter euer Geheimnis kommt, holt euch der Tempel. Willst du das?«
»Nein, natürlich nicht, aber ich habe auch keine Lust, stundenlang Waren für dich herumzutragen und mich dann so kurz vor dem Ziel hinzusetzen und dir den ganzen Spaß allein zu überlassen.«
»Waren für mich herumtragen?« Die Augen ihres Vaters wurden schmal und nahmen jenen stechenden, unerbittlichen Ausdruck an, der ihr anzeigte, dass sie einen Schritt zu weit gegangen war. »Denkst du, ich mache das für mich? Denkst du, ich lebe zum Spaß abgeschieden von aller Welt in den Bergen oben?«
»Tut mir leid, dass wir sind, wie wir sind«, sagte Sana beleidigt. »Sag doch gleich, dass du bereust, dass du uns gekriegt hast.«
Ihr Vater seufzte, der strenge Blick wurde sanfter. Ein trauriger Zug legte sich um seinen Mund. Er legte Sana die Arme auf die Schultern. Sie sah trotzig zu Boden. Er ergriff ihr Kinn und hob es an, so dass sie ihm in die Augen sehen musste.
»Ihr beide seid mein größter Schatz. Ich würde euch nie hergeben wollen. Doch genau deshalb müssen wir so vorsichtig sein. Ich kann euch nicht verlieren!«
»Das wirst du auch nicht, wir …«
»Nein.« Er wandte sich ab, schulterte den Rucksack und die anderen Bündel und ging. »Ihr wartet hier auf mich. Ich bin bald zurück. Und denkt an die Zeichen.«
Ein Stein schoss haarscharf an Worinas Gesicht vorbei. Sie schrak aus ihren Gedanken hoch und sah auf.
»’tschuldige«, nuschelte Sana. »Ich wollte den Stein nicht in deine Richtung kicken, ich …«
»Er hat recht, weißt du?«, sagte Worina leise. Sie hatte denselben schlanken Körper wie Sana, dieselben langen braunen Haare, dasselbe schmale Gesicht mit den leicht hervorstehenden Wangenknochen, ein braunes und ein weißes Auge, doch bei ihr war im Gegensatz zu Sana das linke Auge weiß.
»Ich weiß, dass er recht hat«, fuhr Sana auf, »doch das heißt noch lange nicht, dass wir ihm deshalb gehorchen müssen. Was ist denn das für ein Leben? Sollen wir uns bis zu unserem Tod in den Bergen oben verstecken, nur weil wir anders sind?«
»Wir haben es doch schön dort oben, und …«
»Sag bloß, du wünschst dir keinen jungen Mann, mit dem du ins Bett steigen kannst!« Sana grinste.
»Nein, das tue ich nicht«, sagte Worina, obschon sie sich schon manches Mal genau das gewünscht hatte. Doch das würde sie vor ihrer Schwester nicht zugeben. »Aber ich würde gerne mehr von der Welt sehen als den Wald und den Berg.«
»Dann lass es uns tun. Lass uns fortgehen. Nur wir zwei. Wir können schon auf uns aufpassen, und …«
»Fortgehen? Ohne Mutter und Vater? Bist du verrückt? Es würde unseren Eltern das Herz brechen. Und mir auch.«
»Dann gehe ich eben allein«, knurrte Sana. »Ich werde nicht mein ganzes Leben aus lauter Angst verschwenden. Ich …«
Ein Pfiff erklang aus dem Wald vor ihnen. Worina erstarrte und sah Sana an. Sie wartete, ob noch ein weiteres Zeichen erklänge, doch es blieb bei dem einen Pfiff.
Das Zeichen, die Augenklappe aufzusetzen.
Vater brachte also jemanden mit. Rasch setzten die beiden Schwestern ihre Augenklappen aus schwarzem Leder auf und verdeckten damit ihre weißen Augen. Nicht lange danach trat Merysan auf die Lichtung. Sein Gang war wie stets aufrecht und stolz, seine schlanke, drahtige Gestalt angespannt. Der Blick seiner klaren, stahlgrauen Augen ging prüfend zu den Gesichtern seiner Töchter, um zu kontrollieren, ob ihre Augenklappen richtig saßen. Nach ihm kamen zwei weitere Männer. Einer war ein wahrer Riese. Er war gut zwei Köpfe größer als ihr Vater und fast doppelt so breit. Worina kannte und mochte ihn. Er hatte sie ein paar Mal zuhause besucht. Crohn der Amboss, einer der Helden des Tempelsturms. Der andere war klein, hatte einen Dreitagebart, ein eingefallenes, trauriges Gesicht und Ringe unter den Augen.
»Das sind meine Töchter, Sana und Worina«, sagte ihr Vater, deutete dann auf den kleinen Mann und ergänzte: »Das ist Tanald. Sein Sohn ist verschwunden. Wir werden versuchen, ihn zu finden.«
»Crohn!«, rief Sana, ging auf ihn zu und umarmte ihn.
Crohn erwiderte die Umarmung, hob Sana hoch, so dass sie einen überraschten Laut von sich gab, und setzte sie dann wieder ab.
»Sana«, sagte der Riese. »Was bis’ du gewachs’n sei’ dem letzt’n Mal. Du bis’ ja eine richtige Frau geword’n. Und Worina auch.«
Worina ging zu Crohn und umarmte ihn ebenfalls. Er stank nach Bier, aber das störte sie nicht. Er drückte sie, dass ihr fast die Luft wegblieb, schob sie dann von sich und nickte anerkennend. »Was has’ du für schöne Mädch’n hervorgebracht, Mery«, sagte er dann. »Fast möchte man mein’n, sie wär’n von mir.« Er lachte dröhnend. Merysan verdrehte die Augen und wandte sich dann an den kleinen Mann.
»Also, zeig uns, wo der Junge zuletzt gesehen wurde und wo ihr seine Spur verloren habt.«
Der Mann nickte, und nachdem sie das Feuer gelöscht hatten, führte er die kleine Gruppe nordwärts.
»Was machst du hier, Onkel Crohn?«, fragte Worina, nachdem sie losmarschiert waren. »Letztes Mal hast du uns doch erzählt, du würdest in den Süden gehen, um dir eine Frau zu suchen?«
Crohn lachte bitter. »Da wollte mich ab’r keine, Kleines. Hab’ dann versucht, mich als Söldn’r zu verding’n, ab’r is’ schwierig. Seit das Vereinigte Darische Reich letzt’s Jahr die Karhyt’n bei Loren vernicht’nd geschlag’n hat, herrscht Fried’n da unt’n. Söldn’r werd’n da nich’ gebraucht. Also bin ich zurück in den Nord’n zur Armee.«
»Sieht aber nicht so aus, als wärst du Soldat.«
Crohn grunzte und zuckte mit den Schultern. »Weil sie mich dort auch nich’ wollt’n. Also dachte ich mir, ich statte Merysan und euch mal wied’r einen Besuch ab.«
»Also wohnst du nun wieder in Thranhalla?«
»Das will ich mein’n.«
»Wie lange bleibst du diesmal?«
»Nicht lange«, knurrte Merysan von vorne. Offenbar hatte er ihr Gespräch mit angehört.
»Freus’ du dich denn nich’, mich zu seh’n?«, fragte Crohn beleidigt.
»Deine Anwesenheit hat die Angewohnheit, meine Börse schneller zu leeren, als ich Tiere jagen und Bögen herstellen kann«, meinte Merysan. »Du solltest dir ein richtiges Zuhause und eine Beschäftigung suchen.«
»Aber das hab’ ich doch.« Crohn holte zu Merysan auf und klopfte ihm so hart auf die Schulter, dass dieser zusammenzuckte. »Hier is’ mein Zuhause. Ich werde dir bei der Jagd helf’n und beim Bogenbau und …«
»Kommt nicht in Frage.« Merysan war stehen geblieben und funkelte den Größeren wütend an. »Ich habe dir schon mehrmals gesagt, dass du nicht bei uns leben kannst. Bau dir selbst ein Leben auf, Mann!« Merysan wandte sich um und ging weiter.
»Aber … Mery!« Crohn blieb noch einen Moment stehen, dann setzte er sich auch wieder in Bewegung. »Ich verstehe dein’n Vat’r einfach nich’, Worina«, sagte er dann und schüttelte den Kopf. »Warum is’ er imm’r so abweis’nd?«
Worina zuckte mit den Schultern. »Er … ist ein Eigenbrötler. Und er hat Angst um uns Mädchen. Als ob wir uns nicht selbst verteidigen könnten«, schnaubte sie.
»Aber genau dabei könnte ich doch helf’n«, sagte Crohn. »Ich würde es mit jed’m aufnehm’n, der euch etwas antun möchte.«
»Ich weiß, Onkel Crohn, aber … es geht nun mal nicht.«
Tanald führte sie durch den Wald bis zu einer kleinen Lichtung, durch die der Schleierbach floss.
»Hier wurde Sarl das letzte Mal gesehen«, sagte er. »Er und Digor haben da gespielt. Digor ist aber früher nach Hause gegangen und Sarl blieb allein zurück. Wir haben seine Spur dann weiter nach Westen verfolgt.« Tanald ging an den westlichen Rand der Lichtung und deutete tiefer in den Wald hinein.
Sana und Merysan folgten dem Mann und untersuchten den Boden an jener Stelle, doch Worina sah sofort, dass die Spuren des Jungen längst nicht mehr sichtbar waren. Zu viele andere Abdrücke überlagerten sie. Vermutlich von den Männern, die sie gesucht hatten. Ihr Vater schien zu dem gleichen Schluss gekommen zu sein, denn er nickte Tanald zu und sagte: »Führ uns zu der Stelle, wo ihr seine Spur verloren habt.«
Tanald nickte und führte sie westwärts. Der kleine Mann folgte dem Lauf des Baches einige Dutzend Schritt, ehe er innehielt, sich etwas orientierungslos umsah und dann auf das Gewässer deutete. »Ich glaube, hier haben wir seine Spur verloren«, sagte er dann.
»Hier schon?« Merysan runzelte die Stirn.
»Ja.« Tanald sah beschämt zu Boden. »Ich sagte ja, dass wir in diesen Dingen nicht sehr bewandert sind. Deswegen brauchen wir Euch. Ich glaube, Sarl ist in den Bach gestiegen. Wir haben die Umgebung abgesucht, aber keine weiteren Spuren mehr gefunden.«
»Na schön.« Merysan nickte. »Wir werden sehen, was wir tun können. Du kannst ins Dorf zurückgehen.«
»Ich … ich würde eigentlich gerne mit Euch gehen.«
»Nein, du kannst nicht mit uns kommen.« Merysan warf Worina einen besorgten Blick zu. »Wir machen das allein. Wir geben dir Bescheid, falls wir ihn finden.«
»Aber, ich …«
Merysan schüttelte streng den Kopf und Tanald verstummte.
»Ich verstehe. Danke, dass Ihr es versucht, das bedeutet mir viel.« Er nickte, drehte sich um und ging.
»Also schön, dann lass uns mal seh’n«, sagte Crohn und stapfte zum Bach, doch Merysan hielt ihn zurück.
»Du bleibst hier. Beweg dich am besten nicht von der Stelle, sonst zertrampelst du uns am Ende noch die Spuren – falls denn noch welche sichtbar sind.«
»Ab’r … was soll ich dann tun?«
»Nichts. Falls wir das Ungeheuer finden, kannst du dagegen kämpfen. Bis dahin … bleib einfach hinter uns.«
Crohn brummte etwas, ging zu einem dicken Baum und setzte sich dann mit dem Rücken an den Stamm hin.
Sana, Worina und Merysan begannen, die Umgebung nach Spuren abzusuchen. An der Stelle, wo Tanald sie hingeführt hatte, war alles zertrampelt und sie konnten keine einzelnen Abdrücke mehr ausmachen. Also suchten sie in immer größeren Kreisen die Umgebung ab, Worina und Sana diesseits und Merysan jenseits des Baches.
Merysan hatte Sana und Worina alles gelehrt, was er übers Spurenlesen wusste, und mittlerweile waren sie fast genauso gut wie ihr Vater, wenn nicht sogar besser. Vor allem Sana. Er besaß zwar mehr Erfahrung, doch seine Augen ließen nach, wie Worina wusste, und oftmals sahen sie oder ihre Schwester kleine Dinge, die seine Augen nicht mehr wahrnahmen. Dafür wusste er besser, wo man hinschauen oder wonach man suchen musste.
Worina blickte zurück zu Crohn, der am Baum lehnte, die Augen geschlossen, den Mund halb geöffnet. Sie wusste, warum Merysan ihm nicht gestattete, bei ihnen zu leben. Er wollte nicht, dass Crohn hinter das Geheimnis ihrer Augen kam. Ihr Vater hatte Angst, der große Mann würde es irgendwann im Suff ausplaudern. Und vermutlich hatte er recht. Dennoch tat ihr der Riese leid. Er hatte nirgends seinen Platz in dieser Welt, und Merysan war ihm wie ein Bruder. Vermutlich der Einzige, der ihm noch geblieben war.
Worina runzelte die Stirn. Vor ihr wies das Unterholz, das hier aus schritthohen Blaudornbüschen und Riesenholundersträuchern bestand, eine Unregelmäßigkeit auf: Ein Blaudornstrauch hatte zwei abgebrochene Äste. Sie näherte sich dem Busch und besah vorsichtig den Untergrund rundherum. Tatsächlich fand sie einige Vertiefungen vor, die von kleinen menschlichen Füßen stammen konnten. Sorgsam darauf bedacht, die Spuren nicht zu zerstören, folgte sie ihnen, passierte die Sträucher mit den abgebrochenen Ästen und entdeckte weitere, identische Abdrücke im feuchten Untergrund. Den Abständen der Spuren nach zu urteilen, musste der Junge gerannt sein. War er vor etwas geflüchtet oder hatte er selbst etwas verfolgt? Ein Tier vielleicht? Sie hielt inne, als sie an eine steil abfallende Felswand kam. Der Boden lag vielleicht fünf Schritt weiter unten. Hier endeten die Spuren. Sie sah hinunter und schauderte. War der Junge hier abgestürzt? Wenn er wirklich gerannt war, wäre es möglich, dass er nicht rechtzeitig hatte anhalten können.
Sie blickte hinab. Unter ihr sah der Waldboden härter aus, war mit kleinen Steinchen versehen. Wenn er hier hinabgefallen war, hatte er sich ziemlich sicher verletzt. Sie entschied, dass sie genug gesehen hatte, um die anderen zu informieren, steckte zwei Finger in den Mund und pfiff zweimal laut. Sie erhielt zwei Pfiffe zur Antwort, einen von rechts und einen von links. Sie pfiff erneut zweimal und wartete dann, bis erst Sana und etwas später Merysan mit Crohn im Schlepptau sie erreichten.
»Hast du ihn gefunden?«, wollte Sana wissen.
Worina deutete hinab. »Ich habe eine Spur von kleinen menschlichen Abdrücken gefunden, die hier endet. Ich denke, der Junge ist hier abgestürzt. Wir sollten runtergehen und uns dort umsehen.«
Merysan nickte anerkennend. »Gut gemacht, Worina.«
Worina ging einige Schritte nach rechts, um allfällige Spuren unter sich durch ihren Sprung nicht zu zerstören. Dann ließ sie sich auf die Knie herab, ergriff die Felskante mit den Fingern und ließ sich langsam über den Abgrund gleiten, bis sie ganz ausgestreckt darüber hing. Sie ließ sich fallen, rollte sich ab und kam in einer fließenden Bewegung wieder auf die Beine. Sana und ihr Vater folgten ihrem Beispiel, während Crohn einfach runtersprang. Der Boden schien zu erbeben, als er landete. Worina ging langsam zu der Stelle hin, wo der Junge aufgekommen sein musste, falls er denn wirklich hier abgestürzt war. Der Boden war hier härter als weiter oben, und es war schwieriger, Abdrücke zu erkennen. Dennoch entdeckte sie sofort eine Stelle, an welcher der Boden etwas eingedrückt war.
»Hier ist er hingefallen«, sagte sie und deutete darauf.
»Da ist etwas Blut.« Sana deutete nach rechts, wo Worina nun auch Steinchen mit getrocknetem Blut erkennen konnte.
»Sieht aus, als wäre er weggekrochen«, sagte Merysan und deutete auf die Schleifspuren, die von der Stelle des Absturzes aus weiter nach Westen führten.
Sie folgten den Spuren und bald wurde der Boden wieder weicher, so dass die Abdrücke wieder besser sichtbar wurden. Doch schon nach kurzer Zeit brachen sie ab. Dafür sah Worina etwas anderes. Etwas, das sie nur aus der Erzählung Sanas kannte.
»Sind das dieselben Spuren, von denen du mir berichtet hast?«, fragte Merysan seine Tochter und deutete auf die riesigen Abdrücke menschenähnlicher Füße, die dort zu sehen waren, wo die Spuren des Jungen abbrachen.
»Ja«, wisperte Sana mit erstickter Stimme.
Das Ungeheuer hatte ihn also tatsächlich erwischt. Worina mochte sich nicht vorstellen, was es dem Jungen angetan hatte. »Was mag solche Spuren verursachen, Vater?«, fragte sie sichtlich beeindruckt. »Ich habe noch nie zuvor sowas gesehen.
»Ich auch nicht«, erwiderte Merysan und runzelte die Stirn, während seine Finger den Rändern der riesigen Abdrücke entlangfuhren. Worina sah, wie er einen besorgten Blick mit Crohn tauschte.
»Was auch imm’r es is’«, meinte der, »es hat größere Latsch’n als ich, un’ das will was heiß’n.«
Merysan richtete sich auf und ging wortlos in die Richtung, in welche die Spuren führten. Bedrückt folgten sie ihm.
»Ich habe Angst«, flüsterte Worina.
»Vor dem Ungeheuer?«, fragte Sana.
Worina schüttelte den Kopf, dann nickte sie. »Das auch, aber vor allem davor, was wir finden werden. Der arme Junge.«
Sana nickte traurig. »Ich habe den Hirsch gesehen, den die Bestie gerissen hat.« Sie schluckte. »Der Junge ist tot. Wir können nur hoffen, dass er schnell gestorben ist.«
»Es wird bald dunk’l«, sagte Crohn hinter ihnen. Seiner Stimme war anzuhören, dass er die Lust an dem Abenteuer längst verloren hatte. »Vielleich’ sollt’n wir umkehr’n.«
Merysan schüttelte den Kopf. »Du wolltest den Jungen suchen, Crohn. Jetzt suchen wir ihn.«
»Und wenn es dunk’l wird? Ich hab’ keine Fack’l dabei.«
»Ich schon.« Merysan deutete auf seinen Rucksack. »Sag bloß, du fürchtest dich im Dunkeln?«
»Ich fürchte mich vor gar nichts«, empörte sich Crohn. »Has’ du zufällig’rweise was zu trink’n dabei?«
Merysan seufzte und reichte Crohn seinen Wasserschlauch. Der nahm einen tiefen Zug und spuckte das Wasser dann angewidert aus.
»Das is’ ja Wasser!«
»Natürlich. Was hast du denn erwartet?«
»Wein natürlich! Has’ du kein’n Wein dabei?«
»Tut mir leid, Hochwürden, aber damit kann ich nicht dienen.«
Crohn grunzte und reichte Merysan den Wasserschlauch zurück. »Da, behalt dein Wass’r. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich selbst welch’n mitgenomm’n.«
»Und womit hättest du ihn bezahlt?«
Crohn sah Merysan finster an, sagte aber nichts mehr.
Sie gingen weiter. Das Gelände wurde nun felsiger, der Wald lichter. Es dauerte gut eine Viertelstunde, ehe Merysan innehielt und nach vorne deutete. Worinas Blick folgte seinem Arm. Im letzten Licht des Tages sah sie, wie sich vor ihnen, vielleicht noch hundert Schritt entfernt, gewaltige Felsbrocken auftürmten. Am Fuß der Felswand war eine schwarze Öffnung auszumachen – eine natürliche Höhle.
»Die Spuren scheinen geradewegs dorthin zu führen«, sagte Merysan. Er nahm seinen Bogen von der Schulter, spannte die Sehne und nahm einen Pfeil aus dem Köcher. Sana und Worina taten es ihm gleich, während Crohn sein Schwert zog. Es war eine schöne Waffe mit einem roten Stein im Knauf, doch sie war schartig und man sah ihr an, dass sie ihre besten Zeiten längst hinter sich hatte – genauso wie ihr Träger.
Sie näherten sich der Höhle vorsichtig. Worinas Blick flog zwischen den Abdrücken und dem Eingang hin und her. Die Spuren vor der Höhle mehrten sich. Es war eindeutig, dass das Biest diesen Ort mehrmals betreten hatte oder sogar darin hauste.
Ein Schauer fuhr Worina über den Rücken. Was, wenn das Ungeheuer da war? Was, wenn es in der Höhle lauerte, auf sie wartete und in ihnen ihre nächste Mahlzeit sah? Angst durchflutete sie. Ihr Blick ging zu Sana, die rechts von ihr war. Auch in ihrem Gesicht war Furcht zu sehen. Nervös fuhr sie sich mit dem Handrücken über die Augenklappe, unter der sich das weiße Auge und ihre Narbe befanden. Merysan ging vor ihr, sein Gesicht konnte sie nicht sehen, doch sein Körper war angespannt, sein Pfeil auf den Eingang der Höhle gerichtet. Crohn befand sich an ihrer linken Seite, das Schwert halb erhoben. Seine trüben Augen blickten nun wachsam umher.
Sie erreichten die Höhle, ohne dass etwas passierte. Merysan hielt kurz inne und spähte hinein, doch es war so dunkel im Inneren, dass er unmöglich etwas erkennen konnte. Rückwärts gehend kam er zu ihnen zurück, ohne die Höhle aus den Augen zu lassen.
»Richtet eure Pfeile auf den Eingang«, wisperte er Sana und Worina zu, während er selbst Bogen und Pfeil wegsteckte, den Rucksack vom Rücken nahm und zwei Fackeln herauszog. »Wenn es rauskommt, schießt, ohne zu zögern.«
Worina nickte und schluckte. Sie behielt den Eingang im Auge, den Pfeil darauf gerichtet. Ihre Hände begannen zu zittern. Sie hoffte, dass das Biest nicht in der Höhle war. Es kam ihr vor wie eine Ewigkeit, bis ihr Vater mithilfe des Feuersteins endlich die Fackeln entzündet hatte.
»Steckt den Bogen weg und zieht den Dolch!«, sagte Merysan. »Da drin werdet ihr keinen Platz haben, einen Pfeil abzuschießen.«
Sie beeilten sich, seiner Anweisung Folge zu leisten. Merysan reichte eine der Fackeln Worina und zog dann seinen eigenen Dolch, ein armlanges, beidseitig geschliffenes Messer. Dann drehte er sich um und ging zum Höhleneingang.
Doch Crohn drängte sich an Worina vorbei, packte Merysan an den Schultern und stieß ihn zurück.
»Ich geh’ zuerst«, sagte er. »Halt dich hint’r mir, leuchte und beschütze die Mädch’n!«
Merysan nickte, dann betraten sie die Höhle. Finsternis breitete sich um sie wie ein wallender Mantel. Worina brauchte einen Moment, ehe ihr Auge sich an die vorherrschende Dunkelheit und die beiden kleinen Lichtschimmer ihrer Fackeln gewöhnt hatte. Vor sich schälten sich die Umrisse ihres Vaters und Crohns aus der Schwärze heraus. Ein leicht modriger Geruch stieg ihr in die Nase. Sie umklammerte den Griff ihres Dolches und wischte sich mit der anderen Hand den Schweiß von der Stirn. Die Höhle verbreiterte sich hinter dem Eingang, doch das Licht der Fackel vermochte nicht mehr als zwei Schritt in alle Richtungen zu erhellen. Als sie einige Schritte gegangen waren, sah Worina am anderen Ende der Höhle einen kleinen Lichtfleck. Offenbar gab es dort ebenfalls einen Ausgang.
»Da is’ was«, hörte sie die grollende Stimme Crohns vor sich. Sie hallte durch die Dunkelheit und kehrte als Echo zu ihr zurück. Worina spannte sich. Ganz langsam gingen sie weiter. »Das is’ …« Crohn blieb stehen.
Worina trat neben ihn, den Dolch abwehrbereit erhoben. Dann hielt auch sie überrascht inne. Aus dem Licht der Fackeln hatte sich ein Bündel geschält, das auf dem Boden lag. Es war der Junge. Und er lebte! Aus schreckgeweiteten Augen starrte er sie an.
»Junge!«, sagte Merysan. »Bist du verletzt?«
Der Knabe starrte ihn verständnislos an, dann begann er zu weinen. Worina ging neben ihm in die Knie und strich ihm übers Haar, doch er zuckte zusammen und rutschte von ihr weg. Dabei sah sie, dass sein rechtes Bein mit einem Stock geschient worden war. Das Holzstück war mit den Überresten von Kleidungsstücken an sein Bein gebunden worden. Sie blickte auf.
»Wir müssen ihn nach Hause bringen«, sagte sie. Crohn nickte, steckte sein Schwert weg und wollte den Jungen hochheben, doch der Knabe wehrte sich und schlug wild um sich.
»Junge!«, donnerte Crohn und verwarf hilflos die Hände. »Ich will dir doch nur helf’n. Dich zurück zu dein’r Familie bring’n.«
Worina legte Crohn die Hand auf den Arm. »Es bringt nichts, wenn du ihn anschreist«, sagte sie. »Ganz ruhig«, hauchte sie dem Knaben sanft zu. »Das ist Onkel Crohn. Er ist ein guter und starker Mann. Er wird dich nach Hause tragen, in Ordnung? Er wird dich zu deinem Papa und deiner Mama bringen, versprochen.«
Beim Klang von Worinas sanfter Stimme schien sich der Knabe etwas zu beruhigen. Sein Weinen ging in ein beinahe lautloses Schluchzen über, ehe er nickte und es zuließ, dass Crohn ihn aufhob. Kurz schrie er schmerzerfüllt auf, als sein verletztes Bein gegen Crohns Hüfte schlug, dann verfiel er wieder in sein leises Schluchzen.
»Also gut«, sagte Merysan. »Raus hier.« Er ging voran, Richtung Ausgang. Doch er war noch nicht weit gekommen, als sich ein Schatten vor den hellen Lichtfleck schob, der ihnen anzeigte, wo es nach draußen ging. Ein Knurren ertönte, das Worina durch Mark und Bein fuhr.
Das Ungeheuer.
Ihr Vater schien es im selben Moment wahrzunehmen.
»Zurück!«, rief er. »Zur anderen Seite!«
Der Schatten begann sich zu bewegen, schneller, als Worina es ihm zugetraut hatte. Sie drehte sich um und stolperte im Dunkeln hinter Crohn und Sana her, die bereits dem anderen Ende der Höhle entgegenrannten. Das Knurren hinter ihr wurde lauter, klang nun bedeutend näher als zuvor. Worina stolperte über einen Stein, verlor das Gleichgewicht und fiel der Länge nach hin. Ihr Kinn kollidierte unsanft mit dem Boden. Ein Ruck ging durch ihren Kopf. Für einen kurzen Moment schwanden ihr die Sinne. Sie schmeckte Blut in ihrem Mund, ihr Kopf dröhnte, hinter ihrer Stirn pochte es dumpf. Jemand ergriff sie am Arm, zog sie wieder auf die Füße.
Vater!
»Weiter!«, zischte er.
Sie taumelte neben ihrem Vater her in Richtung des immer größer werdenden Lichtflecks auf der anderen Seite der Höhle, während das Knurren hinter ihr immer lauter wurde. Die Schatten, die das Licht der Fackel in Merysans Hand warf, tanzten auf dem steinigen Höhlenboden hin und her. Worina hatte Mühe, nicht erneut zu stolpern und hinzufallen, während sie auf dem unebenen Boden weiterrannte. Sie waren noch ein gutes Dutzend Schritt vom Ausgang entfernt, als Worina die Kreatur hinter sich riechen konnte. Ein fürchterlicher Gestank – eine Mischung aus Schweiß, Blut und Verwesung – drang an ihre Nase. Ihr wurde übel. Sie beschleunigte ihre Schritte und hastete ins Freie. Da fühlte sie, wie ihr Merysans Hand entglitt. Als sie über die Schulter sah, erkannte sie, dass er beim Ausgang stehen geblieben war und sich zu dem nahenden Ungeheuer umgedreht hatte.
»Vater!«, schrie sie und wollte ebenfalls innehalten, doch er schüttelte grimmig den Kopf.
»Geh!«, zischte er: »Ich halte es auf!«
»Nein!«, kreischte sie verzweifelt.
»Geh!«, rief er erneut und diesmal hörte sie die Angst in seiner Stimme. Angst um sie, realisierte sie, nicht um sich selbst. Sie schluckte ihre eigene aufkeimende Panik herunter, blieb stehen und wollte sich neben ihn stellen, doch da erst merkte sie, dass sie beim Sturz ihren Dolch fallen gelassen hatte. Rasch nahm sie den Bogen von der Schulter und wollte einen Pfeil einlegen, da hatte die Bestie ihren Vater bereits erreicht. Die Sonne war mittlerweile untergegangen. Der Wald rund um sie herum war in ein düsteres Dämmerlicht getaucht. Vor ihr warf Merysans Fackel tanzende Schatten auf die Felsen rund um den Höhleneingang. In diesem trügerischen Licht sah sie eine riesige Gestalt aus der Höhle kommen. Vor ihr wirkte ihr Vater wie ein kleines Kind. Worina sah dichtes, dunkles Fell, lange Klauen und spitze Zähne im Licht der Fackel aufblitzen. Für seine Größe bewegte es sich rasend schnell. Eine ihrer Klauen fuhr auf Merysan hernieder, der ihr jedoch auswich und seinerseits mit seinem langen Dolch zustieß. Das Biest heulte schmerzerfüllt auf, als die Klinge ihm die Seite aufschnitt. Dennoch erfolgte der nächste Angriff umgehend. Die andere Klaue fuhr auf Merysan nieder, und diesmal war ihr Vater zu langsam. Sie hörte ihn aufschreien und sah ihn zurücktaumeln, da schoss etwas an ihr vorbei. Das Ungetüm kreischte auf. Ein Pfeil ragte aus seiner Brust. Worina wandte sich um und sah, wie Sana hinter ihr eben einen neuen Pfeil einlegte. Die Kreatur schien die Gefahr ebenfalls erkannt zu haben, die von der jungen Frau ausging, denn sie heulte noch einmal laut auf und zog sich dann in den Schutz der Höhle zurück. Worina rannte zu ihrem Vater, der auf die Knie gesunken war und sich die linke Hand gegen die rechte Schulter presste. Blut sickerte darunter hervor. Er keuchte. Sie half ihm, aufzustehen und führte ihn zu den anderen zurück.
»Was war das?« Sanas Stimme zitterte vor Angst, doch ihr Bogen war gespannt, der Pfeil auf den Höhleneingang gerichtet.
Merysan schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Ahnung.« Worina sah, wie er Crohn erneut diesen seltsamen, beinahe beschwörenden Blick zuwarf, den sie schon zuvor wahrgenommen hatte.
»Es sah aus wie … ich weiß nicht … ein Bär?«, fragte Worina.
»Es war kein Bär«, sagte Merysan. »Obschon es fellbedeckt, massig und groß war. Allerdings habe ich noch nie so einen großen Bären gesehen.«
»Und es ging auf zwei Bein’n.« Crohn runzelte die Stirn. Dann kniff er die Augen zusammen und sah Worina überrascht an. »Dein Auge! Was is’ …? Is’ das … ein Weißauge?«
Worina hob erschrocken die Hand an den Kopf. Ihre Augenklappe war verschoben. Sie musste beim Sturz verrutscht sein. Sie fluchte und schob sie wieder vor das weiße Auge. »Nein, es ist bloß ein zerstörtes Auge«, sagte sie. »Der Schein der Fackeln muss dich getäuscht haben.«
»Ich weiß doch, was ich geseh’n hab’, Mädch’n«, grollte Crohn. »Un’ das war ein weißes Auge. Ich hab’ mein’r Lebzeit genug davon geseh’n. Zu viele«, fügte er noch an.
»Ich …« Worina sah hilflos zu Merysan.
Merysan seufzte. »Du hast sie gehört, Crohn. Sie ist keine Sehende.« Im Gegensatz zu Crohn benutzte er das Wort Sehende, weil er den Begriff Weißauge hasste. Es war die abschätzige Bezeichnung für die Sehenden.
Crohn trat einen Schritt näher. »Dann soll sie die Aug’nklappe nochmal hochheb’n.«
Merysans Blick verhärtete sich. »Genug. Du wagst es, unser Wort anzuzweifeln?«