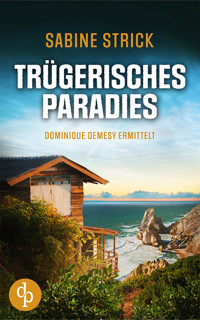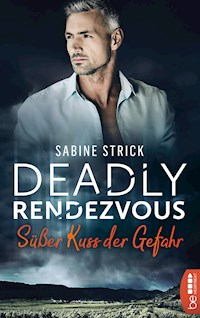5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine verborgene Familiengeschichte und eine tragische Liebe …
Der mitreißende Liebesroman vor der sommerlichen Kulisse Kubas – Jetzt mit Epilog!
Als die junge Kubanerin Lisandra ans Sterbebett ihrer Großmutter Madelin gerufen wird, kann sie kaum glauben, was diese ihr dort berichtet. Lisandras leiblicher Großvater ist kein Kubaner, sondern ein US-Amerikaner, mit dem Madelin während der kubanischen Revolution eine Liebesaffäre hatte. Bevor Madelin enthüllen kann, welches düstere Geheimnis sich hinter der heimlichen Liebe verbirgt, stirbt sie.
Lisandra lässt diese geheimnisvolle Geschichte ihrer Großmutter nicht los und sie begibt sich – von Neugier getrieben – auf die Suche nach Antworten. Nicht nur findet sie das fehlende Puzzleteil – Madelins altes Tagebuch – sie verliebt sich auch Hals über Kopf in den charmanten deutsch-kubanischen Fotografen Andy. Doch er wird Kuba bald verlassen und Lisandra möchte mehr als nur ein kurzes Abenteuer. Dennoch begibt sie sich mit ihm zusammen auf Spurensuche in den Südosten der Insel, ins Jahr 1958. Kann Lisandra die tragische Liebesgeschichte ihrer Großmutter entschlüsseln? Und hat ihre eigene Liebe zu Andy eine Zukunft?
Dies ist eine überarbeitete Neuauflage des bereits erschienenen Titels Der Himmel über Havanna.
Erste Leser:innenstimmen
„Ein berührender Liebesroman über eine junge Frau, die ihren Weg im Leben sucht.“
„Havanna ist ein unglaublich tolles Setting, ich hatte das Gefühl direkt vor Ort zu sein!“
„Lisandras und Madelins Geschichten haben mich von der ersten Seite an gefesselt.“
„Mit der kubanischen Kulisse, den tollen Charakteren und der tiefgehenden Geschichte, ist dieser Roman perfekt für den Sommer …“
„Eine Liebesgeschichte, die ihresgleichen sucht – einfach toll!“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Kurz vorab
Willkommen zu deinem nächsten großen Leseabenteuer!
Wir freuen uns, dass du dieses Buch ausgewählt hast und hoffen, dass es dich auf eine wunderbare Reise mitnimmt.
Hast du Lust auf mehr? Trage dich in unseren Newsletter ein, um Updates zu neuen Veröffentlichungen und GRATIS Kindle-Angeboten zu erhalten!
[Klicke hier, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!]
Über dieses E-Book
Als die junge Kubanerin Lisandra ans Sterbebett ihrer Großmutter Madelin gerufen wird, kann sie kaum glauben, was diese ihr dort berichtet. Lisandras leiblicher Großvater ist kein Kubaner, sondern ein US-Amerikaner, mit dem Madelin während der kubanischen Revolution eine Liebesaffäre hatte. Bevor Madelin enthüllen kann, welches düstere Geheimnis sich hinter der heimlichen Liebe verbirgt, stirbt sie. Lisandra lässt diese geheimnisvolle Geschichte ihrer Großmutter nicht los und sie begibt sich – von Neugier getrieben – auf die Suche nach Antworten. Nicht nur findet sie das fehlende Puzzleteil – Madelins altes Tagebuch – sie verliebt sich auch Hals über Kopf in den charmanten deutsch-kubanischen Fotografen Andy. Doch er wird Kuba bald verlassen und Lisandra möchte mehr als nur ein kurzes Abenteuer. Dennoch begibt sie sich mit ihm zusammen auf Spurensuche in den Südosten der Insel, ins Jahr 1958. Kann Lisandra die tragische Liebesgeschichte ihrer Großmutter entschlüsseln? Und hat ihre eigene Liebe zu Andy eine Zukunft? Dies ist eine überarbeitete Neuauflage des bereits erschienenen Titels Der Himmel über Havanna.
Impressum
Überarbeitete Neuausgabe Mai 2023
Copyright © 2025 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-98778-364-7 Taschenbuch-ISBN: 978-3-98778-443-9
Copyright © 2019, dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2019 bei dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH erschienenen Titels Der Himmel über Havanna (ISBN: 978-3-96087-486-7).
Covergestaltung: Mirja Bülow unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com: © Taiga, © tomarillo, © t_korop, © Sabino Parente, © gan chaonan, © Elena Efimova, © Lori Martin Lektorat: Martin Spieß
E-Book-Version 28.05.2025, 13:58:40.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
TikTok
YouTube
Im Schatten des Zuckerrohrs
1
Havanna, Februar 2015
Lisandra
Eine große Welle des Atlantiks brach sich krachend an der steinernen Mauer der Uferpromenade Malecón, und die Gischt spritzte weit hinauf zu den Touristen und Einheimischen, die dort saßen und in die Sonne blinzelten.
Mit einem kleinen Aufschrei rutschte Lisandra von der hüfthohen Mauer und wich zurück, aber es war bereits zu spät. Das Meerwasser war gegen ihre rechte Körperhälfte geklatscht und hatte sie durchnässt.
Ihre Freundin Alina, die rechtzeitig in Deckung gegangen war, lachte. „Du wirst es nie lernen, oder?“
„Ich brauchte sowieso eine Dusche.“ Lisandra wischte sich die salzigen Tropfen aus dem Gesicht und wrang die nassen Strähnen ihrer überschulterlangen, dunkelbraunen Locken aus. Ihre Bluse klebte nass an ihrer Brust, aber zum Glück trug sie ein Bikinioberteil darunter.
Auf einmal bemerkte sie ein Frotteehandtuch, das ihr jemand hinhielt. Sie sah zur Seite und blickte in ein lächelndes Männergesicht. „Sieht so aus, als könntest du das brauchen, Señorita.“
„Danke. Spazierst du immer mit einem Handtuch unterm Arm durch Havanna?“, fragte sie spöttisch und begann ihre nassen Arme zu trocknen.
„Ja, so versuche ich, nass gewordene Habaneras kennenzulernen“, erklärte er ernsthaft, aber mit Schalk in den cognacbraunen Augen.
Lisandra lachte auf und rieb mit dem Handtuch über die nassen Stellen ihrer Bluse. „Und funktioniert das gut?“
„Das hängt von dir ab, du bist die Erste.“
Lisandra ließ den Blick von seinem charmanten Lächeln tiefer gleiten, über seinen trainiert wirkenden Oberkörper in dem verwaschenen T-Shirt, über die auf Kniehöhe abgeschnittenen Jeans und die leicht muskulösen Waden.
„Du bist Tourist, oder?“, schaltete sich nun Alina ein. Um dies zu erraten, genügte bereits ein Blick auf die teure Kamera, die vor seiner Brust baumelte. Und natürlich sein Akzent, obwohl sein Spanisch beinahe fehlerfrei war.
„Ich komme aus Deutschland. Aber mein Vater ist Kubaner, und ich bin hier, um meine Familie zu besuchen. Ich bin also kein richtiger Tourist.“ Es klang, als wolle er sich rechtfertigen.
Alina verzog ihre vollen Lippen zu einem Lächeln. „Wär auch nicht schlimm, wenn du einer wärst. Und Deutschland ist bestimmt super. Wie heißt du? Thomas, Michael, Andreas?“
„Fast. Andy.“
„Das ist kubanisch“, wunderte sie sich.
„Ist aber auch die deutsche Kurzform von Andreas. Meine Eltern wollten einen Namen, der in beiden Sprachen funktioniert. Und wie heißt ihr?“
„Ich bin Alina.“
„Lisandra.“
„Seid ihr aus Havanna?“
„Ja, wir verbringen hier unseren Feierabend. Das heißt, ich tue das. Lisandra muss nachher noch arbeiten.“
Andy blinzelte in die Sonne, die langsam tiefer sank und das Meer silbrig glitzern ließ.
Eine Windböe durchbrach die Nachmittagshitze und trieb Schaumkronen der Brandung bis auf die Uferstraße. Das Februar-Wetter war in Havanna manchmal noch launisch. Lisandra fröstelte und rieb sich die nackten Arme.
„Zeit für einen Aperitif, oder? Darf ich euch auf einen Drink einladen?“, fragte er.
„Na klar“, antwortete Alina sofort. „Da schräg gegenüber ist eine coole Bar. Du stehst bestimmt auf kubanische Musik, oder?“
„Solange es nicht Guantanamera ist.“
Sie lachten. Egal wo auf Kuba Touristen waren, tauchten Musiker auf, die sich vor ihnen aufbauten und Guantanamera zu fiedeln begannen.
Sie schlenderten den Malecón entlang und versuchten, die Straßenseite zu wechseln. Es war kein leichtes Unterfangen, die belebte Ufer- und Umgehungsstraße in der Rushhour zu überqueren. Surrende Ladas, klapprige Oldtimer, Busse und knatternde Motorradtaxis rauschten nahezu lückenlos an ihnen vorbei.
Kurz darauf erreichten sie die Bar, aus der kubanische Rhythmen erklangen.
Alina führte sie eine Treppe hinauf zu einem großen Balkon, auf dem kleine Korbsessel und Tischchen standen. Von hier aus konnten sie aufs Meer und die Uferpromenade sehen, ohne allzu sehr vom Lärm und Gestank des Verkehrs belästigt zu werden.
„Was wollt ihr trinken?“, fragte Andy.
„Cuba Libre.“ Das war Lisandras Lieblingsdrink.
„Für mich einen Mojito“, sagte Alina.
Andy bestellte zwei Cuba Libre und einen Mojito, dann lehnte er sich entspannt zurück.
„Ich würde gerne Fotos von euch machen.“ Er blickte Lisandra an. „Du wirkst sehr fotogen.“
„Ich zieh mich nicht aus, das kannst du vergessen“, wehrte sie sofort ab.
Er lachte und zeigte dabei ebenmäßige, weiße Zähne. „Sollst du ja auch gar nicht. Ich will euch nicht in irgendein dubioses Studio locken. Einfach nur ein paar Fotos machen, am Malecón oder im Café oder so. Irgendwas aus eurem Alltag.“
„Na, für Fotos muss wenigstens eine Einladung zum Abendessen drin sein.“ Alina blinzelte ihm zu.
„Darüber lässt sich reden. Wenn ihr mir dann auch was von eurem Leben erzählt.“
„Warum interessiert dich das? Und was willst du mit den Fotos von uns?“, fragte Lisandra misstrauisch.
„Ich bin freier Mitarbeiter für zwei Reisemagazine. Manchmal kaufen die meine Fotos und Artikel. Ich hoffe, mir so meinen Kuba-Aufenthalt zu finanzieren.“
„Willst du länger bleiben?“, fragte Lisandra und hoffte, dass es nicht zu interessiert klang.
„Mindestens einen Monat. Ich bin erst vor wenigen Tagen angekommen und möchte auch den Süden und Osten Kubas sehen. Bis jetzt kenne ich nur Havanna und das Valle de Viñales.“
Alina winkte ab. „Damit kennst du das Wichtigste.“
Lisandra betrachtete Andy fasziniert. Wenn das bei deutsch-kubanischen Kindern herauskam, konnte sich das Ergebnis sehen lassen. Ausdrucksvolle Augen, hohe Wangenknochen, ein stolzes Kinn. Er hatte sein welliges, dunkles Haar aus dem ovalen Gesicht gekämmt und im Nacken zu einem kurzen Zopf zusammengebunden. Und seine Lippen… noch nie hatte sie bei einem Touristen so sinnliche Lippen gesehen – nicht zu voll und nicht zu schmal, und perfekt geschwungen. Wie es sich wohl anfühlen würde, sie zu küssen?
Er sah Lisandra an, und sie fühlte sich ertappt. Etwas verschämt senkte sie den Blick.
„Was macht ihr so im Leben?“, fragte er.
„Ich bin Assistentin im CENESEX“, erwiderte Alina.
„Was?“ Er starrte sie an, und seinem Gesicht war deutlich anzumerken, wie er versuchte, die Worte Assistentin und Sex miteinander in Verbindung zu bringen.
Alina brach in helles Gelächter aus. „CENESEX ist das kubanische Nationale Zentrum für Sexualaufklärung. Das ist eine der liberalsten und fortschrittlichsten Institutionen auf Kuba. Ich arbeite für den Leiter der wissenschaftlichen Abteilung.“
„Ich wusste nicht, dass es hier so etwas gibt“, stellte Andy verwundert fest.
„Wir sind kein Entwicklungsland, mein Lieber! Unser Land wurde nur von vielen Jahren Sozialismus beeinträchtigt, das ist alles.“
„Mir brauchst du das nicht zu erklären. Ich bin noch in der ehemaligen DDR geboren. Allerdings nur fünf Jahre vor der friedlichen Revolution.“
„Dein Vater ist von Kuba aus in die DDR ausgereist?“
„Genau. Er hat in Ost-Berlin studiert und dort meine Mutter kennengelernt. Sie haben geheiratet, und dann kamen meine Schwester und ich.“
„Lebt er jetzt wieder auf Kuba?“
„Nein, seit einiger Zeit lebt er in Italien. Er hatte zwar früher oft Heimweh, aber nach dem Mauerfall lebte es sich in Deutschland eindeutig besser als auf Kuba in den Neunzigern.“
Alina nickte. „Zu Anfang der Nullerjahre war es auch noch eine Katastrophe hier. Erst seit Raúl Castro an der Macht ist, bessert sich alles so langsam.“
„Das sagen meine Verwandten auch.“
„Leben die in Havanna?“
„Ja, nicht weit von hier. Und dann habe ich noch Verwandte in Cienfuegos, da will ich als Nächstes hin. Die kenne ich noch gar nicht persönlich. Wir hatten bisher nur Kontakt über Facebook, seit sie dort ein Internetcafé haben.“
„Bist du zum ersten Mal auf Kuba?“
„Nein, aber das letzte Mal ist fast zwanzig Jahre her. Als ich ein Kind war, haben wir zwei Mal Urlaub hier gemacht, weil mein Vater seine Heimat wiedersehen wollte. Aber er wollte auch die Welt entdecken, und so haben Geld und Urlaubszeit nicht immer für alles gereicht.“
„Dafür ist dein Spanisch echt gut“, sagte Alina anerkennend. „Du hast nur einen etwas putzigen Akzent.“
Er seufzte. „Den krieg ich nicht weg.“
„Oh, ich könnte dich unterrichten. Ich bin sehr zungenfertig“, sagte Alina und fuhr sich mit gespreizten Fingern durch ihr vom Wind zerzaustes, krauses Haar.
Lisandra ahnte, was nun kommen würde. Ihre Freundin war sich nicht zu schade, ihren Sexappeal dafür zu nutzen, sich an gut betuchte Männer heranzuschmeißen. Und für Durchschnittskubanerinnen waren fast alle Touristen gut betucht.
Lisandra hatte dies bisher immer amüsiert verfolgt und die Anekdoten über die Abenteuer ihrer Freundin stets recht unterhaltsam gefunden.
Der Kellner brachte die Cocktails.
Alina nahm den dicken Strohhalm zwischen ihre Lippen und begann daran zu saugen. „Also, Andy, wann machen wir diese Fotos?“, fragte sie.
„Bleib so.“ Er nahm seine Kamera, drehte ein wenig am Objektiv herum und drückte auf den Auslöser. Dann warf er einen prüfenden Blick gen Himmel. „Das Licht wird langsam schlechter. Vielleicht treffen wir uns lieber ein anderes Mal für Aufnahmen am Malecón.“
„Denk dran, wenn du mich noch mal fotografieren willst, kostet dich das mindestens ein Abendessen.“ Alina lehnte sich so weit über das kleine Tischchen, dass ihre vollen Brüste in dem weit ausgeschnittenen Top Andy förmlich entgegensprangen.
Zum ersten Mal störte Lisandra das aufreizende Verhalten ihrer Freundin, und sie verspürte einen Stich von Eifersucht.
Zwar hatte Lisandra keine Komplexe, sie wusste, dass sie hübsch war: Ihre bräunliche Haut war ebenmäßig, ihre Augen groß und dunkel und ihre Gesichtszüge fein geschnitten. Aber mit Alinas Kurven und ihrer sinnlichen Ausstrahlung konnte ihr gertenschlanker Körper nicht mithalten. Alina war das, was man gemeinhin eine Latina-Bombe nannte, und ihre üppigen Kurven verkörperten das weibliche Schönheitsideal Kubas. Lisandra hingegen war als Teenager oft damit gehänselt worden, dass sie zu dünn war. Inzwischen hatten sich einige zarte Rundungen eingestellt, aber es blieb eine Tatsache, dass sie für den Geschmack der meisten Kubaner zu schlank war. Durstig trank sie ihren Cocktail aus Cola und Rum.
„Und was machst du beruflich, Lisandra?“, hörte sie Andy in ihre Gedanken hinein fragen.
„Meine Eltern und ich betreiben ein Paladar“, antwortete sie.
„Meinst du diese Wohnzimmer-Lokale?“
„Privates Restaurant ist die korrekte Bezeichnung. Wir vermieten auch Zimmer an Touristen.“
„Trifft sich gut, ich suche eins. Das Hotel wird mir auf Dauer zu teuer.“
„Wohnst du nicht bei deinen Verwandten?“
„Das war mir zu kompliziert mit diesem Familienvisum, das man dafür beantragen muss. Außerdem haben die keinen Platz.“
„Wir wohnen in einer wunderschönen Villa aus der Kolonialzeit, auch wenn es überall bröckelt – aber die Touristen lieben das. Und meine Mutter ist eine tolle Köchin. Man kann bei uns an fünf Tagen in der Woche essen.“
„Dann reserviere mir bitte einen Tisch für morgen Abend“, sagte er.
„Ich muss erst mit meiner Mutter klären, ob noch einer frei ist. Oft haben wir Reisegruppen, dann ist alles voll.“
Alinas Handy klingelte. Es war ein modernes Smartphone, Souvenir einer Liebesnacht mit einem Kanadier. Lisandra besaß kein Handy und vermisste es auch nicht.
Alina meldete sich. „Ah, hallo Elena! Wie geht’s dir?“
Als Lisandra den Namen ihrer Mutter hörte, durchfuhr sie sofort eine ungute Vorahnung. Es kam nicht oft vor, dass Elena Alvarez Ortega hinter ihrer achtundzwanzigjährigen Tochter hertelefonierte.
„Ja, sie sitzt neben mir.“ Alina reichte das Telefon weiter.
„Mama? Was gibt es?“, fragte Lisandra beunruhigt.
„Es geht deiner Großmutter schlechter. Dr. Ramos ist hier und meint, es könnte noch heute Abend zu Ende gehen.“ Sie hörte, wie ihre Mutter ein Schluchzen unterdrückte.
Lisandra sprang auf. „Ich komme sofort nach Hause.“
„Ja, deswegen habe ich angerufen.“
„Bin unterwegs.“ Lisandra gab Alina das Smartphone zurück.
„Madelin?“, fragte diese ahnungsvoll.
„Ja. Der Arzt sagt, sie liegt im Sterben.“ Sie blickte Andy an. „Tut mir leid, ich muss gehen. Danke für den Drink.“
„Wann kann ich dich wiedersehen?“, fragte er sofort.
„Komm einfach irgendwann mal zum Essen vorbei“, erwiderte sie zögernd und nannte ihre Adresse.
„Das mache ich auf jeden Fall. Tschüss, ihr beiden, hat mich gefreut.“
Alina leerte schnell ihren Mojito und stand auf. „Warte, Lissy, ich komme mit dir.“
„Willst du nicht bleiben, um ihn aufzureißen?“, fragte Lisandra spöttisch, als sie außer Hörweite waren.
„Ich gebe es ja nur ungerne zu, Schatz, aber der steht auf dich, nicht auf mich.“ Alina zupfte verdrossen an dem schmalen Träger ihres Tops. „Du kennst doch das Sprichwort: Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist.“
Lisandra schnalzte genervt mit der Zunge. „Wann kapierst du endlich, dass ich nicht so bin wie du? Ich habe kein Interesse daran, mit Touristen ins Bett zu gehen, in der Hoffnung, dass ich dann teure Geschenke kriege.“
„Du hast ja durch deine Gäste auch jederzeit Zugang zu Devisen. Ich bin auf die Touristen angewiesen. Von meinem Gehalt könnte ich mir nicht mal einen verdammten Lippenstift kaufen! Außerdem, so wie du das sagst, hört es sich an, als wäre ich eine Nutte!“, sagte Alina beleidigt.
„Das habe ich nicht gemeint. Du hast eben deinen Spaß an Abenteuern mit wechselnden Männern. Ich nicht, ich will eine richtige Beziehung. Den Mann fürs Leben.“
Alina seufzte. „Was findest du daran so toll? Du weißt doch, wie unsere Männer sind: Spätestens nach den Flitterwochen ist Schluss mit der Romantik; sie wollen zwei Mal täglich Sex, und das ist ja nicht so deins, oder? Dann macht er dir drei Kinder, von denen du nicht weißt, wie du sie durchbringen sollst – wenn er sich nicht schon nach dem ersten aus dem Staub macht. Sechzig Prozent aller Ehen auf Kuba werden geschieden, wusstest du das? Da frage ich mich: Wozu überhaupt heiraten?“
„Ich will auf keinen Fall wie meine Cousine Marcia enden, mit vier Kindern von vier Männern“, knurrte Lisandra.
Alina zuckte mit den Schultern. „Ist doch normal. Meine Mutter hat schließlich auch vier Kinder von drei Männern, und durch meinen Erzeuger hab ich noch fünf weitere Halbgeschwister.“
„Wozu gibt es dann eigentlich dein Institut für Sexualaufklärung, wenn so was wie Verhütung offenbar nicht bekannt ist?“
Alina hob entschuldigend die Arme. „Theorie und Praxis.“
„Meine Eltern führen seit über dreißig Jahren eine glückliche Ehe“, betonte Lisandra.
„Eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Deine Großeltern haben sich schließlich auch getrennt.“
„Aber erst nach rund zwanzig Jahren Ehe.“
„In den alten Zeiten haben sie eben noch länger durchgehalten.“
„Da kommt der Bus“, rief Lisandra und begann schneller zu laufen.
Wie immer war der Bus vollkommen überfüllt, und es gelang ihnen gerade noch so hineinzukommen. Es war keine Seltenheit, dass sich die Einheimischen außen auf die Trittbretter schwangen und dort festgeklammert mitfahren mussten.
„Wie findest du den Typen?“, fragte Alina, als sie dicht beieinander im Gedränge standen, und klammerte sich an Lisandras Schultern, da sie keinen Haltegriff erreichen konnte.
„Wen?“, fragte Lisandra, in Gedanken bereits bei ihrer Großmutter.
Alina verdrehte die Augen. „Wen schon? Diesen Andy!“
„Was weiß ich? Ich kenne ihn ja kaum.“
„Na, rein optisch hat er schon mal alles, was frau sich so erträumt, oder?“ Alina grinste. „Er ist noch kubanisch genug, um heiß zu sein, und europäisch genug, um irgendwie exotisch zu wirken.“
Lisandra gluckste. „Das hast du schön formuliert. Okay, er sieht verdammt gut aus und scheint nett zu sein, aber in einem Monat ist er wieder weg, was soll ich also mit dem?“
„Lissy! Deine Beziehung zu Dario ist seit fast einem Jahr vorbei. Meinst du nicht, du solltest mal wieder mit einem Mann zusammen sein? Und sei es auch nur für ein paar Wochen? So lange allein zu bleiben ist doch nicht normal.“
„Ich vermisse das nicht“, protestierte Lisandra. „Und nenn mich nicht unnormal!“
„Ich will ja nur, dass du ein bisschen mehr Spaß im Leben hast, Süße.“
„Ich frage mich wirklich, wie wir seit fünfundzwanzig Jahren Freundinnen sein können“, sagte Lisandra kopfschüttelnd. „Manchmal sind wir so gar nicht auf einer Wellenlänge.“
Alina lachte nur. „Gegensätze ziehen sich eben an. Ich hole dich auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn du vor lauter, romantischer Träumereien den Sinn für die Realität verlierst, und du…“ Sie überlegte. „Du bewahrst mich davor, eine total abgeklärte Zynikerin zu werden.“
„Mach ich gerne. Das ist nämlich noch viel schlimmer, als ein Jahr keinen Sex zu haben.“
Alina ließ sie los, um sich feierlich eine Hand aufs Herz zu legen. „Baby, nichts ist schlimmer als ein Jahr keinen Sex zu haben“, erklärte sie mit so dramatischer Stimme, dass Lisandra lachen musste.
„Manchmal denke ich, ich bin gar keine richtige Kubanerin“, sagte sie und blickte aus dem Fenster. „Komm, wir müssen uns zum Ausgang durchkämpfen, wir sind gleich da.“
2
Kurz darauf traf Lisandra in dem kleinen Stadtpalais ein, in dem ihre Familie lebte. Im Patio, dem Innenhof der typisch kubanischen Häuser, begegnete ihr ihr jüngerer Bruder Yannis, der gerade die Treppe hinuntergelaufen war.
„Warst du bei Oma?“, rief Lisandra ihm entgegen.
„Ja. Ich habe mich von ihr verabschiedet.“ Sein sonst so fröhliches Gesicht war ungewohnt ernst. „Mama ist jetzt bei ihr.“
„Und wo ist Papa?“
„Bereitet sich seelisch auf den Küchendienst vor, damit Mama nicht unter Druck ist.“
„Das wird er alleine nicht schaffen, wir haben heute ein volles Haus, oder? Kannst du nicht–?“
„Ich muss zur Nachtschicht, sorry.“ Yannis war Taxifahrer bei einem der staatlichen Unternehmen.
„Herrje. Na gut, ich beeile mich bei Oma.“ Lisandra verzog bekümmert das Gesicht.
Alina legte kurz den Arm um sie. „Lass dir die Zeit, die du brauchst. Ich helfe beim Servieren.“
„Ehrlich? Du bist ein Schatz!“ Lisandra gab ihrer Freundin einen raschen Kuss auf die Wange.
„Das wirst du nicht mehr sagen, wenn ich eure Teller zerdeppere und das Essen auf dem Schoß der Leute landet.“
„Ehrlich gesagt finde ich es gerade zweitrangig, wie du dich anstellst.“
„Dass deine Talente nicht in der Küche liegen, wissen wir, Alina“, sagte Yannis mit anzüglichem Unterton.
Sie streckte ihm die Zunge heraus.
Kurz darauf saß Lisandra mit ihrer Mutter am Krankenbett von Madelin. Das Krankenhaus konnte schon lange nichts mehr für sie tun, und da die hygienischen Zustände dort bedenklich waren, pflegten sie Madelin so gut es ging zuhause.
Lisandra betrachtete ihre Großmutter besorgt. Der Krebs, der sie seit Jahren auszehrte, schien nun die Oberhand zu gewinnen. Mit achtzig Jahren war die einst bildschöne Madelin nur noch Haut und Knochen, und ihr faltiges, hellbraunes Gesicht wirkte auf dem blassgelben Kissen winzig.
Ihre dunklen Augen flackerten unruhig, als sie die Hand nach ihrer Tochter ausstreckte. „Setzt euch näher zu mir“, flüsterte sie. „Bevor ich gehe, muss ich euch eine Geschichte erzählen.“
„Oma, nicht, das strengt dich zu sehr an.“ Lisandra drückte die andere Hand, die kraftlos auf der dünnen Decke über ihrem flachen Leib ruhte.
„Es ist aber wichtig, dass ihr die Wahrheit erfahrt.“
Elena runzelte die Stirn. „Wovon redest du, Mama? Was für eine Wahrheit?“
„Es war während der Revolution. Er hieß Robert und war US-Amerikaner. Ein wunderschöner Mann, blond, mit blaugrauen Augen wie der Atlantik im Winter bei Sturm…“
Elena und Lisandra tauschten einen Blick.
„Bekommt sie Morphium?“, flüsterte Lisandra.
Elena nickte. „Regelmäßig. Sie fantasiert.“
„Sprecht nicht von mir, als wäre ich nicht da“, sagte die alte Frau ärgerlich und mit etwas kräftigerer Stimme. „Ich fantasiere nicht. Ich weiß genau, was ich sage.“
„Gut, Mutter, erzähl uns einfach alles, was du loswerden möchtest“, sagte Elena beruhigend und streichelte ihren Arm.
„Salvador und ich waren seit zwei Jahren verheiratet. Aber er hatte nur die Revolution im Kopf“, fuhr Madelin fort. „Er klebte förmlich an Che und Fidel, und war pausenlos mit ihnen unterwegs. Ich war ständig allein in Havanna. Und dann habe ich Robert kennengelernt.“
„Den Yankee?“, vergewisserte sich Lisandra. Das war der gängige Spitzname für US-Amerikaner.
„Ja. Er war anders als die Männer hier. Nicht nur, weil er schön war wie ein Gott und immer gut rasiert. Er hatte auch mit Politik nichts am Hut. Er hat für eine amerikanische Firma in Havanna gearbeitet. Und er war so höflich zu mir, ein richtiger Gentleman. Hat mir die Tür aufgehalten, in die Jacke geholfen, den Stuhl zurechtgeschoben, eben all das, was den Kerlen bei uns fremd ist. Und nie schlüpfrige Komplimente. Aber seine Blicke… Manchmal genauso kühl wie der Atlantik, und dann wieder voller Begehren, wenn er mich lange angesehen hat.“ Ein glückliches Lächeln überzog das runzlige Gesicht.
Lisandra lauschte gebannt. „Hast du dich in ihn verliebt, Oma?“
„Oh ja, mein Herz. Diesem Mann wäre ich für ein Lächeln bis ans Ende der Welt gefolgt.“
„Beim Lächeln ist es sicher nicht geblieben“, kommentierte Elena säuerlich. „Hast du Papa mit ihm betrogen?“
„Liebes, Salvador ist nicht dein Vater. Das war es, was ich euch sagen wollte.“
Elena rang nach Luft, während Lisandra die Kinnlade herunterklappte. „Du hast… dieser Robert ist…“
„Ja, Kind. Er ist dein leiblicher Vater.“
Lisandra warf ihrer Mutter Elena einen Seitenblick zu. Sie verdankte ihr die fein gezeichneten Gesichtszüge. Elenas Teint war heller als ihrer, und ihre Augen waren hellbraun. Nun war ihr endlich klar, wo das herkam. Madelin und Salvador hatten etwas dunklere Haut und fast schwarze Augen und Haare, genau wie der Rest der Familie. Lisandra hatte immer gedacht, dass ihre Mutter irgendwie europäisch aussah. Oder eben nordamerikanisch.
Elena fuhr sich mit zitternden Fingern über das glatte, braungraue Haar, das im Nacken zu einem Knoten zusammengesteckt war. „Warum sagst du mir das erst jetzt, Mutter? Papa – ich meine Salvador – ist seit Jahren tot, du hättest es mir früher sagen müssen!“
„Wozu dich durcheinanderbringen, Kind?“
„Was ist mit meinem leiblichen Vater? Lebt er noch? Wo ist er? In den USA?“
„Dann wäre ich jetzt auch dort. Und du wärst in Amerika aufgewachsen. Er wollte mich mitnehmen, als er erfahren hat, dass ich schwanger bin.“
„Was ist passiert?“ Elena schluckte. „Warum hast du dich entschlossen, es mir nun doch zu erzählen?“
Madelin fiel merklich in sich zusammen, und ihr Gesicht wurde eine schmerzvolle Grimasse. Sie rang nach Luft.
„Oma, soll ich Dr. Ramos rufen?“, fragte Lisandra besorgt. „Ich glaube, er ist noch hier.“
„Nein, warte. Der spritzt mir nur wieder was und ich kann nicht mehr klar denken. Ich muss das hier zu Ende bringen. Ihr müsst es erfahren, so schmerzhaft es auch ist. All die Jahre… mein Gewissen erleichtern… Frieden finden…“ Sie begann, etwas Unverständliches zu stammeln.
Elena legte ihr die Hand auf die glühende Stirn. „Mama, du fantasierst. Du hast bestimmt nichts so Schlimmes gemacht, dass du es jetzt beichten müsstest.“
„Doch“, keuchte Madelin und krallte ihre Finger in Lisandras Handrücken. „Mein altes Tagebuch… der Brief… in meinem Zimmer. Lest es alles, dann wisst ihr… fahrt nach Trinidad, auf die Plantage. Zu Celia. Und in die Sierra Maestra. Mein Robert…“
Ihre Augen fielen zu und der Druck ihrer Finger erlosch.
„Oma?!“, rief Lisandra voller Angst.
„Mamita!“ Elena rüttelte vorsichtig an der zerbrechlichen Schulter ihrer Mutter.
Lisandra sprang auf. „Ich gehe Dr. Ramos holen.“
Sie stürzte in das zum Restaurant ausgebaute, große Esszimmer des Hauses, wo der Arzt zusammen mit einigen Touristen das Abendessen einnahm. Als er Lisandra erblickte, legte er sofort sein Besteck nieder und erhob sich.
„Bitte kommen Sie schnell, ich glaube, es ist vorbei!“
Alina, die gerade ein Tablett mit Getränken balancierte, warf ihr einen mitfühlenden Blick zu.
Der Arzt, der kurz darauf zusammen mit Lisandra in Madelins Zimmer eilte, konnte nur noch deren Tod feststellen.
Elena schluchzte laut, hatte den Kopf gesenkt und umklammerte eine Hand ihrer toten Mutter.
„Sie ist jetzt erlöst“, sagte Dr. Ramos sanft.
Elena hob ihren Kopf und schnäuzte sich in ein Taschentuch. „Sie hat merkwürdige Dinge erzählt, kann es sein, dass sie fantasiert hat?“
„Möglich. Das Morphium…“
„Was sie erzählt hat, kann unmöglich wahr sein“, flüsterte Elena.
Lisandra trat hinter sie und legte ihr die Hände auf die Schultern. „Warum denn nicht?“
„Mein Vater kann doch kein Yankee sein – du weißt, dass ich die nicht leiden kann.“
„Warum eigentlich nicht? Du hast die ersten Amerikaner erst vor sechs Wochen gesehen, als sie plötzlich wieder nach Kuba einreisen durften, oder? Die, die bei uns gegessen haben, waren nett und haben gutes Trinkgeld gegeben.“
„Stimmt schon. Aber weißt du, mein Leben lang waren US-Amerikaner für uns ein Feindbild. Vater hat sie gehasst.“
„Vielleicht hat er nur einen einzigen gehasst, aus sehr persönlichen Gründen. Wenn stimmt, was Oma erzählt hat, hat sie ihn mit dem Mann betrogen und ein Kind von ihm erwartet. Wow, ich bin vielleicht zu einem Viertel Amerikanerin!“ Sie blickte in erschreckter Faszination auf Madelin hinunter.
„Sie war bestimmt nur vom Morphium berauscht“, beharrte Elena.
Lisandra setzte sich wieder neben die Tote und berührte ein letztes Mal zärtlich die Wangen ihrer Großmutter. „Das wird sich zeigen“, sagte sie nachdenklich. „Wir müssen diese Tagebücher und Briefe finden.“
3
Mit schwerem Herzen zog Lisandra am nächsten Tag die Bettwäsche der Verstorbenen ab und legte Decke und Kissen zum Auslüften auf das schmiedeeiserne Geländer der Fensterbrüstung.
Dann setzte sie sich auf den Stuhl, der vor einem kleinen Sekretär stand und durchsuchte die Schubladen und Fächer. Darin lagen alle möglichen Dinge, aber kein Tagebuch. Und die Briefe, die sie fand, erschienen ihr allesamt unbedeutend. Kein Hinweis auf eine mysteriöse Vergangenheit.
Lisandra hatte die Tür einen Spalt breit offen gelassen, und die füllige Gestalt des Hausmädchens Rosa schob sich hinein. „Lissy, da ist ein Andy Santiago Varela, der dich sprechen will.“
„Wer?“, fragte Lisandra zerstreut.
„So ein gutaussehender Typ… ein Tourist, glaube ich.“
„Ach so, der. Okay, lass ihn im Patio warten, ich komme gleich.“
Lisandra ging die Treppe hinunter, die zum Innenhof führte, dem ein plätschernder Springbrunnen und üppige Grünpflanzen eine gemütliche Atmosphäre verliehen.
Andy saß neben einer Palme in einem Sessel aus Rattan und blätterte in einem Reiseführer über Havanna. Er erhob sich, als Lisandra zu ihm trat und küsste ihr die Wangen. „Hallo. Ich wollte zum Mittagessen kommen, aber das Mädchen sagte mir, ihr habt heute geschlossen.“
„Meine Oma ist gestern Abend gestorben. Und meine Eltern wachen heute bei ihr.“
„Das tut mir leid. Wie alt war sie?“
„Achtzig.“
„War sie krank?“
Lisandra nickte. „Sie hatte Krebs. Es war eine Erlösung für sie.“
„Und du hältst keine Totenwache?“
„Ich war die ganze Nacht dort. Bin heute früh nach Hause gekommen und habe nur kurz geschlafen“, erklärte sie. „Ich bin gerade erst aufgestanden.“
„Habe ich dich bei irgendwas gestört? Du siehst etwas mitgenommen aus.“
Sie strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, die sich aus ihrem Pferdeschwanz gelöst hatte. Sie war ungeschminkt und wirkte übernächtigt, aber ihre Wangen glühten.
„Ich bin dabei, das Schlafzimmer meiner Oma aufzuräumen.“
„Verstehe.“ Andy nickte betreten. „Ihr müsst ihr Zimmer auflösen.“
„Das auch. Aber erst mal habe ich etwas gesucht“, murmelte sie.
„Einen geerbten Familienschatz?“, scherzte er.
„Sowas in der Art.“ Sie zwang sich zu einem Lächeln. Nur dass es vermutlich kein Schatz war, der da ans Tageslicht kommen würde. Nach den Andeutungen von Madelin war es eher etwas Unangenehmes. Aber Lisandras Neugier war geweckt und sie wollte Gewissheit haben: Ob ihr Großvater tatsächlich ein Amerikaner gewesen war oder ob Madelin kurz vor ihrem Tod fantasiert hatte. „Aber wohl leider kein materieller Schatz, eher ein Geheimnis.“
„Klingt spannend. Ich liebe sowas.“ In seinen Augen funkelte es. „Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.“ Er lächelte, und für einen Moment blieb ihr Blick an seinen Lippen hängen.
„Mach ich.“ Allerdings dürfte dieses Geheimnis zu heikel sein, um einen Fremden zu involvieren, dachte sie. Was ging es den Deutschen an, mit wem ihre Großmutter einst ihren Ehemann betrogen hatte?
„Wann ist die Beerdigung?“
„Heute am späten Nachmittag.“
Er hob verwundert die dichten, dunklen Augenbrauen. „So schnell?“
Sie nickte. „Bei uns werden Verstorbene fast immer gleich am nächsten Tag beerdigt. In Deutschland nicht?“
„Nein, das kann bis zu einer Woche dauern, manchmal länger. Könnt ihr das denn alles so rasch organisieren?“
„Ihr Tod kam ja nicht gerade überraschend. Schade ist nur, dass mein Onkel Luis nicht so schnell aus Florida herüberkommen kann. Aber er war zu Weihnachten hier und konnte da schon Abschied nehmen.“
Sie schwiegen einen Moment, dann fragte Andy:
„Habt ihr ein Zimmer frei?“
„Ja. Wir nehmen fünfunddreißig CUC pro Nacht, inklusive Frühstück.“
„Das passt.“
„Komm mit, ich zeige es dir.“
Er folgte ihr die gewundene Treppe hinauf in den zweiten Stock, in dem sich die Zimmer für die Gäste befanden, und blickte sich bewundernd um. Von hier oben konnte man in den Patio blicken und seine Arkaden, den Springbrunnen und den mit Mosaiken gefliesten Boden bewundern.
„Ein beeindruckendes Haus. Gehört es euch?“
„Natürlich nicht. Es ist Staatsbesitz. Aber meine Familie lebt schon seit Ende der Revolution hier.“
„Da hattet ihr ziemliches Glück, oder?“
„Ja. Dieser Stadtpalais gehörte einer reichen Familie, die wie so viele überstürzt das Land verlassen musste, als die Rebellen an die Macht kamen. Mein Großvater hat zusammen mit Fidel und Che gekämpft, dafür hat er zum Dank ein lebenslanges Wohnrecht in diesem Haus erhalten.“
„Dein Opa war ein Revolutionär?“ Andys Augen weiteten sich.
Sie nickte. „Er ist vor einigen Jahren gestorben, aber wir dürfen weiter hier wohnen, da wir ja diese Pension betreiben.“
Andy blickte sich in dem Zimmer mit glänzendem Steinfußboden und Möbeln um, deren Eleganz längst verblasst war. Schrank, Tisch und Stuhl aus dunklem Holz waren museumsreif – schlicht, aber edel. Das breite Bett mit den hohen, schmiedeeisernen Pfosten wirkte in dem großen, hohen Raum recht verloren. In einer Stadt, wo in den meisten Wohnungen und Häusern Zwischenwände und -decken eingezogen wurden, um Platz zu gewinnen, war das hier ein echter Luxus.
Lisandra warf ihm einen unsicheren Seitenblick zu. „Es ist nicht das Hotel Nacional“, sagte sie verlegen und ärgerte sich sofort über sich selbst. Hatte sie es nötig, sich für das Haus zu entschuldigen? Doch sie ertappte sich bei dem Wunsch, Andy möge es gefallen. „Das Bad ist am Ende des Flurs. Du müsstest es dir mit noch vier anderen Gästen teilen.“
„Kein Problem. Ich nehme das Zimmer.“
„In Ordnung.“
Er lächelte sie an. „Ich ziehe morgen Vormittag ein. Mein Hotelzimmer muss ich für die nächste Nacht sowieso noch bezahlen.“
Als Lisandra die Tür hinter sich schließen wollte, hielt sie plötzlich die Klinke in der Hand. „Ach, verdammt!“
Andy lachte. „Das ist Kuba, oder? Überall Zerfall.“
„Mach dich nicht lustig über uns“, wies sie ihn ungehalten zurecht.
„Tut mir leid, das war taktlos“, gab er zu und berührte leicht ihren nackten Unterarm. Es fühlte sich an wie ein kleiner elektrischer Schlag, aber viel angenehmer. Er stand so nah bei ihr, dass sie sein dezentes, herbes Rasierwasser roch und unwillkürlich tief einatmete.
„Schon okay.“ Sie wandte sich ab, weil sie feststellte, dass ihr Blick schon wieder auf seine Lippen fixiert war. „Wir machen uns ja selbst darüber lustig. Aber wir mögen es nicht, wenn Ausländer es tun.“
„Ich bin nur zur Hälfte Ausländer“, erinnerte er sie.
„Honey, du bist ungefähr so kubanisch wie ein Vollkornbrot“, imitierte sie Alinas burschikos-neckischen Tonfall. „Auf deiner Stirn steht groß TOURIST geschrieben.“
Er hob resigniert die Arme. „Vielleicht schaffe ich es noch, das in den nächsten Wochen zu ändern.“
„Warum?“, fragte sie verständnislos. „Sei doch froh, dass du ein Rückflugticket nach Europa in der Tasche hast.“
„Ich bin hier, um meine kubanischen Wurzeln zu finden. Nicht, um mich möglichst deutsch zu fühlen.“
„Das gefällt mir.“ Sie lächelte ihn an.
„Ich habe Hunger.“ Andy rieb sich den Bauch. „Du auch?“
„Eigentlich nicht. Aber ich kann dir ein Sandwich machen.“
„Ich möchte dich gerne in ein Restaurant einladen. Wie wäre es mit dem Al Medina?“
„Danke, aber…“ Lisandra zögerte. Bei dem Gedanken an ein Essen in einem guten Touristenlokal lief ihr das Wasser im Mund zusammen. „Wegen der Beerdigung habe ich heute nicht viel Zeit. Es gibt noch so viel zu tun, und vorher muss ich auch noch mal in die Funeraria. Vielleicht ein anderes Mal.“
„Was ist das?“, fragte er.
„Eine Funeraria ist eine Trauerhalle, wo die Toten aufgebahrt werden, damit Verwandte und Freunde Abschied nehmen können.“
„Ach so. Hm, wenn du es so eilig hast, dann komme ich auf dein Angebot mit dem Sandwich zurück.“
„Käse oder Schinken?“
„Käse.“
„Willst du was trinken?“
„Habt ihr Cola?“
„Ich glaube nicht.“
„Dann ein Wasser?“
„Haben wir. Du kannst im Patio auf mich warten.“
Als sie wenige Minuten später mit dem belegten Brötchen und einer kleinen Wasserflasche zu Andy zurückkehrte, saß er wieder in dem etwas morschen Korbsessel und blätterte in seinem Reiseführer.
Lisandra stellte das Tablett vor ihm auf ein zerkratztes Holztischchen.
„Guten Appetit.“
„Danke. Hast du noch kurz Zeit, um mir Gesellschaft zu leisten?“
„Aber nur kurz.“ Sie merkte, wie gut es ihr tat, mit ihm zu reden und ließ sich auf den Korbstuhl sinken, der auf der anderen Seite des Tischchens stand.
„Hast du eigentlich Geschwister?“, fragte er und biss in sein Sandwich.
„Ja, eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder.“
„Leben die auch hier im Haus?“
„Dayana hat einen Mann aus Santiago de Cuba geheiratet, sie lebt dort mit ihm und den Kindern. Yannis wohnt im Zimmer neben meinem, aber er ist eigentlich nur zum Schlafen da.“
„Arbeitet er nicht mit in der Pension oder im Paladar?“
„Nein, er hat was Besseres. Er ist Taxifahrer.“
„Oh. Vielleicht findet er ja noch was Richtiges.“
„Ich meine das ernst! Hast du eine Ahnung, wie viel meine Eltern für die Lizenz zahlen mussten? Taxifahrer ist ein sehr begehrter Job in Havanna.“
„Ach ja, wegen der Devisen“, fiel es Andy ein.
„Genau. Allerdings gibt er das meiste, das er verdient, fürs Ausgehen, Frauen und technische Spielereien aus.“ Sie seufzte und warf einen Blick auf ihre altmodische Armbanduhr.
„Ich werde dann mal gehen“, sagte Andy rücksichtsvoll. „Wie viel bekommst du für Sandwich und Wasser?“
„Drei fünfzig, bitte.“
Er gab ihr einen Fünf-Pesos-Schein. „Stimmt so.“
„Gracias. Hasta mañana, Andy.“
4
Lisandra saß auf dem Bett ihrer Großmutter und weinte. An dem Abend, als Madelin gestorben war, hatte sie nicht weinen können, weil der Schmerz noch zu tief saß, und auch am darauffolgenden Tag hatte sie keine Tränen vergossen. Selbst bei der Trauerzeremonie am Vortag nicht. Jetzt aber, während sie das Zimmer von Madelin nach dem Tagebuch durchsuchte, war sie auf einmal von Erinnerungen an die schönen Momente mit ihrer Großmutter überfallen worden.
„Hey“, sagte eine leise Stimme.
Sie hob den Kopf und sah Andy im Türrahmen stehen.
„Hola. Wollte nur Bescheid sagen, dass ich da bin. Das Hausmädchen meinte, ich solle mich zum Einchecken an dich wenden.“
„Ja, gleich“, murmelte sie und schluchzte noch einmal.
Er musterte sie und kam langsam näher. „Tut mir leid. Ich wollte dich nicht stören.“
„Schon okay.“
Er blickte sich in dem schlicht eingerichteten Raum um, in dem Dämmerlicht herrschte. Lisandra hatte zum Schutz gegen das Sonnenlicht die dünnen, braunen Vorhänge zugezogen.
„Das ist das Zimmer deiner Großmutter, ja? Darf ich?“ Ohne ihre Antwort abzuwarten, setzte er sich neben sie aufs Bett. „Hast du ihr sehr nahegestanden?“
„Ja. Sie hat sich viel um mich gekümmert, als ich ein Kind war. Und auch danach war sie immer für mich da, wenn meine Eltern keine Zeit hatten. Sie wird mir fehlen.“
Lisandra brach erneut in Tränen aus. Andy legte den Arm um sie, und sie sank an seine Schulter.
Auf einmal wurde ihr bewusst, wie intim die Situation war. Sie lag in den Armen eines fast Fremden und ließ sich von ihm den Rücken streicheln, während sie auf dem Bett eines schummrigen Schlafzimmers saßen. Und das Verwunderliche daran war, dass es sich ganz natürlich und unwahrscheinlich gut anfühlte. Zu gut.
Hastig rückte sie von ihm ab. Andy räusperte sich verlegen und ließ sie los.
Lisandra lächelte unter Tränen. „Du bist definitiv kein Kubaner!“
Seine Stirn legte sich in Falten. „Was soll das denn heißen?“
„Jeder Kubaner hätte versucht, die Situation auszunutzen.“
Er verdrehte die Augen. „Es gibt auch genug Deutsche, die das versucht hätten. Das ist wohl eher eine Charakterfrage, meinst du nicht?“
„Vielleicht, aber vor allem eine des Temperaments. Mit den Latinos gehen da schneller die Pferde durch.“
„Du sitzt hier und weinst um deine Großmutter! Wie uneinfühlsam muss man denn sein, da einen Annäherungsversuch zu wagen? Außerdem ist deine Großmutter vor zwei Tagen in diesem Bett gestorben – das ist mir zu morbide!“
Sie kicherte und wischte sich mit dem Handrücken eine letzte Träne von der Wange.
„Hast du schon gefunden, wonach du gesucht hast?“
„Nein, noch nicht.“
Er erhob sich vom Bett und ging zu einer Anrichte aus Mahagoniholz, die aussah, als würde sie aus der Kolonialzeit stammen. „Was ist das denn – ein Altar?“ Er betrachtete prüfend die Heiligen-Figürchen, vertrockneten Blumen und verschrumpelten Früchte in einer Vitrine. Daneben stand ein weißes Porzellanschälchen, das mit einer Flüssigkeit gefüllt und von einer Glasperlenkette umschlungen war.
„Meine Oma war eine Santería“, erklärte Lisandra.
„Wow. So richtig mit lebenden Hühnern die Kehle durchschneiden und so?“ Andy verzog den Mund voller Abscheu.
„Ich glaube nicht, dass sie das je selbst gemacht hat oder zu solch religiösen Veranstaltungen gegangen ist. Madelin hätte keiner Fliege was zuleide tun können. Es war für sie einfach eine Stütze im Alltag, so wie andere Menschen sonntags in die Kirche gehen. Oft hat sie sich in der Aufmachung einer Santería-Priesterin auf die Plaza de Armas gesetzt, eine Zigarre gepafft und sich für ein paar Dollar von Touristen fotografieren lassen. Sie hat richtig Geld damit verdient, obwohl sie einfach nur in der Sonne herumsaß. Und sie war natürlich auch keine Priesterin.“ Lisandra lachte.
„Schade, dass ich sie nicht mehr fotografieren kann.“
Lisandra trat neben ihn und starrte nachdenklich auf den Altar.
„Wonach suchst du denn?“, fragte Andy.
„Tagebücher und Briefe. Aber du bringst mich auf eine Idee. Wenn dies ihr Santería-Altar ist, hat sie das vielleicht hier in der Nähe aufbewahrt.“ Sie öffnete die Schranktür unter der Vitrine, kramte darin herum, warf vergilbte Bücher, mit Kräutern gefüllte Säckchen und ein Paar hochhackige Sandaletten aus rotbraunem Leder, die noch aus Madelins Jugend stammen mussten, ins Zimmer. Sie fand eine stabile, mit Stoff bespannte Pappschachtel und öffnete sie.
„Ha!“ Triumphierend hob sie ein dickes, kartoniertes Heft in die Höhe. Ein Foto fiel heraus und segelte zu Boden.
Andy bückte sich danach, hob es auf und betrachtete es. Es war ein vergilbtes Schwarz-Weiß-Foto, das einen blonden Mann mit entschlossenen Gesichtszügen zeigte. Sein Blick war gleichermaßen eindringlich und verträumt.
„Wer ist das?“, fragte Andy.
Lisandra studierte den festen Mund mit den dennoch sinnlichen Lippen und wusste, dass sie deren Form schon gesehen hatte: bei ihrer Mutter – und wenn sie in den Spiegel blickte.
„Das ist vielleicht mein Großvater“, sagte sie nachdenklich.
„Was?“
Lisandra schlug das Buch auf, dessen vergilbte Seiten mit einer zierlichen Handschrift beschrieben waren. Auf der ersten Linie stand das Datum: 1. Januar 1958. Das war ein knappes Jahr vor der Geburt ihrer Mutter. Es musste also das richtige Tagebuch sein. Sie legte das Foto dazu und schloss das Buch wieder.
„Dies ist das Geheimnis, das meine Oma auf dem Sterbebett loswerden wollte“, erklärte sie feierlich.
„Dass sie was mit diesem Mann da hatte?“
„Ja. Er war Amerikaner.“
„Und das wusste bisher niemand?“
„Nein. Sie war damals schon mit meinem Großvater verheiratet – also der, von dem ich dachte, er wäre der Vater meiner Mutter.“
„Und jetzt willst du Ahnenforschung betreiben?“
„Genau. Aber da muss noch irgendwas anderes gewesen sein. Nur wegen eines unehelichen Kindes gibt es auf Kuba keinen Skandal, das ist eher die Regel. Obwohl, in den 50er und 60er Jahren war das vielleicht noch anders.“
„Und du meinst, das steht in dem Tagebuch?“
„Wahrscheinlich. Oma hat jedenfalls darauf bestanden, dass wir es lesen sollen.“
„Dann werde ich dich mal allein lassen und meinen Koffer auspacken“, sagte Andy.
„Okay. Kannst du mir bitte deinen Pass geben, wegen des Check-ins?“
„Klar.“
„Willst du hier zu Abend essen?“
„Gern. Den Pass bringe ich dir gleich“, sagte er und verließ das Zimmer.
***
Lisandra brannte darauf, Madelins Tagebuch zu lesen, aber sie fand es unfair, das ohne ihre Mutter zu tun. Als Elena am Nachmittag vom Schlangestehen für die Lebensmitteleinkäufe zurückkehrte, stürmte sie auf sie zu und wedelte mit dem Tagebuch in der Luft herum. „Ich habe es gefunden!“
Elena wirkte eher unangenehm berührt. „Um ehrlich zu sein, bin ich nicht sicher, ob ich wirklich wissen will, was darin steht.“
„Oma wollte es doch aber so.“
„Es reicht ja, wenn du es liest. Ich muss jetzt sowieso das Abendessen vorbereiten. Vater hat frische Tomaten auf dem Markt gefunden; ich werde als Vorspeise Tomatensuppe kochen. Wir erwarten zehn Gäste. Kannst du mir helfen?“
„Mhh, Tomaten, lecker. Und klar helfe ich dir. Wir haben übrigens einen neuen Gast in der Pension. Er wird auch hier essen.“
„Schön. Aber hoffentlich bringt er nicht zu großen Hunger mit, sonst wird es knapp mit dem Fleisch.“
„Bitte, Mama, lass uns nach dem Essen wenigstens die ersten Seiten lesen. Schau mal.“ Sie zog das Foto hervor und hielt es Elena hin.
Ihre Mutter studierte die edel geschnittenen Gesichtszüge des blonden Mannes. „Ist er das?“
„Ich nehme es an. Er hat den gleichen Mund wie du. Und auch die Form der Augen – länglicher und schmaler als wir alle.“
„Tatsächlich?“ Elena presste die Lippen zusammen. „Nun, er sieht nett aus“, bemerkte sie trocken.
„Und sehr attraktiv“, ergänzte Lisandra. „Ich kann verstehen, dass Madelin sich in ihn verliebt hat.“
„Hm. Mit Papa hatte sie es wohl auch nicht immer leicht“, gab Elena zu und reichte Lisandra das Foto zurück. „All seine Frauengeschichten… Hör mal, fang das Buch einfach an und erzähl mir davon. Vielleicht lese ich es nach dir, okay?“
Später am Abend, als das kleine Restaurant, das sie im Speisesaal des Stadtpalais betrieben, geschlossen war, als in der Küche wieder Ordnung herrschte und Lisandra müde unter ihre Bettdecke schlüpfte, nahm sie Madelins Tagebuch vom Nachttisch und blätterte es neugierig auf.
5
Havanna, Januar 1958
Madelin
Madelin Ortega Gonzáles ging schnellen Schrittes den Malecón entlang und zog das breite Tuch, das sie um ihre Schultern geschlungen hatte, fester um sich. Es war ein frischer Tag im Januar, der kalte Wind vom Atlantik trieb die Wellen bis weit über die Mauer des Malecón, bis hin zu den Häusern auf der anderen Straßenseite, wo sich das Salz der Gischt unerbittlich in die Fassaden fraß und sie allmählich und unaufhaltsam zerstörte.
Der Wind zerrte an Madelins langen, dunkelbraunen Haaren und ihrem wadenlangen Rock. Ihre Korbtasche mit den Einkäufen fürs Abendessen wog schwer in ihrer Hand. Rasch bog sie in die Gassen der Altstadt ein und war dabei, eine schmale Straße zu überqueren. Eine Haarsträhne legte sich ihr quer über die Augen, während gleichzeitig die Sonne zwischen den Wolken hervorbrach und ein blendender Sonnenstrahl zwischen die Häuser fiel. Während Madelin die Hand hob, um sich die Haare aus dem Gesicht zu streichen, hörte sie quietschende Bremsen und spürte auf einmal einen kräftigen Stoß. Sie landete auf der Straße und verspürte stechenden Schmerz in Knien und Händen, ehe sie auf die Seite fiel. Als sie versuchte, sich aufzurichten, erkannte sie, dass sie vor den Rädern eines dunkelroten Cadillacs lag. Ein Mann stieg aus und eilte auf sie zu.
„Ist Ihnen was passiert?“, rief er erschrocken und beugte sich über sie.
Madelin bewegte prüfend ihre Glieder.
„Ich glaube nicht“, sagte sie etwas benommen. Ihre Knie brannten höllisch. Sie zog ihren Rock ein Stückchen nach oben, um sie zu begutachten. An ihren schlanken, hellbraunen Waden rann etwas Blut hinunter.
Passanten hatten sich genähert und wollten ihr zu Hilfe kommen, aber der Fahrer des Cadillacs scheuchte sie mit einer Handbewegung weg. „Alles okay, gehen Sie bitte weiter.“ Dann wandte er sich an Madelin. „Können Sie aufstehen?“ Er hockte sich neben sie und legte ihr einen Arm um die Taille. „Ich werde Sie ins Krankenhaus bringen“, entschied er.
„Das ist nicht nötig“, wehrte Madelin ab. Sie hatte keine Lust, die nächsten Stunden auf einem unbequemen Plastikstuhl zu verbringen, nur damit ein überlasteter Arzt ihr auf jedes Knie ein Pflaster kleben und dafür eine unverschämt hohe Summe verlangen würde. „Es sind sicher nur Schürfwunden.“
„Dann werde ich Sie wenigstens nach Hause fahren und einen Arzt kommen lassen. Sie könnten innere Verletzungen haben.“
Sie ließ sich von ihm aufhelfen und merkte, dass ihre Knie nicht nur schmerzten, sondern außerdem vor Schreck zitterten. Sie zögerte, zu einem Fremden ins Auto zu steigen und warf ihm einen prüfenden Seitenblick zu. Er hatte ein offenes, helles Gesicht, und der Blick seiner blaugrauen Augen war besorgt auf sie gerichtet. „Gut, tun Sie das“, hörte sie sich sagen.
Er öffnete die cremefarbene Beifahrertür des Cadillacs und ließ Madelin vorsichtig auf den Sitz gleiten. Es war das erste Mal, dass sie in so einem Wagen saß, in dem es nach Leder und edlem Herrenparfüm roch.
Hinter ihnen erklangen die ersten ungeduldigen Hupsignale. Dennoch ging der Mann seelenruhig noch einmal auf die Straße zurück und sammelte Guaven, Maniok und Zwiebeln ein, die aus Madelins umgefallener Korbtasche gerollt waren. Er stellte den Korb hinter den Fahrersitz, stieg ein und ließ den Motor an.
„Es tut mir sehr leid“, sagte er. „Die Sonne hat mich geblendet, ich war eine Sekunde abgelenkt und habe Sie nicht rechtzeitig gesehen.“
„Mir hat der Wind die Haare ins Gesicht geweht und so habe ich Ihren Wagen nicht gesehen.“
„Wo wohnen Sie?“
„In Centro Habana. Es ist nicht weit.“ Sie nannte ihm die Straße. „Wissen Sie, wie Sie da hinkommen?“
„Ich weiß jedenfalls, wie ich nach Centro Habana komme.“
Sie lachte. „Sie sind schon da. Diese Straße hier gehört bereits zu Centro Habana.“
„Ah, ich dachte, wir wären noch in Habana Vieja. Da werden Sie mir den Weg zeigen müssen.“ Ebenmäßige, helle Zähne schimmerten in seinem Gesicht, als er lächelte.
„Kein Problem. Fahren Sie erst mal weiter geradeaus. Sind Sie Amerikaner?“, fragte sie. Er sprach recht gut Spanisch, aber sein Akzent war unverkennbar.
„Ja. Ich komme aus Tennessee.“
Madelin hatte keine Ahnung, wo Tennessee lag. Ihre geografischen Kenntnisse über die Vereinigten Staaten von Amerika beschränkten sich auf Florida, dessen südlichste Küste an klaren Tagen vom Malecón aus zu erkennen war. „Machen Sie Urlaub hier?“
„Nein. Ich arbeite für eine amerikanische Firma, die in Kuba investiert hat, unter anderem in einer Zuckerrohrplantage.“
Er gehörte also zu den Ausbeutern, wie Salvador und seine Freunde das immer so verächtlich nannten. Dabei sah er so sympathisch aus.
„Ich heiße übrigens Robert Manson“, stellte er sich vor.
„Madelin Ortega Gonzáles.“ Sie betrachtete mit gerunzelter Stirn ihre Handballen, die ebenfalls Schürfwunden davongetragen hatten, und die dreckig waren von Straßenstaub.
„Sie wohnen sicher nicht allein, oder? Ich meine, haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmern kann?“
„Ich wohne bei der Familie meines Mannes. Die nächste rechts abbiegen.“
„Und Ihr Mann?“
„Er ist in der Sierra Maestra, bei Che und Fidel“, sagte sie mit einer Mischung aus Stolz und Unbehagen.
„Oh… Ach so.“ So einer ist das also. Sie konnte förmlich hören, wie er das in Gedanken hinzufügte.
„Für ein freies Kuba“, ergänzte sie trotzig.
„Meinen Sie, die werden es schaffen, Batista zu vertreiben?“
„Keine Ahnung. Ich hoffe nur, sie schaffen es, bevor mein Mann getötet wird.“ Madelin seufzte und drehte ein wenig nervös an ihrem Ehering.
„Das muss schwer für Sie sein.“ Er warf ihr einen forschenden Seitenblick zu. „Haben Sie Kinder?“
„Noch nicht. Und Sie? Sind Sie mit Ihrer Familie hier, Señor?“
„Nein“, erwiderte er.
„Gleich links abbiegen, und dann sind wir auch schon da.“
In dem schäbigen Viertel, in dem Madelin lebte, erregte der Cadillac genauso großes Aufsehen wie der blonde Robert in seinem blassblauen Maßanzug. Er wollte ihr wieder beim Gehen behilflich sein, aber Madelin wehrte ihn rasch ab. Es war ganz und gar nicht gut, wenn Salvadors Familie sah, wie sie Arm in Arm mit einem Mann nach Hause kam, aufgeschlagene Knie hin oder her. Ihr selbst war seine Berührung keineswegs unangenehm gewesen, er hätte sie auch gerne die Treppe hinauftragen dürfen.
„Ich komme alleine die Treppe hinauf, Sie brauchen nicht mitzukommen“, wehrte sie ab. „Ich bin okay.“
„Davon möchte ich mich lieber selbst überzeugen. Ich habe Sie schließlich fast über den Haufen gefahren. Oder ist gerade niemand in der Wohnung? Ich kann verstehen, dass Sie nicht mit einem Fremden allein sein wollen.“
„Doch, meine Schwiegermutter ist zu Hause.“
„Dann kommen Sie. Ich verstehe ein bisschen was von Erster Hilfe.“
Madelin gab nach. Sie betraten die spartanisch eingerichtete Wohnung und gingen in die Küche, wo eine beleibte Frau mittleren Alters Geschirr abtrocknete. Madelin stellte die Korbtasche auf den Tisch und erklärte ihrer Schwiegermutter Yolanda hastig die Sachlage.
„Dios mío, was haben Sie mit ihr gemacht?“, fuhr die Frau im geblümten Wickelkleid ihn an, und ein wütender Wortschwall ergoss sich über ihn, den er offensichtlich nicht ganz verstand. Und das war auch sicher besser so.
Madelin zog Robert am Arm aus der Küche und machte die Tür von außen zu. Sie führte ihn ins Wohnzimmer, wo Salvadors jüngere Schwester Maria auf dem Sofa saß.
„Geh mir eine Schüssel heißes Wasser holen, Maria. Und ein Handtuch und Verbandszeug. Bitte setzen Sie sich, Señor Manson.“
Robert setzte sich in den abgewetzten Polstersessel und wirkte wie ein Fremdkörper in dem Raum, dessen Mobiliar alt und bunt zusammengewürfelt war. Sicher besaß er zu Hause in diesem Tennessee ein großes elegantes Haus, so wie die reichen Kubaner in den besseren Vierteln Havannas. Ob es dort auch eine Mrs. Manson gab? Und ob blonde Kinder dort in einem kleinen Swimmingpool herumplanschten?
Wie alt er sein mochte? Er hatte kleine Lachfältchen in den Augenwinkeln und einige feine Linien auf der Stirn und um den Mund. Sie schätzte ihn etwa fünfzehn Jahre älter als sich selbst, also bestimmt siebenunddreißig oder achtunddreißig. Er wirkte reifer und gesetzter als Salvador, aber das mochte auch daran liegen, dass Nordamerikaner wohl eine völlig andere Mentalität als Kubaner besaßen.
Maria kehrte mit Schüssel, Handtuch und einer Rolle Verbandsmull zurück.
Madelin erwog, ihre junge Schwägerin hinauszuschicken, entschied dann aber, dass es besser wäre, sie als Anstandsdame hierzubehalten. Sie wollte vermeiden, dass ihre Schwiegermutter Gerüchte streute, die dann ihrem Mann zu Ohren kommen würden. Er war ohnehin eifersüchtig. Allerdings nicht eifersüchtig genug, um sie nicht monatelang allein zu lassen, während er sich mit den anderen bärtigen Rebellen in den Bergen verschanzte und den wilden Mann spielte, dachte sie mit leisem Groll. Sie fragte sich langsam, ob es eine gute Idee gewesen war, ihn zu heiraten. Ja, sie waren ineinander verliebt gewesen, aber sie hatte nicht gedacht, dass sie nun immer die zweite Geige spielen würde. Seit Fidel Castro aus dem Exil in Mexiko zurückgekehrt war, wirkte Salvador wie einer Gehirnwäsche unterzogen. Sprach nur noch von den schlechten Lebensverhältnissen der Unter- und Mittelschicht in Kuba.