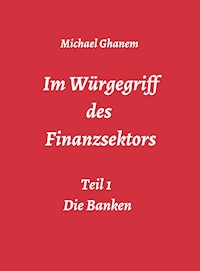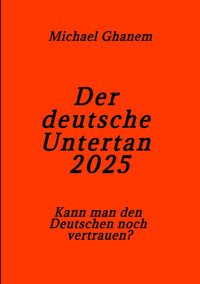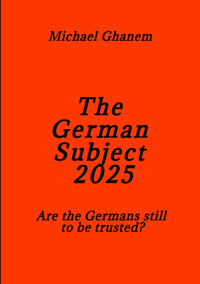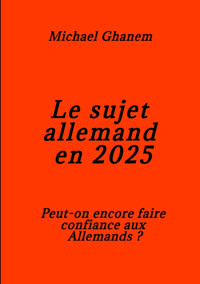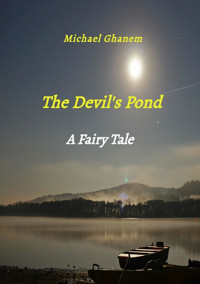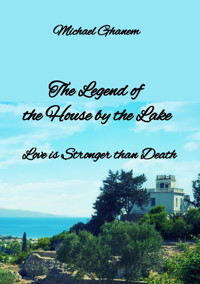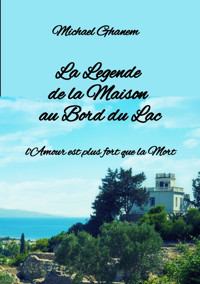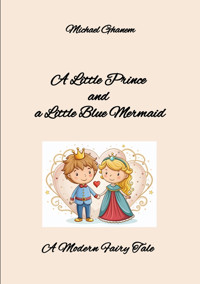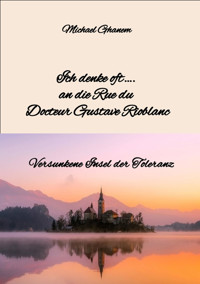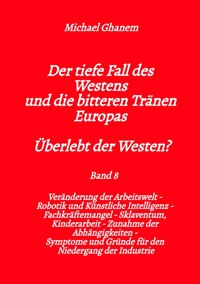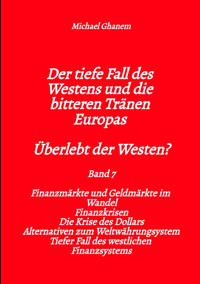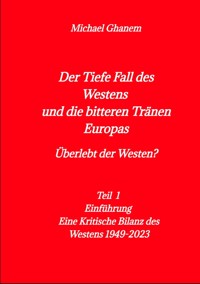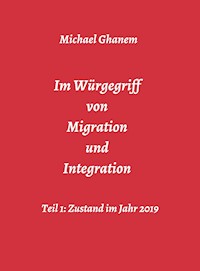
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Im Würgegriff ...
- Sprache: Deutsch
Keine anderen Themen wie die Migration und die Integration von Fremden in eine Gesellschaft sind so stark emotional beladen. Denn grundsätzlich haben große Teile der Völker Bedenken gegen das Unbekannte, was sie mit einem Fremden verbinden. Tatsache ist jedoch, dass seit Menschengedenken Völkerwanderungen in der ganzen Welt stattgefunden haben. Diese waren bedingt durch Nahrungssuche, durch Klimabedingungen, durch Kriege und Vertreibung. Insbesondere Deutschland und Mitteleuropa waren in ihrer gesamten Geschichte mit Wanderungen konfrontiert, sei es vom Westen nach Osten, sei es von Osten nach Westen, sei es vom Norden zum Süden oder vom Süden zum Norden. Die Germanen waren konfrontiert mit den Römern, es gab die Hunnen, es gab die Schweden, es gab die Franken, es gab die Franzosen, es gab die Alliierten, es gab die Russen, und dies ist nur eine kleine Aufzählung. Viele Deutsche, sei es im Osten oder im Westen, die sich gegen Flüchtlinge wehren, scheinen die deutsche Geschichte nicht zu kennen. Tatsache ist, dass Deutschland ohne Einwanderer und Flüchtlinge nicht das Land wäre, auf das sie heute so stolz sind. Allerdings hat eine ignorante Politik in den letzten Jahrzehnten geleugnet, dass Einwanderung notwendig ist, um dem Arbeitskräftemangel in einer alternden Gesellschaft zu begegnen. Es ist allerhöchste Zeit, dass die deutsche Bevölkerung diesen Tatsachen ins Auge blickt und ein angemessenes Einwanderungsgesetz verabschiedet. Und vor allem den vorhandenen Ängsten mit Aufklärung und mit Selbstbewusstsein über ihre Geschichte und Kultur begegnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 721
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dieses Buch ist allen Mahnern und einsamen Rufern gewidmet, denen das Wohlergehen unserer Gesellschaft am Herzen liegt. Jeder kritische Geist ist einsam und gehört zu einer Minderheit. Die Minderheit von heute kann jedoch die Mehrheit von morgen sein.
Dieses Buch ist auch meiner Frau Marlene gewidmet für ihre kritischen und klugen Ratschläge, die mich mein Leben begleitet haben und die mir stets eine gute Ratgeberin war.
Bonn, im April 2019
Michael Ghanem
„Die Gedanken sind frei“
Im WürgegriffvonMigrationundIntegration
Teil 1:Zustand im Jahr 2019
© 2019 Michael Ghanem
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
978-3-7482-7617-3
(Paperback)
978-3-7482-7618-0
(Hardcover)
978-3-7482-7619-7
(e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die verwendeten Abbildungen sind bei Statista lizenziert
Dies ist der erste Teil des Buchs über Migration und Integration und beschreibt den Ist-Zustand im Jahr 2019.
Der zweite Teil nimmt die kritische Würdigung der Entwicklung vor:
- Die Bevölkerungsbombe
- Spaltung der Gesellschaft
- Teure Integration
- Soziale Unruhen
- Was Tun?
Über den Autor:
Michael Ghanem
https://michael-ghanem.de/
Jahrgang 1949, Studium zum Wirtschaftsingenieur, Studium der Volkswirtschaft, Soziologie, Politikwissenschaft, Philosophie und Ethik, arbeitete viele Jahre bei einer internationalen Organisation, davon fünf Jahre weltweit in Wasserprojekten, sowie einer europäischen Organisation und in mehreren internationalen Beratungsunternehmen.
Bonn, im April 2019
Er ist Autor von mehreren Werken, u.a.
„Ich denke oft…. an die Rue du Docteur Gustave Rioblanc – Versunkene Insel der Toleranz”
„Ansätze zu einer Antifragilitäts-Ökonomie“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 1: Angela Merkel – Eine Zwischenbilanz“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 2: Politisches System – Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 3: Gesellschaft - Bilanz und Ausblick
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 4: Deutsche Wirtschaft- Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 5: Innere Sicherheit-Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 6: Justiz- Quo vadis?“ „2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 7: Gesundheit- Quo vadis? Band A, B und C“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 8: Armut, Alter, Pflege - Quo vadis?“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 9: Bauen und Vermieten in Deutschland - Nein danke“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 10: Bildung in Deutschland“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 11: Der Niedergang der Medien“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 12: Literatur – Quo vadis - Teil A“
„2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 13: Entwicklungspolitik – Quo vadis - Teil A“
„Eine Chance für die Demokratie“
„Deutsche Identität – Quo vadis?
„Sprüche und Weisheiten“
„Nichtwähler sind auch Wähler“
„AKK– Nein Danke!“
„Afrika zwischen Fluch und Segen Teil 1: Wasser“
„Deutschlands Titanic – Die Berliner Republik“
„Ein kleiner Fürst und eine kleine blaue Sirene“
„21 Tage in einer Klinik voller Narren“
„Im Würgegriff von Bevölkerungsbombe, Armut, Ernährung Teil 1“
„Im Würgegriff von Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Rechtsradikalismus,Faschismus, Teil 1“
„Im Würgegriff der politischen Parteien, Teil 1“
„Die Macht des Wortes“
„Im Würgegriff des Finanzsektors, Teil 1“
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Der Fachkräftemangel: Überlebensfrage für Deutschland
2.1 Vorbemerkung
2.2 Der Fachkräftemangel in Deutschland
2.3 Migration und Bevölkerungsentwicklung
2.4 Die gescheiterte Bevölkerungspolitik
2.5 Eine nicht vorhandene Einwanderungspolitik
2.6 Eine aus dem letzten Jahrhundert beibehaltene starre Lebensarbeitszeit
2.7 Die ausgesprochen familienfeindliche Behandlung von Familien und Kindern durch Wirtschaft und Politik
2.8 Die mangelnde Gestaltung zukünftiger Ausbildungsberufe
2.9 Die nicht vorhandene Organisationsentwicklung vieler Unternehmen und Konzerne
2.10 Betroffene Wirtschaftszweige
2.10.1 Der Pflegebereich
2.10.2 Gesundheitswesen
2.10.3 Polizei des Bundes und der Länder
2.10.4 Justiz
2.10.5 Äußere Sicherheit
2.10.6 Öffentliche Verwaltung
2.10.7 Mittlere und kleine Unternehmen
2.11 Ausbildung
2.11.1 Vorbemerkung
2.11.2 Zahlen und Fakten
2.11.3 Dauer des Studiums
2.11.4 Anzahl der Abbrecher
2.12 Gründe für den Fachkräftemangel
2.12.1 Mangelhafte Erziehung
2.12.2 Versagen der Schulen
2.12.3 Die Über-Akademisierung
2.13 Katastrophale Konsequenzen
2.14 Mögliche Lösungsansätze
3. Migration
3.1 Migration als Gefahr für die deutsche Identität?
3.2 Migration?
3.3 Migration Quo vadis?
3.3.1 Zur Auswanderung
3.3.2 Zur Einwanderung - Von den 50er Jahren bis heute
3.3.3 Kein Konzept vorhanden
3.4 Afrikanische Migration: Segen oder Fluch?
3.4.1 Vorbemerkung
3.4.2 Wassermangel und Verteilung der Rohstoffe: Konsequenzen und Umweltprobleme
3.4.3 Bevölkerungsexplosion?
3.4.4 In Afrika kann man Folgendes feststellen:
3.4.5 Hat der Club of Rome Recht mit der Bevölkerungsbegrenzung?
3.4.6 Bildung
3.4.7 Die Fehler des Westens
3.4.8 Konsequenzen
3.4.9 Migration als politische Waffe
3.4.10 Mögliche Lösungsansätze
3.5 Die illegale Migration
3.5.1 Vorbemerkung
3.5.2 Die Illegale Migration
3.5.3 Irreguläre Migration
3.6 Wie hoch sind die Kosten der Migration seit 2014?
3.7 Einwanderungsgesetz
3.8 Europa als Einwanderungskontinent
4. Flucht und Flüchtlinge
4.1 Flucht
4.2 Flüchtling
4.3 Flüchtlingskrise in Europa ab 2015
4.4 Flüchtlingskrise ab 2015 in Deutschland
4.5 Flüchtlingspolitik (Deutschland)
4.6 Flüchtlingslager
4.7 Flüchtlingseigenschaft
4.8 Eine große Illusion?
4.9 Das Grundgesetz, Europa und die Genfer Konvention
4.10 Kritische Würdigung des deutschen Asylrechts
4.11 Dubliner Vertrag
4.12 Kritische Würdigung des EU Asylrechts
4.13 Die Genfer Konvention
5. Integration
5.1 Integration (Soziologie)
5.2 Integration von Zugewanderten
5.3 Integrationsbeauftragter
5.4 Integrationsbeirat
6. Identität, Migration, Integration und Auseinandersetzungen zwischen Kulturen
6.1 Vorwort
6.2 Identität und Migration
6.3 Die Rolle der Grundidentität in der Migrationspolitik
6.4 Aufkommende Probleme der Migration
6.5 Erkenntnisse über die Rolle der Identität bei der Migration
6.6 Erwartungen
6.7 Identität und Integration
6.8 Lebenslüge der bisher propagierten Integration
6.9 Erwartungen
6.10 Kulturelle Auseinandersetzungen und Identität
6.11 Weltoffenheit?
6.11.1 Vorbemerkung
6.11.2 Der Weg zur Islamisierung
6.11.3 Kommunitarismus versus Assimilation
7. Zahlen und Fakten
7.1 Deutschland
7.2 Europa
7.3 Weltbevölkerung
7.4 Migration
7.5 Integration
7.6 Rassismus
8. Fazit
9. Epilog
10. Literaturverzeichnis
10.1 Migration, Flucht, Integration
10.2 Rassismus
1. Vorwort
Kein anderes Thema wie das der Migration und der Integration von Fremden in eine Gesellschaft ist so emotional beladen. Denn grundsätzlich hat ein großer Teil der Völker Bedenken gegen das Unbekannte, was mit einem Fremden verbunden wird.
Tatsache ist jedoch, dass seit Menschengedenken Völkerwanderungen in der ganzen Welt stattgefunden haben. Die Völkerwanderung war vor allem bedingt durch Nahrungssuche, durch Klimaveränderungen, durch Kriege und Vertreibung. Insoweit ist dies kein neues Phänomen; insbesondere Deutschland und Mitteleuropa sind durch ihre gesamte Geschichte hindurch stets mit Wanderungen konfrontiert gewesen, sei es von Westen nach Osten, sei es von Osten nach Westen, sei es vom Norden zum Süden, oder vom Süden zum Norden. Die Germanen waren konfrontiert mit den Römern, es gab die Hunnen, es gab die Schweden, es gab die Franken, es gab die Franzosen, es gab die Alliierten, es gab die Russen, und viele andere mehr.
Bereits Friedrich der Große hatte sich mit der Einladung der Hugenotten die ersten Gastarbeiter ins Land geholt. Ohne die polnischen Arbeiter hätte das Ruhrgebiet im 19. Jahrhundert nicht die rasante Entwicklung nehmen können, ohne die Fremdarbeiter im Dritten Reich hätte Hitler nach ein paar Monaten den Krieg verloren. Nach dem Krieg hätte der Wiederaufbau in Deutschland ohne Italiener, ohne Spanier, ohne Portugiesen, ohne Jugoslawen, ohne Türken, ohne Vietnamesen (in der DDR) sei es im Osten oder im Westen nicht so schnell erfolgen können. Insoweit ist die Migration eigentlich eine bekannte Sache in Deutschland. Jedoch muss festgestellt werden, dass vor allem die CDU/CSU mit der bornierten Behauptung, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei, schlicht einfach die Geschichte Deutschlands verfälscht hat. Dieses hirnverbrannte Festhalten an einer Auffassung die seit über 50 Jahren nicht mehr stimmt, führte dazu, dass Deutschland heute erhebliche Probleme hat hinsichtlich des Mangels an Fachkräften.
Die heutige Teil Deutschlands, sei es im Osten oder im Westen, der gegen Flüchtlinge aufsteht, scheint die deutsche Geschichte nicht zu kennen. Im 19. Jahrhundert führten die Weber Aufstände, Hunger und Not in Hessen, Württemberg, Bayern, selbst in Berlin dazu, dass über 2 Millionen Deutsche in die USA ausgewandert sind. Diese Tatsache scheinen viele angebliche Patrioten vergessen zu haben.
Die Flüchtlingskrise in Deutschland ist dadurch entstanden, dass eine mittelmäßige Kanzlerin, die niemals konzeptionell gedacht hat, sich nicht der Probleme bewusst war, die sie im Lande mit der Aufhebung der Grenzsicherung verursacht hat. Festzuhalten ist: hätte die CDU vor 30 Jahren ein Einwanderungsgesetz verabschiedet, wäre diese Krise niemals entstanden. Zudem hat diese möchte-gern-alternativlose Kanzlerin nicht nur Deutschland geschadet, sondern ganz Europa.
Festzuhalten ist aber auch, dass eine Einwanderungspolitik an einem von der Bevölkerung akzeptierten Typ von Einwanderer ausgerichtet werden muss. Wenn die Fremdheit der Kultur zu groß ist, ist mit Widerstand zu rechnen. Es ist daher nicht nachzuvollziehen, dass die Berater dieser mittelmäßigen Kanzlerin sie auf diese Probleme nicht hingewiesen haben.
Deutschland ist bedingt durch seine Alterspyramide auf Einwanderung angewiesen, und nach Ansicht der meisten Sachverständige brauchen wir eine Netto-Einwanderung von 200.000 bis 300.000 Menschen jährlich. Dies muss jedoch dem Volk verkauft werden, was die Politiker wie der Teufel das Weihwasser vermeiden, denn sie meinen, dass die deutsche Bevölkerung nicht reif sei, um mit Problemen konfrontiert zu werden. Dies ist falsch.
Ziel des Buches ist es zu zeigen, dass Migration und Integration mit sehr vielen Facetten verbunden sind, und dass Deutschland internationale Verträge unterschrieben hat, die es zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet. Das muss man der Bevölkerung auch klar mitteilen. Dies ist bis heute nicht geschehen. Migration und Integration sind nach heutigen Erkenntnissen eine unabdingbare Notwendigkeit, um halbwegs den jetzigen Wohlstand zu erhalten.
Der Autor versichert, dass er zum Erstellen dieses Buches nicht auf Erkenntnisse aus seinem beruflichen Werdegang zurückgegriffen hat, er hat sich ausschließlich öffentlich zugänglicher Informationen bedient.
2. Der Fachkräftemangel: Überlebensfrage für Deutschland
2.1 Vorbemerkung
Betrachtet man die heutigen Anforderungen der Wirtschaft und der Gesellschaft, so muss festgestellt werden, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren mehrere Millionen Fachkräfte in der Pflege, im Gesundheitswesen, in den Ingenieurswissenschaften, im Handwerk, im Ausbildungsbereich, bei den Beamten, insbesondere bei Sicherheitsbeamten (innere und äußere Sicherheit), in der Wissenschaft sowie in der Chemieindustrie fehlen werden. Demgegenüber werden mehrere Millionen Arbeitskräfte durch die technische Revolution (wie autonomes Fahren, Digitalisierung und Gentechnologie) freigestellt. Allein im Bereich der Finanzdienstleistungen (Banken und ähnliches) werden nach vorsichtigen Schätzungen des DIW 50 % der Beschäftigten freigestellt werden. Durch die Einführung der Elektrifizierung und des autonomen Fahrens werden im Bereich der Autoindustrie bis zu 40 % der Beschäftigten ihren Arbeitsplatz verlieren (vor allem weil bei einem Verbrennungsmotor 7.000 Einzelteile benötigt werden, für einen Elektroantrieb lediglich 400). Im Bereich der Werkzeugmaschinen werden Arbeitnehmer zunehmend durch Robotik ersetzt. In der Chemieindustrie wird der Automatisierungsgrad bis zu 70 % der Arbeitsprozesse betragen.
Das Problem besteht jedoch darin, dass diese Transformation der Arbeitswelt nicht 1:1 gelingen wird. Sei es aus humanen Gründen, aus strukturellen Gründen oder aus soziologischen Gründen. Mit anderen Worten: Die totale Flexibilisierung des Menschen hat und soll ihre Grenzen haben. Es ist daher wichtig, dass Politik und Wirtschaft die Vorbereitung auf diese Transformationen ernsthaft in den Griff bekommen und mittel- und langfristige Transformationskonzepte erstellen, die Verluste zumindest minimieren würden. Nur zu fordern, dass Fachkräfte benötigt werden, reicht nicht aus.
Es stellt sich daher die Frage, wer diese Transformationen bezahlen soll und über welchen Zeitraum sie mit so wenigen Verwerfungen wie möglich vollzogen werden können.
2.2 Der Fachkräftemangel in Deutschland
Der Fachkräftemangel in Deutschland hat verschiedene Ursachen:
- eine gescheiterte Bevölkerungspolitik
- eine nicht vorhandene wirksame Einwanderungspolitik
- eine aus dem letzten Jahrhundert beibehaltene starre Lebensarbeit
- die ausgesprochen familienfeindliche Bewertung der Familie und Kinder durch Wirtschaft und Politik
- die mangelhafte zukünftige Berufsbildergestaltung und deren Anforderungen
- die nicht vorhandene Organisationsentwicklung vieler Unternehmen und Konzerne
- die grundsätzliche Veränderung der Arbeit hinsichtlich Zeitarbeit und Verträgen auf Zeit
- veraltete Berufsbilder sowie deren Organisation (Konzeption der IHK) und Arbeitsorganisationen (Gewerkschaften).
2.3 Migration und Bevölkerungsentwicklung
In Anlehnung an Abschnitt 4.3.13 sollen hier folgende mengenmäßigen Darstellungen erfolgen.
Merkel verweigert stets die Kenntnisnahme dessen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass die Bevölkerungszunahme nicht mehr allein durch den natürlichen Zuwachs gewährleistet wird1, denn deutsche Frauen stehen mit einer Gesamtfruchtbarkeitsrate von 1,4 an der untersten Grenze der Fruchtbarkeitsrate Europas, dabei würde mindestens eine Fruchtbarkeit von 1,8 benötigt. Dies bedeutet, dass die deutsche Bevölkerung von 81,1 Millionen im Jahr 2015 auf 76,4 Millionen im Jahr 2050 fallen wird.
Quelle: Statistisches Bundesamt, entnommen von: https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/#!o=2014v1
Quelle: Statistisches Bundesamt: Bevölkerung Deutschlands bis 2060, 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, S. 15.
Diese Verminderungszahl ist lediglich ein Indikator, die wesentliche Aussage jedoch ist die sogenannte Alterspyramide Deutschlands.
Dies zeigt, dass die Alterspyramide Deutschlands in den unteren Jahrgängen zwischen 0-40 Jahren äußerst ungünstig ist. Im Jahr 2060 ergibt sich wiederum abermals eine Minderung der jungen Leute und zwar bis zu einer Gruppe von 45 Jahren. Die beiden oben dargestellten Abbildungen zeigen auf eine erschreckende Weise die Überalterung der deutschen Bevölkerung. Insoweit ist es notwendiger denn je, eine aktive Bevölkerungspolitik zu betreiben, die auf einem vernünftigen Konzept basieren könnte. Dies ist in den letzten 13 Jahren von Angela Merkel tunlichst vermieden worden, denn weder in den Investitionen für Wohnungen für junge Paare, noch für die Steuerung der Wirtschaftspolitik hinsichtlich langfristiger Beschäftigungsräume, die notwendig sind um Familienplanung vornehmen zu können, noch in der Migrationspolitik wurde ein nachhaltiges Konzept dargestellt.
Die Unehrlichkeit Angela Merkels hinsichtlich des realen Zustands der arbeitenden Klasse (Niedriglohnsektor und Befristung der Tätigkeit selbst bei Akademikern) stellen eines der größten Hindernisse für eine proaktive Bevölkerungspolitik dar. Proaktive Bevölkerungspolitik heißt nichts anderes, als dass die Leute bei ihren Entscheidungen, Kinder zu zeugen, keine Bedenken haben, diese Kinder in einer „vernünftigen“ Umgebung aufwachsen zu sehen, die insbesondere in den ersten Jahren weniger Finanzproblematiken mit sich bringt. Zudem hat Angela Merkel versäumt, den Wert der Kinder in der Gesellschaft gleichzustellen, denn es kann nicht sein, dass ein Kind eines Millionärs über steuerliche Anreize der Eltern höhere Anreize anbietet als ein Kind von einem Klein- oder Mittelverdiener. Es ist jedoch zu vermerken, dass die Geburtenrate bei Akademikerinnen um 1,5% gestiegen ist.
Bei einer proaktiven Bevölkerungspolitik muss auch die Gebärfähigkeit der Frauen in Bezug auf ihr Alter beachtet werden. Hierfür soll die nachfolgende Tabelle angeführt werden.
Nach dem DIW und verschiedenen Wirtschaftsinstituten bedarf Deutschland einer qualifizierten Einwanderung von ca. 40.000 Einwanderern pro Jahr. Dies ist mit dem Prinzip verbunden, eine Verjüngung der Alterspyramide und Verhinderung starker Rückgänge der Bevölkerung im Jahr 2050-2060 insgesamt zu verhindern. Um jedoch so eine geregelte Einwanderung durchführen zu können, muss endlich ein Konzept, dass möglicherweise an das kanadische oder australische Einwanderungssystem angelehnt sein kann, geschaffen werden. Dies soll jedoch mit einer qualifizierten Auswahl der Einwanderer verbunden sein, die nach dem langfristigen Bedarf Deutschland ausgerichtet sind. Der Kampf um die besten Köpfe der Welt ist jedoch voll entbrannt und daher werden diese Einwanderer Deutschland Geld kosten. Kostengünstige qualifizierte Einwanderungen gibt es nicht.
Zudem muss in dem Konzept die sogenannte Absorptionsfähigkeit der deutschen Gesellschaft von fremden Kulturen berücksichtigt werden, das heißt der Anteil der Minderung von Integrationsreibungspunkten gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Dies wird jedoch auch nicht kostengünstig sein und muss durch eine langfristige Kommunikationspolitik mit der Bevölkerung möglich gemacht werden.
Der Versuch Deutschlands, in der Informationstechnologie gut ausgebildete Einwanderer zu gewinnen, ist kläglich gescheitert, denn das Angebot, das Deutschland dieser Zielgruppe gemacht hat, war schlicht einfach unterdurchschnittlich. Das zu schaffende Konzept der Einwanderung muss unbedingt den Gesichtspunkt der Planungssicherheit für die Einwanderer enthalten, das heißt die Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis oder besser nach einer kurzen Zeit das Anbieten der deutschen Staatsbürgerschaft. Damit ist jedoch die Problematik der Zwei-Staats-Angehörigkeit verbunden. Daher ist es wichtig, dass die Auswahl der Einwanderer von Ländern kommt, die den Verzicht der ersten Staatsangehörigkeit ermöglichen.
Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass die Auswahl der Einwanderer das Gleichgewicht zwischen Moslems und Juden nicht beeinträchtigt. Die dritte Hauptkomponente ist, dass die Anzahl der auszusuchenden Einwanderer nicht einseitig (wie in Deutschland mit der Türkei) aus einem Land in das andere kommen, um die Einflussnahme von politischen Führern des Herkunftslandes zu verhindern oder zu vermindern.
Nach dem DIW und verschiedenen Wirtschaftsinstituten bedarf Deutschland einer qualifizierten Einwanderung von ca. 40.000 Einwanderern pro Jahr. Dies ist mit dem Prinzip verbunden, eine Verjüngung der Alterspyramide und Verhinderung starker Rückgänge der Bevölkerung im Jahr 2050-2060 insgesamt zu verhindern. Um jedoch so eine geregelte Einwanderung durchführen zu können, muss endlich ein Konzept, dass möglicherweise an das kanadische oder australische Einwanderungssystem angelehnt sein kann, geschaffen werden. Dies soll jedoch mit einer qualifizierten Auswahl der Einwanderer verbunden sein, die nach dem langfristigen Bedarf Deutschland ausgerichtet sind. Der Kampf um die besten Köpfe der Welt ist jedoch voll entbrannt und daher werden diese Einwanderer Deutschland Geld kosten. Kostengünstige qualifizierte Einwanderungen gibt es nicht.
2.4 Die gescheiterte Bevölkerungspolitik
In den letzten 30 Jahren und insbesondere in den letzten 13 Jahren wurde weder eine reale Bevölkerungspolitik konzipiert noch durchgeführt. In Deutschland wurde, gemäß der Aussage des ersten Bundeskanzlers Adenauer „die Leute wissen, wie man Kinder bekommt“, verfahren. Entwicklungen der Frauen hinsichtlich ihrer Ausbildung, Entwicklungen im Berufsleben und Entwicklungen in der Gleichberechtigung wurden nicht ernsthaft bedacht. Hierzu kommt erschwerend, dass außer Acht gelassen wird, dass die Gebärfähigkeit einer Frau altersbedingt abnimmt, da dies einfach als ein Faktum der Gesellschaftsentwicklung festgestellt wird. Diese Problematik wurde von Gesellschaftskritikern bereits in den 80-er Jahren sehr oft reklamiert. Die Beteiligten (Wirtschaft, politische Klassen, Kirchen, Arbeitsorganisationen) und die Frauen selbst (insbesondere Frauenbewegungen) haben dies jedoch nie ernsthaft in Betracht gezogen. Es ist daher wichtig, dass zukünftige Konzepte in der Bevölkerungspolitik die Gebärfähigkeit als den wichtigsten Teil erachtet, um die Abnahme der Bevölkerung zumindest zu mindern.
2.5 Eine nicht vorhandene Einwanderungspolitik
Bis heute hat Deutschland kein Einwanderungsgesetz, dabei kamen die ersten Einwanderer schon Anfang der 50er Jahre. Was man verächtlich unter dem Begriff „Gastarbeiter“ ins Land geholt hat, hat in erheblichem Maße dazu beigetragen, die Weiterentwicklung Deutschlands, sei es im Autobahnbau, im Brückenbau, im Wohnungsbau (inklusive Sozialwohnungsbau), im Bereich der Wissenschaft und im Bereich des Gesundheitswesens voranzutreiben. Die Generation der Gastarbeiter und ihre Nachkommen tragen, nach einschlägigen Rechnungen, mit mindestens 20 % zum jährlichen BIP bei. Diese Generation hat auch dazu beigetragen, dass sich die sozialen Aufwendungen in Grenzen gehalten haben. Das hat auch dazu geführt, dass Unternehmen sich über die letzte Dekade hinweg einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Wettbewerbern erarbeitet haben und es ist bis heute nicht verständlich, dass insbesondere große Teile der CDU Deutschland nicht als Einwanderungsland ansehen. Es ist für die heutige Wirtschaft und die zukünftige Entwicklung eine unabdingbare Voraussetzung, dass eine geregelte Einwanderungspolitik zustande kommt. Dies setzt wiederum voraus, dass es moderne Einwanderungsgesetze gibt, so wie es die Kanadier oder die Australier vormachen.
Der Kampf „um die besten Köpfe“ hat schon längst begonnen. Weltweit werben andere Länder mit sehr attraktiven Konditionen um jeden gut ausgebildeten Einwanderer. Die so genannte Blaue Karte für IT-Fachleute in Deutschland war und ist ein misslungener Versuch, der an kleinen Befindlichkeiten so mancher Politiker gescheitert ist. Eine erstklassige IT-Fachkraft ist heute weltweit nicht unter einem Jahreseinkommen von 130.000 bis 150.000 US Dollar zu bekommen. Neben der Schwierigkeit, die die deutsche Sprache für ausländische Fachkräfte darstellt, stellt sich Deutschland durch viele Restriktionen als ein Land dar, in dem Fachkräfte nicht willkommen sind. Gegen dieses Bild Deutschlands im Ausland und die reale Willkommenskultur für gewollte und benötige Fachkräfte muss endlich ein nachhaltiges Konzept erstellt, umgesetzt und mit erheblichen Finanzmitteln ausgestattet werden. Zu der Finanzierung dieser Programme muss die deutsche Wirtschaft in erheblichem Maße beitragen.
Eine weitere Problematik in diesem Bereich ist die fachliche Anerkennung der Eignung von Fachkräften. Dies ist insbesondere für die Bereiche Technik und Gesundheit (Ärzte) relevant. Hier gilt es, überkommene Ansichten und Traditionen über Bord zu werfen, um endlich eine gewisse Flexibilität zu erreichen, damit die betroffenen Wirtschaftsbereiche eine reale Chance zur Weiterentwicklung erhalten. Zu diesem Problem der Migration gesellt sich gleichzeitig das Problem, dass sehr viele gut ausgebildete Deutsche in die USA, nach Kanada, Australien, Brasilien, England oder in die nordischen Länder auswandern. Diese Auswanderung muss mit aller Macht bekämpft werden und die Ursachen für eine Auswanderung, die in der Verwaltung, mangelnder Risikobereitschaft der Gesellschaft, der Banken, der Regierung und Organisationen, rechtlichen Hürden und der mangelnden Bereitschaft der Gesellschaft, das Scheitern zu erlauben, begründet sind, zu beseitigen.
2.6 Eine aus dem letzten Jahrhundert beibehaltene starre Lebensarbeitszeit
Mit der technischen Revolution (Digitalisierung, autonomes Fahren oder Gentechnologie) werden ab dem Jahr 2025 verschiedene Arbeitsformen entstehen. Dadurch werden jetzige Arbeitsformen, wie der 8-Stunden-Tag und feste Monatsgehälter zum Teil verschwinden. Demgegenüber wird die sogenannte Projektarbeit zunehmen. Die Projektarbeit ist gekennzeichnet durch das Erbringen einer konkreten Leistung über einen definierten Zeitraum. Dies bedeutet, dass jemand nach Beendigung der Projektarbeit erst einmal arbeitslos ist. Gleichzeitig muss parallel für Nachfolgeprojekte akquiriert werden. Damit stellt sich die Frage, ob diese Form der Arbeit überhaupt jedem zugänglich ist. Damit verbunden ist, dass die Zahl der sogenannten strukturellen Arbeitslosigkeit zumindest zeitweise zunehmen wird. Um das jedoch in Grenzen zu halten, besteht die Notwendigkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens, verknüpft mit der Verpflichtung, Ausbildung und Weiterbildung im gleichen Bereich oder ähnlich gelagerten Bereichen zu absolvieren. Um dies jedoch realisieren zu können, müssen die wirtschaftlichen und politischen Eliten das Verständnis haben, dass sich mit der technischen Revolution eine grundlegende Transformation der deutschen Gesellschaft vollzieht. Der Autor ist sehr pessimistisch im Hinblick auf die Einsicht bei den politischen Klassen. Mit der traditionellen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wird diese Problematik nicht gelöst. Mit Zunahme der Flexibilisierung wird sich auch die Treue der Arbeitnehmer zu ihren Unternehmen verändern, da diese nicht auf Dauer an ihre Arbeitgeber gebunden sind. Das bedeutet, dass die gewünschte Flexibilität der Wirtschaft und Unternehmen auch eine Flexibilität der Fachkräfte mit sich ziehen wird. Ist dies jedoch nicht der Fall, so werden mit Sicherheit viele Unternehmen ein erhebliches Problem zur Bewältigung von Aufträgen haben. Umso wichtiger ist es, dass diese Unternehmen ihre Fachkräfte durch gezielte Strategien langfristig an sich binden.
2.7 Die ausgesprochen familienfeindliche Behandlung von Familien und Kindern durch Wirtschaft und Politik
In Deutschland stellt die Familienpolitik ein Konglomerat von Einzelmaßnahmen dar die teilweise ohne Sinn und Verstand nebeneinandergelegt werden und die letztendlich die Übersicht und Kontrolle sehr schwer macht. Es ist kein allgemeines Ziel ausformuliert. Welche Ziele verfolgt die Familienpolitik, welche Vorgaben haben die Familien, welche Rechte und Pflichten haben die Familien., mit welchen genau definierten Organen werden die Familien betreut und ggf. überwacht, nach welchen Methoden werden diese Organe zur Familienbetreuung und – Überwachung kontrolliert, haben diese Organe die nötigen Mittel, (die Jugendämter usw.) haben diese Organe die ausreichend qualifizierten Mitarbeiter, wie sieht es aus mit der steuerlichen Bewertung der Familie und er Kinder?
Allein an der letzten Frage stellt sich ein Problem der Gerechtigkeit dar und zwar, warum die Kinder von Millionären bevorzugt sind gegenüber Kindern aus armen Familien, denn die Möglichkeit von steuerlichen Vorteilen für Kinder aus vermögenden Elternhäusern besteht, Kinder von ärmeren Eltern müssen sich hingegen mit dem sog. Kindergeld begnügen. Warum erhalten reiche Eltern noch Kindergeld? Warum werden die Aufwendungen zur Kinderbetreuung und Kindergeld den Vermögenden gewährt und nicht mit diesen Mitteln die Kinder aus unteren und mittleren Schichten gefördert?
Die Kinder- und Familiengesetzgebung sind für durchschnittlich ausgebildete Personen äußerst schwierig zu verstehen, und es gibt sehr viele Grauzonen, die zu Fehlverhalten führen können. In diesem Bereich ist eine schwarz-weiße Klarstellung vonnöten. Zudem stellen das Scheidungsrecht und die Zuordnung der Kindererziehung die Gesellschaft vor erhebliche Schwierigkeiten. Dies ist verbunden mit späteren Kosten für die Gesellschaft. Es ist daher vonnöten, alles daran zu setzen, dass Scheidungen zum Wohl der Kinder und trotz gegenteiliger Meinung von sog. Fachleuten erschwert werden müssen. Das Benutzen von Kindern in Scheidungsverfahren für persönliche Abrechnungen der Elternteile, auch wenn diese so subtil sind, müssen mit strafrechtlich geahndet werden. Dass der Staat alle die Verwerfungen nicht lösen kann, ist dem Autor klar. Aber das Wohl der Kinder und die Schutzfunktion des Staates müssten Priorität haben vor dem Recht der Erwachsenen.
2.8 Die mangelnde Gestaltung zukünftiger Ausbildungsberufe
Wirtschaft und Politik und insbesondere die Bildungspolitik haben in den letzten Jahren in erheblichem Maße versagt hinsichtlich einer engen Zusammenarbeit bei der Gestaltung und Festlegung von neuen Berufsbildern. Unter dem Vorwand, dass Bildung Ländersache ist, sind in Deutschland einige Berufsbilder entstanden, die den zukünftigen Anforderungen nicht entsprechen, insbesondere unter Qualitätsaspekten. Unter dem Vorwand der Freiheit der Wissenschaft haben die Universitäten in Deutschland eine akademische Elite aufgebaut, die zum großen Teil nicht den Anforderungen zukünftiger Berufe entsprechen. Das stolze Bild der berufsbildenden Schulen im Dualen System hat in den letzten 13 Jahren stark gelitten und dies vor allem durch das Versagen der IHKen, die nicht in der Lage sind, Berufsbilder zeitnah und dem Bedarf entsprechend zu formulieren. Die Prüfungen der IHKen für die einzelnen Ausbildungsberufe haben an Qualität und Quantität sehr stark nachgelassen und müssen revidiert werden. Es wird immer noch viel in Berufen ausgebildet, die es längst nicht mehr gibt oder die in der nahen Zukunft verschwinden werden.
Neben den Berufsbildenden Schulen haben die Grundschulen und Hauptschulen in eklatantem Ausmaß versagt. Und in den verschiedenen Bundesländern werden verschiedene Qualitäten an Schülern produziert. Die Qualität der Schulabgänger hat sich insbesondere in den Stadtstaaten, in NRW, in Teilen der östlichen Länder, in Rheinland-Pfalz, im Saarland verschlechtert. Dies kann angesichts der Herausforderungen, die kurz-, mittel und langfristig Deutschland erreichen werden, nicht mehr hingenommen werden. Sei es der Lehrermangel in wichtigen Fächern, sei es die mangelhafte Qualität der Lehrer, sei es die nicht ausreichend durchgeführte Grunderziehung der Kinder durch die Familie. Dies trifft in erheblichem Maß Kinder aus Migrationsumfeldern. Es bleibt zu hoffen, dass letztendlich die Wirtschaft ihre Forderungen an die Qualität der Ausbildung gegenüber der Politik in erheblichem Masse verdeutlicht und diese Forderungen durchsetzt.
2.9 Die nicht vorhandene Organisationsentwicklung vieler Unternehmen und Konzerne
Die Organisationsentwicklung ist eine kontinuierliche Aufgabe für jedes Unternehmen, sei es ein kleines, mittleres oder großes. Die kontinuierliche Organisationsentwicklung, sei sie durch den Markt, durch die Produktentwicklung, oder durch die organische Entwicklung getrieben, ist stets mit Kosten verbunden. Diese Kosten müssen jedoch im Interesse der Langlebigkeit des Unternehmens aufgebracht werden. Betrachtet man jedoch, dass in den meisten Unternehmen, insbesondere bei den Nicht-Familienunternehmen, diese langfristigen Ziele nicht verfolgt werden, so darf man sich nicht darüber wundern, dass Organisationsentwicklung bei vielen Vorständen mit Organisationsumbrüchen verwechselt werden. Organisations- Umbrüche und Reorganisationen sind keinesfalls Organisationsentwicklungen, denn diese werden häufig kurzfristig ohne Rücksicht auf Verluste durchgeführt und sind in den meisten Fällen verbunden mit einem Ausbluten des Unternehmens, welches durch den Abgang von tragenden Mitarbeitern des Unternehmens verursacht wird, die deren Säule darstellen. In diesem Zusammenhang werden aber keine Berufsbilder für die Organisationsentwicklung formuliert, die auf die Bewältigung zukünftiger Aufgaben ausgerichtet sind, sondern lediglich der kurzfristigen Gewinnsteigerung folgen müssen.
2.10 Betroffene Wirtschaftszweige
Folgende Wirtschaftszweige sind akut von dem prognostizierten Fachkräftemangel für den Zeitraum 2018 bis 2030 betroffen.
2.10.1 Der Pflegebereich
Bereits heute fehlen ca. 200.000 Fachkräfte in der Altenpflege und es ist damit zu rechnen, dass bis 2030 bei einem pessimistischen Szenario bis zu 600.000 Fachkräfte benötigt werden. Der zu erwartende Mangel ist heute schon bekannt, es fehlt jedoch der politische Wille, konzeptionell den gesamten Pflegebereich umzugestalten und mit den nötigen Mitteln auszustatten.
2.10.2 Gesundheitswesen
Bedenkt man, dass das Durchschnittsalter der niedergelassenen Ärzte heute bei ca. 55 Jahren liegt, ist ein Ärztemangel in erheblichem Ausmaß zu erwarten. D.h. über 50% der Ärzte werden spätestens 2030 ersetzt werden müssen. Im Krankenhausbereich und in ambulanten Gesundheitsberufen fehlen bereits heute über 150.000 Stellen und das Durchschnittsalter liegt bei über 50 Jahren. Der Kollaps des Gesundheitswesens ist vorprogrammiert und die politische Elite versucht dies totzuschweigen.
2.10.3 Polizei des Bundes und der Länder
Das Durchschnittsalter der Polizisten liegt bei über 50 Jahren. Daraus ergibt sich, dass 40% der Beamten bis 2030 ersetzt werden müssen. Auch hier werden die Probleme von der Politik und von der Presse totgeschwiegen.
2.10.4 Justiz
Bereits heute fehlen 2.000 Richter. Die Anzahl fehlender Staatsanwälte und sonstigen Mitarbeitern in der Justiz beträgt Tausende von Stellen. Das Durchschnittsalter liegt teilweise über 55 Jahren. Daraus ergibt sich, dass 60% der vorhandenen Beschäftigten bis 2030 ersetzt werden müssen.
2.10.5 Äußere Sicherheit
Auch hier fehlen bereits heute mindestens 20.-30.000 Soldaten vor dem Hintergrund der geopolitischen Herausforderungen. 35% der Bundeswehrangehörigen sind älter als 50 Jahre und werden in den nächsten Jahren mit Erreichen der Altersgrenze von 55 Jahren ausscheiden. Dies stellt die Bundeswehr vor die Herausforderung, das notwendige Personal mit der erforderlichen Qualifikation zu rekrutieren.
2.10.6 Öffentliche Verwaltung
Auch in der Öffentlichen Verwaltung und bei den Beamten ist ein Durchschnittsalter von über 50 Jahren festzustellen, d.h. 60% des vorhandenen Personals muss in den nächsten 13 Jahren ersetzt werden. Auch hier hat die Politik versagt und keine Vorsorge getroffen.
2.10.7 Mittlere und kleine Unternehmen
Sowohl in Baden-Württemberg als Stammland des Mittelstands als auch durchgängig in der Bundesrepublik stellt sich die Herausforderung der Suche nach einem Unternehmensnachfolger. Es muss davon ausgegangen werden, dass bei mindestens 35% aller Unternehmen kein physischer Erbe vorhanden ist, der bereit ist sind die Nachfolge zu übernehmen. Es muss daher befürchtet werden, dass ein Teil dieser Unternehmen entweder an Finanzinvestoren oder ausländische Investoren verkauft oder schlichtweg aufgelöst werden. Der Verlust für Deutschland und seine Wirtschaftskraft ist heute nicht mit realen Zahlen zu beziffern. Der Starrsinn der Politik, diese Problematik möglicherweise durch die Vereinfachung der Gründung von Stiftungen zu mindern ist nicht zu verantworten.
2.11 Ausbildung
2.11.1 Vorbemerkung
Auch hier werden in den Schulen, Gymnasien und Hochschulen mit dem Ausscheiden der Lehrkörper erhebliche Lücken entstehen. Es ist damit zu rechnen, dass bis zu 65% der Lehrkräfte in Deutschland bis 2030 zu ersetzen sein werden. Die Ausbildung von Lehrkräften, sei es in Schulen, Gymnasien oder Hochschulen, bedarf eines gewissen Vorlaufs. Angesichts der bisherigen sinnlosen Sparpolitik wurden notwendige Maßnahmen nicht rechtzeitig eingeleitet. Daher steuert das Land auf eine Bildungskatastrophe zu.
2.11.2 Zahlen und Fakten
Es ist festzustellen, dass das Durchschnittsalter der Erstabsolventen gesunken ist, von 24,4 Jahre auf 23,8 Jahre innerhalb von zwei Jahren. Die Altersverteilung sieht aus wie folgt:
-
Bachelorabschluss
23,8 Jahre
-
Fachhochschulabschluss
26,2 Jahre
-
Lehramtsabschluss
24,7 Jahre
-
Sonstige universitäre Abschlüsse
26,6 Jahre.
Vgl. Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, Ausgabe 2016
Abweichungen zwischen verschiedenen Fächern
Die Ausbildung spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Versorgung der Wirtschaft und des gesamten Landes mit Fachkräften sicherzustellen. Umso wichtiger ist es, dass die Ausbildung nicht nur technisches Wissen vermittelt, sondern auch Methoden und Verhaltensweisen, die maßgebend für den Erfolg in einer beruflichen Laufbahn sind. Es ist in den letzten fünfzehn Jahren jedoch eine besorgniserregende Diskrepanz zwischen der Anzahl der Studierenden und der Anzahl derjenigen, die sich eine Berufsausbildung aussuchten, zu beobachten. Dabei ist zu vermerken, dass die Akademiker in Deutschland auf eine maximale Nachfrage von 20 bis 25% aller Tätigkeiten treffen. Zu vermerken ist aber im Gegensatz dazu auch, dass in der letzten Zeit die Anzahl derjenigen, die ein Studium beginnen wollten, fast 70% der Jugendlichen darstellte und dass kaum 20% eine andere betriebliche Berufsausbildung anstrebten. Es gibt zu viele Akademiker für zu wenig Stellen. Insoweit ist mit einer Proletarisierung des Standes der Akademiker zu rechnen. Die nachfolgenden Ausführungen stellen die Zahlen genau zusammen, sowohl hinsichtlich der Studierenden als auch der Auszubildenden in Betrieben.
2.11.3 Dauer des Studiums
Die mittlere Fachstudiendauer (Median) sah 2014/2015 aus wie folgt:
-
Bachelorabschluss
6,7 Semester
-
Fachhochschulabschluss
7,3 Semester
-
Lehramtsabschluss
8,4 Semester
-
Sonstige universitäre Abschlüsse
13,6 Semester.
Für den Bereich der Masterabschlüsse wurde die mittlere Gesamtstudiendauer für das Erststudium im Jahr 2014/2015 wie folgt ermittelt:
-
Masterabschluss
7,2 Semester
-
Fachhochschulabschluss
7,6 Semester
-
Lehramtsabschluss
9,8 Semester
-
Sonstige universitäre Abschlüsse
13,5 Semester
Es ist festzuhalten, dass nur 40% aller Hochschulabschlüsse innerhalb der Regelstudienzeit erreicht wurden.
Während das Fach Volkswirtschaftslehre einen überschaubaren Zugang an Studierenden hat, studieren circa zehnmal so viele das Fach Betriebswirtschaftslehre mit der Begründung einer besseren Arbeitsplatzperspektive. Diese Unverhältnismäßigkeit lässt sich aber nicht allein damit erklären, denn gut ausgebildete Volkswirte finden reichlich Arbeitsangebote, ob in der Forschung, in Ministerien, Banken oder Unternehmen. Eine mögliche Erklärung ist die Verschlechterung des Images der Volkswirte im Zusammenhang mit der Finanzkrise. Denn kaum ein Ökonom hatte diese Krise vorhergesehen. Zeitweise wirkten sie sprachlos. Danach brach der Streit über den Wert der makroökonomischen Theorien aus.
BWLer müssen vor allem konkret büffeln. Angeblich sind die Jobchancen gut, jedoch sind Enttäuschungen vorprogrammiert.
Folgende Berufe wurden 2018 als die besten Ausbildungsberufe ermittelt:
Die Mädchen haben folgende Ausbildungsberufe gewählt:
- Kauffrau für Büromanagement,
- Kauffrau im Einzelhandel,
- Medizinische Fachangestellte,
- Verkäuferin und
- Zahnmedizinische Angestellte.
Die Jungen haben folgende Ausbildungsberufe gewählt:
- Kraftfahrzeugmechatroniker,
- Kaufmann im Einzelhandel,
- Elektroniker,
- Industriemechaniker und
- Fachinformatiker.
Die bestbezahlten Ausbildungsberufe sind:
- Fluglotse / Fluglotsin,
- Binnenschiffer/in,
- Schiffmechaniker/in,
- Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen,
- Bankkaufmann/-frau,
- Beton- und Stahlbauer/in,
- Lacklaborant/in,
- Mechatroniker/in,
- Industriemechaniker/in,
- Technische/r Systemplaner/in,
- Physiklaborant/in,
- Polizeivollzugsbeamter/in,
- Fachinformatiker/in,
- Stuckateur/in und
- Verwaltungsangestellte/r.
Folgende 17 Berufe wurden als ausgesprochene Zukunftsberufe ausgewiesen:
Im technischen Bereich:
- Elektroniker/in für die Betriebstechnik,
- Mechatroniker/in und
- Technische/r Systemplaner/in.
In der IT-Branche:
- Fachinformatiker/in,
- Informatikkaufmann/-frau und
- Mathematisch-technische/r Softwareentwickler/in.
Im kaufmännischen Bereich:
- Industriekaufmann/-frau,
- Kaufmann/-frau für Büromanagement und
- Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel.
In der Chemie:
- Chemielaborant/in,
- Lebensmitteltechniker/in und
- Pharmakant/in.
Im medizinischen Bereich:
- Altenpfleger/in,
- Zahntechniker/in,
- Augenoptiker/in,
- Hörakustiker/in und
- Gesundheits- und Krankenpfleger/in.
Trotz zunehmender Beschäftigung geht die Zahl der Auszubildenden zurück. Dies ist eine Feststellung, die seit Jahren bekannt ist und der trotzdem seit Jahren nicht entgegengewirkt wird. Laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB wurden 2016 ein Drittel der neuen Ausbildungsverträge in lediglich 10 Berufen abgeschlossen.
Während die Zahlen der Beschäftigten zwischen 1999 und 2015 um 13,1% gestiegen sind, ging im gleichen Zeitraum die Zahl der Auszubildenden um 6,7% zurück. Dadurch sinkt die Ausbildungsquote 2015 auf 5,1 Auszubildende auf 100 Beschäftigte. Die Entkopplung von Beschäftigtenzuwachs und Ausbildungszuwachs hat mehrere Ursachen. Zuerst ist die Beteiligung der Betriebe an der Ausbildung rückläufig. Gleichzeitig möchte immer weniger Jugendliche eine berufliche Ausbildung durchführen. Besonders deutlich ist der Rückgang der Ausbildungsquote bei Kleinbetrieben mit höchstens fünf Mitarbeitern. Für sie ist es finanziell sehr schwer, die Ausbildung zu stemmen.
Der DIHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, betont, dass der Rückgang der AZUBI-Zahlen nicht darauf zurückzuführen sei, dass die Betriebe keine ausreichende Zahl an Ausbildungsplätzen zur Verfügung stellen würden. Es sei vielmehr so, dass die sinkende Bewerberzahl aufgrund des demographischen Wandels zustande käme und dass weniger Schulabgänger sich für einen Beruf entschieden, sondern stattdessen lieber für ein Studium.
Insbesondere sind folgende Branchen davon betroffen: Bäcker, Installateure, KFZ-Betriebe, Uhrmacher und die Bauwirtschaft. Es ist daher notwendig, dass der Staat eine Ausbildungsgarantie für die kleinsten und kleinen Betriebe in Form von finanziellen Zusagen gibt. Es gibt auch Wirtschaftsbereiche wie die Gastronomie oder das Lebensmittelhandwerk, die so unattraktiv sind, dass eine große Zahl von Arbeitsplätzen unbesetzt bleibt. Hinzu kommt, dass die höchste Zahl der Ausbildungs-Abbrecher ausgerechnet in diesen Bereichen zu verzeichnen ist.
Die Stellungnahme des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW) vom 10.3.17 lautet wie folgt:
- Das Sinken des Interesses junger Frauen an der dualen Berufsausbildung ist mit Sorge zu betrachten.
- Die Quote der jungen Erwachsenen ohne abgeschlossene Berufsausbildung ist mit 13,4% immer noch zu hoch, sie ist sogar im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. In absoluten Zahlen betrifft dies immerhin 1,95 Millionen Menschen im Alter von 20 bis 34 Jahren.
- Es ist zwar zu begrüßen, dass die Bildungsintegration die hohe Zahl der Geflüchteten mit einbezieht. Fest steht jedoch, dass, da 70% der Geflüchteten unter 30 Jahre alt sind, noch eine erhebliche Herausforderung für die Zukunft besteht
- Die fortschreitende Digitalisierung ist für die berufliche Bildung eine sehr große Herausforderung, denn es fehlt noch an zukunftsorientierten Berufsbildern.
2.11.4 Anzahl der Abbrecher
Die Zahl der Studienabbrecher hat ein alarmierendes Ausmaß erreicht. Bis zu 40% der Studierenden brechen heute ihr Studium ab. Die OECD mahnt diesen Missstand seit 2014 an. Jedoch muss festgestellt werden, dass seitens der Politik bis heute nichts dagegen Wirksames getan wurde.
Dieses Phänomen betrifft insbesondere die mathematischnaturwissenschaftlichen Studiengänge mit einer Abbruchquote von 39% an den Universitäten und 42% an den Fachhochschulen. Knapp die Hälfte der Studierenden verlassen in den ersten beiden Semestern die Universitäten oder Hochschulen, weitere 29% sind es im dritten oder vierten Semester. Die überwiegende Zahl der Studienabbrecher findet eine schnelle Bildungs- oder Berufsalternative. Ein halbes Jahr nach dem Abschied von der Universität oder Hochschule finden 43% eine andere Berufsausbildung, 31% werden allerdings nie erwerbstätig.
Nach Aussage des Bundesforschungsministeriums sind de facto drei Gründe für den Studienabbruch maßgeblich:
• Die Leistungsprobleme: Ein Fünftel der Studienabbrecher fühlt sich den Anforderungen des Studiengangs nicht gewachsen. Entweder können sie die Fülle des Lernstoffs nicht verarbeiten oder dem Druck nicht standhalten. Rund 30% der Befragten sind aufgrund der Überforderung gescheitert. Hier zeigen sich die Probleme des Bologna-Prozesses für die Bachelorabschlüsse. Während bei herkömmlichen Studiengängen lediglich 17% der Abbrecher die Leistung als Hauptgrund für den Abbruch angeben, so sind bei Bachelorstudiengängen 25%.
• Das zweite Problem ist die Finanzierung des Studiums. Knapp hinter dem Grund der Überforderung, d.h. mit 19%, stellt die Finanzierung des Studiums ein erhebliches Problem dar. Damit sind nicht nur die rein finanziellen Engpässe gemeint, sondern die Herausforderung, Studium, Nebenjob und Hauptjob unter einen Hut zu bekommen.
• Der dritte Grund ist die mangelnde Motivation. 18% der Ex-Studierenden geben diese als Ursache für den Abbruch an. Die Studienabbrecher merken, dass sie sich nicht mehr mit ihrer Studienrichtung identifizieren können oder mit den daraus resultierenden Berufsmöglichkeiten unzufrieden sind. Sehr häufig sind falsche Erwartungen an das Studienfach mit entscheidend.
Andere Gründe für den Studienabbruch sind schlechte Studienbedingungen, eine berufliche Neuorientierung, familiäre Probleme und, nicht zu vergessen, Krankheiten.
Immerhin 15% der Studienabbrecher bleiben entweder Langzeitarbeitslose oder sie schlagen sich mit mehreren Tätigkeiten durch. Dies ist ein realer Verlust für die Gesellschaft, der sehr oft durch eine bessere Vorbereitung und Aufklärung hätte vermieden werden können. Diese 10 bis 15% heute junger Leute sind die zukünftigen Armen im Alter.
Zur dualen Berufsausbildung ist festzuhalten, dass 2016 146 000 oder 25% der Auszubildenden diese Form der Lehre abgebrochen haben oder dafür ungeeignet waren. Die bedeutendsten Gründe für diese Abbrüche stellen die soziale Schicht bzw. der familiäre Hintergrund und das Versagen der Schulen in Hinblick auf die Vorbereitung auf das Berufsleben dar. Die Hauptprobleme nach Ansicht der Betriebe sind folgende:
- Das soziale Verhalten. Viele dieser AZUBIS bringen keine grundsätzlichen Verhaltensregeln wie Pünktlichkeit, Kommunikation und Lernbereitschaft mit, d.h. die Mängel beziehen sich eher auf das Verhalten als auf die Leistung.
- Das Wissen und die Fähigkeiten. Es fehlen Kenntnisse, die Grund- und Hauptschule im Hinblick auf die Sprache und die Grundrechenarten hätten vermitteln sollen.
- Der dritte Punkt betrifft Kinder mit Migrationshintergrund, die von zuhause aus nicht die notwendigen Grundlagen der deutschen Sprache beherrschen sowie vom Standard abweichende Verhaltensweisen mitbringen.
Es ist festzustellen, dass mit einer Abbruchsquote zwischen 13 und 15% ein Proletariat entsteht und damit ein Grundbestand an Arbeitslosigkeit geschaffen wird. Dabei ist es notwendiger denn je, jedem Jugendlichen eine duale Berufsausbildung anzubieten und vor allem abzuschließen.
Abschließend sollte vermerkt werden, dass der Kampf um Ausbildungsplätze sich in den nächsten Jahren verschärfen wird, wenn die zahlreichen Studienabbrecher als Mitbewerber für die Hauptschulabsolventen auftreten werden.
2.12 Gründe für den Fachkräftemangel
Die Gründe sind nicht einzeln zu benennen, vielmehr sind diese vielfältig und miteinander verknüpft. Folgende wesentlichen Gründe sind maßgebend für den Fachkräftemangel.
2.12.1 Mangelhafte Erziehung
Wenn man sich detailliert mit Unternehmen, Handwerkern und der Verwaltung über die Problematik von Auszubildenden und Studenten austauscht, so kommt eine wesentliche und wiederholte Kritik zustande, nämlich die mangelhafte soziale Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen hinsichtlich des Verhaltens und grundlegender moralischer Kriterien. Dieser Niedergang bei der Qualität der Erziehung durch die Eltern führt dazu, dass Schulen, Betriebe und Universität sich immer mehr gezwungen sehen, soziale Defizite auszumerzen. Hier haben Gesellschaft, Staat und Politik insoweit versagt, als sie dies nicht mit der nötigen Deutlichkeit und Schärfe von den Eltern fordert.
Dies betrifft auch gleichzeitig die Unkontrollierbarkeit einer Mediengesellschaft. Unter dem Vorwand der Freiheit des Internets und der Medien werden Kinder und Heranwachsende manipuliert. Diese Frage muss sich die deutsche Gesellschaft stellen, inwieweit sie bereit ist diese Untätigkeit der Politik hinzunehmen. Es kann nicht angehen, dass viele Eltern die Erziehung der Kinder dem Fernsehen oder dem Internet überlassen, damit sie selbst sich einen gewissen materiellen Wohlstand erarbeiten. Nach dem Motto, ich möchte ein schönes Leben und der Staat wird schon meine Kinder erziehen. Angesichts der zu erwartenden technischen Revolutionen, insbesondere im Hinblick auf die zu erwartende Informationsgesellschaft, ist es notwendiger denn je, im Verhalten von Kindern und Heranwachsenden Selbstdisziplin und Mitmenschlichkeit sowie das Prinzip der Verantwortung zu verankern.
2.12.2 Versagen der Schulen
Schulen stellen nun einmal ein wesentliches Erziehungselement für Kinder und Heranwachsende dar, sie ersetzen jedoch nicht die Grunderziehung, die die Kinder in ihren jungen Jahren zuhause erhalten müssen. Schulen dienen zur Vertiefung des sozialen Verhaltens, das von zuhause mitgebracht werden muss.
Schulen müssen jedoch auch die Grundelemente der Kommunikation vermitteln denn diese Fähigkeit ist nicht ausreichend vorhanden. Insoweit müssen Schulen sich konzentrieren auf wesentliche Fächer, die für eine Informationsgesellschaft notwendiger denn je sind: Sprache, Mathematik, Sport, Geschichte, Grundzüge der Politik und der Wirtschaft und ggfs. Naturwissenschaften.
Die Landschaft des deutschen Schulsystems muss jedoch unbedingt bundeseinheitlich gestaltet werden. Die Qualifikationsmerkmale, die Lehrinhalte und die Benotung müssen bundesweit einheitlich sein. Notwendige Werkzeuge wie analytisches und vernetztes Denken, Kreativität, Selbstdisziplin und soziales Verhalten müssen maßgebende Kriterien für die Bewertung der Schüler werden
Abschlussprüfungen wie z.B. das Abitur müssen bundesweit den gleichen Inhalt haben und gleich benotet werden. Es kann nicht angehen, dass Abiturnoten nach Gusto und Möglichkeiten von Landesfürsten abhängig sind. Die Wirtschaft, sei es über eine reformierte IHK, sei es über die Beeinflussung der Politik, muss frühzeitig Berufsbilder und zukünftige Berufsbilder festlegen. Diese Berufsbilder müssen ein Leben lang veränderbar sein und an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Die Schulen müssen, die notwenigen Mittel erhalten, damit die Ausfälle von Lehrern und Lehrstunden minimiert werden. Schulen müssen gegebenenfalls untereinander in ein Ranking gestellt werden und wenn es notwendig ist, müssen elitäre Schulen aufgebaut werden, die auch für sozial schwächere Schüler über Stipendien oder sonstige staatliche Hilfe zugänglich sind.
2.12.3 Die Über-Akademisierung
Betrachtet man die Anzahl der Abiturienten und Hochschulzugängen und – Abgängen, so sind folgende Entwicklungen zu beobachten:
- während die gesamte Wirtschaftsstruktur Deutschlands lediglich 20-25% Akademiker pro Gesamtheit der Schulabgänger benötigt, können zurzeit bis zu 70% der Schulabgänger einen Hochschulabschluss vorweisen. Dies wird eine Schwemme von Akademikern zur Folge haben und gleichzeitig werden benötigte Fachkräfte wie Techniker, Programmierer, Elektrotechniker, Fachkräfte in der Pflege, in der Justiz, Polizisten, Handwerker, Soldaten lediglich durch 20-30% der Schulabgänger abgedeckt. Dieses Ungleichgewicht ist nicht nur gefährlich, sondern auch auf Dauer schädlich für das natürliche und organische Wachstum unserer Wirtschaft.
- mit dem erhöhten Zugang an die Universitäten ist auch ein Massenbetrieb in der Lehre und Forschung verbunden, was zu bis zu 35% Studienabbrechern führt, die keine abgeschlossene Qualifikation haben. Dieser Teil der Bevölkerung sind die realen Verlierer einer propagierten Akademisierung, die ohne Verstand und Augenmaß verfolgt wurde.
- ein weiterer Gesichtspunkt ist die Inflation von Promotionen. Der größte Teil der Universitäten ist verkommen zu Promotionsfabriken. Wenn der Doktortitel sich zwischen Wissenschaft, Prestige und Betrug befindet, so muss man sich fragen, welchen Wert die Promotion noch hat. Viele Promotionen, insbesondere in Jura, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, haben keine reale Grundlage für zukünftige Forschung in diesen Bereichen. Man muss sich fragen, welchen Wert diese Doktoren haben gemessen an den Aufwendungen, die sie produziert haben. Sind diese Doktoranden überhaupt für die Gesellschaft, Politik und Wirtschaft brauchbar? Der Autor ist sehr skeptisch im Hinblick auf die Qualifikation und auf die Vergleichbarkeit im internationalen Vergleich. Im Übrigen ist das Tragen von Titeln außer bei der Medizin in der ganzen Welt auf 3-4 Länder in Europa begrenzt.
2.13 Katastrophale Konsequenzen
Bei gründlicher Betrachtung all dieser Punkte stellt man fest, dass das Bildungswesen in den letzten 30 Jahren versagt hat. Insbesondere in den letzten 5 Jahren, in denen wir eine relative wirtschaftliche Stabilität und Wachstum hatten, hat die Politik nicht die Kraft gefunden, reale und durchgreifende Reformen durchzuführen. Denn die zu erwartenden Probleme der zunehmenden Alterung der Bevölkerung sind schon seit langem bekannt. Die Weigerung der CDU, dem Land eine konkurrenzfähige Einwanderungspolitik zu geben, hat diesen Mangel nur noch verschärft. Folgende direkte Konsequenzen werden eintreten:
1. In der Pflege müssen die Alten und Kranken sich auf eine ernsthafte Verschlechterung und ihrer Situation und auf die Steigerung der Kosten gefasst machen.
2. In den Schulen müssen die Eltern sich auf einen erhöhten Ausfall der Schulstunden und die Verschlechterung der Ausbildung ihrer Kinder einstellen.
3. Hinsichtlich der Inneren Sicherheit müssen die Bürger häufiger private Sicherungsdienste in Anspruch nehmen. Die Höhe der Schäden, seien es persönliche oder wirtschaftliche, könnte durchaus steigen.
4. Die Gerichtsverfahren werden mit großer Wahrscheinlichkeit langwieriger und teurer als heute sein.
5. Hinsichtlich des Handwerks müssen sich die Kunden auf erhebliche Kostensteigerung und auch auf eine Verschlechterung der Arbeitsqualität einstellen.
6. Im Gesundheitswesen müssen sich die Patienten auf längere Wartezeiten sowie die Erhöhung der Gesundheitskosten und damit verbundener Versicherungskosten einstellen.
7. Unternehmen werden zunehmend Schwierigkeiten haben zu gleichen Kosten Qualität und Termine einzuhalten.
Die oben genannten Konsequenzen stellen nach Ansicht des Autors die wesentlichen Folgen dar. Selbstverständlich kann es auch weitere Konsequenzen geben.
2.14 Mögliche Lösungsansätze
Um diese o.g. Konsequenzen aus der Fehlentwicklung abzumildern, müssen nach Ansicht des Autors folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
1. Die politische Ebene muss dazu gezwungen werden, endlich ein Konzept zu einer echten Bevölkerungspolitik zu entwerfen und die Umsetzung in einem Ministerium für Bevölkerungspolitik zu bündeln, in dem die gesamten Zuwendungen für die Familie, alle Anforderungen an die Bildung und berufliche Entwicklung für Frauen koordiniert und gesteuert werden.
2. Es ist ein Migrationskonzept für benötigte Arbeitskräfte mit einer Willkommenskultur ins Leben zu rufen.
3. Eine Umschichtung der Bildungspolitik und Aufwertung der nichtakademischen Berufsbilder, ggf. durch Werbekampagnen, muss durchgeführt werden.
4. Die Attraktivität von dienstleistenden Berufen, in der Inneren Sicherheit, in der Justiz, in der Pflege und in der Bildung muss erhöht werden.
5. Durch Vereinfachung von Stiftungen sind die Möglichkeiten der Unternehmensnachfolge zu erleichtern und ggf. mit steuerlichen Vorteilen zu versehen.
6. Die notwendigen Finanzmittel sind zur Verfügung zu stellen ohne nach neoliberalen Gesichtspunkten zu sparen.
1 Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (2013): Soziale und demographische Daten weltweit. Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, Hannover.
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (2015): Soziale und demographische Daten weltweit. Datenreport 2015 der Stiftung Weltbevölkerung. Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, Hannover.
3. Migration
3.1 Migration als Gefahr für die deutsche Identität?
Kein Thema ist so belastend für die Gesellschaft wie der Begriff der Migration. Denn dieser Begriff produziert für die Menschen, die ihren Standort auf Dauer wechseln (d.h. migrieren), Angst vor dem fremden Land, dem fremden Ort, an den sie gehen wollen, der fremden Sprache, der fremden Kultur und der fremden Umgebung. Die Leute, die ihrerseits mit einer nicht gewollten Migration konfrontiert werden, d.h., dass sich unter ihnen plötzlich fremde Leute befinden, mit fremder Sprache, nicht gewohntem Verhalten, fremder Kultur, fremder Religion und anderen Farben, entwickeln Befürchtungen, wenn nicht sogar Ängste. Eine besorgt gestellte Frage könnte sein, ob sich das Gefühl des „Zuhause-Seins“ ändert, eine andere, ob die Ansässigen in die Minderheit geraten werden. Zudem entwickeln sich Ängste im Hinblick auf die Erhaltung der eigenen Identität. 25.2 Migration?
3.2 Migration?
Als Migration wird eine auf Dauer angelegte räumliche Veränderung des Lebensmittelpunktes einer oder mehrerer Personen verstanden. Migration, die über Landesgrenzen hinweg erfolgt, wird als internationale Migration bezeichnet. Als Gegenstand von Forschung und praktischer Begleitung ist Migration in einer Reihe wissenschaftlicher Disziplinen vertreten, darunter den Gesellschaftswissenschaften, der Rechts- und Wirtschaftswissenschaft. Daraus resultiert eine Vielzahl spezieller Perspektiven und begrifflicher Differenzierungen, sodass der Fachliteratur eine einheitliche Definition nicht zu entnehmen ist.
Migration ist ein die Menschheitsgeschichte durchziehendes, erdumspannendes Geschehen. Verbreitete und historisch wiederkehrende Motive für den dauerhaften Ortswechsel sind die Aussicht auf bessere Siedlungs- und Erwerbsmöglichkeiten, auf Zufluchtsorte bei Naturkatastrophen oder – neuerdings – im Zuge der globalen Erwärmung, sind die Suche nach Sicherheit für Leib und Leben nach Flucht oder Vertreibung als Folge von Kriegen sowie der Schutz vor Diskriminierung und persönlicher Verfolgung aus rassischen, religiösen bzw. weltanschaulichen Gründen oder auch aufgrund erlebter anderer Einschränkungen der persönlichen Freiheit im Herkunftsmilieu. Weitere Beweggründe ergeben sich beispielsweise aus Altersmigration, Bildungsmigration, Heiratsmigration und Remigration.
Bedingt durch die Weltkriege des 20. Jahrhunderts, regionale Instabilität, Globalisierung, Digitale Revolution und Erderwärmung nimmt das Migrationsgeschehen an Komplexität zu. Es stellt Gesellschaften und politische Akteure weltweit in Fragen der Zuzugssteuerung und der Integration von Einwanderern vor neue Herausforderungen.
Markante historische Wanderungsbewegungen
Vor etwa 40.000 Jahren erschloss sich der Homo sapiens die gemäßigten Zonen Eurasiens; vor 12.000 Jahren war er in allen Großräumen der Kontinente präsent. Die Entstehung der Sahara löste zwischen 3000 und 1000 v. Chr. eine Wanderung von Bantu aus West- bis ins südliche Afrika aus. Im Zeitraum zwischen 200 und 1500 breiteten sich die Chinesen von ihren Ursprungsgebieten in alle Richtungen aus, besonders nach Südasien. Um 500 migrierten arabische Stämme in großer Zahl über weite Strecken und erreichten u. a. Ostafrika. Die oft aus Diskriminierung, Unterdrückung und Verfolgung hervorgegangene jüdische Migration zeigte sich unter anderem beim Auszug aus Ägypten 1250 v. Chr., im Diaspora-Judentum, hervorgerufen durch Fremdherrschaft und den Ausgang des Jüdischen Krieges, sowie in der durch die Zeit des Nationalsozialismus und den Holocaust vorangetriebenen Remigration nach Palästina.
Zu den frühen Wanderungsbewegungen im europäischen Raum gehören die Griechische Kolonisation am Mittelmeer im 1. Jahrtausend v. Chr. und die Völkerwanderung am Übergang zwischen Spätantike und Frühmittelalter. Mit dem 16. Jahrhundert begann die europäische Expansion, in deren Folge sich Kolonialismus und neuzeitlicher Sklavenhandel entwickelten. Eine massenhafte Auswanderung aus Europa insbesondere nach Amerika und vor allem in die Vereinigten Staaten setzte im 19. Jahrhundert bei fortgesetzt stark anwachsender europäischer Bevölkerung und Binnenwanderung ein.4
Aus den weltweiten kriegerischen oder kriegsähnlichen Konflikten des 20. Jahrhunderts gingen verstärkt zwangsbedingte Migrationen in Form von Deportationen und Vertreibungen hervor, zum Beispiel als Folge der Russischen Revolution und im Stalinismus der Sowjetunion oder bei der Westverschiebung Polens nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu Ende des 20. Jahrhunderts – nach dem Ende des Ost-West-Konflikts scheint das weltweite Wanderungsgeschehen an Komplexität zuzunehmen. Die klassischen Migrationsformen Einwanderung, Gastarbeit und Flucht treten weniger in Reinform als in Varianten auf.5
Unterscheidung spezifischer Migrationsweisen und -beteiligungen
Migrierende Menschen sind mobiler als andere, konstatiert Annette Treibel, und will das nicht allein räumlich, sondern auch psychisch und sozial verstanden wissen: „Sie lenken ihre Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen in den Wanderungsentschluss um.“6 Bewegen sich Wanderungen innerhalb eines Landes, so handelt es sich um eine Binnenwanderung. Werden Staatsgrenzen überschritten, sogeht es sich aus Sicht des Herkunftslandes um Auswanderung (Emigration) und aus Sicht des Aufnahmelandes um Einwanderung (Immigration). Transitstaaten dienen dem temporären Aufenthalt beim Übergang vom Herkunfts- ins Zielland.
Unfreiwillige Migranten sind Flüchtlinge, Zwangsverschleppte oder von Naturkatastrophen vertriebene Menschen. Allerding ist die Unterscheidung zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Migration relativ, weil fast immer gewisse Zwänge (z. B. Ressourcenknappheit, unsichere Lage) mitentscheidend für eine Migrationsentscheidung sind. Flüchtlinge sind Menschen, die vor Kriegen, vor politischer oder religiöser Verfolgung oder auch vor Naturkatastrophe und Umweltschäden geflohen sind. Der letztere Migrationsanstoß dürfte vor allem im Zuge der globalen Erwärmung weiter an Bedeutung gewinnen, auch wenn die gegenwartsbezogenen Schätzungen stark schwanken. Allein der Meeresspiegelanstieg droht in den tiefer gelegenen Regionen Asiens die Reisproduktion und -versorgung für rund 200 Millionen Menschen unmittelbar zu gefährden.7 Dabei folgt auch Fluchtmigration oft den persönlichen Verhältnissen: Während die Ärmeren sich nur die Flucht in Nachbarregionen leisten können, haben besser Gestellte eher die Chance, entferntere Regionen zu erreichen.8
Sowohl Zivil- als auch Militärpersonen fliehen unter Umständen in großer Zahl vor kriegerischen Auseinandersetzungen.
Laut der Genfer Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 ist Fluchtmigration die räumliche Bewegung einer Person, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will.“
Ökonomische Gründe werden für die Definition einer Person als Flüchtling in der Genfer Flüchtlingskonvention nicht anerkannt. Migration erfolgt jedoch in der Regel mit der Hoffnung auf eine Verbesserung der Lebenssituation. In solchen Fällen stellt sich das Problem der Unterscheidung zwischen Freiwilligkeit und „ökonomischem Zwang“. Individuen sind in unterschiedlichem Maße fähig und willens, Frustrationen zu ertragen (Frustrationstoleranz). Und auch wenn sie nicht im Status quo zu verharren bereit sind, haben sie unterschiedliche Handlungsoptionen: Sie können ihre Umgebung verändern oder ihr zu entkommen versuchen.9
Die Strafverfolgung wegen Fahnenflucht und Kriegsdienstverweigerung lässt viele Flüchtlinge Schutz vor der Verfolgung im Ausland suchen. Diese Flucht gelingt oft nur wenigen Deserteuren.10 In vielen Staaten wird Desertion nicht unmittelbar als Schutzgrund anerkannt. So besteht in der Bundesrepublik kein Recht auf Asyl für Deserteure: „In der bundesrepublikanischen Rechtsprechung zur Gewährung von Asyl wird darauf insistiert, dass jeder Staat das Recht habe, seine Bürger zumKriegsdienst heranzuziehen.“ Auch die Gefahr im Herkunftsgebiet wieder im Krieg eingesetzt zu werden „schützen die Deserteure nicht vor einer Abschiebung.“12Eine Möglichkeit der Anerkennung in der Rechtsprechung besteht, „wenn nachgewiesen werden kann, dass die Rekrutierung auf der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie basiert, sie also eine Diskriminierung darstellt“.
Arbeitsmigranten sind Menschen, welche aus ihrer Heimat zum Zweck der Beschäftigung in ein fremdes Land auswandern. Die Wanderungsbewegung erfolgt in der Regel von industriell gering entwickelten Ländern in Industrienationen. Deshalb werden diese Migranten zum Teil umgangssprachlich abschätzig als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet. Wirtschaftsmigranten erfüllen nicht die Kriterien für den Flüchtlingsstatus. Sie genießen daher keinen Anspruch auf internationalen Schutz als Flüchtlinge im Sinne des Asylrechtes.
Eine wachsende Rolle spielt die Bildungsmigration, obwohl sie kein ganz neues Phänomen ist. Immer mehr Länder bemühen sich heute, attraktive Bedingungen der Ausbildung, des Studiums und der Forschung zu schaffen, um wanderungswillige und qualifizierte Personen zu gewinnen. Laut einer 2015 veröffentlichen OECD-Studie ist Deutschland das Industrieland mit der höchsten Zahl von Personen, die zum Studium ins Ausland ziehen; das meistbesuchte Zielland deutscher Studenten ist Österreich.
Transmigration bezeichnet das Pendeln von Migranten zwischen Wohnorten in unterschiedlichen Kulturen. Transmigranten zeichnen sich u. a. durch hohe Formalqualifikation und räumliche Mobilität bei Beibehaltung der sozialen Bindung an die Herkunftsgesellschaft aus. Verbunden mit dem Begriff sind Fragen der Identitätsbildung (Stichworte: „Third-culture kids“, Bikulturalität). Aus Untersuchungen geht hervor, dass die Qualifikation von Migranten ihre Identität beeinflusst und dass es insbesondere Hochqualifizierte sind, die ihre Identität nicht (mehr) nationalstaatlich definieren. Für Industriestaaten, international aufgestellte Unternehmen oder Forschungseinrichtungen ist das Wanderungsverhalten von gut ausgebildeten Fachkräften von Interesse. Sie gelten als diejenigen, die aufgrund ihrer Qualifikation und Erfahrung, aber auch wegen ihrer weltweiten Vernetzung Innovationsvorsprünge schaffen und transportieren.
Der Soziologe Christoph Butterwegge spricht von einer Polarisierung der Migration in „Elends- und Fluchtmigration“ einerseits und einer „Eliten- und Expertenmigration“ andererseits, „bei der sich Höchstqualifizierte, wissenschaftlichtechnische, ökonomische und politische Führungskräfte sowie künstlerische- und Sportprominenz heute hier, morgen dort niederlassen, sei es, weil ihre Einsatzorte rotieren, der berufliche Aufstieg durch eine globale Präsenz erleichtert wird oder Steuervorteile zum modernen Nomadentum einladen.“16 Die Elendsmigration unterliege sehr viel restriktiveren und repressiveren Formen der Regulierung als die Eliten- und Expertenmigration.
Zunehmende Bedeutung hat zudem die "Altersmigration" oder "Ruhesitzmigration". Dagegen ist die "Heiratsmigration" in Deutschland der wichtigste Grund für die Einwanderung von Drittstaatsangehörigen.
Das deutsche Ausländerrecht definiert Migranten als „Oberbegriff für Menschen nicht deutscher Herkunft“ und schließt neben Ausländern auch „eingebürgerte deutsche Staatsangehörige und Aussiedler“ ein.
Forschungsaspekte und Theoriebildung
Die aufgrund der Vielfältigkeit ihres Gegenstandes in unterschiedlichen Disziplinen stattfindende Migrationsforschung wird zunehmend auch in interdisziplinärer Zusammenarbeit von Wissenschaftlern betrieben. Migrationsprozesse und - rückwirkungen sind komplex, „sowohl hinsichtlich der verschiedenen Hürden und Etappen auf Wanderungen selbst als auch in Folge der vielfältigen Veränderungen in den Herkunfts-, Transit- und Zielgesellschaften, die durch die Wanderungen entstehen. Sie sind daher Forschungsgegenstand vieler Disziplinen und werden vor dem Hintergrund der jeweiligen Theoriebildung diskutiert, weshalb meist nur spezifische Segmente von Migrationsphänomenen behandelt werden. Da dies jeweils von einer ganz bestimmten Perspektive aus geschieht, die von anderen Disziplinen nicht eingenommen wird, ist es sinnvoll, Migrationsforschung interdisziplinär anzulegen; migrationssoziologische Fragestellungen sollten offen sein für den Perspektivenwechsel.“
Motivationsfaktor Wirtschafts- und Wohlstandsgefälle
Die wirtschaftlich unterschiedlichen Niveaus von Herkunfts- und Ankunftsregion wirken als sogenannte Push- und Pull-Faktoren auf individueller und auf struktureller Ebene einer Volkswirtschaft. Dabei stehen den abstoßenden (Push)-Faktoren in den Herkunftsländern anziehende (Pull-)Faktoren in den Einwanderungsländern gegenüber. Typische mögliche Auslöser für Migrationsströme sind Konstellationen, in denen wirtschaftsgeografisch ein Nord/Süd-, Ost/West- oder Stadt/Land-Gefälle sichtbar gemacht werden kann.20 Als weitere für Migrationsentscheidungen wichtige Faktoren gelten außer Einkommensentscheidungen auch Alter, Beruf und familiäre Einbindung der potentiellen Migranten sowie Arbeitslosenrate und Zuwanderungspolitik des Ziellandes.21
Bei Fluchtmigration vor dem Hintergrund von Kriegshandlungen oder Naturkatastrophen zeigen sich vorherrschend die Push-Faktoren; andererseits finden sich auch „vorausplanende“ Fluchtmigranten, sodass für Flüchtlinge wie für Arbeitsmigranten insgesamt ein Gemenge von Schub- und Sogfaktoren zugrunde zu legen ist. „Der Verlauf von Fluchtbewegungen hängt einerseits von den nationalen politischen Systemen und dem internationalen Flüchtlingssystem und andererseits von den Ressourcen, Handlungschancen und den Netzwerken ab, auf die Flüchtlinge zurückgreifen können.“22
Türöffner Qualifikation und Ausbildungsstand
Wirtschaftspolitisch vielfach gewünscht und nachgefragt ist die Zuwanderung von hochausgebildeten und gut situierten Fachkräften (high skilled migration). Wenn in Deutschland aus demografischen Gründen zunehmend ein Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften zu erwarten ist, dürfte sich (trotz Wirtschaftskrise) die Konkurrenz der Metropolen um diese Fachkräfte verstärken.23 Für ökonomisch weniger entwickelte Länder wirft der Brain-Drain Hochqualifizierter allerdings zusätzliche Probleme auf.
Gesellschaftspolitische Probleme und Lösungsansätze
Gelingende Integration von Zuwanderern ist ein an vielfältige Bedingungen gebundener Prozess, wie Jochen Oltmer schon für die Ausgangslage der Wandernden zeigt: „Migranten agieren als Individuen und in Netzwerken oder Kollektiven mit unterschiedlichen Autonomiegraden vor dem Hintergrund verschiedener Erfahrungshorizonte im Gefüge von gesellschaftlichen Erwartungen und Präferenzen, Selbst- und Fremdbildern, Normen, Regeln und Gesetzen. Sie verfolgen dabei ihre eigenen Interessen und Ziele, verfügen über eine jeweils unterschiedliche Ausstattung mit ökonomischem, kulturellem, sozialem, juridischem und symbolischem Kapital mit der Folge je verschieden ausgeformter Handlungsspielräume.“24
Die angestrebte Art der Einbeziehung von Zuwanderern unterscheidet sich deutlich in den einzelnen Aufnahmegesellschaften, nicht nur begrifflich. Dazu heißt es bei Ingrid Oswald: „Unter Assimilation wird der Prozess verstanden, in dem sich kulturelle, ethnische oder religiöse Minderheiten an die Mehrheitsgesellschaft anpassen und deren Werte und Lebensweisen übernehmen.“ Damit sei letztlich die allmähliche Aufgabe der Herkunftskultur bzw. das Verblassen ihrer Elemente unter dem Eindruck der neuen Kultur gemeint. „Begriffe wie »Akkulturation« oder »Integration« bezeichnen dagegen Eingliederungsprozesse, bei denen die Annäherung an die Zielkultur weit oberflächlicher sein kann bzw. auf eine gegenseitige Annäherung von Minderheits- und Mehrheitskultur verweisen.“
Problemlose Integration findet, wo sie vorkommt, nur selten die Aufmerksamkeit von Öffentlichkeit und Wissenschaft, die beide eher auf Probleme reagieren, wie es bei Franck Düvell heißt. Diese entstehen aus seiner Sicht vornehmlich, wenn die aufnehmende Gesellschaft sich zu ablehnend verhält, wenn Migranten die Integration ihrerseits ablehnen oder wenn die Politik passiv verharrt oder abweisende Signale setzt.25 Für Treibel wäre schon viel gewonnen, wenn sich der Ton änderte, in dem über und mit Migranten gesprochen wird. „An die Stelle von herablassender Duldung, Bevormundung, Ausgrenzung oder Unterstellung einer mangelnden Integrationsbereitschaft sollte die Unterstellung treten, daß die Mehrheit der Zugewanderten gute Gründe für die Migration hat und ihrAktivitätspotential mit der Einreise keineswegs erschöpft ist. Hieran können und sollten Angebote der gesellschaftlichen Teilhabe anschließen.“26
Integrationshürden
Maßgebliche Einflussgrößen für Integrationsverläufe von Migranten sind neben dem Zugang zu Arbeitsmarkt und Beschäftigung das Hineinfinden in Sprache und Kultur der Aufnahmegesellschaft durch adäquate Bildungsangebote und zunehmend gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Doch hat der Migrantenstatus, sofern er überhaupt die Aufnahme von Erwerbsarbeit zulässt, in der Regel eine Beschäftigung in den unteren Rängen der gesellschaftlichen Hierarchie zur Folge, oft verbunden mit der Entwertung der am Herkunftsort erworbenen Qualifikationen.27
Kulturelle oder ethnische Andersartigkeit der Zuwanderer dient den Einheimischen als Zurückweisungsgrund aus Angst vor eigenem Status- bzw. Ansehensverlust. Nicht Qualifikation oder Leistung, sondern die ethnische Herkunft liegt dieser „Unterschichtung“ zugrunde. Als treibende Kraft von Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sieht Treibel unterprivilegierte Einheimische ohne Mobilitätschancen oder solche mit Furcht vor Deklassierung. „Der Wunsch der Einheimischen, die Zugewanderten möglichst tief zu platzieren, korrespondiert mit dem Bestreben der Unternehmen und Branchen, sich mit den Zuwanderinnen und Zuwanderern flexible und ausgrenzbare Reservearbeitskräfte zu sichern. Dies betrifft insbesondere weniger angesehene Branchen wie die Gastronomie oder die Landwirtschaft oder krisenanfällige Branchen wie den Bergbau oder die Bauwirtschaft.“28 Fehlwahrnehmung, Stereotypisierung und Fremdenfeindlichkeit ex istieren aber auch ohne Konkurrenzmotive auf dem Arbeitsmarkt. Abgrenzungsverhalten tritt nicht nur zwischen Zuwanderern und Langzeiteinwohnern, sondern auch unter Zuwanderern unterschiedlicher Herkunft auf, „die um Gesellschaftsinterpretationen streiten und um die geringer werdenden Ressourcen konkurrieren“.29
Speziell in Deutschland ist zu beobachten, dass die Kinder von Zugewanderten die Möglichkeiten schulischer und beruflicher Bildung oft nicht ausschöpfen können. „In vielen Zuwandererfamilien kumulieren die Benachteiligungen: Arbeitslosigkeit, formal nicht anerkannte höhere Schul- oder Berufsbildung, beengte Wohnverhältnisse in stigmatisierten städtischen Bezirken, Traumatisierungen infolge Vertreibung, Flucht oder des Migrationsverlaufs, geringe Deutschkenntnisse und Kontakte zu Einheimischen etc.“30 Benachteiligung und Diskriminierung in den Aufnahmegesellschaften können Einwanderer auf die mitgebrachten ethnischen und kulturellen Bindungen zurückverweisen, eine Re-Ethnisierung bewirken, die der Integration entgegenwirkt und der Ausbildung von Parallelgesellschaften Vorschub leistet.
Integrationsförderliches
Positive Weichenstellungen für das Hineinfinden in eine andere als die gewohnte Kultur und Gesellschaft beginnen damit, dass die Mehrzahl der Migranten die eigene Lebenssituation am neuen Ort zunächst als besser empfindet als die vorherige.31 Unterstützung erhalten Migrationswillige auf der Wanderung und in den Aufnahmegesellschaften durch Kommunikationsnetzwerke von Eingewanderten, die ihre Erfahrungen weitergeben und Optionen für Unterkunft und Arbeitsbeschaffung vermitteln.32 „Knotenpunkte bilden ethnische Gemeinden und Migrantenunternehmen, weil in ihnen der Warenabsatz, aber auch die Rekrutierung billiger Arbeitskräfte organisiert werden kann.“33