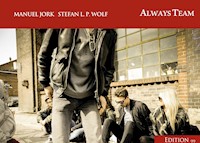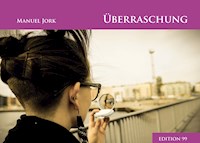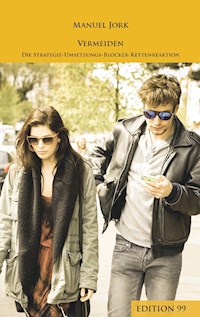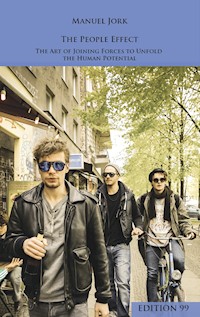Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: EDITION 99
- Sprache: Deutsch
Teams verändern sich ständig. Sie entwickeln sich in Phasen. Diese sind nicht immer leicht zu erkennen. Zur Orientierung dient das erweiterte Teamphasen-Modell. Das Ziel lautet Selbstorganisation. Die Entwicklung von Teams verläuft nie geradlinig. Ständig müssen Einflüsse und Veränderungen in ihrer Wirkung erkannt und gemeinsam bewältigt werden. Im Verlauf dieses Prozesses wandelt sich auch die Rolle der Führungskraft mit jeder Phase. Gleichzeitig werden erfolgreiche Teams nicht lange Bestand haben. Beförderungen, Versetzungen und Neubesetzungen, auch von Vorgesetzten, begrenzen die Haltbarkeit. Dann beginnt alles wieder von vorn. Teams zu Selbstorganisation zu führen, ist die Königsdisziplin jeder Führungskraft. Den Zustand echter Selbst-Organisation erlangt ein Team jedoch erst, wenn es gemeinsam Krisen gemeistert hat. Dann erst erkennen alle ihre mentalen und emotionalen Grenzbereiche. Wenn sie Krisen gemeistert haben, setzt eine neue Stufe des Selbstvertrauens und des Vertrauens in die Kollegen ein. Dies ist gleichzeitig eine neue Stufe der Entfaltung. Entfaltung beginnt an den eigenen Grenzen. Deine Rolle als Führungskraft wandelt sich in diesen Situationen zum Krisen- und Entfaltungsmanager. Dein Arbeitsfeld sind die Grenzbereiche. Du wirst nie überflüssig. Wir sind gewohnt, vorrangig einzelne Personen und deren individuellen Kompetenzen zu betrachten. Dies ist merkmal-orientiertes Denken. Unter der Annahme, dass wir stets die Mitwirkung anderer benötigen und die Lösung in Kooperation und Co-Kreation liegt, möchten wir den Fokus neu ausrichten: Von der Betrachtung und Bewertung einzelner Personen und individueller Fähigkeiten hin zu der Qualität interaktiver Dynamiken von Teams und Arbeitsgruppen an Schnittstellen. Wir betrachten nun vorrangig systemische Kompetenzen, die Selbstorganisation, Kooperation und Transformation ermöglichen: Gemeinsames überwinden von Widerständen und Widersprüchen, gemeinsames Denken und Entscheiden, gemeinsames Handeln, gemeinsames Reflektieren, Lernen und Justieren. Hierdurch entsteht ein neuer Denkrahmen: Unternehmen streben nach Entfaltung und Wachstum, beides erfordert die Fähigkeit und Bereitschaft zu kontinuierlicher Transformation, dies ist dauerhaft nur durch selbstorganisierte Kooperation möglich, verlässliche Kooperation erfordert systemische Kompetenzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 62
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gemeinsames Denken und Handeln ist unser Anliegen für die nahe Zukunft. Wir schreiben gleichermaßen für weibliche Leserinnen und männliche Leser und denken dabei auch an Lesende, die sich anderen Geschlechtern zugehörig fühlen. Wir sehen die Vielfalt und würdigen die Gleichrangigkeit. Wir machen es uns nur so einfach wie möglich mit der Schriftsprache und versuchen gleichzeitig, alle Persönlichkeiten gendergerecht einzubeziehen.
»Ich bin kein Self-Made Man. Wenn ich diese Rolle annehmen würde, würde ich jeden, der mir auf diesem Weg geholfen hat und jeden Rat, den ich erhalten habe, einfach nur abwerten. Du kannst es ruhig zugeben, Du kannst das alles nicht allein schaffen. Jedenfalls ich kann das ganz sicher nicht. Niemand kann das.«
– Arnold Schwarzenegger, aus dem Vorwort zu Tim Ferris, Tools of Titans, Vermilion, 2016.
»Kein lebendes System existiert für sich allein. Es ist immer mit anderen Lebensformen verbunden und kann nur leben und sich weiterentwickeln inmitten von anderen.
Menschen entfalten ihre Potentiale durch gemeinsames Denken und Handeln mit anderen, möglichst unterschiedlichen Persönlichkeiten.«
– Prof. Gerald Hüther, Etwas mehr Hirn, bitte – Eine Einladung zur Wiederentdeckung der Freude am eigenen Denken und der Lust am gemeinsamen Gestalten, Vandenhoeck & Ruprecht, 2015
»Die stärkste und beste Droge für den Menschen ist der andere Mensch. Für eine gelingende Beziehungsgestaltung lassen sich fünf wesentliche Voraussetzungen beschreiben:
Sehen und gesehen werden,
gemeinsame Aufmerksamkeit gegenüber etwas Drittem,
emotionale Resonanz,
gemeinsames Handeln und
das wechselseitige Verstehen von Motiven und Absichten.«
– Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren, Hoffmann und Campe 2006.
Wer darf sich jetzt angesprochen fühlen?
Du führst jemanden, der ein Team führt.
Das Führen von Teams ist ein sich ständig verändernder komplexer Prozess. Du kannst Deinen Team-Leiter am wirksamsten unterstützen, indem Du so oft wie möglich auf die Interaktionen im Team schaust, Deine Wahrnehmungen teilst und ihm hilfst, das Team vor allem an den Schnittstellen zu schützen.
Du führst ein Team.
Du bist mittendrin. Wer mittendrin ist, sieht nicht immer alles. Ich möchte Deine Wahrnehmung schärfen, damit Du jederzeit handlungsfähig bleibst.
Du bist Teil eines Teams.
Ohne Dich kann das Team nicht wirksam sein. Deshalb mache ich für Dich alle Erfolgsfaktoren transparent. Kooperieren bedeutet nicht, darauf zu warten, dass Dir jemand sagt was Du tun sollst. Kooperieren bedeutet, eigene Verantwortung für den Teamprozess zu übernehmen. Jeder im Team muss führen können. Auch Du.
Ihr seid alle gleichwertig.
Eure Wirkung
Wir alle möchten etwas Sinnvolles erreichen und dabei unsere Potentiale entfalten. Niemand kann dies allein. Wir brauchen andere, mit denen wir unsere Kräfte bündeln und kooperieren. Wir lösen uns dabei vom Eigennutz und betreten einen größeren Raum gemeinsamen Gestaltens. Ein Team, dass auf diese Weise zusammenwirkt und diese Qualität an den Schnittstellen auf andere Teams überträgt, erzeugt für das gesamte Unternehmen ein neues Kompetenzfeld:
Die Transformations-Kompetenz.
Je mehr Teams in dieser Qualität vernetzt arbeiten, desto wandlungsfähiger und agiler ist ein Unternehmen.
Dies alles entscheidet sich an den Schnittstellen.
Alles hängt von der Wirkungskraft der einzelnen Teams ab.
Alles beginnt mit Dir.
Das schwächste Glied
Das Gehirn des Menschen dient dazu, dessen Potentiale zur Entfaltung zu bringen. Potentiale sind Möglichkeiten. Menschen verfügen über eine unerschöpfliche Vielfalt von Möglichkeiten. Sie sind fein gestimmte Lebewesen, die elastisch sind und viel aushalten. Sie sind empfindsam und empathisch, sie können sich selbst und andere reflektieren, sie können Wissen und Erfahrungen auf unterschiedliche Handlungsfelder übertragen und sie können die Wirkungen ihres Handelns vorhersehen. Sie können damit großartige Taten vollbringen.
Es gibt aber einen Haken. Kein Gehirn existiert für sich allein. Für Individualisten klingt dies befremdlich. Gehirne interagieren immer mit anderen Gehirnen. Potentiale entfalten sich folglich nur durch sinnvolles Zusammenwirken von möglichst unterschiedlichen Menschen. Je unterschiedlicher die Menschen, desto vielfältiger die Möglichkeiten. Menschen können nicht nicht interagieren. Sie haben also gar keine Wahl. Sie müssen kooperieren. Das möchten sie aber nicht immer; schon gar nicht mit unterschiedlichen Menschen. An dieser Stelle entstehen Spannungsfelder und Widersprüche.
Das schwächste Glied ist der Übergang vom Eigennutz zur Gesamtoptimierung.
Vom ICH zum WIR.
Unter welchen Voraussetzungen Menschen gerne zusammenarbeiten
Wenn Du auf einen Kollegen schaust, suchst Du vermutlich instinktiv nach den folgenden Merkmalen, Verhaltensweisen und Haltungen [1]:
Ist er kompetent?
Denkt und handelt er mit uns gemeinsam für das Ganze oder verfolgt er eigennützig nur seine eigenen Absichten und Ziele?
Ist er verlässlich?
Dies gilt genauso für Teams.
Dies klingt einfach.
Ist es aber nicht.
Ab jetzt nimmt die Komplexität zu.
Jeder einzelne ist gefordert.
Erfolgreich kooperieren könnt Ihr nur gemeinsam.
[1] Roger C. Mayer and James H. Davis, Indiana University of Notre Dame, “An Integrative Model of Organizational Trust”.
Inhalt
Teil 1 – Denken
01 Denken in Merkmalen und Relationen
02 Komplexität und Stress
03 Das Stress-Frühwarn-Radar
04 Der tägliche Team-Check
Teil 2 – Wahrnehmen
05 Teams zu Selbstorganisation führen
06 Das erweiterte Modell der Teamphasen
Phase 1 – Forming
Phase 2 – Storming
Phase 3 – Norming
Phase 4 – Managing Stress
Phase 5 – Joint Thinking
Phase 6 – Decision Making
Phase 7 – Self-Organization
Phase 8 – De-Bottlenecking
07 Vier spezielle Phasen
Managing Crises
Post Crisis
Silent Running
Boring Routine
Teil 3 – Transformieren
08 Die innere Struktur von Transformation
09 Ein neuer Blick auf Kompetenzen
10 Fünf systemische Transformationskompetenzen
11 Neun Arten der Transformation und was Menschen befürchten
12 Iterationen und »deutsches« Denken
13 Der Surfer-Guide
14 Manuel Jork
15 Dr. Stefan L. P. Wolf
TEIL 1 DENKEN
01 Denken in Merkmalen und Relationen
Wenn Führungskräfte auf Teams schauen, erkennen sie drei Ebenen.
Sie sehen einzelne Mitarbeiter und deren Kompetenzen. Sie führen dementsprechend Einzelgespräche. Dies ist so, als würden sie Spieler einer Fußballmannschaft einzeln trainieren und am Samstag um 15.30 Uhr gemeinsam auf den Platz stellen.
Sie sehen wie einzelne Mitarbeiter miteinander interagieren. Es entsteht ein erweitertes Blickfeld und Zweier-Beziehungen werden wahrgenommen.
Sie sehen das gesamte Team und können komplexe Wechselwirkungen erkennen und steuern.
Die erste Wahrnehmungsebene ist uns vertraut. Es fällt uns leicht, einzelne Personen zu betrachten und zu bewerten; wie bei einem Einzel-Sportler. Der Fokus ist eindeutig. Wir aktivieren merkmalorientiertes Denken.
Die zweite Wahrnehmungsebene ist uns ebenfalls vertraut, auch wenn nun die zu beobachtenden Interaktionen komplexer werden; wie bei einem Tennis-Match. Der Fokus wechselt ständig. Unsere Aufmerksamkeit wird mehr gefordert. Wir beginnen Relationen zu erkennen.
Die dritte Wahrnehmungsebene ist uns zwar ebenfalls bekannt; wie bei einem Fußballspiel mit 22 Akteuren. Der Fokus ist jedoch nicht mehr eindeutig. Alle stehen miteinander in Beziehung, bewegen sich ständig und verändern so fortlaufend das Geschehen und die Gewichtungen der interaktiven Kräfte. Es ist kaum möglich, all dies zu überblicken. 22 Akteure sind durch 231 mögliche Zweier-Beziehungen [2] miteinander verknüpft. Die Interaktionen und deren Auswirkungen werden unübersichtlich. Wir befinden uns nun in relationalen Denkprozessen.
Unser Gehirn ist in der Lage, beide Denkoperationen auszuführen. Denken in Merkmalen fällt ihm leichter als Denken in Relationen, weil es weniger Energie verbraucht.
Wenn unser Gehirn die Wahl hat, wählt es immer den Modus, der Energie spart.
Relationales Denken kostet mehr Energie und wird instinktiv zurückgestellt.
Die Folge:
Wir erkennen interaktive Wechselwirkungen in Teams nicht oder zu spät und können deshalb nicht angemessen darauf reagieren oder wir verpassen es, diese Interaktionen bereits im Anfangsstadium zu begleiten und mitzugestalten.
Die Erkenntnisse über diese Denkoperationen verdanken wir Karl Josef Klauer [3]. Er hat hierfür folgendes Schaubild entworfen: