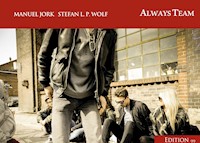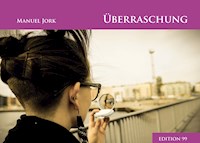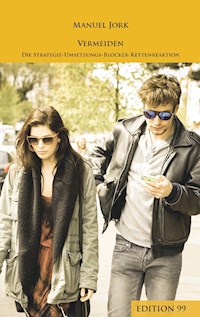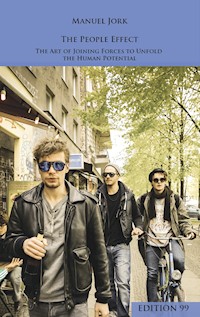Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: EDITION 99
- Sprache: Deutsch
Menschen haben ein Gehirn. Es dient dazu, Potentiale des Menschen zur Entfaltung zu bringen. Potentiale sind Möglichkeiten. Menschen verfügen über eine unerschöpfliche Vielfalt von Möglichkeiten. Sie sind fein gestimmte Lebewesen, die elastisch sind und viel aushalten. Sie sind empfindsam und empathisch, sie können sich selbst und andere reflektieren, sie können Wissen und Erfahrungen auf unterschiedliche Handlungsfelder übertragen und sie können die Wirkungen ihres Handelns vorhersehen. Sie können damit großartige Taten vollbringen. Es gibt aber einen Haken. Kein Gehirn existiert für sich allein. Das klingt befremdlich. Vor allem für Individualisten. Ist aber wahr. Gehirne interagieren immer mit anderen Gehirnen. Potentiale entfalten sich folglich nur durch das möglichst sinnvolle Zusammenwirken von Menschen. Je unterschiedlicher die Menschen, desto vielfältiger die Möglichkeiten. Menschen können nicht nicht interagieren. Sie haben also gar keine Wahl. Sie müssen kooperieren. Das möchten sie aber nicht immer. Idealerweise kooperieren sie mit unterschiedlichen Menschen. Das möchten sie aber noch weniger. An dieser Stelle entstehen Spannungsfelder, jede Menge Widersprüche und Empfindlichkeiten. Hier können Sie nun Einfluss nehmen, sollten Sie sich für das Zusammenleben mit einem Menschen entscheiden. Sie können ihm behilflich sein, diese Spannungsfelder zu überwinden und seine Potentiale zu entfalten. Die folgenden Seiten möchten Sie ermutigen, dies zu tun. Trotz aller Widersprüche wird das Zusammenleben mit Menschen beglückende Momente für Sie bereithalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe sind wir selbst.«
– Konrad Lorenz
Gemeinsames Denken und Handeln ist mein Anliegen für die ferne Zukunft. Ich unterscheide dabei nicht zwischen Interaktionen von Familien, Freunden, Nachbarn, Mitarbeitern oder Kollegen. Ich wende mich an alle Menschen in allen Beziehungsformen. Ich schreibe gleichermaßen für weibliche Leserinnen und männliche Leser und denke dabei auch an Lesende, die sich anderen Geschlechtern zugehörig fühlen. Ich sehe die Vielfalt und würdige die Gleichrangigkeit. Ich mache es mir nur so einfach wie möglich mit der Schriftsprache.
Vorwort
Die Welt ist in Bewegung. Schmelzende Pole, Hitzewellen, Wassermangel: Die Effekte des Klimawandels sind unübersehbar. Auch wenn die Zahlen erst langsam ins Bewusstsein dringen. 200 Millionen Klimaflüchtlinge in den nächsten 30 Jahren. 800 Millionen Menschen, die bis 2050 von Stürmen und steigendem Meereswasserspiegel bedroht sind. Und 9 von 10 Menschen, die bereits heute verschmutzte Luft einatmen. Wir müssen dringend handeln – und das geht nur gemeinsam. Kein einziges der anstehenden gesellschaftlichen oder ökologischen Themen kann im Alleingang gelöst werden. Während diese Erkenntnis nicht neu ist, hapert es oft bei der Umsetzung. Menschen verhaken sich in Widersprüchen. Wir möchten mit anderen Menschen gemeinsam unser Leben gestalten und gleichzeitig weichen wir vor anderen Menschen zurück. Vor allem dann, wenn sie anders sind. Dabei liegt genau in der Unterschiedlichkeit von Menschen das Potential, neue Wege zu entdecken – und gleichzeitig miteinander zu wachsen.
Dieses Buch zeigt lebensnah und pointiert wie ein Zusammenleben und -arbeiten unterschiedlicher Menschen gelingen kann. Die Andersartigkeit von Menschen begreift Manuel Jork nicht als Hürde für gelungene Kooperation, sondern als Chance, daraus gemeinsam Potentiale zu entfalten. Damit ist dieses ein optimistisches Buch und eine Navigationshilfe. Noch ist Zeit, ein ökologisches Gleichgewicht wiederherzustellen. Gemeinsam können wir es schaffen.
– Dr. Felicitas von Peter
Active Philanthropy
Bevor Sie sich für einen Menschen entscheiden
Menschen haben ein Gehirn. Es dient dazu, Potentiale des Menschen zur Entfaltung zu bringen. Potentiale sind Möglichkeiten. Menschen verfügen über eine unerschöpfliche Vielfalt von Möglichkeiten. Sie sind fein gestimmte Lebewesen, die elastisch sind und viel aushalten. Sie sind empfindsam und empathisch, sie können sich selbst und andere reflektieren, sie können Wissen und Erfahrungen auf unterschiedliche Handlungsfelder übertragen und sie können die Wirkungen ihres Handelns vorhersehen. Sie können damit großartige Taten vollbringen.
Es gibt aber einen Haken.
Kein Gehirn existiert für sich allein. Das klingt befremdlich. Vor allem für Individualisten. Ist aber wahr. Gehirne interagieren immer mit anderen Gehirnen. Potentiale entfalten sich folglich nur durch das möglichst sinnvolle Zusammenwirken von Menschen [1]. Je unterschiedlicher die Menschen, desto vielfältiger die Möglichkeiten. Menschen können nicht nicht interagieren. Sie haben also gar keine Wahl. Sie müssen kooperieren. Das möchten sie aber nicht immer. Idealerweise kooperieren sie mit unterschiedlichen Menschen. Das möchten sie aber noch weniger. An dieser Stelle entstehen Spannungsfelder, jede Menge Widersprüche und Empfindlichkeiten. Hier können Sie nun Einfluss nehmen, sollten Sie sich für das Zusammenleben mit einem Menschen entscheiden. Sie können ihm behilflich sein, diese Spannungsfelder zu überwinden und seine Potentiale zu entfalten. Die folgenden Seiten sollen Sie ermutigen, dies zu tun. Trotz aller Widersprüche wird das Zusammenleben mit Menschen beglückende Momente für Sie bereithalten.
Inhalt
Teil 1 Das widersprüchliche Innenleben der Menschen
01 Ähnlichkeit – Segen und Fluch
02 Sechs Stärken für eine Welt
03 Das ultrafeine Radar
04 Der seltsame Selbstbezug
05 Fünf fundamentale Innenstrukturen
Beziehung
Ordnung
Leistung
Territorium
Innovation
06 Potentialentfaltung durch kooperative Vielfalt
Beziehung und Ordnung
Beziehung und Leistung
Ordnung und Leistung
Beziehung – Ordnung – Leistung
Beziehung und Innovation
Leistung und Innovation
Ordnung und Innovation
Beziehung und Territorium
Territorium und Ordnung
Territorium und Leistung
Territorium und Innovation
Leistung – Beziehung – Territorium
Territorium – Ordnung – Leistung
Teil 2 Das empfindliche Innenleben der Menschen
07 Ludwig – Ordnung
08 Tanja – Beziehung
09 Janina – Leistung
10 Heinrich – Territorium
11 Susan – Innovation
Teil 3 Wie Sie Menschen artgerecht ansprechen
12 Worte als Werkzeug
13 Keine Angst vor dem Ansprechen
14 Die wundersame Welt der Widerstände
Nachschlag
Wie Menschen ihre Interessen sortieren
Wenn es schnell gehen soll
Ja oder Nein?
Leseprobe: Der Situations-Navigator
Fußnoten
Empfehlenswerte Bücher und Artikel
Dankeschön
Manuel Jork
Teil 1 Das widersprüchliche Innenleben der Menschen
Haben Sie schon einmal jemanden wie Harald kennengelernt? Harald ist ständig in Bewegung, kennt sich mit allem aus und packt überall mit an. Er arbeitet schon seit vielen Jahren als Laborant, allerdings ohne Führungsverantwortung. Er hat seinem Chef jedoch ständig angeboten, alle möglichen Dinge für ihn zu erledigen. Mit viel Enthusiasmus ist er auch gern bereit, seine Kollegen auf Trab zu bringen. Der Chef hat das natürlich abgelehnt. Anfänglich. Dann aber kam der Tag, an dem er schwach wurde. Harald ist eben wirklich hilfsbereit und er schafft was weg. Er handelt wo andere nur reden. Von dem Tag an hatte Harald den Fuß in der Tür und sein Chef konnte nicht mehr Nein sagen, wenn er ihm seine Hilfe aufdrängte. Da Harald die Arbeit nicht auslastet, hat er mit seiner Frau einen kleinen Catering-Service aufgemacht. Es gibt kaum eine Abteilung im Unternehmen, in der er nicht schon eine Geburtstagsfeier oder ein Buffet ausgerichtet hat. Er macht das echt gut. Er ist wirklich schnell, nützlich und preisgünstig. Keiner kommt an ihm vorbei. Er ist immer da und wartet auf seine Einsatzmöglichkeiten. Die Kehrseite ist allerdings, dass einige Kollegen von ihm ziemlich genervt sind. Würden Sie sich einen Harald anschaffen?
Viele zögern bei diesem Gedanken. Das ist verständlich. Das Zusammenleben mit Menschen ist nicht immer einfach. Menschen haben drei Eigenschaften, die Ihnen alles abverlangen werden:
Menschen sind widersprüchlich
empfindlich
und gleichzeitig mit den erstaunlichsten Fähigkeiten ausgestattet
Die bereichernden Momente, die auf Sie warten, sind allerdings jede Mühe wert.
Angenommen Sie haben sich für Harald entschieden und möchten ihn in Ihr Leben integrieren. Am Anfang werden Sie das Gefühl haben, dass Harald eine große Bereicherung ist. Er verhält sich tatsächlich wie oben beschrieben. Er sucht nach Möglichkeiten, Ihnen behilflich zu sein, nimmt Ihnen Arbeiten ab, kann nicht stillsitzen und ist ständig aktiv. Nach einer Weile kennt er all Ihre Freunde und Bekannten und kümmert sich um Ihr soziales Netzwerk. Er macht Termine für Sie, organisiert Ihre Freizeit, entscheidet mit wem und wann Sie sich treffen. Er nimmt auch jederzeit hilfsbereit an Ihren Freizeitaktivitäten teil. Ihre Freunde und Bekannten schließen ihn ins Herz und bald ist er ein Teil Ihrer kleinen Gesellschaft. Diese Gesellschaft wird immer größer, neue Bekanntschaften kommen dazu. Plötzlich merken Sie, Harald hat Ihr Leben verändert. Sie nehmen sich einen Moment Zeit, denken nach und stellen folgendes fest: Nicht Sie haben Harald in Ihr Leben integriert, sondern Harald hat Sie in sein Leben integriert. Nicht Sie haben die Verantwortung für Harald übernommen, Harald hat die Verantwortung für Sie übernommen. Nicht Sie führen Harald, Harald führt Sie. Harald hat Ihr Leben gekapert. Kapern durch Hilfsbereitschaft.
Jetzt fragen Sie sich: Ist das gut oder nicht? Will ich das oder nicht? Sie merken, dass diese Frage nicht leicht zu beantworten ist, denn Harald ist ja ein super Typ. Sie wollen ihn nicht enttäuschen, Sie wollen nicht seinen Enthusiasmus bremsen, Sie möchten ihm einen artgerechten Lebensraum ermöglichen. Gleichzeitig denken Sie, dass es an der Zeit ist, mit ihm über das gemeinsame Zusammenleben zu reden. Sie spüren, dass Sie die Verantwortungen und die Aufgaben etwas anders verteilen müssten. Sie laden ihn zu einem Gespräch ein:
Sie:
»Harald, wir müssen mal reden.«
Harald:
[Erschrocken] »Ja, was denn?«
Sie:
»Ich glaube, wir müssen unser Zusammenleben nochmal sortieren.«
Harald:
»Was meinst du denn damit? Mach´ ich etwas falsch?«
Sie:
»Nein, natürlich nicht.«
Harald:
»Na dann ist es ja gut. Ich habe übrigens eine tolle Idee für das nächste Wochenende. Du wolltest doch immer mit Gisela und Tobias auf die kleine Hasenspitze rauffahren, mit dieser neuen Seilbahn. Ich habe euch schon Tickets besorgt und oben einen Tisch in der Gaststätte reserviert.«
Harald schaut Sie jetzt erwartungsvoll an. Was sagen Sie nun? Dieser Frage werden wir jetzt ausführlich nachgehen.
Was nehmen Sie an Menschen wahr?
Wie ordnen Sie dies ein?
Was können Sie dann tun?
Bevor Sie eine Entscheidung treffen, ob und mit welchem Menschen Sie zusammenleben möchten, ist es also hilfreich zu verstehen, was in einem Menschen vorgeht. Ja, auch ein Mensch hat ein Innenleben. Von außen können wir das nicht immer sofort erkennen, aber hierin liegt der Schlüssel für erfolgreiches Zusammenleben. Wer das Innenleben eines anderen erkennen und einordnen kann, kann auch das Zusammenleben auf eine für alle wohltuende Weise gestalten.
Hinsehen, Erkennen und Einordnen stehen daher am Anfang aller Entscheidungsprozesse. Dies ist meist nicht einfach. Oft ist es sogar für den einzelnen Menschen schwierig, sich selbst zu erkennen und einzuordnen. Der Mensch ist sich oft selbst ein Rätsel. Wenn aber schon dieser erste Schritt eine ernstzunehmende Hürde zu sein scheint, worauf sollten Sie dann achten und wie können Sie vorgehen, damit Sie bei Ihrer Auswahl die richtige Entscheidung treffen?
Es gibt Menschen in sehr vielfältigen Formen und jeder verhält sich etwas anders. Diese Unterschiede machen die Auswahl kompliziert. Schauen Sie nicht zuerst auf das Äußere. Das Äußere ist für ein gelingendes Zusammenleben zweitrangig. Achten Sie zuerst auf das Innere des anderen. Dazu müssen Sie Ihr eigenes Inneres kennen. Dann können Sie dieses mit dem Inneren des anderen in Beziehung setzen. Nun ist eine Prognose möglich, ob Sie mit dem Menschen Ihrer Wahl harmonisch zusammenleben werden.
Der Schlüssel hierfür ist in den meisten Fällen Ähnlichkeit. Dies gilt jedenfalls für die Anfangsphase der Beziehung. Damit lernen wir ein erstes Merkmal des Innenlebens der Menschen kennen: Der Wunsch nach Ähnlichkeit.
01 Ähnlichkeit – Segen und Fluch
Der Entwicklungsprozess des Menschen unterliegt ebenso der Evolution, wie bei allen Lebewesen. Menschen sind ein Naturprodukt. Die Evolution fördert Merkmale und Eigenschaften, die langfristig das Überleben sichern. Sie hat nicht das Überleben eines einzelnen Menschen im Sinn, sondern das Überleben der gesamten Spezies. Für den einzelnen Menschen ist dieser Denkrahmen zu groß. Er sieht sich vorrangig als Einzelwesen und sorgt sich zuerst um sich selbst. Auch Sie möchten, dass sich Ihr Mensch in seiner eigenen Lebensspanne als Individuum wohlfühlt und sich vielleicht sogar etwas weiterentwickelt. Damit dies gelingt, ist es hilfreich, einen kurzen Blick auf das größere evolutionäre Bild zu werfen.
Um auf diesem Planeten als Spezies zu überleben, benötigt der Mensch eine Vielzahl unterschiedlicher Fähigkeiten. Ein Mensch allein verfügt über all diese nicht. Also hat die Natur eine Arbeitsteilung entwickelt. Jeder verfügt über andere Fähigkeiten in unterschiedlichen Ausprägungen. Merke: Jeder (!) hat Fähigkeiten und jeder ist ein bisschen anders. Auf der einen Seite ist das gut, weil dadurch alle Menschen gemeinsam über alle notwendigen Fähigkeiten verfügen. Auf der anderen Seite besteht die Herausforderung, diese Unterschiedlichkeiten sinnvoll zusammenzufügen. Dies erfordert ein sehr hohes Maß an Übersicht und Koordination. Ein Einzelner kann dies nicht leisten. Hierfür ist wiederum gemeinsames und koordiniertes Handeln vieler Menschen notwendig. Wir erkennen an dieser Stelle zum ersten Mal ein Dilemma. Übersicht und Koordination unterschiedlicher Fähigkeiten erfolgen am besten durch gemeinsames Handeln. Ein Einzelner kann das nicht allein bewältigen, weil ihm die Gesamtsicht fehlt und weil er seine Einzelinteressen in den Mittelpunkt stellt. Wie kann es Menschen dann überhaupt gelingen, zu sinnvollem gemeinsamem Handeln zu gelangen? Hier stoßen wir auf den ersten Widerspruch.
Menschen sind gefordert, miteinander zu kooperieren, um als Spezies zu überleben. Sie sind aber darauf fokussiert, als Individuum erfolgreich zu sein. Sie sind auf Kooperation nicht vorbereitet.
Sie erwarten nun möglicherweise, dass Menschen andere Artgenossen suchen, die völlig anders sind. Dadurch würden sich unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten überhaupt erst zusammenfügen. Das hat die Evolution aber nicht hervorgebracht. Folgendes Beispiel zeigt das.
Es gibt Menschen, die sich gern mit Artgenossen umgeben. Sie möchten immer in deren Nähe sein. Manchmal geht das so weit, dass sie am anderen regelrecht kleben. Allein zu sein, fällt diesen Menschen schwer. Gleichzeitig gibt es Menschen, die mehr Raum für sich selbst benötigen, auch mal allein sein und sich ausbreiten wollen, ohne sich ständig um einen anderen Menschen kümmern zu müssen. Beides ist in Ordnung. Beides hat die Natur hervorgebracht. Beides gehört zu den überlebenswichtigen Unterschieden. Wenn sich diese beiden unterschiedlichen Menschen nun treffen, dann passiert in deren Inneren folgendes. Beide erkennen sofort die Unterschiede und DENKEN: Der ist anders als ich und das ist eigentlich interessant und gut. Gleichzeitig FÜHLEN die beiden: Der andere ist mir aber echt zu anstrengend und darauf möchte ich mich erst einmal nicht einlassen.
Es kommt deshalb nicht zu einer Verbindung. Das, was allen Menschen zusammen das Leben leichter und erfolgreicher machen würde, empfindet der einzelne Mensch häufig als unbequem und störend. Was er dagegen als angenehm und erstrebenswert empfindet, ist Ähnlichkeit. Die meisten Menschen mögen andere Menschen, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Gegenüber so ist, wie sie selbst. Wenn Menschen aber hauptsächlich Menschen mögen, die ihnen ähnlich sind, dann verbinden sich auch nur ähnliche Eigenschaften und Fähigkeiten miteinander. Überlebenswichtige Vielfalt wird dadurch eingeschränkt und kann sich nicht vollständig entfalten.
Dies ist ein weiterer erstaunlicher Widerspruch.
Potentiale entfalten sich durch Vielfalt. Menschen suchen aber eher nach Ihresgleichen.
Was sich die Natur dabei gedacht hat, ist bis heute ein Rätsel. Um ihren Wunsch nach Verbindung und Potentialentfaltung zu verwirklichen, benötigen Menschen also Ähnlichkeit als eine Brücke zur Vielfalt. Hierbei geht es nicht um äußere Ähnlichkeiten, wie zum Beispiel Größe, Gewicht, Aussehen, Kleidung oder die bevorzugte Automarke, sondern um innere. Nach welchen Merkmalen werden nun Ähnlichkeiten und Unterschiede sortiert? Menschen haben hier tatsächlich ausgeprägte innere Strategien. Sehr feine Instinkte sind am Werk. Um relevante Merkmale der Artgenossen sortieren zu können, muss der Mensch sie überhaupt erst einmal wahrnehmen. Das können Menschen auch, oftmals unbewusst. Menschen sind sehr fein konstruierte Lebewesen. Der erste Blick auf das Äußere täuscht manchmal. Diese Erkenntnis führt zum nächsten naheliegenden Gedanken. Menschen sind mit dieser inneren Feinheit auch sehr empfindsam. Es gibt kaum eine Spezies, die schneller krank wird, vor allem innerlich. Wenn Sie jetzt schon darüber nachdenken, vielleicht doch lieber darauf zu verzichten, sich einen Menschen anzuschaffen, dann wäre das völlig verständlich. Das ist eine verantwortungsvolle und sehr komplexe Aufgabe. Dennoch ist es empfehlenswert, etwas mehr vom geheimen Innenleben des Menschen zu erfahren, bevor Sie sich endgültig entscheiden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Zusammenleben mit Menschen durchaus beglückende Momente bereithalten kann.
02 Sechs Stärken für eine Welt
Die feine Wahrnehmung von Menschen ist wie ein hochauflösendes Radar [2]. Wenn Sie einem Menschen zum ersten Mal begegnen, wird er Sie sehr sorgfältig und minutiös durchleuchten, wie am Flughafen, wenn Sie durch einen Body-Scanner gehen. Wehe der Scanner findet etwas, das ihn irritiert oder stört. Dann sendet er sofort ein Warnsignal, aber nicht laut, sondern in aller Stille, für Außenstehende nicht wahrnehmbar. Der Mensch macht das auf gleiche Weise. Er würde das, was er wahrnimmt, nicht laut äußern und ansprechen, sondern sich unauffällig von Ihnen abwenden. Damit stünde ein Zusammenleben von Anfang an unter einem unglücklichen Stern.
Wie funktioniert dieses geheimnisvolle Radar? Wonach sucht es? Wann sendet es Warnsignale? Bei diesem Radar handelt es sich um eine Gehirnfunktion. Neurowissenschaftler gehen davon aus, dass sich das Gehirn von Menschen seit geschätzten 150.000 Jahren nicht mehr weiterentwickelt hat, weil es keinen Evolutionsdruck gibt [3]. Das Radar der Menschen ist dementsprechend eine Uraltversion. Das heißt aber nicht, dass es unbrauchbar wäre. Im Gegenteil. Wir können davon ausgehen, dass der Mensch von der Natur mit allem ausgestattet ist, was er zu seinem Überleben und zu seiner Entwicklung benötigt. Die Natur gibt deshalb nichts Neues mehr hinzu. Der Mensch muss alles weitere selbst machen. Die Herausforderung ist, eigene innere Widersprüche zu überwinden, ein feines Empfinden für die Verwirklichung seiner besonderen Fähigkeiten zu aktivieren und sich mit anderen Menschen zu vernetzen. Dann wird er zu dem, der er sein kann. Dafür ist artgerechte Haltung erforderlich.
Menschen verfügen über sechs herausragende Fähigkeiten, die in einem feinen Gleichgewicht zueinanderstehen. Die Empfindsamkeit ist bereits eine dieser Fähigkeiten. Zunächst sind Menschen belastbar und elastisch. Sie halten viel aus. Weiterhin sind sie empfindsam und empathisch. Sie können feinste Signale aufnehmen und weiterverarbeiten. Dies ermöglicht Empathie. Empathie bedeutet, dass der jeweilige Mensch andere sehr genau wahrnehmen und gleichzeitig sich selbst jederzeit reflektieren kann. Dieses feine Wahrnehmungssensorium ermöglicht ihm, gemachte Erfahrungen und Gelerntes auf andere Kontexte zu übertragen. Mit dieser Transferfähigkeit kann er innere Prozesse in äußeres Handeln übersetzen und aus dem äußeren Handeln wiederum Material für seine inneren Prozesse gewinnen. Dies erweitert seinen Wahrnehmungsradius, macht ihn beweglich und kreativ. Er kann mögliche Handlungsoptionen in die Zukunft vorausdenken und dessen Folgen erkennen und einschätzen, bevor er überhaupt zur Tat schreitet. Transferfähigkeit und Antizipation stehen im Zentrum menschlicher Intelligenz. Alles Erlebte und Gelernte entfaltet sich erst dann, wenn es auf konkrete Lebenssituationen übertragen und im Handeln verwirklicht wird. Eine Idee wird erst dann zur Innovation, wenn sie sich mit einem Nutzen im Äußeren manifestiert. Diese beiden gedanklichen Schritte sind sehr anspruchsvoll und gleichzeitig der Schlüssel zu menschlichem Erfolg. Sie ermöglichen einen fast grenzenlosen Raum für schöpferisches Handeln, vor allem für gemeinsames Handeln.
Auf einen Blick. Die sechs besonderen Fähigkeiten von Menschen sind:
Artgerechte Haltung von Menschen bedeutet, diesen Fähigkeiten Raum zu geben, sie zu entwickeln und gemeinsam sinnvoll zu nutzen. Diese Fähigkeiten sind miteinander verknüpft. Ohne Elastizität und Belastbarkeit keine Empfindsamkeit und Empathie, ohne Empathie keine Selbstreflexion und ohne eine gut funktionierende Selbstreflexion wird am Ende dieser Kette auch Kooperation nicht gelingen. Wir ahnen bereits, dass aufgrund der Empfindlichkeit von Menschen geringe Störungen ausreichen, um diese feine Verknüpfung von Fähigkeiten ins Wanken zu bringen. Belastbarkeit wird zum konstituierenden Faktor für die Entfaltung von Menschen. Ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität zu geben, eröffnet diesen Wachstumsraum. Wir müssen also Menschen als Spezies sorgsam behandeln und schützen. Deshalb beginnen wir unsere Reise in das Innere der Menschen mit einem Blick auf deren empfindlichstes Instrument, das oftmals unbekannte Wahrnehmungsradar.
03 Das ultrafeine Radar
Die Vielfalt menschlicher Fähigkeiten beginnt mit Empfindsamkeit und Empathie. Sie sind ursächlich für das sensible Radar. Erstaunlicherweise sind sich Menschen dieses feinen Instruments oft nicht bewusst. Auch unbewusst erfüllt es seine vollständige Funktion. Die aufgefangenen Signale werden in diesem Fall aber nicht bewusst weiterverarbeitet und eingeordnet. Sie erzeugen eher diffuse aber dennoch wirksame emotionale Impulse, sich auf Menschen hinzuzubewegen oder Abstand zu nehmen. Selbstreflexion und Transferfähigkeit entfalten nicht ihre vollständige Wirkung. Sicheres und zielgerichtetes Verhalten sind nur eingeschränkt möglich. Dennoch entscheidet dieses Radar wirksam über die nächsten Schritte, die ein Mensch vollzieht. Denken wir noch einmal zurück an Harald in seinem beruflichen Umfeld. Seine Kollegen empfangen vielfältige und damit mehrdeutige Signale, können diese nicht bewusst einordnen und sind infolgedessen verwirrt. Aus der Verwirrung entstehen Störgefühle. Die Kollegen sind genervt. Daraus könnten Konflikte resultieren. Das wäre vermeidbar. Harald ist, wie wir später noch genauer sehen werden, ein ganz normaler Mensch. Er verfügt nur über ungewöhnlich viele Interessen und Talente, die er eher ohne Fokus einsetzt. Wer das weiß und diese Verhaltensweisen einordnen kann, gibt Harald einen sicheren und strukturierten Raum. Dort wird er seine Fähigkeiten zum Nutzen anderer einsetzen können. Bewusstsein über diese inneren Prozesse vermeidet Konflikte und fördert gemeinsames Handeln.
Für die Entstehung des Radars gibt es vermutlich drei Hauptgründe: Gefahren erkennen – Jagen – Partnerwahl. Menschen haben schnell Angst. Angst vor Hunger, Not und allen möglichen Gefahren. Letztlich haben sie Angst vor dem Tod. Um sich davor zu schützen, haben Menschen früh begonnen, sich in Gruppen zu organisieren. Wahrscheinlich war Ähnlichkeit der Bedürfnisse und des Lebensraumes hierfür das Bindemittel. Gleichzeitig entstand ein Gefühl von Unterschiedlichkeit und Individualität gegenüber anderen Gruppen bis hin zu dem Gefühl von Wettbewerb, Gegnerschaft und Feindschaft. Zwischen Gruppen von Menschen gilt das gleiche Prinzip wie zwischen einzelnen Menschen. Auch hier sichert gemeinsames Handeln das Überleben. Und auch hier steht das Bedürfnis nach Ähnlichkeit dem gemeinsamen Handeln mit anderen im Wege. Daraus resultiert eine neue Gefahrenquelle: Andere Menschen. Menschen fürchten sich vor Menschen [1 - Seite →]. Das klingt seltsam, widersprüchlich und ziemlich unsinnig, gleichzeitig ist es Realität. Fakt ist, der Mensch ist sehr empfindlich und dadurch auch sehr verletzlich. Das Radar dient also zu einem großen Teil dazu, Unannehmlichkeiten oder Gefahren frühzeitig einzuschätzen, die unter anderem auch von Menschen ausgehen. Gleichzeitig hat der Mensch früh gelernt, dass er Kooperationspartner braucht, um erfolgreich überleben zu können, zum Beispiel bei der gemeinsamen Jagd. Dies hat eine weitere Fähigkeit in ihm hervorgebracht. Er ist ein guter Beobachter. Kennen Sie diese Situation? Sie stehen an einer Bushaltestelle, warten und haben das merkwürdige Gefühl, dass Sie jemand beobachtet. Was empfinden Sie dann? Freuen Sie sich darüber? Nein, wahrscheinlich nicht. Wer sich »beobachtet« fühlt, merkt das sehr schnell. Er wird nach etwa 10 Sekunden nervös. Das Gehirn signalisiert: Jemand beobachtet mich. Es entsteht das instinktive Gefühl, zur Jagdbeute zu werden. Wenn dieser Zustand noch etwas länger fortdauert, entwickelt sich im Menschen eine zunehmend stärker werdende Abwehr. Vermeiden Sie also, Menschen zu lange zu beobachten. Sie könnten dann unruhig und unfreundlich werden.
Neben Gefahreneinschätzung und Jagd braucht der Mensch das Radar natürlich auch für die Partnerwahl. Tief in seinem Inneren sucht er nach Verbindungen mit anderen Menschen, die sicher, sinnvoll, verlässlich und gewinnbringend sind. Da kommt es auf Details an und deshalb ist sein Radar auch sehr fein justiert. Es gibt eine unendliche Vielzahl Signale, die auf Menschen einwirken. Das natürliche Radar filtert die wichtigsten Signale heraus und sortiert diese nach einer Bedeutungsreihenfolge. Diese Reihenfolge variiert je nach Menschentypus und Situation. Zwölf Kriterien stehen im Vordergrund.
Ist der andere eine Gefahr für mich oder ist er friedlich?
Ist der andere präsent? Ist er »bei mir« oder ist er gerade mit sich selbst beschäftigt?
Nimmt er mich wahr? Werde ich gesehen oder sieht er nur sich selbst?
Hat er ein Interesse an mir als Person oder sieht er nur einen sachlichen Nutzen in mir?
Begegnet er mir mit Wertschätzung und Respekt oder verhält er sich abwertend und respektlos?
Kann ich ihn leicht einschätzen oder verhält er sich mehrdeutig und unklar?
Ist er mir ähnlich?
Ist er kompetent? Kann er etwas, das für mich nützlich ist?
»Leuchtet« er für das, was er tut oder macht er dies nur, weil er muss?
Ist er bereit, seine Kompetenzen auch für mich einzusetzen? Empfindet er dabei meine Interessen als mindestens genauso wichtig wie seine eigenen oder stellt er meine Interessen vielleicht sogar in den Vordergrund?
Kann ich mich dauerhaft auf ihn verlassen oder muss ich damit rechnen, dass er seine Versprechen nicht einhält oder morgen gar nicht mehr für mich da ist?
Bleibt er auch unter Druck und Belastung verlässlich?
Erst wenn ALLE diese Kriterien erfüllt sind, fühlt der Mensch sich sicher und wohl und beginnt, Vertrauen aufzubauen. Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, ist er irritiert und sein Scan reagiert mit einem Warnsignal. Der Scan läuft dann besonders intensiv weiter. Dies kostet Energie und erzeugt Störgefühle, die den Aufbau von Vertrauen und stabilen Beziehungen behindern. Vertrauen ist die Voraussetzung für dauerhaftes und verbindliches gemeinsames Handeln. Dieser Begriff wird oft ungenau verwendet und als emotionaler »Soft-Faktor« in seiner wahren Bedeutung missverstanden. Dahinter verbirgt sich die logische Struktur des inneren Radars mit seinen genauen Kriterien und situationsgerechten Filterstrategien. Bei unklaren Signalen läuft dieses Radar fast pausenlos. Ein Radar im Dauereinsatz kostet Energie und das Gehirn empfindet dies als äußerst unangenehm. Wenn stattdessen jemand das Radar positiv passiert, kann sich das Gehirn entspannen, den Energieverbrauch auf einen Sparmodus herunterfahren und anfangen, sich wohlzufühlen. Menschen sagen dann auch oft, dass die »Chemie« stimmt und dass sie jetzt so sein können, wie sie sind. Diesen Zustand verbinden sie mit dem Gefühl und dem Begriff »Vertrauen«. Jetzt ist gemeinsames Handeln vorbehaltlos möglich.
Befragen Sie sich an dieser Stelle bitte einmal selbst:
Bin ich friedlich und sind andere bei mir sicher?
Bin ich in Interaktionen mit Menschen präsent?
Sehe ich den anderen oder geht es mir hauptsächlich um mich selbst?
Kann ich Interessantes im anderen entdecken?
Bin ich wertschätzend und respektvoll?
Bin ich für andere leicht »lesbar«?
Kann ich mit anderen ein wechselseitiges Gefühl der Ähnlichkeit herstellen?
Habe ich etwas zu geben? Leiste ich einen Beitrag, der für andere nützlich ist?
»Leuchte« ich für das, was ich tue?
Stelle ich den Gewinn des anderen in den Vordergrund meines Handelns [»Erst du, dann ich« – »Erst dienen, dann verdienen«]?
Bin ich dauerhaft verlässlich?
Bleibe ich auch unter Belastung stabil, verbunden und handlungsfähig?
Grundsätzlich verfügen Menschen über all diese Fähigkeiten. Bei der geringsten Verunsicherung geraten sie jedoch schnell aus dem Takt und senden dann gegenteilige Signale. Dann bricht das Vertrauen oder es baut sich erst gar nicht auf. Das Radar ist wie ein empfindlicher Fühler. Es tastet sich vorsichtig voran. Bei dem geringsten Widerstand zuckt es zurück. Hier erkennen wir einen weiteren Widerspruch, der Zusammenleben und Kooperieren erschwert.
Menschen suchen nach vertrauensvollen Beziehungen. Gleichzeitig schenken sie nicht von Anfang an Vertrauen. Der andere spürt dies und zieht sich zurück. Wenn er sich nun zurückzieht, zieht sich der andere auch wieder zurück. Ein Teufelskreis entsteht. Einer von beiden muss mit seinen Fühlern dranbleiben. Auch wenn der andere zuckt. Einer muss den ersten Schritt machen und bei Misserfolgen nicht gleich aufgeben. Aber wer?
Vertrauen ist die Voraussetzung für gemeinsames Handeln. Es aufzubauen ist ein außerordentlich empfindlicher und leicht störbarer Vorgang. Ohne Vertrauen entsteht aber kein gemeinsames Handeln. Wieder befinden wir uns in dem bekannten Dilemma. Deshalb erfordert artgerechtes Halten von Menschen Ihren ganzen Einsatz und allerhöchste Aufmerksamkeit. Vor allem erfordert es den sicheren Umgang mit der erstaunlichen Empfindlichkeit und den merkwürdigen Widersprüchen von Menschen.
04 Der seltsame Selbstbezug
Wenn wir noch einmal einen Blick auf die Struktur des Radars werfen, fallen drei Elemente auf:
Werde ich gesehen?
Kann ich ihn leicht einschätzen?
Ist er mir ähnlich?
Hier erkennen wir eine weitere widersprüchliche Feinheit. Menschen möchten gesehen werden [4]. Das macht sie glücklich. Sie möchten aber nicht beobachtet werden. Das macht sie nervös. Was ist der Unterschied? Ein Mensch, der einen anderen beobachtet, bleibt – um die Sprache des Jägers zu verwenden – in Deckung. Er hält sich bedeckt. Er offenbart sich nicht. Er entzieht sich dem Radar des anderen. Dieser kann ihn dann nicht einschätzen und hat keine Möglichkeit, sich zu orientieren. Dies führt zu Verunsicherung und Abwehr. Beobachten ist also kein Akt der Empathie und des Miteinander, sondern ein Akt der Abgrenzung, des Selbstschutzes und möglicherweise sogar des Beuteverhaltens. Wissenschaftler sagen dazu, dass man den anderen zu einem Objekt macht. Das ist eindeutig ein ungünstiges Signal, wenn wir das Vertrauen von Menschen gewinnen wollen. Ein wirksameres Signal ist: Ich sehe Dich. Noch wirksamere Signale sind:
Ich sehe Dich
Ich bin auch für Dich sichtbar
Wir sind uns ähnlich.
Das klingt gut, ist aber nicht so einfach in die Tat umzusetzen. Die Frage ist, wie kann es gelingen, diesen Widerspruch zu überwinden?
Menschen wollen gesehen werden. Wer aber selbst gesehen werden will, kann nicht gleichzeitig den anderen sehen. Am Ende wird keiner gesehen.
Wenn ein Mensch gesehen werden möchte, ist er mit seiner Aufmerksamkeit bei sich. Dann kann er aber seinem Gegenüber nicht mehr die vollständige Aufmerksamkeit schenken und ihm das Gefühl geben, gesehen zu werden. »Ich sehe Dich« bedeutet, für einen Moment vollständig beim anderen zu sein. Dafür wird das eigene Bedürfnis, gesehen zu werden, ebenfalls für einen Moment zurückgestellt. Genau das fällt Menschen schwer. Ist aber ein Mensch mit seiner Aufmerksamkeit nicht vollständig bei seinem Gegenüber, wird er sofort von dessen Radar erfasst. Es erkennt, dass der andere mit seiner Aufmerksamkeit bei sich selbst ist und sendet ein Warnsignal. Dies führt zu einem Rückzug des Gegenübers und nicht zu einer Hin-Bewegung. Das ist ein Dilemma: Der Wunsch, gesehen zu werden steht gleichzeitig der Erfüllung dieses Wunsches im Wege. Ist das ein Webfehler der Natur oder gibt es dahinter einen Sinn?
Der Mensch steht nun an einer Weggabelung und muss eine Entscheidung treffen. Schenkt er seinem Gegenüber Aufmerksamkeit oder möchte er selbst im Mittelpunkt stehen? In solchen Momenten zeigt sich die Genialität der Natur. Es entsteht ein Spannungsfeld, dem sich der Mensch nicht entziehen kann. Er kann nicht nicht entscheiden. Ob er handelt oder nicht, er verändert die Situation und die Interaktion mit dem Gegenüber. Stillstand ist unmöglich. In dieser widersprüchlich erscheinenden Dynamik tritt eine unvermeidliche Spannung zu Tage, die die Entfaltung von Menschen stetig vorantreibt. Entscheidungen treffen zu müssen wird damit zu einem Baustein der Evolution. Spannungen, die aus Widersprüchen entstehen, sind eine fundamentale Voraussetzung menschlicher Entwicklung. Die Natur gewährt einen Blick in ihre feinsten Konstruktionspläne.
Sind sich Menschen der Bedeutung dieser Weggabelungen nicht bewusst, treffen sie Entscheidungen, die zwischen Ich-Bezug und Altruismus diffus hin- und herpendeln. Die Ergebnisse und Auswirkungen sind nicht eindeutig, geradlinig und verlässlich, sondern verwirrend und für den Aufbau von Vertrauen nicht hilfreich. Bewusste Entscheidungskompetenz ist dagegen ein evolutionärer Vorteil. Hier macht der Mensch den fundamentalen Schritt zu sinnvoller und kooperativer Selbstorganisation.
Diene ich mir selbst oder diene ich zuerst dem anderen? Sie werden jetzt sagen: Indem der Mensch dem anderen zuerst dient, dient er am Ende auch sich selbst. Das ist klug und Sie haben damit völlig recht. Für einen Menschen ist das jedoch ein Dilemma und er zögert hier. Warum eigentlich, er kann doch am Ende nur gewinnen? Tatsächlich ist Menschen dieser Erst-du-dann-ich-Altruismus angeboren. Kleine Kinder helfen, teilen und informieren ohne Erwartungen an Gegenleistungen [5