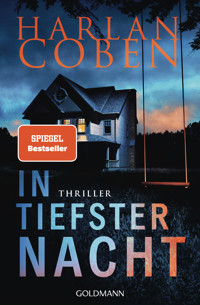
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jahrelang hat Kierce sich die Schuld an Annas Tod gegeben, als er plötzlich ein vertrautes Gesicht in der Menge entdeckt: Anna.
MALAGA – 2003
Der junge Sami Kierce reist quer durch Spanien und genießt das Leben. In Malaga lernt er die geheimnisvolle Anna kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Doch als er eines Morgens nach einer wilden Nacht aufwacht, ist er voller Blut. In seiner Hand liegt ein Messer – neben ihm Annas toter Körper. Und Sami kann sich an nichts erinnern …
NEW YORK CITY – 2025
Kierce ist mittlerweile ein suspendierter Detective und unterrichtet an der Abendschule, als er plötzlich ein vertrautes Gesicht in der Menge von Schülern entdeckt. Anna. Ohne Zweifel. Einen flüchtigen Moment treffen sich ihre Blicke, dann ist sie verschwunden. Kierce ist fassungslos. Er muss Anna finden. Er muss wissen, was in jener schrecklichen Nacht in Spanien passiert ist. Die Nacht, die sein ganzes Leben zerstörte …
»Harlan Coben gilt als König der Cliffhanger« bild.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Sami Kierce ist ein gescheiterter Detective in New York City. Seit seiner Suspendierung unterrichtet er an der Abendschule Kriminologie für Hobbydetektive und True-Crime-Podcaster. Eines Abends taucht ein vertrautes Gesicht im Kursraum auf – ein Gesicht, das sich vor zweiundzwanzig Jahren in Kierce’ Gedächtnis gebrannt hat: Anna. Seine Jungendliebe aus Spanien. Anna, neben der er eines Morgens blutüberströmt und mit einem Messer in der Hand aufgewacht ist, ohne sich an etwas erinnern zu können. Von der er dachte, sie sei tot. Doch bevor Kierce Anna um Antworten bitten kann, ist die Frau verschwunden. Für Kierce beginnt eine verzweifelte Suche. Er muss Anna finden, um die Wahrheit über die schreckliche Nacht vor zweiundzwanzig Jahren herauszufinden. Eine Nacht, die sein ganzes Leben zerstörte …
Weitere Informationen zu Harlan Coben
sowie zu lieferbaren Titeln des Autors
finden Sie am Ende des Buches.
Harlan Coben
In tiefster Nacht
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Gunnar Kwisinski
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »Nobody’s Fool« bei Grand Central Publishing, New York/Boston.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2025
Copyright © 2025 by Harlan Coben
Copyright © dieser Ausgabe 2025
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: © Mark Fearon / Arcangel Images
Redaktion: Anja Lademacher
ES · Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-33454-3V002
www.goldmann-verlag.de
Prolog
Lief alles schief, seit ich dir begegnet bin?
Ich war gerade mal einundzwanzig Jahre alt, rückblickend also fast noch ein Baby, hatte erst vor wenigen Wochen meinen Abschluss am Bowdoin College gemacht und mich daraufhin unerschrocken in das in meinen Kreisen übliche Ritual einer Rucksackreise durch Europa gestürzt. Es war Mitternacht. Tanzmusik dröhnte durch den Saal. Ich nuckelte an meiner ersten Flasche Victoria Málaga, der billigsten Cerveza, die man in diesem Club an der spanischen Costa del Sol bekam (hey, ich musste mein Geld zusammenhalten). Ich war davon ausgegangen, dass dies eine meiner üblichen Clubnächte werden würde – große Hoffnungen, Angst, etwas zu verpassen, leise Enttäuschung (sprich: allein nach Hause gehen) –, als ich dich auf der Tanzfläche erblickte.
Der DJ legte »Can’t Get You Out of My Head« von Kylie Minogue auf, was sich als absoluter Volltreffer herausstellen sollte. Ein Vierteljahrhundert später gelingt es mir immer noch nicht, dich aus dem Kopf zu bekommen. Du hast mir in die Augen gesehen, hast den Blick nicht abgewendet, auch wenn ich damals nicht geglaubt habe, dass du mich meintest. Nicht nur, weil ich nicht deine Liga war. Das war ich natürlich nicht. Du warst ein paar Nummern zu groß für mich. Ich habe vor allem deshalb nicht geglaubt, dass du mich gemeint hast, weil ich inmitten des Lacrosse-Teams von Bowdoin saß – Mikey, Holden, Sky, Shack und natürlich Teamkapitän Quinn. Alle kräftig gebaut, attraktiv und vor Gesundheit strotzend, fast wie die Kennedys auf den alten Fotos beim Footballspielen in Hyannis Port. Ich dachte, du würdest einen von ihnen ansehen – vielleicht Captain Quinn mit seinem perfekt welligen Haar und einem Körperbau, den man nur dank einer sorgsam abgestimmten Mischung aus Krafttraining, Waxing und Anabolika erhält.
Wie um das zu überprüfen, blickte ich übertrieben, fast wie in einem Cartoon erst nach rechts, dann nach links. Als ich es wagte, dich wieder anzusehen, gelang es dir irgendwie, nicht die Augen zu verdrehen, sondern dich stattdessen barmherzig zu zeigen und mir kurz wissend zuzunicken. Du hast mich weiter angeblickt, oder vielleicht war es eher wie bei diesen alten Ölgemälden, die ich zwei Tage zuvor im Prado in Madrid gesehen hatte, auf denen die Personen auf den Bildern einem mit Blicken überallhin zu folgen scheinen, ganz egal, wo man steht. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass damals außer uns beiden alle Personen aus der Discoteca Palmeras verschwunden wären, wie in einem kitschigen Film, in dem die Musik leiser und herangezoomt wird, aber so war es nicht.
Die Tanzfläche war voll mit jungem Partyvolk. Ein Typ stieß mit dir zusammen. Dann der nächste. Andere wogende Körper schoben sich zwischen uns.
Du verschwandst aus meinem Blick, als hätte die Menge dich verschluckt.
Ich stand auf. Die Lacrosse-Bros, die mit mir am Tisch saßen, bemerkten es nicht einmal. Ich war eher ein Maskottchen als ein Freund, ein witziger Sidekick, der komische kleine Typ, der im ersten Jahr zufällig dem extrem beliebten Captain Quinn als Zimmergenosse zugelost worden war. Die meisten Bros hielten mich für einen Inder, nannten mich häufig Apu und ahmten irgendeinen südasiatischen Akzent nach, was mich nervte, weil ich in Fair Lawn, New Jersey, geboren und aufgewachsen war und auch so sprach. Die Lacrosse-Bros waren nicht meine erste Wahl als Reisebegleitung für eine Europareise gewesen, aber meine besten Freunde Charles und Omar hatten bereits Jobs, der eine bei der Bank of America in Manhattan, der andere in der Genforschung am Massachusetts General Hospital. Ich war an der medizinischen Fakultät der Columbia University angenommen worden und sollte dort im Herbst mein Studium beginnen – aber ehrlich gesagt war es ziemlich cool, ja sogar schmeichelhaft, mit den Lacrosse-Bros reisen zu dürfen, selbst wenn Quinn dafür ein gutes Wort bei den anderen hatte einlegen müssen.
Ich schwamm eher auf die Tanzfläche, als dass ich ging, und kämpfte mich wie durch brechende Wellen zwischen den schweißgebadeten Körpern voran. Der DJ wechselte zu »Murder On The Dance Floor« von Sophie Ellis-Bextor, was im Nachhinein wirklich passend, aber irgendwie auch ironisch klingt, auch wenn ich gar nicht so ganz genau weiß, was das Wort »ironisch« bedeutet, seit Alanis Morrisette ihren Song »Ironic« gesungen hat, und selbst jetzt, fast ein Vierteljahrhundert nach dieser Nacht, möchte ich vermeiden, es falsch zu verwenden.
Ich schob mich eine volle Minute zwischen den wogenden Leibern hindurch, bis ich dich in der Mitte der Tanzfläche fand. Du hattest die Augen geschlossen, die Hände erhoben, bewegtest dich langsam, bedächtig und geschmeidig. Ich weiß bis heute nicht, wie dieser Move heißt, war aber vollkommen fasziniert. Immer wenn du die Arme über den Kopf strecktest, hob sich dein Oberteil und deine gebräunte Taille kam zum Vorschein. Einen Moment lang stand ich einfach nur da und starrte dich an. Du sahst so verloren aus, warst gleichzeitig so im Reinen mit dir, dass ich beinahe nichts weiter unternommen hätte.
Stell dir vor, ich hätte es nicht getan.
Aber leider war ich an diesem Abend untypisch verwegen. Das eine Bier hatte mir den Mut verliehen, vorzutreten und dir auf die Schulter zu tippen.
Du hast erschrocken die Augen geöffnet.
»Willst du tanzen?«, fragte ich.
Gucken Sie sich an, wie ich einfach aufs Ganze gegangen bin. Bin ich jemals so dreist gewesen? Eine schöne Frau, die allein tanzte, und ich besaß die Unverfrorenheit, sie anzusprechen.
Du hast mich angesehen und gerufen: »Was?«
Ja, so laut war es auf der Tanzfläche. Ich beugte mich näher zu dir. »Willst du tanzen?«, schrie ich, mein Mund so nahe an deinem Ohr, dass ich Angst hatte, dein Trommelfell könnte platzen.
Du hast das Gesicht verzogen und geschrien: »Ich tanz doch schon.«
Das war der Moment, an dem ich – aber das gilt ehrlich gesagt wohl für die meisten Männer – normalerweise aufgegeben hätte. Warum habe ich das damals nicht getan? Warum habe ich etwas in deinen Augen gesehen, das mir sagte, ich sollte es noch einmal versuchen?
»Ich meine mit mir«, rief ich.
Dein rechter Mundwinkel verzog sich zu einem schwachen Lächeln, das mir noch immer, wenn ich daran denke, durch Mark und Bein geht. »Ja, schon klar. War nur ein Witz.«
»Der war gut«, sagte ich, ohne zu wissen, ob du es ernst genommen oder als Sarkasmus aufgefasst hast – und nur um das hier jetzt einmal festzuhalten, es war Sarkasmus.
Und dann haben wir getanzt. Du warst ein absolutes Naturtalent. Entspannt, anziehend, sinnlich. Du konntest dich völlig gehen lassen, sodass die Bewegungen gleichzeitig spontan aber auch einstudiert wirkten. Ich habe mich auf meinen besten Tanzschritt konzentriert, der darin bestand, mich gewissenhaft von einer Seite zur anderen zu bewegen, ohne auch nur die geringste Mühe darauf zu verwenden, wie ein guter Tänzer zu erscheinen. Vielmehr versuchte ich, nicht aufzufallen, mich diskret einzufügen, um nicht wie ein totaler Idiot dazustehen. Mein Tanz war also ein einziger Versuch, mich nicht zu blamieren, was natürlich gerade dazu führte, dass ich extrem unsicher wirkte – aber vielleicht spricht jetzt auch nur meine Unsicherheit aus mir.
Es schien dich nicht zu stören.
»Wie heißt du?«, fragte ich.
»Anna. Und du?«
»Kierce.« Dann ergänzte ich aus irgendeinem Grund: »Sami Kierce.« Herrgott klang das bescheuert. Als wäre ich James Bond.
Du deutetest mit dem Kinn in Richtung der Lacrosse-Bros. »Du siehst nicht aus, als würdest du zu ihnen gehören.«
»Du meinst, weil ich nicht muskulös und attraktiv bin?«
Wieder dieses schwache Lächeln. »Ich mag dein Gesicht, Sami Kierce.«
»Danke, Anna.«
»Es hat Charakter.«
»Ist das ein Euphemismus für einfältig?«
»Ich tanze mit dir, nicht mit ihnen.«
»Andererseits haben sie dich auch nicht aufgefordert.«
»Stimmt«, hast du gesagt. Dann wieder dieses Lächeln. »Aber ich werde den Club heute Nacht auch nicht mit einem von ihnen verlassen.«
Meine Augen müssen aus den Höhlen hervorgetreten sein, denn du hast wunderschön gelacht und meine Hand genommen, woraufhin wir weiter tanzten, und ich anfing, mich zu entspannen und loszulassen, und ja, zwei Stunden später habe ich mit dir zusammen den Club verlassen, während die Lacrosse-Bros die Fäuste in die Luft reckten und in betrunkenem Chor »Kierce, Kierce, Kierce« grölten.
Wir haben Händchen gehalten und sind am Strand von Fuengirola spazieren gegangen. Du hast mich im Mondlicht geküsst, und ich habe den salzigen Duft des Mittelmeers immer noch in der Nase. Du hast mich zu deiner Wohnung mitgenommen, die in einem bescheidenen Hochhaus eine halbe Meile vom Embarcadero entfernt lag. Ich habe dich gefragt, ob du mit jemandem zusammenwohnst. Du hast nicht geantwortet. Ich habe dich gefragt, wie lange du schon in Fuengirola wohnst. Du hast nicht geantwortet.
Ich hatte vorher noch nie einen One-Night-Stand, hatte noch nie ein Mädchen in einem Club aufgerissen. Oder, um es genauer zu sagen, mich von einem Mädchen aufreißen lassen. Ich war keine Jungfrau mehr. Ich war in unserem ersten Jahr in Bowdoin mit Sharyn Rosenberg gegangen, und wir hatten es oft gemacht, trotzdem war ich nervös. Ich versuchte, mich an Captain Quinn zu orientieren. Der Mann hatte ein schier unerschöpfliches Selbstbewusstsein. In unserem ersten Studienjahr hatte Quinn jedes Mal einen Treffer gelandet und war erst sehr spät in der Nacht oder früh am nächsten Morgen nach Hause gekommen. Als ich ihn einmal fragte, warum er nie ein Mädchen mit in unser Zimmer brachte, sagte er: »Ich will nicht, dass etwas von ihr bei mir bleibt, verstehst du?«, und verschwand für eine halbe Stunde unter der Dusche.
Captain Quinn hatte ein ernsthaftes Problem mit Nähe – und das hat er wahrscheinlich immer noch.
In der ersten Nacht haben Anna und ich auf der Couch gekuschelt und eine Weile rumgemacht, dann ist sie eingeschlafen oder vielleicht ohnmächtig geworden, ich weiß es nicht mehr. Wir waren noch voll bekleidet. Ich habe überlegt, ob ich gehen sollte, aber das kam mir falsch vor – einfach unhöflich –, also schloss ich die Augen, versuchte, es mir bequem zu machen, und tat so, als wäre ich auch eingeschlafen.
Als du am Morgen aufgewacht bist, hast du mich angelächelt und gesagt: »Ich freu mich, dass du noch da bist.«
»Ich mich auch«, antwortete ich.
Dann hast du meine Hand genommen und mich unter die Dusche geführt, und weiter möchte ich das jetzt nicht ausführen.
Zwei Tage später reisten die Lacrosse-Bros nach Sevilla weiter. Ich habe mich am Bahnhof von Málaga mit ihnen getroffen, um mich zu verabschieden. Captain Quinn legte seine riesigen Pranken auf meine schmalen Schultern, sah auf mich herab und sagte: »Wenn du in den nächsten drei Tagen mit Vögeln durch bist, treffen wir uns in Sevilla. Am vierten und fünften Tag sind wir dann in Barcelona. Am sechsten Tag überqueren wir die Grenze nach Südfrankreich.«
Quinn fuhr so fort, bis ich ihn daran erinnerte, dass ich es war, der die Reiseroute geplant hatte und daher wüsste, wo sie wann wären. Er umarmte mich kurz und heftig. Die anderen Lacrosse-Bros verabschiedeten sich mit Fistbumps. Ich wartete, bis sie in den Zug gestiegen waren.
Eine kurze Randbemerkung noch, Anna: Ich habe keinen der Lacrosse-Bros je wiedergesehen.
Holden hat mich einmal angerufen, weil ich damals – anders als heute – noch Polizist war und sein Sohn bei einer Kneipenschlägerei festgenommen worden war. Aber ich habe Holden nie getroffen. Genau wie Mikey. Und Sky. Und Shack. Und selbst Captain Quinn nicht.
Ich habe keinen von ihnen je wiedergesehen.
Aber ich frage mich immer wieder, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich mich einfach an die Reiseroute gehalten hätte und mit ihnen nach Sevilla gefahren wäre.
Ich frage mich auch, wie dein Leben dann wohl verlaufen wäre.
Vielleicht hätte es auch für dich alles verändert. Ich weiß es nicht.
Ich versuche, Zeit zu schinden, Anna.
Ich glaube nicht, dass wir ineinander verliebt waren. Es war eine Urlaubsaffäre. Du hast mir nicht das Herz gebrochen. Leider nicht. Darüber wäre ich hinweggekommen. Mir wurde schon öfter das Herz gebrochen. Ein paar Jahre später habe ich sogar einen weitaus verheerenderen Verlust erlitten als diesen, aber bei Nicole hatte es zumindest einen Abschluss gegeben.
Man braucht einen Abschluss, Anna.
Aber bei dir …
Ich schinde immer noch Zeit.
Es war unser fünfter gemeinsamer Tag. Wir waren uns einig, dass ich mein Bett im Hostel aufgeben und bei dir einziehen sollte. Mein Herz schlug höher. Wir verbrachten unsere Nächte in verschiedenen Clubs und tanzten. Wir tranken. Wir nahmen wohl viele Drogen. Ich weiß nicht, was es war. Ich bin eigentlich kein Partylöwe, aber wenn du feiern wolltest, war ich dabei. Warum auch nicht? Ein bisschen leben, oder? Du hattest eine »Quelle« – einen etwas älteren Holländer namens Buzz mit lila Stachelfrisur, Nasenring und vielen geflochtenen Armbändern. Du hast uns das Zeug immer besorgt. Du wolltest es so. Du hast dich mit Buzz an der Ecke hinter dem El Puerto Hotel getroffen. Ich weiß noch, wie ihr beide miteinander geflüstert habt. Manchmal schien es recht lebhaft zu werden. Ich nahm an, dass ihr verhandelt habt, bevor du Buzz Geld und er dir was auch immer zugesteckt hat.
Was wusste ich schon? Ich war jung und unbedarft.
Dann haben wir gefeiert. Wir sind in deine Wohnung zurückgegangen, meistens gegen drei Uhr morgens. Wir haben uns geliebt. Wir sind nicht eingeschlafen, wir haben einfach das Bewusstsein verloren. Frühestens gegen Mittag sind wir wieder aufgewacht. Wir haben uns aus dem Bett gerollt und an den Strand geschleppt.
Am nächsten Tag fing alles wieder von vorne an.
An die letzte Nacht erinnere ich mich nicht so genau.
Ist das nicht seltsam? Ich weiß noch, dass wir wieder in die Discoteca Palmeras gegangen sind, den Club, in dem wir uns kennengelernt hatten, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, dass ich ihn verlassen habe oder den Hügel zu deinem Hochhaus hinaufgegangen bin – warum hast du in Fuengirola überhaupt in einem Apartment gewohnt? Warum warst du nicht in einem Hotel oder einem Hostel, wie alle anderen in unserem Alter? Warum hattest du keine Mitbewohner oder Freunde, und warum kanntest du anscheinend niemanden außer diesem Buzz? Warum habe ich nicht darauf gedrängt, mehr zu erfahren? – Aber ich erinnere mich noch genau, wie die heiße spanische Sonne mich am nächsten Tag geweckt hat.
Ich lag in deinem Bett. Ich weiß noch, dass ich aufstöhnte, als mir das Licht in die Augen fiel und mir klar wurde, dass es mindestens Mittag sein musste, weil die Sonne so hoch am Himmel stand, und dass wir wieder einmal vergessen hatten, das Rollo herunterzuziehen.
Ich verzog das Gesicht, blinzelte und hielt mir die Hand vor die Augen.
Aber meine Hand war nass. Sie war von etwas Feuchtem, Klebrigem bedeckt.
Und ich hielt etwas darin.
Ich hob sie langsam und sah es mir an.
Ein Messer.
Ich hatte ein Messer in der Hand.
Es war blutverschmiert.
Ich drehte mich zu dir um.
Dann schrie ich.
Es gibt Wissenschaftler, die glauben, dass kein Ton je ganz verschwindet, dass er immer leiser wird, verhallt, so weit abklingt, dass wir ihn zwar nicht mehr hören können, dass er aber irgendwie immer noch da ist, und wenn wir nur leise genug wären, könnten wir diesen Ton bis in alle Ewigkeit wahrnehmen.
So kam es mir bei diesem Schrei vor.
Denn manchmal höre ich den Nachhall dieses Schreis in der Stille der Nacht sogar heute noch.
Eins
Zweiundzwanzig Jahre später
Ich stehe hinter dem Baum und fotografiere mit einer Kamera mit Teleobjektiv die Nummernschilder. Der Parkplatz ist voll, also fange ich mit den teuersten Autos an – unglaublich, dass neben diesem Drecksloch ein Bentley parkt – und arbeite mich die Preisliste hinab.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt, bevor meine Zielperson herauskommt – ein reicher Mann namens Peyton Booth. Fünf Minuten, vielleicht zehn. Aber ich mache diese Fotos aus folgendem Grund: Ich schicke sie an meine heimliche Partnerin bei der Zulassungsstelle. Besagte Partnerin checkt dann die Kennzeichen und sucht die zugehörigen E-Mail-Adressen heraus. Sie schickt die Fotos an die zugehörigen E-Mail-Adressen und droht mit Entlarvung, wenn die Empfänger nicht Geld auf das angegebene, nicht zurückverfolgbare Cash-App-Konto überweisen. Nur fünfhundert Dollar. Nur nicht gierig werden. Wenn die Leute nicht reagieren – und neunzig Prozent tun das nicht –, hat sich die Sache erledigt, wir verdienen trotzdem so viel, dass es sich lohnt.
Ja, die Zeiten sind hart.
Ich stehe auf der anderen Seite des Parks und bin gekleidet wie einer, den man früher Landstreicher oder Penner nannte. Der Euphemismus, mit dem man das heutzutage beschönigt, ist mir gerade entfallen, also frage ich Debbie.
»Obdachlose«, erwidert Debbie.
»Echt?«
»Oder auch Wohnungslose. Sind beide scheiße.«
»Welchen bevorzugst du?«
»Göttin.«
Debbie, die Göttin, behauptet, dass sie dreiundzwanzig sei, sieht aber jünger aus. Sie verbringt einen Großteil ihrer Tage damit, mit Tränen in den Augen vor verschiedenen, äh, »Gentlemen’s Clubs« – noch so ein Euphemismus – zu stehen und jedem Mann, der reingeht oder rauskommt, zuzurufen: »Daddy, warum?« Anfangs hat sie das nur zum Spaß gemacht – sie findet es einfach toll, dass manche Typen dann leichenblass werden und erstarren –, aber inzwischen grüßen sie ein paar Stammgäste mit einem freundlichen »Hallo« oder stecken ihr gelegentlich einen Zwanziger zu.
»Für mich ist das eine Übung in Kapitalismus und Ethik«, erklärt sie.
»Wieso?«
»Das mit dem Kapitalismus ist doch offensichtlich.«
Debbie hat gute Zähne. Das ist hier draußen selten. Ihre Haare sind gewaschen. Sie trägt ein ärmelloses Top und hat saubere Arme.
»Okay, du verdienst Geld damit«, sage ich. Dann: »Und die Ethik?«
Ihre Unterlippe zittert. »Manchmal rennt ein Typ panisch weg, wenn er meinen Spruch hört. Als hätte ich ihm etwas Vernunft eingehämmert. Als hätte ich ihn daran erinnert, wer er eigentlich ist. Und vielleicht, nur ganz vielleicht, hätte es meinen Daddy davon abgehalten, in solche Läden zu gehen, wenn eine junge Frau wie ich so etwas oder etwas Ähnliches getan hätte …«
Ihre Stimme verklingt. Sie senkt den Blick, blinzelt und lässt die Unterlippe weiter zittern.
Ich mustere ihr Gesicht noch einen Moment, dann sage ich: »Schluchz.«
Blinzeln und Zittern sind wie von Zauberhand weggewischt. »Was?«
»Soll ich dir dieses Klischee von einem Vaterkomplex etwa abkaufen?« Ich schüttle den Kopf. »Da hätte ich von dir was Besseres erwartet.«
Debbie lacht und schlägt mir auf den Arm. »Verdammt, Kierce, du musst ein fantastischer Polizist gewesen sein.«
Ich zucke die Achseln. Das war ich. Ich habe keine Ahnung, wie Debbie auf der Straße gelandet ist. Ich habe sie nicht gefragt, und sie hat es mir nicht erzählt, und wir scheinen damit beide gut klarzukommen.
Ich sehe auf die Uhr.
»Showtime?«, fragt Debbie.
»Muss ja.«
»Den Code weißt du noch?«
Ich weiß ihn. Wenn sie schreit: »Daddy, warum?«, ist es der falsche Mann. Wenn sie schreit: »Aber Daddy, ich bin von dir schwanger«, bedeutet das, dass Peyton – der Mann, den ich suche – gerade herausgekommen ist. Der Code war Debbies Idee. Ich gebe ihr fünfzig Dollar für diese Aktion, und wenn ich Erfolg habe und bekomme, was die Kanzlei braucht, verdoppele ich auf hundert.
Debbie geht den Weg hinunter zu einer Stelle, von der aus sie die Tür des Clubs sieht. Von meinem Aussichtspunkt aus kann ich die Tür nicht sehen. Ich habe Debbie das Foto von Peyton Booth auf meinem Handy gezeigt, sie weiß also, wie er aussieht. Wahrscheinlich haben Sie es schon erraten – Peyton lässt sich scheiden. Mein Job hier ist simpel.
Ertapp ihn dabei, wie er seine Frau betrügt.
So tief bin ich gesunken, seit ich von der Polizei entlassen wurde, weil ich gewaltigen Mist gebaut habe. Schlimmer noch: Obwohl ich für eine der besten Anwaltskanzleien Manhattans arbeite, kriege ich kein Geld dafür. Das Ganze ist ein Tauschgeschäft. Ich wurde von der Familie von PJ Dawson, Schüler einer Highschool, verklagt. In der Klageschrift heißt es, dass ich PJ auf das Dach eines dreistöckigen Gebäudes gejagt und dadurch in Gefahr gebracht habe. Aufgrund dieses fahrlässigen Verhaltens sei der junge PJ ausgerutscht, vom Dach gestürzt und drei Stockwerke hinuntergefallen, wodurch er schwere Verletzungen erlitten habe. Die Anwaltskanzlei Whit Shaw – die alle White Shoe nennen, in Anlehnung an die gängige Bezeichnung für eine Spitzenkanzlei in den USA – vertritt mich im Gegenzug dafür, dass ich inoffiziell zweifelhafte Aufträge wie diesen für sie erledige.
Amerika ist wunderbar.
Peyton ist Chef eines großen konservativen Firmenkonglomerats und angeblich – schließlich sind wir alle Heuchler – ein großer Frauenheld. Die Aussage seiner Frau ihrem Anwalt gegenüber lautete, dass ihr zukünftiger Ex eine Schwäche für »blondierte Schlampen mit riesigen falschen Hupen« habe. Die Frau ist davon überzeugt, dass Peyton mit ihrer Nachbarin rummacht, woraufhin ich das gründlich überprüft habe, und ja, die Nachbarin entspricht dieser Beschreibung, aber nein, er macht nicht mit ihr rum.
Peyton hat darauf geachtet, seinen Lexus in der hintersten Ecke des Parkplatzes abzustellen, weit entfernt von neugierigen Blicken. Deshalb stehe ich auf diesem Hügel, der einzigen Stelle, an der ich die Kamera positionieren und das gesamte mögliche Geschehen aufnehmen kann. Näher dran würde man mich entdecken. Weiter weg wäre nichts zu erkennen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, von hier zu filmen und rechtzeitig zu erfahren, wann meine Zielperson den Club verlässt.
Außerdem ist der Parkplatz so angelegt, dass er sich die Stellplätze mit einem altmodischen Lebensmittelladen mit dem vielsagenden Namen »Besorg’s dir« und einem Blumenladen mit dem Namen – passen Sie auf – »Frauenschuh & Rittersporn« teilt, sodass den Besuchern des »Gentlemen’s Club« durch diese Läden ein gewisser Schutz zuteilwird. Wenn ich Peyton also dabei filme, wie er hier parkt oder wegfährt, wird das vor Gericht keine große Wirkung entfalten. Erwische ich ihn aber mit einer dieser Tänzerinnen (schon wieder so ein Euphemismus – vermissen wir nicht alle die Zeiten, in denen man einfach sagen konnte, was man meinte?), wird das eine erhebliche Wirkung zeigen.
»Daddy, warum?«, ruft Debbie.
Ich stelle die Kamera aufs Stativ. Ich prüfe den Bildausschnitt. Ja, direkt durch die Windschutzscheibe meines Autos. Ich blicke immer noch in die Kamera, als hinter mir eine Stimme ertönt.
»Wo ist Debbie?«
Ein kurzer Blick verrät mir, dass es sich um einen wohnungslosen (oder obdachlosen) Mann handelt.
»Sie arbeitet«, sage ich.
»Ich bin Raymond.«
»Hey, Raymond.«
»Normalerweise bringt Debbie mir ein Sandwich.«
»Gib ihr noch etwas Zeit, okay, Raymond?«
»Sie weiß, dass ich Mayo nicht ausstehen kann.«
»Alles klar.«
»Hat Debbie erzählt, wie Düsenflugzeuge über den Himmel fliegen können?«
»Nein.«
»Soll ich das erzählen?«
»Habe ich eine Wahl, Raymond?«
»Hexen«, sagt er.
»Hexen«, wiederhole ich.
»Fliegende Hexen, um genau zu sein. Drei an jedem Flugzeug. Eine hält die rechte Tragfläche, eine die linke und die dritte ist hinten und hält das Heck.«
»Ich war schon in Flugzeugen«, sage ich. »Ich hab auch ein paarmal an der Tragfläche gesessen. Aber ich habe da noch nie eine Hexe gesehen.«
Ich weiß nicht, warum ich das sage, aber ich rede und handle manchmal, ohne sämtliche Konsequenzen mitzubedenken. Das erklärt vielleicht auch, warum ich keine Mörder und Schwerverbrecher mehr festnehme, sondern als Quasi-Spanner auf dem Parkplatz des Frauenschuh & Rittersporn stehe.
Raymond runzelt die Stirn. »Sie sind unsichtbar, Sie Dussel.«
»Unsichtbare fliegende Hexen?«
»Klar«, sagt er, als widere ihn meine Dummheit an. »Glauben Sie etwa, riesige Metallrohre könnten sich von alleine in der Luft halten? Also bitte. Sie glauben wohl einfach alles, was die Regierung Ihnen erzählt?«
»Da ist was dran, Raymond.«
»Ein mittlerer Airbus wiegt mindestens fünfundsiebzigtausend Kilo. Wussten Sie das?«
»Nein.«
»Und wir sollen glauben, dass so etwas Schweres den ganzen Weg über einen Ozean in der Luft bleiben kann?«
»Mhm.«
»Nehmen Sie die Scheuklappen ab, Mann. Sie wurden voll verarscht. Schon mal was von Schwerkraft gehört? Die Physik spielt da einfach nicht mit.«
»Daher die Hexen«, sage ich.
»Genau, Mann. Hexen. Und die spielen der Menschheit so einen voll fiesen Streich.«
Ich kann mir nicht helfen. »Was meinst du damit, Raymond?«
Er runzelt die Stirn. »Ist das nicht offensichtlich?«
»Für mich nicht.«
»Eines Tages«, sagt Raymond, reibt seine Hände aneinander und leckt sich die Lippen, »wenn wir Narren es am wenigsten erwarten, werden alle Hexen gleichzeitig loslassen.«
»Die Flugzeuge?«
Er nickt zufrieden. »Genau. Alle Hexen werden die Flugzeuge einfach gleichzeitig loslassen. Mit einem schrillen Lachen. Sie wissen schon, wie Hexen eben lachen. Sie lachen schrill und sehen zu, wie die Flugzeuge auf die Erde plumpsen.«
Er sieht mich an.
»Übel«, sage ich.
»Lassen Sie sich das gesagt sein. Sehen Sie zu, dass Sie mit dem Herrn ins Reine kommen, bevor es so weit ist.«
Unten auf der Straße höre ich Debbie schreien: »Aber Daddy, ich bin von dir schwanger.«
Bingo.
»Können wir das später besprechen, Raymond?«
»Sagen Sie Debbie, dass ich auf das Sandwich warte. Und ohne Mayo.«
»Mach ich.«
Im Sucher der Kamera entdecke ich Peyton, er trägt einen Businessanzug. Mein Mut sinkt, als ich sehe, dass er allein ist. Er geht zu seinem Auto und steigt auf der Fahrerseite ein. Ich warte in der Hoffnung, dass sich jemand zu ihm gesellt. Es kommt niemand. Er startet den Motor.
Setzt aber nicht zurück.
Jetzt lächle ich, während ich die Kamera weiter auf ihn richte. Zielperson Peyton wartet auf jemanden. Da bin ich mir sicher.
Während ich weiter durch den Sucher blicke, höre ich Debbie rufen: »Daddy, warum?«, und ein schnauzbärtiger Mann, ebenfalls im Businessanzug, erscheint auf dem Parkplatz.
Mein Handy klingelt. Es ist Arthur, der junge Anwalt und meine Kontaktperson bei der White Shoe Kanzlei. »Bist du an ihm dran?«
»Bin ich.«
»Gut. Die Papiere werden gleich morgen früh unterschrieben.«
»Ich weiß.«
»Wenn wir dann nicht beweisen können, dass er sie betrogen hat, kann sie nichts gegen die Vereinbarung im Ehevertrag machen.«
»Ich weiß.«
»Hast du dann was oder nicht?«
Jemand öffnet die Beifahrertür von Peytons Auto und schlüpft hinein. Peyton dreht sich zu der Person um.
Sie fangen an, heftig rumzumachen.
Allerdings macht er nicht mit einer vollbusigen Blondine rum.
Sondern mit dem schnurrbärtigen Mann im Businessanzug.
Zwei
An diesem Abend – ein paar Minuten bevor wieder alles schieflief – gab ich einen Kurs an einer Abendschule mit der recht vagen, aber fantasievollen Bezeichnung »Academy Night Adult School« in der Lower East Side. Die Schule wirbt immer noch in diesen kostenlosen Magazinen oder Broschüren, die man in Aufstellern auf der Straße findet, und auf den elektronischen Anzeigen über den Sitzen der U-Bahnlinien F und M. In der Broschüre, die für meinen Kurs wirbt, werde ich als »weltbekannter Ex-Kriminalbeamter« bezeichnet, und das daneben abgedruckte Foto ist so wenig schmeichelhaft, dass die Führerscheinstelle vor Neid erblassen würde.
Mein Kurs geht von zwanzig bis zweiundzwanzig Uhr, und die Teilnehmer bezahlen direkt bei der Ankunft. Wir nehmen sechzehn Dollar pro Doppelstunde. Bar. Ich teile das Geld fifty-fifty mit Chilton, dem »Direktor« der Academy Night Adult School, deshalb achten wir darauf, dass es ein gerader Betrag ist. Chilton ist hier auch Hausverwalter und Hausmeister, daher weiß ich nicht, wie seriös das ganze Unternehmen ist. Es ist mir aber auch ziemlich egal.
Wir befinden uns im Schatten des Hochhauskomplexes Baruch Houses in der Nähe der Williamsburg Bridge in der Rivington Street, einer Straße, die Sie auf der Karte finden oder auch nicht. Unser Domizil ist eher Ruine als Gebäude und wurde 1901 als erstes öffentliches Badehaus in der Stadt eröffnet. Manche Leute, die das hören, glauben, dass es sich um einen exotischen oder extravaganten Ort handelt. Da liegen sie falsch. Öffentliche Bäder dienten damals der Hygiene, nicht der Freizeitgestaltung.
Ich habe es nachgeschlagen. Damals gab es in der Lower East Side eine Badewanne für neunundsiebzig Familien. Schon beim Lesen dieser Statistik fängt man vor lauter Gestank fast an zu würgen, oder? Der ursprüngliche Verwendungszweck des Gebäudes ist kaum noch zu erkennen, allerdings ist mein höhlenartiger Seminarraum aus Beton und hat eine ziemlich gute Akustik, und manchmal kann ich die Geister der Vergangenheit sehen, wenn schon nicht riechen.
Aber ich bin auch anfällig für so etwas.
In meinem Kurs geht es um Kriminologie. Ich habe beschlossen, ihn – passen Sie auf – »No Shit, Sherlock« zu nennen. Ja, okay, okay … aber Sie müssen zugeben, dass es recht eingängig ist. Am Anfang jeder Stunde schreibe ich ein anderes Zitat von Sherlock Holmes (oder von Sir Arthur Conan Doyle, für die, die es ganz genau nehmen wollen) an die Wandtafel. Dann sprechen wir darüber. Und von dort entwickeln wir es weiter. Vor sechs Wochen habe ich mit zwei Schülern angefangen. Heute Abend sind dreiundzwanzig hier, von denen einundzwanzig für den Kurs bezahlt haben und zwei – Debbie und Raymond – dank eines Sami-Kierce-Stipendiums kostenlos teilnehmen. Debbie ist begeistert und macht große Augen. Raymond schneidet sich während des gesamten Kurses die Zehennägel, dazu studiert er jeden einzelnen Nagel sehr genau, bevor er ihn mit der gleichen Präzision schneidet, wie die Mittagessensgruppe meiner Großmutter die gemeinsame Rechnung aufteilt.
Die Gruppe ist bunt gemischt. Vorne im Raum sitzen drei Frauen in den Siebzigern, die sich die Pink Panthers nennen. Sie sind Amateurdetektivinnen, die sich gerne mit realen Verbrechen beschäftigen oder sich eine Geschichte aus der Zeitung heraussuchen und ihr nachgehen. Ich habe ein paar Sachen gesehen, die die Pink Panthers zuwege gebracht haben, und finde es ziemlich beeindruckend. Seltsamerweise sitzen hinten im Raum, als wären die Panthers durch ein filmisches De-Aging-Verfahren verjüngt worden, ebenfalls drei Frauen. Sie sind um die fünfundzwanzig, attraktiv und, wie ich gehört habe, eher unbedeutende Instagram-Influencerinnen, die gerade unter dem Namen »Three Dead Hots« einen True-Crime-Podcast gestartet haben. Ich vermute, dass sich im Raum noch weitere Möchtegern-True-Crime-Podcaster befinden. Auch ein paar True-Crime-Fans. Ein Typ namens Hex, der immer eine graue Jogginghose mit dazu passendem Kapuzenpulli trägt, will den Mord an seiner Tante aus dem Jahr 1982 aufklären. Dann ist da noch Golfer Gary, der immer ein gebügeltes Golfshirt mit dem Logo eines noblen Clubs trägt. Eigentlich würde ich ihn hier unten in der Lower East Side für einen Poser halten, aber ich bin ein ausgebildeter Detective, und irgendetwas an seinem Auftreten riecht nach altem Geld. Ich weiß nicht, was er macht, bin aber neugierig. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, in diesem Kurs scheint aber noch mehr zu stecken.
Nach gut der Hälfte der Zeit schleicht sich jemand durch die Seitentür in den Seminarraum.
Meine Spiderman-Sinne kribbeln. Aber vielleicht tun sie das auch nur in der Rückschau.
Ich sehe die Gestalt nur im peripheren Blickfeld. Ich gucke nicht genau hin. Hier kommen ständig Leute herein. Letzte Woche war es ein Mann mit einem so struppigen schmutzig-grauen Bart, dass es aussah, als würde er gerade ein Schaf essen. Er schlug die Hände vors Gesicht, schrie: »Himmler mag Thunfischsteaks«, und verschwand wieder.
Für diesen Teil des Unterrichts haben die Teilnehmer etwas mitgebracht, um es den anderen zu zeigen und darüber zu berichten. Leisure Suit Lenny ist an der Reihe. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Er sitzt etwas zu nah an den Influencerinnen, strahlt aber auch etwas Harmloses aus. Er stellt eine Kiste auf die abgestoßene Betonplatte, die wir als Tisch benutzen, und nimmt kleine Elektrogeräte heraus.
»Das sind Peilsender«, erklärt Lenny den Kursteilnehmern.
Wahrscheinlich haben Sie schon etliche Memes gesehen, in denen sich Leute fragen: »Wie bin ich hier nur hierher geraten«, und fragen sich vielleicht, wie das bei mir passiert ist. Aber der Sommer mit Anna hat mich tatsächlich aus der Bahn geworfen. Als ich wieder zu Hause war, kam mir alles falsch vor. Ich habe mich lange in meinem Zimmer verkrochen. Ich wollte nicht mehr Medizin studieren. Meine Eltern haben – so gut sie konnten – versucht, mich zu verstehen, waren aber auch überzeugt davon, dass es wieder vorbeigehen würde. Verschieb es um ein Jahr, drängten sie mich. Das tat ich. Verschieb es um noch ein Jahr. Auch das tat ich. Aber auch danach fand ich nicht wieder zurück. Ich wollte mein Leben lang Arzt werden. Ich habe dieses Studium weggeworfen. Meine Eltern waren am Boden zerstört.
»Ich habe immer mindestens drei Peilsender dabei«, fährt Lenny fort.
Instagram Influencerin eins sagt: »Echt jetzt? Drei?«
»Immer. Seht ihr den hier?« Lenny hält etwas hoch, das wie ein schwarzer, rechteckiger Tracker aussieht. »Das ist ein Alert1A4. Erinnert ihr euch noch an diese Werbung früher: ›Ich bin gestürzt und kann nicht mehr alleine aufstehen‹?«
Viele nicken. Raymond drückt den Nagelknipser. Der abgeschnittene Nagel schnellt davon.
Golfer Gary greift sich an die Wange: »Au, was zum …? Der wär mir fast ins Auge geflogen!«
Raymond hebt die Hand und deutet auf sich: »Mein Fehler, das geht ganz klar auf mich.«
Lenny fährt unbeirrt mit seiner Präsentation fort. »Dieser Tracker ist deutlich fortschrittlicher und hat sehr viel mehr Funktionen. Ich kann ihn von dieser Seite aus stumm schalten …«, er demonstriert es, »… und den Lautsprecher eingeschaltet lassen, sodass man ihn sowohl als Wanze, als auch als Peilsender einsetzen kann. Das Problem dabei ist, dass der Akku nicht sehr lange hält.« Er sieht die Leute im Raum an. »Das gilt übrigens für alle diese Geräte. Der GPS-Sender zieht viel Strom. Dies hingegen …«, er zieht ein Gerät heraus, das die Form einer dicken Münze hat, »… hält zwar bis zu einem halben Jahr – man muss sich aber im Umkreis von zwanzig Metern befinden, um das Signal empfangen zu können.«
Instagram Influencerin zwei hebt die Hand, kaut ihr Kaugummi und sagt: »Das ist irgendwie schon so ’ne Art Stalking.«
Eins (ebenfalls Kaugummi kauend): »Auf jeden.«
Drei (ebenfalls Kaugummi kauend): »Gadgets für Perverse.«
Zwei: »Es gibt auch andere Möglichkeiten, Leute zu connecten.«
Eins: »Hast du auch Kabelbinder dabei?«
»Nein!« Lenny läuft rot an. »Dafür nutze ich die nicht!«
Eins: »Wofür dann?«
»Falls ich Zeuge eines Verbrechens werde. Wie diesen hier.« Er hält einen kleinen GPS-Tracker mit beiden Händen hoch in die Luft wie Simba am Anfang von Der König der Löwen. »Der hat einen sehr starken Magneten. Ich kann ihn an ein Auto hängen.«
Zwei: »Uuuuund das hast du bestimmt schon mal gemacht, oder?«
Eins: »Bestimmt mehr als einmal.«
Drei: »Bestimmt, um ein Mädchen kennenzulernen.«
Eins: »Mit mir hat das mal ein Typ gemacht.«
Zwei: »Echt jetzt?«
Drei: »Krass.«
Eins: »Er hat da einen GPS-Sender an mein Auto gehängt, damit er einen Zeitpunkt festlegen kann, an dem wir …«, sie malt mit den Fingern Anführungszeichen in die Luft, »… aufeinanderstoßen.«
Zwei: »Ihh.«
Eins: »Du meinst, so ein perverses kleines Treffen?«
Drei: »Genau.«
Zwei: »Hat es funktioniert?«
Drei zuckt die Achseln. »Irgendwie schon, ja. Aber er hat auch einen Porsche gefahren.«
Eins: »Nice, was fährst du, Lenny?«
Lenny reißt die Arme hoch. »So was mach ich alles nicht.«
Eins: »Ich find’s pervers.«
Zwei: »Voll gruselig. Außer, na ja, was für ein Auto fährst du, Lenny?«
Lenny jammert: »Mr Kierce?«
»Okay«, sage ich, stelle mich neben ihn, nehme den ersten GPS-Sender und werfe ihn lässig in die Luft. »Ich denke, wir sollten …«
Da sehe ich Anna.
Ich halte inne, blinzle. Fast hätte ich den Kopf geschüttelt, um die Spinnweben loszuwerden.
Ich weiß, dass das unmöglich ist, daher reagiere ich einige Augenblicke lang praktisch gar nicht. Ich will warten, bis der Moment vorbei ist.
Es wäre nicht das erste Mal, dass ich verstorbene Menschen sehe.
Letztes Jahr habe ich eine Phase durchlebt, in der ich halluziniert und sogar ganze Gespräche mit meiner »anderen« ermordeten Geliebten Nicole geführt habe.
Ja, ermordet.
Offenbar ist es nicht sehr sicher, mit mir etwas anzufangen, Ladys.
Geschmackloser Witz.
Aber immer, wenn ich Nicole in den Halluzinationen gesehen habe, war sie nicht gealtert. Sie sah vor meinem geistigen Auge so aus wie früher, so wie sie am Tag ihrer Ermordung ausgesehen hat – sie war genau die herzzerreißend schöne Sechsundzwanzigjährige, mit der ich verlobt war.
Ich habe mir auch schon eingebildet, Anna zu sehen. Sie kennen das bestimmt. Zum Beispiel habe ich in einem vollen Park oder in einer überfüllten Bar in Manhattan eine Frau mit langen kastanienbraunen Haaren gesehen, und einen Moment lang war ich davon überzeugt, dass es Anna war. Aber dann habe ich geblinzelt oder ihr auf die Schulter getippt, habe das Gesicht der Frau gesehen und die Realität hat mich wieder eingeholt.
Das mache ich jetzt auch. Ich blinzle. Ich blinzle noch einmal. Dann schüttele ich wirklich leicht den Kopf, um ihn frei zu kriegen. Aber schon als ich das tue, weiß ich, dass dies nicht dasselbe ist. In der Vergangenheit habe ich bei den »Anna-Visionen« – ein viel zu bedeutungsschwangerer Ausdruck – jedes Mal die Anna gesehen, die ich kannte, die einundzwanzigjährige (oder wie alt sie auch immer war) Anna. Sie hatte lange kastanienbraune Haare und unergründliche Augen, was seltsam ist. Ich kann mich jedoch nicht an Annas Augenfarbe erinnern – vielleicht, weil ihre Augen geschlossen waren, als ich sie das letzte Mal sah –, aber jetzt, inmitten der übelriechenden Geister des ehemaligen Badehauses, sehe ich das Haselnussbraun in den Augen dieser Frau, und ja, jetzt erinnere ich mich.
Anna hatte haselnussbraune Augen.
Jemand – ich glaube, es ist Golfer Gary – sagt: »Kierce? Alles okay mit dir?«
Aber diese Frau hat keine langen kastanienbraunen Haare. Ihre Haare sind kurz und blond. Und als ich sie kannte, hat Anna nie eine Brille getragen. Diese Frau trägt eine mit einem eleganten Drahtgestell. Anna war etwa einundzwanzig Jahre alt. Diese Frau ist Mitte vierzig.
Sie kann es nicht sein.
Die Vielleicht-Anna schreckt zurück. Sie hatte sich an die Wand gelehnt, aber jetzt eilt sie hastig aus dem Seminarraum.
»Kierce?«
»Erzähl weiter, Lenny. Ich bin gleich zurück.«
***
Ich sprinte hinter ihr her.
Alle Köpfe drehen sich. Die Kursteilnehmer wissen natürlich, dass etwas im Busch ist. Sie befinden sich in einem Kriminologiekurs und sind demzufolge situationsbedingt oder von Natur aus neugierig. Und extrem aufmerksam. Ich höre, wie Stühle nach hinten geschoben werden, als würden sie sich darauf vorbereiten, zu mir zu kommen.
»Dableiben«, befehle ich.
Sie gehorchen, wenn auch nur widerwillig.
Ich verlasse den Raum. Von unten hallen Schritte durchs Treppenhaus. Hier hallt alles. Ich folge dem Geräusch. Auf dem Weg kehrt ein gewisses Maß an Vernunft zurück. Ich ermahne mich, dass ich schon früher halluziniert habe. Da ging es, wie schon erwähnt, um meine ermordete Verlobte Nicole. Damals habe ich lange Gespräche mit ihr geführt. Einmal hat mich die halluzinierte Nicole sogar überredet, die Brücke zu verlassen, von der ich hinunterspringen wollte. Sie hat mir klugerweise zugeredet und mich überzeugt – eine Halluzination, wohlgemerkt –, dass ich zu meiner schwangeren Verlobten Molly (die jetzt meine Frau ist) nach Hause gehe.
Bevor Sie mich für völlig durchgeknallt halten, muss ich klarstellen, dass die Schuld für diese Halluzinationen nicht bei mir lag. Wie ich später erfahren habe, waren sie eine Nebenwirkung eines ungenehmigten Medikamententests, der mich fast umgebracht hätte, in Verbindung mit einem seltsamen Chemiecocktail, der meinen Körper durchströmt, und – um mich nicht ganz von Verantwortung freizusprechen – einer Vergangenheit, in der ich extrem viel Alkohol getrunken habe.
Aber nachdem ich das Medikament abgesetzt hatte, waren die Halluzinationen verschwunden.
Aber ist eine Halluzination nicht trotzdem die beste Erklärung?
Das kann nicht Anna sein.
Das wäre absurd.
Und doch würde es in gewisser Weise alles erklären.
Schon seltsam, wie schnell sich die eigene Wahrnehmung ändert. Ich akzeptiere bereits jetzt, dass das, was ich das letzte Vierteljahrhundert geglaubt habe, falsch war.
Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.
Alles hallt hier drinnen, sodass ich deutlich höre, wie sie die Treppe hinunterläuft. Ich folge ihr, nehme zwei oder sogar drei Stufen auf einmal. Ich sehe sie. Sie hat das Erdgeschoss erreicht.
»Stopp«, sage ich.
Ich schreie nicht. Bei dem Hall hier ist das nicht nötig. Vor allem aber will ich sie nicht erschrecken. Sie soll nur einfach nicht mehr weglaufen.
»Bitte«, ergänze ich. »Ich will nur reden.«
Vielleicht hat sie den irren Blick in meinen Augen gesehen und sich dadurch bedroht gefühlt. Vielleicht war sie, wie Thunfisch-Himmler, einfach hereinspaziert, weil sie Schutz vor der Außenwelt suchte, einen sicheren Ort brauchte, an dem sie sich kurz hinsetzen und nachdenken konnte, ohne ständig auf der Hut sein zu müssen.
Aber sie sah weder arm aus noch so, als wäre sie vom Glück verlassen. An ihrem Handgelenk trug sie etwas, das wie ein dickes Goldarmband aussah. Ihr edler Mantel beschwor eine Aura von Kaschmir und fetter Kohle herauf.
Sie ist schon fast am Ausgang.
Ich renne schneller, schlage alle Bedenken in den Wind und so weiter. Ich sehe, wie Vielleicht-Anna die Hand nach der Tür ausstreckt, die in die nächtliche Lower East Side hinausführt. Mir bleibt keine Zeit mehr. Sie umfasst den Knauf und dreht ihn. Ich springe zu ihr und ergreife ihren Unterarm.
Sie schreit. Sehr laut. Als hätte ich sie erstochen.
»Anna«, sage ich.
»Lassen Sie mich los!«
Das tu ich nicht. Ich halte sie fest und starre ihr ins Gesicht. Sie wendet sich ab, versucht, sich loszureißen. Ich packe noch fester zu. Schließlich dreht sie sich um und sieht mich an. Unsere Blicke begegnen sich. Und es besteht kein Zweifel mehr.
»Anna«, sage ich noch einmal.
»Lassen Sie mich gehen.«
»Erinnerst du dich an mich?«
»Mein Arm. Sie tun mir weh.«
Dann höre ich eine vertraute tiefe Stimme: »Kierce?«
Es ist Chilton. Er trägt seinen engen weißen Hausmeisteroverall, und die aufgerollten Ärmel sitzen eng wie Aderpressen auf seinen muskulösen Armen. Chilton ist Jamaikaner, ein großer, kräftiger Mann mit einem starken Rasta-Akzent, kahl rasiertem Kopf und Ohrringen. Er möchte, dass man ihn Schwarzer Meister Proper nennt. Das tut zwar niemand, aber es würde passen.
Anna zögert nicht. Sie nutzt ihre Chance und reißt den Arm los. Wieder greife ich nach ihr, erwische den Mantel – ja, auf jeden Fall Kaschmir – und mache das, was ich geplant hatte, denn im Augenwinkel sehe ich, dass Chilton auf mich zukommt. Die Zeit ist knapp. Ich will sie nicht aus den Augen lassen, weiß aber, dass ich sie nicht einfach festhalten kann. Alle Fehler, die ich im Leben gemacht habe – und das waren eine ganze Menge –, sind mir in solchen Augenblicken unterlaufen, in denen ich impulsiv gehandelt habe.
Chilton tritt zu mir und legt mir eine Hand auf die Schulter. Die hat ungefähr die Größe und das Gewicht eines Gullydeckels. Er drückt meine Schulter so fest, dass ich fast in die Knie gehe.
Anna rennt raus.
Ich könnte mich nicht bewegen, selbst wenn ich es wollte. Aber ich will es auch gar nicht. Ich brauche ihr nicht zu folgen.
Ich habe erreicht, was ich wollte.
Chilton verringert den Druck auf meine Schulter. Ich richte mich zu meiner vollen Größe auf, sodass ich gut dreißig Zentimeter kleiner bin als er. Er starrt mit in die Hüfte gestemmten Händen auf mich herab.
»Was zur Hölle ist mit dir los, Kierce?«
Mit Lügen bin ich immer schnell bei der Hand. »Sie hat nicht für den Kurs bezahlt.«
»Was ist los?«
»Die Frau ist reingekommen, hat am Kurs teilgenommen, und als sie bezahlen sollte …«
»Und deshalb hast du sie verfolgt?«, fragt Chilton erschrocken.
»Ja.«
»Eine weiße Frau?«
»Sei nicht rassistisch, Chilton.«
»Findest du das witzig?«
Ich strecke die Hand nach vorne, die Handfläche nach unten, und drehe sie leicht hin und her, in einer Geste, die so viel besagt, wie »vielleicht ein bisschen«.
»Man verfolgt keine weiße Frau«, sagt er. »Nicht in dieser Stadt. Was habe ich dir am ersten Tag gesagt, als du zu mir gekommen bist?«
»Wenn mir dein Kurs kein Geld einbringt, bist du für mich gestorben.«
»Und danach?«
»Dass ich keine weißen Frauen verfolgen soll?«
Chilton schüttelt den Kopf. »Dass du keinen Ärger machen sollst.«
»Oh«, sage ich, »stimmt.«
»Ich wollte dir einen Gefallen tun, als ich dir diesen Job gegeben habe.«
»Ich weiß, Chilton«, sage ich, obwohl das nur ein Teil der Wahrheit ist, eigentlich beruhte es eher auf Gegenseitigkeit. Marty, mein früherer Partner bei der Polizei, hat drei Strafzettel für Falschparken zerrissen, damit Chilton mir diesen Job gibt.
»Ich will meine Großzügigkeit nicht bereuen«, sagt Chilton.
»Sorry, du hast recht. Ich hab überreagiert.« Dann zeige ich nach oben. »Ich habe oben mehr als zwanzig zahlende Teilnehmer.«
Das weckt seine Aufmerksamkeit. »Ehrlich? So viele?« Er stößt mich Richtung Treppe. »Los, los.«
Das muss er mir nicht zweimal sagen, auch wenn er genau das gerade getan hat.
»Vielleicht können wir den Preis nächste Woche auf achtzehn Dollar erhöhen«, schlägt Chilton vor. »Mal sehen, ob jemand abspringt. Und die Woche drauf dann auf zwanzig.«
»Raffiniert«, sage ich und eile die Treppe wieder hinauf. Als ich ankomme, ist es im Seminarraum völlig still. Alle starren mich an.
»Lenny«, sage ich, »kann ich dich kurz auf dem Flur sprechen?«
Der Kurs stößt ein »Uhhh« aus, als wären wir in der dritten Klasse und ich hätte Lenny ins Büro des Rektors geschickt. Lenny wirkt tatsächlich nervös, also ergänze ich: »Du steckst nicht in Schwierigkeiten.«
Als wir weit genug von der Tür entfernt sind, entsperre ich mein Handy mit der Gesichtserkennung und reiche es ihm. »Du musst mir einen Gefallen tun.«
Lenny sieht auf mein Handy. »Was denn?«
»Lad die GPS-App für mich runter«, sage ich.
Als ich an der Tür in Vielleicht-Annas Mantel gegriffen habe, habe ich einen von Lennys Peilsendern in ihre Tasche fallen lassen.
»Wie war das?«
»Ich brauch die App«, sage ich.
»Wieso?«
»Ich bin auf dem Weg zu einem Stelldichein.«
Drei
V ielleicht-Anna ist schon auf dem FDR Drive.
Also ist sie entweder eine Weltklasse-Sprinterin, oder sie ist mit dem Auto unterwegs, was mich überraschen würde. Hierher fährt niemand mit dem Auto. Man nimmt die U-Bahnlinien F oder M. In der Umgebung gibt es keine Parkplätze. Und hier kommen auch nur sehr wenige Taxis vorbei. Eventuell hätte sie sich einen Uber-Wagen bestellen können, aber wenn ich mir angucke, wo sie jetzt ist, müsste der innerhalb von Sekunden hier gewesen sein, was in diesem Teil der Lower East Side nicht häufig vorkommt.
Ausgeschlossen ist es aber nicht.
Ich habe mein Auto natürlich nicht hier. In New York ist ein Garagenplatz zu teuer, also lasse ich den klapprigen 2002er Ford Taurus, den ich vor zehn Jahren einem Sportagenten abgekauft habe, meistens in Queens bei meinem Freund Craig in der Einfahrt stehen. Er nimmt fünfzig Dollar im Monat dafür. Vielleicht sagen Sie jetzt: Toller Freund, aber wenn Sie hier in der Gegend wohnen, wissen Sie, dass das ein absolutes Schnäppchen ist. Ich überlege, ob ich mir ein Taxi rufe und dem Fahrer die grobe Richtung sage, in die er fahren soll, während ich die Tracker-App im Auge behalte, aber das wäre nicht nur teuer, ich würde mich auch verdächtig machen. Lennys GPS-Sender steckt in ihrer Manteltasche. Er funktioniert. Also kann ich es mir leisten, etwas Geduld zu haben.
Ich nehme die U-Bahnlinie M Richtung Norden, steige in Queens aus und gehe die drei Blocks zu Craig zu Fuß. Das Haus ist dunkel. Keiner da. Craig hat einen Autoschlüssel in seiner Küche. Ich habe meinen immer bei mir. Also steige ich ins Auto, setze auf die Straße zurück und checke die Tracker-App. Vielleicht-Anna steht in der Nähe der 125th Street im Stau, ungefähr da, wo der FDR Drive zum Harlem River Drive wird. Ich weiß nicht, warum sich der Straßenname dort ändert. Es ist die gleiche Straße. Es verwirrt alle, sogar die Einheimischen, aber starkes Verkehrsaufkommen auf dem FDR/Harlem River Drive ist eher die Regel als die Ausnahme. Die Straße ist berüchtigt für die häufigen nächtlichen Vollsperrungen wegen Bauarbeiten. Ich schalte mein Navi ein, um mir anzugucken, wie ich zu ihr komme. Wenn sie in Manhattan bleibt, fährt sie wohl am ehesten über die Robert F. Kennedy Brücke, die Chancen stehen aber gut, dass ihr Wagen weiter Richtung Norden unterwegs ist. Hätte Vielleicht-Anna bei dem Verkehr in Manhattan bleiben wollen, dann wäre sie vom FDR abgebogen und durch die Stadt gefahren.
Trotzdem. Ich habe keine Ahnung, wohin sie will, also muss ich immer wieder aufs Smartphone-Display sehen. Als ich das tue, klingelt das Handy. Das schöne Gesicht meiner Frau Molly erscheint und verdeckt die Tracker-App.
Ich zögere, überlege, ob ich den Anruf ignorieren soll, aber nein, das geht nicht. Ich drücke die Annehmen-Taste, fahre mit dem Daumen über die Karte der Tracker-App und versuche, mich in einem normalen Tonfall zu melden. »Hey«, sage ich.
»Hey, mein Hübscher. Wie ist der Kurs gelaufen?«
»Gut«, sage ich.
Ich habe in meinem Leben eine Menge Geheimnisse für mich behalten. Das ergibt sich, wenn man zu viel trinkt. Große Neuigkeiten sind das allerdings nicht. Früher habe ich in Beziehungen zu oft gelogen, und auch Molly war davon betroffen. Bei unserer Hochzeit im letzten Jahr habe ich ihr versprochen, dass so etwas zwischen uns nicht mehr vorkommt, dass wir uns nicht mehr belügen oder Geheimnisse voreinander haben, ganz egal, wie schlimm oder bedeutsam die Dinge auch sein mögen. Ich habe dieses Versprechen gehalten, habe ihr allerdings nie von Anna und dem Sommer in Spanien erzählt. Das wäre dann womöglich eine Lüge durch Verschweigen. Der einzige Mensch auf der Welt, dem ich die ganze Geschichte über jene Nacht erzählt habe, ist mein Dad. Seine knappe Antwort lautete: »Nimm die nächste Maschine nach Hause.«
Seitdem haben wir beide nicht mehr darüber gesprochen. Nicht ein einziges Mal.
»Bist du auf dem Heimweg?«, fragt Molly.
»Noch nicht«, sage ich. »Ich muss noch einer Sache nachgehen.«
»Aha?«
Ich höre etwas in ihrer Stimme, das mir nicht gefällt. Ich möchte sie beruhigen, werde aber nicht lügen. Ich werde mein Versprechen halten.
»Ich kann das am Telefon nicht erklären«, sage ich ihr.
»Verstehe.«
»Aber es ist alles okay. Ich erzähl es dir, wenn ich zu Hause bin.«
Ich checke die Tracker-App. Vielleicht-Anna fährt auf dem Cross Bronx Expressway Richtung Osten.
»Wie geht’s Henry?«, frage ich.
Henry ist unser kleiner Sohn. Er wird bald ein Jahr alt. Mit Henrys Geburt ist meine ganze Welt auf eine Masse von drei Komma ein Kilo zusammengeschrumpft. Bevor man ein Kind bekommt, ist die Welt eine Sache. Danach ist sie etwas ganz anderes. Damit will ich das Kinderkriegen weder propagieren noch verteufeln. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Tatsache ist aber, dass ein Kind – ob Sie wollen oder nicht – bis zur Molekularebene hinab absolut alles verändert. Dagegen ist niemand immun.
»Er ist wach und reagiert auf jedes noch so leise Geräusch«, antwortet Molly. Henry schläft nicht sehr gut oder fest. Dann fragt sie in einem Ton, der mir noch immer nicht gefällt: »Weißt du, wann du nach Hause kommst?«
»Nicht so richtig«, sage ich.
»Dann geht es wohl um etwas Großes?«
Ich weiß nicht recht, was ich darauf antworten soll. »Es ist viel zu tun, ja. Aber es geht schon.«
»Das ist alles ein bisschen kryptisch«, sagt Molly.
»Das ist gar nicht so gemeint. Ich kann auch versuchen, es jetzt zu erklären …«
»Aber du würdest es lieber von Angesicht zu Angesicht machen.«
»Ja«, sage ich. »Viel lieber.«
»Okay. Ich liebe dich, Sami.«
»Ich liebe dich mehr«, sage ich, weil ich das tue.
Molly legt zuerst auf. Auf dem Major Deegan Expressway hole ich etwas auf, und ehe ich michs versehe, fahren wir beide die Interstate 95 entlang in Richtung Connecticut. Ich blicke auf die Tankuhr und stelle erfreut fest, dass der Tank noch halb voll ist. Craig benutzt mein Auto häufig, was zwar eigentlich nicht Teil der Abmachung ist, er weiß aber, dass mir das egal ist, und normalerweise tankt er es dann auch wieder auf. Craig arbeitet in der Verwaltung des Bronx Zoo. Er hat seine Frau Cassie, ein wahres Energiebündel, vor zwei Jahren an Eierstockkrebs verloren, und wenn Craig jetzt lächelt, erreicht das Lächeln seine Augen nicht mehr.
Ich behalte die Straße im Auge. Der Peilsender biegt bei Ausfahrt 3 ab. Ich folge ihm. Ich denke nach, überlege, wie es angehen kann, dass es sich um Anna handelt und warum sie in meinen Kurs gekommen ist, doch dann fällt mir das Sherlock-Holmes-Zitat auf der alten Schultafel wieder ein:
Es ist ein kapitaler Fehler, eine Theorie aufzustellen, bevor man entsprechende Anhaltspunkte hat. Unbewusst beginnt man, Fakten zu verdrehen, damit sie zu den Theorien passen, statt die Theorien den Fakten anzupassen.
Kurz gesagt, bleiben Sie unvoreingenommen. Stellen Sie nicht zu früh Theorien auf. Warten Sie damit, bis Sie mehr wissen.
Ach … vergessen Sie’s.
Ich erinnere mich an den Polizisten in Fuengirola, Carlos Osorio, dessen jugendliches, aber weltverdrossenes Gesicht verriet, dass er mir kein Wort glaubte, als ich ihm die Wahrheit erzählte. Oder jedenfalls einen Teil der Wahrheit. Nicht die ganze Wahrheit. Wer würde einem Polizeibeamten in einer solchen Situation auch die ganze Wahrheit erzählen? Wer würde zum Beispiel erwähnen, dass er mit der Mordwaffe in der Hand aufgewacht ist? Aber ich war noch ein dummer Junge – Osorio hat sicher gespürt, dass ich nicht vollkommen ehrlich war. Ich erinnere mich noch, wie er mit verschränkten Armen gewartet hat, bis ich endlich so klug war, den Mund zu halten, um mir dann gezielte Fragen zu stellen: Wie viel habt ihr getrunken? … Wie viel habt ihr geraucht? … Wie viel habt ihr durchgezogen? … Soll ich dich lieber direkt zum Drogentest schicken?
Ich folge der Tracker-App in eine hochpreisige Hauptstraße, die Molly als »goldig« bezeichnen würde, mit edlen Restaurants und schick herausgeputzten Boutiquen, deren Besitzer sie eher als Hobby denn als Geschäft zu betreiben scheinen. Meine alte Rostbeule passt in diese wohlhabende Umgebung wie eine Zigarette in ein Fitnessstudio. Ich kurble das Fenster herunter, um das Geld riechen zu können. Dann biege ich links ab und komme auf Straßen, die von immer prächtigeren Villen gesäumt werden – je weiter man sich von der Hauptstraße entfernt, desto größer und abgelegener sind die Anwesen.
So fahre ich einen Kilometer. Dann zwei weitere. Gelegentlich sehe ich noch mal ein Haus oder vielmehr ein paar Lichter, die hinter dichten Hecken aufblitzen. Die Einfahrten sind mit Toren versperrt, die Gärten mit aufwendig gestalteten schmiedeeisernen Zäunen. Schwer zu glauben, dass ich mich noch in derselben Welt befinde, in der auch die Lower East Side existiert, womit ich weder die eine verurteilen noch die andere aufwerten will. Ich bin eindeutig nicht reich, und obwohl ich die urtümliche Anziehungskraft der riesigen Villen verstehe – das schlichte menschliche Bedürfnis nach »mehr« –, frage ich mich doch, wer tatsächlich so viel Platz braucht oder auch nur besitzen will? In wie vielen Räumen kann man sich gleichzeitig aufhalten? Mein Vater hat mich immer mit einer alten Redewendung davor gewarnt, zu gierig zu sein: Man kann mit einem Hintern nicht auf zwei Pferden reiten.
Ich finde, das passt hier.
Laut der App hat sich der Sender seit sieben Minuten nicht mehr bewegt.
Ist sie zu Hause? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich das auf der App richtig erkenne, befindet sie sich nicht mehr auf einer Straße. Ich vergrößere das Bild mit den Fingern. Laut der Tracker-App ist Anna 2,8 Kilometer von meinem aktuellen Aufenthaltsort entfernt, an einem abgelegenen Ort, mit mindestens zwei- oder dreihundert Metern Abstand zur nächsten Straße.
Seltsam.
Eine Satellitenansicht wäre praktisch, aber die Tracker-App hat keine. Ich halte auf dem Seitenstreifen und tippe auf die drei Punkte oben rechts in der App. Das Drop-down-Menü zeigt die genauen Koordinaten des Ziels in Längengrad und Breitengrad an. Ich kopiere sie, füge sie in Google Earth ein und warte, während sich der Globus dreht.
Als er stoppt, sage ich leise: »Au Backe.«
Die Stelle, an der sich Anna – der Einfachheit halber nenne ich sie jetzt Anna und nicht mehr Vielleicht-Anna –, die Stelle also, an der Anna sich laut Tracker-App seit neun Minuten aufhält, ist auf dem Satellitenbild verpixelt.
Verpixelt?
Das ist ziemlich ungewöhnlich. Die Regierung kann verlangen, dass sensible Orte wie Militärbasen oder bestimmte Bürogebäude auf Satellitenkarten unkenntlich gemacht werden. Ich bezweifle, dass das der Fall ist, weil die Mieten hier draußen zu hoch sind für diese Klientel. Aber es wäre möglich. Manchmal verpixelt Google Earth auch andere Grundstücke, wenn die Privatsphäre der Bewohner unbedingt geschützt werden muss. Sehr häufig machen sie das allerdings nicht. Und normalerweise kostet das.
Kurz gesagt, jemand, der über Macht, Geld oder beides verfügt, möchte, dass dieser Ort – an dem sich Anna aufzuhalten scheint – geheim bleibt.
Was nun?
Eigentlich sollte ich natürlich nach Hause fahren. Einmal durchatmen. Mit Molly reden. Ein bisschen recherchieren. Ich weiß ja jetzt, wo Anna ist. Zumindest glaube ich es zu wissen. Vielleicht ist es aber auch nur ein Zwischenstopp. Oder sie besucht einen Freund, der hier wohnt. Oder sie bleibt nur ein paar Stunden oder vielleicht eine Nacht. Sie könnte jedoch auch in einer Stunde wieder wegfahren – oder morgen früh oder sonst irgendwann.
Ich checke das Batteriesymbol oben links in der Ecke der App. Der Sender ist nur noch bei elf Prozent. Wie lange kann ich sie damit noch orten? Wohl höchstens eine Stunde.
Danach könnte Anna wieder verschwinden.
Das darf ich doch nicht riskieren, oder?
Die Straßen sind leer und praktisch nur von meinen Scheinwerfern erleuchtet. Auf den letzten fünf, sechs Kilometern ist mir auch kein anderes Auto begegnet. Ich fahre die bewaldete Straße entlang, die am nächsten an dem Ort vorbeiführt, an dem Anna sich laut der Tracker-App befindet. In einer Lücke zwischen den Bäumen befindet sich eine Einfahrt. Ich fahre langsamer und sehe, dass sie von einem schmiedeeisernen Tor versperrt wird. Einem hohen Tor mit Spitzen oben. Daneben steht ein kleines Häuschen. Dort brennt Licht, und ich erkenne die Silhouette einer Person, bei der es sich vermutlich um einen Wachmann handelt.
Massive Sicherheitsmaßnahmen für ein Privathaus.
Falls es sich tatsächlich um ein Privathaus handelt.
Hastig suche ich nach einem Schild, einer Hausnummer oder etwas Ähnlichem – ich will mich hier nicht allzu lange aufhalten –, finde aber nichts. Ich überlege, ob ich vors Tor fahren soll, aber was dann? Es ist schon nach zweiundzwanzig Uhr. Ich kann nicht so tun, als wollte ich ein Paket ausliefern – und einfach zu sagen: »Ich würde Anna gern sehen«, tja, das käme vermutlich nicht besonders gut an.
Mein impulsives Ich will immer noch dieses Spiel spielen. Mein impulsives Ich will direkt zum Wachmann gehen und sagen: »Ich möchte zu Anna. Sagen Sie ihr, dass ich Sami Kierce heiße und wir uns vor zweiundzwanzig Jahren an der Costa del Sol in Spanien kennengelernt haben.« Mein impulsives Ich macht häufig Fehler. Mein impulsives Ich war es, das aus dem Schlafzimmer rannte und Anna zurückließ. Mein impulsives Ich war es, das in Fuengirola aufs Polizeirevier ging und Osorio einen Mord meldete. Mein impulsives Ich hat PJ auf dieses Dach gejagt, worauf er hinuntergestürzt ist. Mein impulsives Ich hat Maya Stern ohne Begleitung auf Judith Burketts riesiges Anwesen Farnwood gehen lassen, ein Fehler, der dazu geführt hat, dass ich mehr oder weniger in Ungnade gefallen bin.
Vielleicht sollte ich mein impulsives Ich aus der Sache heraushalten – einfach wieder nach Hause fahren werde ich aber trotzdem nicht.
Langsam fahre ich die stark bewaldete Straße entlang und biege sofort ab, als ich eine kleine Lücke zwischen den Bäumen entdecke. Von der Straße aus kann man mein Auto zwar noch sehen, aber nur, wenn man intensiv danach Ausschau hält. Ich stelle den Motor ab und schalte die Innenbeleuchtung aus. Ich glaube nicht, dass mich hier jemand sieht, habe aber auch nicht vor, so lange zu bleiben, dass die Polizei einen Abschleppwagen ruft. Trotzdem nehme ich einen Stift und einen Zettel aus dem Handschuhfach und kritzle darauf: »Auto defekt, bin bald zurück.« Ich überlege, ob ich hinzufügen soll, dass ich Polizist bin, aber erstens ist das nebensächlich und zweitens entspricht es nicht mehr der Wahrheit.
Ich steige aus. Die Nacht ist klar. Herbstgeruch liegt in der Luft. Die Sterne strahlen hier draußen viel heller, als man es aus der Stadt kennt. Ich halte das Handy mit der App wie einen Kompass in der Hand. Der Tracker, den ich in Annas Tasche gesteckt habe, ist dreihundert Meter von meinem aktuellen Standort entfernt, allerdings führt der gesamte Weg durch den Wald.
Kein Grund, Zeit zu verschwenden.





























