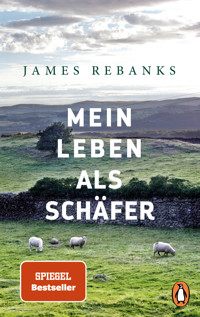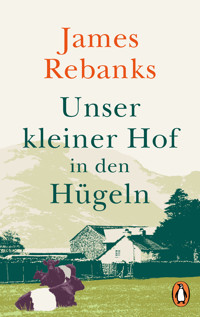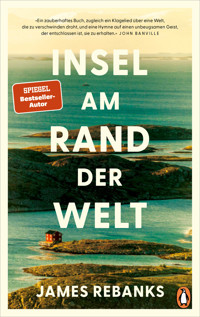
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein magisches Buch über einen lebensverändernden Frühling am Ende der Welt
»Ein zauberhaftes Buch, zugleich ein Klagelied über eine Welt, die zu verschwinden droht, und eine Hymne auf einen unbeugsamen Geist, der entschlossen ist, sie zu erhalten. James Rebanks hat ein stilles und doch eindrucksvolles Meisterwerk geschrieben.« John Banville
Drei Monate verbringt James Rebanks auf einer norwegischen Insel, wo im Frühjahr schwere Stürme toben, wo im kurzen Sommer die Sonne das Meer Tag und Nacht leuchten lässt, wo die Gezeiten das Leben bestimmen. Hier, auf der letzten Insel vor dem offenen, wilden Atlantik, begegnet Rebanks der alten Norwegerin Anna: einer zähen Frau, die ganz im Einklang mit der Natur lebt und sich weigert, sich von der Hektik der modernen Zeit vereinnahmen zu lassen. Im Lauf der Monate entwickelt sich eine innige Freundschaft zwischen ihnen, und James lernt von Anna, dass es sich lohnt, für das zu kämpfen, was einem wichtig ist.
»Dieses Buch fühlt sich nicht nur an wie ein moderner Klassiker, sondern auch wie einer, den wir gerade jetzt dringend brauchen - menschenfreundlich, sanft und seltsam fesselnd, in wunderschönem Rhythmus erzählt.« George Saunders
»Eine leise, berührende Fabel über die Sehnsucht, eine sterbende Welt zu retten.« Sydney Morning Herald
»Einfühlsam und bezaubernd... Rebanks ist ein außergewöhnlicher Autor, und dieses Buch wird lange in Erinnerung bleiben.« Daily Telegraph
»Eine poetische, wehmütige und zärtliche Hymne auf eine verschwindende Lebensweise.« Financial Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Vom einfachen Leben im Rhythmus der Gezeiten
Drei Monate verbringt James Rebanks auf einer norwegischen Insel, wo im Frühjahr schwere Stürme toben, wo im kurzen nordischen Sommer die Sonne das Meer Tag und Nacht leuchten lässt, wo die Gezeiten das Leben bestimmen. Hier, auf der äußersten Insel vor dem offenen, wilden Atlantik, begegnet Rebanks, der Farmer aus dem englischen Lake District, der alten Norwegerin Anna, die als eine der letzten Entenhüterinnen eine jahrhundertealte Tradition vor dem Aussterben bewahrt.
Voller Hochachtung beschreibt Rebanks diese zähe Frau, die ganz im Einklang mit der Natur und im Rhythmus der Gezeiten lebt und sich weigert, sich vom Lärm und der Hektik der modernen Zeit vereinnahmen zu lassen. Im Lauf der Monate entwickelt sich eine innige Freundschaft zwischen ihnen. James lernt von Anna, dass es sich lohnt, für das zu kämpfen, was einem wichtig ist.
James Rebanks wurde 1974 auf einer Farm im englischen Lake District geboren, die seine Familie seit über sechshundert Jahren bewirtschaftet. Er studierte Geschichte in Oxford, bevor er die Farm von seinem Vater übernahm. Sein erstes Buch, der eindrucksvolle autobiografische Bericht Mein Leben als Schäfer, wurde zum internationalen Bestseller und verschaffte ihm in England Kultstatus. Sein zweites Buch Mein englisches Bauernleben wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. als Sunday Times Nature Book of the Year 2020 und mit dem Wainwright Prize for Nature Writing 2021. Einblicke in sein Leben gibt er auf X und Instagram (@herdyshepherd1).
»Dieses Buch fühlt sich nicht nur an wie ein moderner Klassiker, sondern auch wie einer, den wir gerade jetzt dringend brauchen – menschenfreundlich, sanft und seltsam fesselnd, in wunderschönem Rhythmus erzählt.« George Saunders
»Ein zauberhaftes Buch, zugleich ein Klagelied über eine Welt, die zu verschwinden droht, und eine Hymne auf einen unbeugsamen Geist, der entschlossen ist, sie zu erhalten. James Rebanks hat ein stilles und doch eindrucksvolles Meisterwerk geschrieben.« John Banville
»Poetisch und bezaubernd … Rebanks ist ein außergewöhnlicher Autor, und ›Insel am Rand der Welt‹ wird lange in Erinnerung bleiben.« Daily Telegraph
www.penguin-verlag.de
James Rebanks
Insel am Rand der Welt
Aus dem Englischen von Henning Ahrens
Die Originalausgabe erschien 2024
unter dem Titel The Place of Tides
bei Allen Lane, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by James Rebanks
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright des Mottos auf S. 7
© 2004 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
© 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG, München
Lektorat: Tanja Ruzicska
Covergestaltung: Sabine Kwauka, München, nach einem Entwurf von Owen Corrigan
Covermotiv: © Alamy Stock Photo / Jan Schliebitz; © Getty Images / mikroman6
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-33164-1V002
www.penguin-verlag.de
Für Chloe Currens – die den Glauben bewahrte, als ich nicht mehr weiterwusste
Manchmal sehe ich die Blumen und Bäume der fernen Sonnenwelt. Aber ich sehe sie nicht in altgewohnter Weise. Ich sehe sie glühend bunter und ergreifend schön. In Wachstum und Farbe lebt ihr geheimster Sinn. Aber die Menschen, die unter der Sonne leben, erscheinen mir fern und klein. Mit gesenkten Köpfen sehe ich sie im Kreise laufen, im Kreis ihrer Sorgen und Kümmernisse. Nur wenige sehen die Herrlichkeit der Sonne.
Christiane Ritter, Eine Frau erlebt die Polarnacht, 1938
Inhalt
Vorrede
1 Die Reise
2 Die Wahl
3 Bauen
4 Varntid
5 Die Enten
6 Ein Ausflug
7 Zuhause
Ein Wort zum Text
Dank
Vorrede
Das Zeitalter des Menschen wird enden. Vielleicht wurde das Ende schon eingeläutet, doch der endgültige Ausklang wird noch auf sich warten lassen. Wäre dies ein Hollywood-Film, dann würde man am Ende jemanden mit einer Waffe durch eine Ruinenstadt hetzen sehen, obgleich ich bezweifele, dass die letzten Menschen in Städten ausharren werden: Nach dem Zusammenbruch aller Strukturen gäbe es in urbanen Zentren keine Nahrung mehr. Die Menschen würden in die Randbereiche ausweichen. Sie würden vor Chaos, Krankheiten und Killermaschinen an Orte fliehen, wo die verheerten Ökosysteme noch gewisse Überlebenschancen bieten. Wie die ersten würden auch die letzten Menschen die Küsten favorisieren, wo sich Meer und Land eine karge Lebensgrundlage abringen ließe. Den letzten Menschen auf Erden stelle ich mir als Frau vor, die an einer Felsküste steht. Einer solchen Frau bin ich begegnet, einer Frau am Rand der Welt. Einer Frau, die nicht aufgab, obwohl alles, was sie gekannt und verstanden hatte, untergegangen war.
~
Das geschah vor gut zehn Jahren. Auf einer Insel vor der Küste Norwegens. Die Reise dorthin kostete mich zwei Tage per Flugzeug, Bahn und Schiff sowie endlose Wartezeiten in Abfertigungshallen. Mit jeder Zwischenstation schienen die Wege aus dem Innern des Flughafens zu den Gates länger zu werden und die Flugzeuge kleiner. Zuletzt flog ich in einer zweimotorigen Propellermaschine. Die Flugbegleiterin musste sich seitwärts an Reihen von Männern in Thermojacken vorbeizwängen, die auf Ölbohrplattformen arbeiteten. Es war Mai, aber die eintönige Küstenlinie unter uns erweckte den Anschein, als wäre der Schnee gerade erst geschmolzen.
Ich lebte in einem Dorf in Cumbria, im Nordwesten Englands, unweit des Ortes meiner Kindheit, in einem alten Farmhaus, das gerade renoviert wurde. Auf der Rückseite stand ein Holzschuppen mit einem Computer. Ich erforschte, wie sich unberührte Orte vor dem ausufernden globalen Tourismus schützen ließen. Mein Vater, der seit jeher mit den Händen gearbeitet hatte, tat sich schwer damit, dies als Arbeit zu verstehen, und manchmal ging es mir genauso.
Eines Tages erhielt ich einen Anruf von Peter, meinem Chef. Er schickte mich in den sogenannten Vega-Archipel. Die Norweger, sagte er, würden den Umweltschutz sehr ernst nehmen, wir könnten von ihnen lernen.
Meine Kenntnisse über Norwegen hätten auf eine Briefmarke gepasst, aber mein Job beinhaltete nicht zuletzt die Aufgabe, rasch dazuzulernen. Wie ich feststellte, lag der Archipel auf halber Höhe der norwegischen Küste in der Region Helgeland, gleich unterhalb des Polarkreises, auf dem sechsundsechzigsten Breitenkreis.
Manche Vögel, die in unserem Tal überwinterten, hielten sich im Sommer an ebenjener Küste auf, Menschen dagegen nahmen die Reise dorthin selten auf sich.
Mein Ziel war Vega, die wenige Quadratkilometer große Hauptinsel des Archipels, vom Schiff aus gesehen eine Kette kaum aus dem Meer ragender Berggipfel. Als wir näher herankamen, entdeckte ich in der unwirtlichen Landschaft verstreute Bauernhöfe und Ansammlungen von Häusern. Zwei Autos warteten auf Kundschaft, neben einem stand ein Mann. Er ließ einen Fahrgast einsteigen und erkundigte sich dann, wohin ich wolle. Es liege auf seinem Weg, erklärte er. Bald darauf fuhren wir durch ein winziges Städtchen mit ein paar Geschäften, einer Werkstatt, einer Schule und einer stattlichen Holzkirche. Nach weiteren zwei, drei Kilometern ließ er mich in einem kleinen Fischerdorf vor einer alten Fischerhütte aussteigen, meiner Unterkunft.
In einem öden Bürogebäude traktierte mich das Fremdenverkehrsamt zwei Tage lang mit Präsentationen. Ich notierte Statistiken und stellte mechanisch die Fragen, die zu stellen man von mir erwartete. Nach einer Weile spürte ich jedoch, dass mich sowohl die entlegenen Inseln als auch die eigentümliche Tradition faszinierten, die gewisse Menschen veranlassten, sich regelmäßig dorthin zu begeben.
Die Diaaufnahmen der Inseln zeigten meist Frauen. Frauen in kleinen Booten. Frauen, die Nester bauten oder Eier hielten. Frauen, die Entenküken in ihren Händen bargen. Frauen, die im Sitzen Eiderdaunen säuberten. Und Frauen, die in einer arktischen Wildnis epischen Ausmaßes aus kleinen Holzhütten lugten. Anfangs glaubte ich, die verblichenen Bilder würden längst vergessene Menschen aus den 1960er- oder 1970er-Jahren zeigen. Als die Referenten von den abgebildeten Frauen erzählten, ging mir aber auf, dass die Aufnahmen aktuell waren. Einige Seemeilen weiter, jenseits der Wellen, gingen diese Frauen ihrer Arbeit nach. Sie schienen auf den Felsen zu leben. Eine Aufnahme zeigte eine Frau mit einem Jagdgewehr über der Schulter.
Ich hatte geglaubt, mich auf einer der abgelegensten Inseln aufzuhalten, doch es gab Hunderte kleinerer, noch entlegenerer Eilande. Der Archipel zog sich weit ins Norwegische Meer. Vega war noch Teil der Zivilisation. Weiter draußen gab es Orte ohne Strom, ohne Geschäfte, ohne jede Annehmlichkeit. Dort waren die Frauen tätig. Wie die Referenten erklärten, suchten sie jedes Jahr zu Frühlingsbeginn diese Inseln auf und errichteten dort kleine Holzhütten, die die Eiderenten vor Fressfeinden schützen sollten. Nachdem der flügge gewordene Nachwuchs mit den Eltern aufs Meer hinausgezogen war, ernteten die Frauen die hinterlassenen Eiderdaunen, säuberten und verkauften sie. Das war eine uralte, bis heute lebendige, aber bedrohte Tradition. Die Arbeit der Frauen setzte Ruhe und Frieden voraus. Das Fremdenverkehrsamt hatte den Auftrag, das, was jenseits des Horizonts lag, vor uns allen zu beschützen.
Am letzten Nachmittag erlebte ich dann eine Überraschung. Man bot an, mir Einblick in diese Welt zu gewähren. Ich würde eine »Entenfrau« kennenlernen.
~
Wir stachen als kleine Gruppe auf einem Fischerboot in See. Ein Mann mit Backenbart stand am Steuer. Das Boot sprang über die immer wilderen, raueren Wellen, es gab nur die offene See und vereinzelte Felsen. Alle Passagiere waren so aufgeregt und nervös wie Kinder auf einem Schulausflug.
Irgendwann beruhigte sich der Seegang, ringsumher war das Meer mit unzähligen kleinen Inseln und Felseilanden gesprenkelt, die wenige Meter aus dem Wasser ragten. Das Fischerboot verlangsamte die Fahrt und schlängelte sich durch die Fahrrinnen. Der Mann wies auf Felsen und nannte den Namen des Ortes. Ich fragte die Führerin, was der Name bedeute, und sie sprach mit dem Steuermann. Am Ende übersetzte sie ihn als »Federinsel«. Der Steuermann murrte protestierend, dann erklärte er mir, seine Leute würden seit jeher vom »Ort der Gezeiten« sprechen.
Er lenkte das Boot geschickt durch die Fahrrinnen mit den Pegelstangen, bis wir uns einer kleinen Insel näherten, die etwas mehr als die anderen aus dem Meer ragte. Mitten darauf sah ich einen Hügel, der einer Holzhütte und einigen rot gestrichenen Scheunen Schutz vor den Sturmböen des Atlantiks bot. Dies war der letzte Außenposten im Ozean, so schien es. In der Ferne brachen sich hohe Wellen weiß schäumend vor einem Riff. Eine letzte Fahrrinne, dann erreichten wir eine kleine Bucht mit einem Anleger, direkt unterhalb des Hauses. Der Steuermann drosselte den Motor.
Weder war ich ein großer Meeresliebhaber, noch fand ich Inseln romantisch. Aber hier war es schlicht schön. Wir waren auf einem fremden Wasserplaneten gelandet. Ich sah, wie ein Seeadler die weiten, zerzausten Schwingen ausbreitete, von einer Pegelstange abstrich und träge über die Wellen flog.
Als ich mich umdrehte, merkte ich, dass meine Begleiter eine Frau anstarrten, die mit wehenden Haaren auf einem großen, von Seetang bedeckten Felsplateau stand – ein trostloses, schwarzes Feld, das bei Flut unter Wasser lag. Eine einsame Gestalt inmitten der Weite von Felsen, Ozean und Himmel. Hier hatte man freie Sicht, konnte die schneebedeckten Gebirgszüge des Festlands und im Süden die Insel Vega sehen. Der Horizont schien so weit, dass die Küste von uns aus gesehen einen leicht gekrümmten Bogen beschrieb, und in dieser riesigen Bucht lag der Archipel.
Die Frau glich einer Zwergin auf einem riesigen Gemälde. Sie war höchstens anderthalb Meter groß, trug einen Wollpullover, eine offene Fleecejacke, eine dunkle Hose und oben umgeschlagene Gummistiefel. Sie schien so etwas wie den abgebrochenen Plastikstiel eines Mops zu halten, als wollte sie diesen isolierten Ort verteidigen. Sie wirkte so feindselig, als wären wir Eindringlinge, die die gewohnte Ordnung in Gefahr brachten. Ich konnte sie partout nicht einordnen, suchte nach Metaphern, nach einer passenden Schublade. Ich war ratlos.
Bei ihrem Anblick sträubten sich meine Nackenhaare. Es verschlug mir fast den Atem. Der Steuermann erkundigte sich nervös bei meiner Führerin, ob man die Frau über unser Kommen informiert habe. »Ja«, antwortete sie. »Ich habe sie benachrichtigt.« Der Steuermann schien weiterhin Zweifel zu haben. Die Wirkung dieser Frau auf uns Ankömmlinge lässt sich schwer beschreiben. Sie schien uns zu hypnotisieren. Dann tat sie ein paar Schritte und hob wie zum Gruß eine Hand. Das brach den Bann. Nun war sie schlicht eine Frau, wir wiederum waren mit dem Boot gekommen, um sie zu besuchen. Ich fragte mich, was zum Teufel gerade geschehen war.
Sie ging über die Felsen zur Anlegestelle, kam uns auf den Holzbohlen entgegen. Wir glitten auf sie zu. Trottellummen flohen klatschend über das stille Wasser der Bucht.
~
Sie hieß Anna. Ich schätze, wir waren eine gute Stunde bei ihr. Sie begrüßte uns mit heißem Tee und gezuckerten Pfannkuchen, aber ich ahnte, sie wäre nicht traurig, wenn wir wieder ablegten. Während die anderen höflich konversierten, ertappte ich mich dabei, sie zu betrachten. Sie erwiderte lächelnd meinen Blick, und ich spürte oder glaubte zu spüren, dass uns etwas verband.
Nach einer Weile wies sie die anderen an, in Ruhe ihren Tee weiterzutrinken, und nickte mir zu. Sie führte mich durch das Gras zu den von ihr gezähmten Eiderenten, die in einer Reihe wackeliger Hühnerställe, Scheunen und ehemaliger Kuhställe in weichen, grauen Nestern saßen. Sie hob den Flügel einer brütenden Ente und zeigte mir die darunter verborgenen Eier und Küken. Die Vögel vertrauten der Frau, reagierten aber ängstlich, wenn ich mich bewegte. Ich lobte die Schönheit der Tiere und versuchte dann, unsere Farm zu beschreiben. Vor einigen Tagen hatte ich meine Herde versorgt und entdeckt, dass mehrere neugeborene Lämmer von Raben gerissen worden waren. Sie nickte ernst, als wären wir die Einzigen, die dergleichen verstehen könnten. Wir hörten die Stimmen der anderen, und sie stöhnte verhalten. Wir glichen Kindern, die dabei erwischt wurden, wie sie Schabernack trieben, und nun gleich voneinander getrennt würden.
Vor der Rückkehr zum Boot schüttelte ich Annas Hand, die sich anfühlte wie die meiner Großmutter, knochig und fest. Als sie sich verabschiedete, empfand ich eine beängstigende Vertrautheit. Wir gingen zum Anleger und fuhren davon. Ich kehrte in mein Leben zurück. Und damit hätte es sein Bewenden haben können.
~
Unsere Welt ist finster und chaotisch. Jeder von uns braucht Leitlichter. Auf der Insel hatte ich das Gefühl, einer Person begegnet zu sein, die ihr Leben nach eigenen Bedingungen gestaltet hatte. Im Gegensatz zu mir, wie ich allmählich begriff. Bald nach meinem Aufenthalt auf Vega starb mein Vater. Ihm folgten weitere hochbetagte Menschen aus meinem Umfeld: Frauen und Männer, die während meiner Jugendjahre Vorbilder für mich gewesen waren. Ein Gefühl der Haltlosigkeit ergriff in immer stärkerem Maß Besitz von mir, ich kam mir vor wie ein Stück Treibholz in einer Strömung.
Dieses Gefühl wurde immer intensiver. Ich arbeitete Stunden über Stunden, um in einer Welt, die mir nicht besonders behagte, erfolgreich zu sein. Ich konnte mein Einkommen verdoppeln und noch einmal verdoppeln, war aber selten zufrieden oder glücklich. Ich war kein guter Ehemann, Vater, Bruder und Sohn. Ich begann, den Glauben an die Gewissheiten zu verlieren, von denen ich lange gezehrt hatte. Ich wurde zunehmend unsicher und orientierungslos. Mein Job führte mich an gefährdete Orte; an Orte, die bis jetzt gerade so überlebt hatten. Ich sah Kinder am Straßenrand unter Blechen liegen, erlebte von Ratten verseuchte, verdreckte Krankenhäuser in den Slums. Die Verzweiflung verfolgte mich, kam mir nach Hause hinterher. Vögel wie Kiebitze oder Schnepfen verschwanden vom Himmel über unserer Farm. Ringsumher ging alles zuschanden, warum also noch die Felder pflegen? Früher waren meine Hoffnung und mein Glaube an mich selbst unerschöpflich gewesen, nun gingen die Reserven zur Neige.
In manchen Nächten fand ich keinen Schlaf. Ich lag da, den Blick voller Angst zur Decke gerichtet. Manchmal hatte ich den Impuls, die Flucht zu ergreifen. Wegzurennen und mich zu verstecken.
Ich musste unaufhörlich an die alte Frau auf den Felsen denken. In ihr war etwas lebendig gewesen, das in mir erstorben war. Ich hatte es ihren Augen angesehen. Um herauszufinden, was es war, musste ich sie ein weiteres Mal aufsuchen – der Drang dazu war überwältigend. Es war, als hätte mir jemand ein paar Zeilen eines unvergleichlich guten Buches gezeigt und es dann zugeschlagen. Nur wusste ich partout nicht, wie es mir gelingen sollte, je wieder dorthin zurückzukehren.
Sieben Jahre verstrichen. Eines Tages schrieb ich einen Brief, den ich Anna durch meine damalige Führerin zukommen ließ. Darin erkundigte ich mich, ob sie noch zur Insel fahre, ob ich sie besuchen, ihre Arbeit kennenlernen, eventuell über sie schreiben dürfe. Ich würde mich zurücknehmen, für meinen Lebensunterhalt arbeiten und mich bemühen, nicht im Weg zu sein. Wochen später antwortete sie, im kommenden Frühling ihre letzte Saison auf der Eiderdaunen-Insel antreten zu wollen, danach werde sie sich zur Ruhe setzen, ihre Gesundheit sei angeschlagen. Sie erinnere sich an mich; ich sei der einzige Engländer, der sie je besucht habe. Ich müsse Arbeitszeug und feste Stiefel mitnehmen und möglichst bald kommen.
Wenige Tage später stand ich auf Vega vor ihrer Tür, und plötzlich hatte ich ein mulmiges Gefühl – wir sprachen ja nicht einmal dieselbe Sprache, und vielleicht wäre mein Ansinnen katastrophal für uns beide.
1 Die Reise
Stetes Klatschen, mal hell, mal dumpf, während sich das Motorboot über den Atlantik schleppt. Anna sitzt stumm da, eine silbergraue Strähne ist ihrem Haarband entwischt. Graue Regensäulen verbinden den Ozean mit den ölig schwarzen Kumuluswolken. Dumpfes Motorendröhnen erfüllt die Kabine. Hin und her ächzende Scheibenwischer klären einen Winkel der Scheibe. Jedes Mal, wenn das Boot schwankt, ruckelt eine kleine Kaffeekanne auf dem Tablett ein Stückchen weiter zur Seite. Der Mann am Steuer dreht sich nach Anna um. Sie hat ihren Blick auf den Horizont geheftet, als gäbe es nichts anderes auf der Welt.
~
Anna war viel älter als gedacht. Am Abend zuvor hatten wir im Wohnzimmer ihres Hauses auf Vega gesessen. Sie hatte starken Kaffee gekocht, dazu aßen wir dunkle Schokolade. Ihr Strickzeug lag über der Lehne ihres Sessels. Zarte Kakteen säumten die Fensterbank. Im Fernsehen lief der norwegische Ceefax – Nachrichten als schmales Textband. Sie schaue gern Science-Fiction-Filme, etwa Star Trek, erzählte sie. Das war nicht die halb wilde Frau auf den Felsen, an die ich mich erinnerte. Hier hätte sie als gewöhnliche Großmutter durchgehen können. Ich traute mich nicht, sie zu fragen, aber sie musste um die siebzig sein.
Wir tauschten uns auf Englisch über unsere Familien aus. Dummerweise verstanden wir jeweils nur die Hälfte, und alle paar Sätze zuckten wir mit den Schultern oder lachten frustriert, und manchmal verstummten wir mit der Bemerkung, das sei jetzt zu kompliziert. Sie zeigte mir alte Fotos, eine einfachere Methode, wie sich herausstellte.
Die Wände ihres Wohnzimmers hatte sie in einen Schrein für die Inselbewohner verwandelt. Sie zeigte mir ihren Vater, dessen Brüder, Schwestern und ihre Großeltern, mehrere Generationen der Familie Måsøy, die auf formellen Porträts ihren hart erarbeiteten Wohlstand präsentierten. Stolz dreinschauende Männer, die ein gestärktes Hemd mit steifem Kragen, eine schwarze Wollweste und einen Anzug trugen. Die Frauen wirkten streng oder schienen sich in ihrer Sonntagskleidung nicht ganz wohlzufühlen: weiße oder cremefarbige, knöchellange Kleider, hochgestecktes Haar. Man trug kostbare Broschen und Ketten zur Schau. Diese Aufnahmen waren gemacht worden, um in einem Goldrahmen an der Wand zu hängen. Die Frauen hatten kräftige Schultern, lederige Wangen und windzerzaustes, flachsblondes Haar. Die Männer hatten ihre Haare mit Fett gescheitelt, die obere Hälfte der Stirn, wo der Fischerhut gesessen hatte, war bleich. Die Außenaufnahmen zeigten Holzhäuser, die sich an wilde, graue Felsen klammerten, und von silberigem Treibgut übersäte Küstenstreifen. Diese Leute glichen meinen Vorfahren – es waren Menschen, die ihr Leben lang mit den Händen gearbeitet hatten und bei jedem Wetter im Freien gewesen waren. Tatsächlich glichen sie uns aufs Haar. Nur dass meine Vorfahren das Meer weder gesehen noch davon erzählt hatten: Sie waren Bauern. Ich spürte Annas Stolz auf die archaische Welt ihrer Familie. Sie wiederum spürte vielleicht, dass ich einen ähnlichen Stolz in mir trug.
~
An dem Abend hörte Anna nicht auf zu erzählen. Einiges drehte sich um den kleinen Hof auf Vega, wo sie nun lebte, anderes um weit draußen gelegene Inseln mit sonderbaren Namen. Teils sprudelte eine komplette Geschichte aus ihr heraus, teils erzählte sie bedächtig. Manche handelten von Enten, manche vom Leben auf der Insel, in anderen ging es um den Handel. Manche hatten sich im frühen neunzehnten Jahrhundert zugetragen, andere vor einer Woche, als täte der Lauf der Zeit nichts zur Sache. Es war ein verwirrendes Gespinst, doch Anna kannte wie eine Weberin den Platz jedes Fadens. Ihr stand das herrlich gewebte Tuch vor Augen, mir nicht. Sie wollte mir begreiflich machen, dass ihre Vorfahren dem Gewebe dieses Ortes eingewirkt waren. Sie entstammte einer Familie von »Eiderdaunen-Königen«, Menschen, die ein seltenes Produkt ernteten und verkauften – die Federn der Eiderente. Ihre Vorfahren hatten die Eiderdaunen von der Nordwestküste Europas in die Welt gebracht.
Anna wollte nicht akzeptieren, dass diese Vergangenheit ein abgeschlossenes Kapitel war, das spürte ich. Sie hatte die Geschichten ihrer Vorfahren verinnerlicht wie die antiken Griechen, lange bevor manches schriftlich festgehalten und einem Dichter namens Homer zugeschrieben wurde. Ihr Stolz beruhte in erster Linie auf der Leistung ihrer Familie, die sich von relativer Armut zu relativem Reichtum, von besitzlosen Arbeitern zu Personen von Rang hochgearbeitet hatte. All das, weil sie das Meer rund um ihre Inseln zu nutzen gewusst hatten und Wege fanden, zu ernten und zu verkaufen, was der Ort hervorbrachte.
Während sie erzählte, zeigte sie auf die alten Fotos an den Wänden. Sie wirkte wie eine Königin – nicht wegen ihrer Kleider oder ihres Besitzes, sondern wegen ihrer unbezähmbaren Augen. Annas Leben war eine einzige Rebellion gegen alles Moderne gewesen. Ihr Glaube, dass alles, was sie schilderte, bis heute von Bedeutung sei, schien unerschütterlich zu sein – eine Gabe Gottes.
~
Sie war der Nachkömmling einer langen Reihe von Fischern: Menschen, die halb auf dem Land und halb auf dem Ozean gelebt hatten. Die norwegische Bezeichnung des flachen Küstensockels, der sich von den Bergen aus nahezu fünfzig Kilometer weit ins Meer erstreckt, lautet strandflat. Im Vega-Archipel ragt der von den gewaltigen Eiszeitgletschern abgeschliffene und zerfurchte Meeresboden in Gestalt Tausender Inseln und Felseilande aus den Wellen. Zwischen diesen Inseln, teils größer, teils winzig, ist das Wasser stellenweise so flach, dass es von den Einheimischen stovelhav genannt wird – »Stiefelmeer«. Bei Ebbe, so sagt man, könne man dort trockenen Fußes herumspazieren.
Wie vor Zeiten jedes Wikingerkind wusste, war die Küste aus dem Körper eines toten Riesen geformt worden. Die Berge waren seine Knochen. Die Erde war sein Fleisch. Seine Haare bedeckten die tiefer gelegenen Berghänge mit Grün. Der Ozean bestand aus seinem Blut und Schweiß. Seine Zähne wurden zu Inseln, Riffen und Felseilanden. Ohne diesen Riesen wäre die Geschichte von Annas Familie in jeder Hinsicht undenkbar. Sie lebte in der aus ihm entstandenen, von ihm hinterlassenen Meereslandschaft.
Nach dem Abschmelzen des Eises hatten die Menschen Mittel und Wege gefunden, hier zu überleben – durch eine inzwischen Jahrtausende alte Kombination von küstennahem Ackerbau, Jagen und Sammeln. In guten Jahren brachten ihre steinigen Äcker hervor, was sie brauchten; Kartoffeln, Roggen, Dinkelweizen oder Hafer. Sie hielten auch Vieh. In der Scheune wurde ein Schwein gemästet. Man hatte einige Schafe. Eine kleine, struppige Kuh wurde mit Heu durch den Winter gebracht.
Doch während zahlloser unbarmherziger Jahrhunderte quollen die Bäuche der Menschen immer wieder vor Hunger auf, wenn der Weizen schwärzlich verfaulte oder die Schweine erkrankten. Tief im Binnenland verhungerte man oder musste auswandern. Lebte man dagegen in Küstennähe, konnte man fischen oder sammeln, was die Felsen oder das flache Wasser boten.
Mit der Zeit mauserten sich die überlebenden Küstenbewohner zu geschickten Fischern, die weit hinausfahren konnten, bis dorthin, wo das Meer von Fischen wimmelte. Der riesige Heilbutt. Der mächtige Dorsch. Gewaltige Heringsschwärme. Und zahllose andere essbare Geschöpfe, von Seehunden bis zu Walen. Obendrein gab es Seevögel, deren Fleisch und Eier essbar waren und deren Federn Wärme spendeten.
Verstand man, sich bei jedem Wetter an dieser Küste zu bewegen, vom Meer und von steinigen Äckern zu leben, dann hinderte einen nichts daran, in alle Nordmeere auszuschwärmen. Und genau das taten diese Menschen.
In der Geschichtsschreibung, die der Feder christlicher Priester, ihrer schwer geprüften Opfer, entsprang, wurden die Menschen, die von dieser Küste aufbrachen – um auf Erkundungsfahrt zu gehen, Handel zu treiben, zu plündern, zu kämpfen oder zu rauben –, als Wikinger bezeichnet. Einer der Orte, zu denen sie aufbrachen, ist meine Heimat.
~
Ich weiß noch, wie ein Lehrer an meiner Schule erzählte, in Norwegen verstehe man unseren Dialekt am besten. Damals hielt ich das für Unsinn, doch er hatte recht. Wir waren vom gleichen Schlag, getrennt durch das Meer und gut tausend Jahre Geschichte. Vieles von dem, was Anna in ihrer Muttersprache erzählte, verstand ich auf Anhieb. Die Vielzahl gemeinsamer Wörter war erstaunlich. Wörter skandinavischen Ursprungs wie:
Beck. Fell. Thwaite. Lowp. Sieves. Laik. Yam. Scribble.
Bach. Hügel. Rodung. Sprung. Sieb. Spiel. Klumpen. Kritzelei.
Ich zeigte Anna meine Ausgabe der Isländersagas, Geschichten, die Wikinger über berühmte Krieger ihrer Zeit erzählt hatten. Sie nickte. Die Sagas berichten, dass man Eiderdaunen als Tribut oder Pacht von daheimgebliebenen Fischer-Bauern verlangte – Annas Vorfahren. Die Federn gelangten auf den damaligen Handelsrouten in die Welt hinaus. Schon in der Eisenzeit wurden Könige, Königinnen und Krieger mit Daunendecken bestattet – manche aus Eiderdaunen, andere aus den Daunen heiliger Vögel –, damit es die Toten auf ihrer Reise in die jenseitige Welt bequemer hatten.
~
Die Lebensweise an der Küste überstand das Verschwinden der Wikinger. Ähnliche Kulturen fanden sich überall im Baltikum, an der Nordküste Russlands, auf Island und Grönland, entwickelten sich auch in den nördlichen Regionen Kanadas und der USA. Annas Vorfahren lebten am Nordrand Europas, auf winzigen Inseln, hinter denen der tiefe Ozean begann.
Je weiter vom Festland entfernt und je felsiger die Inseln, desto ärmer die Menschen – doch sowohl Annas Vorfahren als auch andere Familien hatten Mittel und Wege gefunden, um zu prosperieren. Sie wussten sich den Reichtum des Meeres und der Küste zunutze zu machen, indem sie fischten, Seehunde jagten, die Eier von Seevögeln sammelten und jedes Frühjahr Hunderte Nester für Eiderenten anlegten. Nester, in denen sich die kostbaren, weltweit nachgefragten Daunen sammelten. Annas Familie hatte die Enten über Generationen vor Raubtieren beschützt, die Jagd auf sie machten, und nachdem die flüggen Jungvögel mit ihren Müttern aufs Meer zurückgekehrt waren, ernteten sie die Daunen, die sich in den verdreckten Nestern fanden. Nach jahrhundertelanger Mühsal waren sie um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zu einem gewissen Wohlstand gelangt und hatten einen merklichen Stolz entwickelt.
~
An jenem Abend ging ich aufgeregt zu Bett. Diese ruhmreiche, gut tausendjährige Geschichte, ein ganzer Korpus von Kenntnissen und Fertigkeiten, hatte dank einer Handvoll dickschädeliger alter Menschen auf einer Handvoll felsiger Eilande überlebt. Ich konnte es kaum erwarten, hinauszufahren und die Arbeit kennenzulernen. In Annas Gästezimmer unter einer Daunendecke liegend, versank ich in einen tiefen Schlaf.
~
Am nächsten Morgen ging es zum Hafen. Hinter einem Spalier roter Bootsschuppen erwartete uns eine Frau auf dem Kiesweg. Sie begrüßte mich förmlich, erklärte, eine Freundin Annas zu sein, und entschuldigte sich für ihr mangelhaftes Englisch. Sie schien zu befürchten, nicht als Dolmetscherin zu taugen. Anna bemerkte die Verwirrung, die die Frau bei mir auslöste. Ingrid werde uns auf die Insel begleiten, sagte sie. Beiden Frauen stand das Unbehagen ins Gesicht geschrieben.
Ein dumpfes Plumpsen. Ein Mann hob Taschen von der Ladefläche eines Pick-ups. Er kam auf uns zu und musterte mich skeptisch. Ingrid sagte: »Das ist mein Mann, Stig. Er sagt Hallo.« Ich wusste nicht, ob er tatsächlich Hallo gesagt hatte, erwiderte aber den Gruß. Ingrid fragte: »Haben Sie zu Hause Frau und Kinder?« Ich erklärte, glücklich verheiratet und Vater von vier Kindern zu sein. Ich zeigte ihr ein Foto auf meinem Handy.
Ingrid wirkte beruhigt und sagte etwas zu ihrem Mann. Er blieb brummig, nickte aber und fuhr weg.
~
Ingrid war kräftiger und stabiler gebaut als Anna, sie trug eine Brille, ihre Haare ließen an Stroh denken. Ich schätzte sie auf Ende sechzig. An Anna gewandt, zählte sie auf, was ihr in letzter Sekunde eingefallen und in Plastiktüten aus dem Supermarkt gepackt worden war. Anna war abgelenkt, sie hantierte mit dem Vorhängeschloss eines der Schuppen. Es war der uralte brygge ihrer Familie, die »Meerscheune«.
Augenblicke später flutete Licht die Scheune. Anna hatte die Türen am hinteren Ende aufgeschoben, was einen Blick auf den Hafen und die Landzunge dahinter eröffnete. Ich betrat einen auf Pfählen ruhenden und hoch über dem Wasser liegenden Plankenboden. Ingrid schleppte ihre Sachen hinein, und ich beeilte mich, ihr zu helfen. Auf einer Seite der Scheune lag ein altes, hölzernes Ruderboot, an den Wänden hingen Utensilien für die Fischerei. Leinen, Angelschnüre und Netze waren sorgsam über ein Holzgestell gehängt worden. Es gab handgeschnitzte Kellen, die dazu dienten, Wasser aus Booten zu schöpfen. Blaue und rote Schwimmwesten. Und in Kisten und Taschen stand alles, was Anna für den Aufenthalt auf der Insel benötigte, zum Einladen bereit. Sie hatte die Sachen am Tag vor meiner Ankunft mit ihrem alten roten Kleinwagen von ihrem etwa einen Kilometer entfernten Zuhause hierhertransportiert.
Die Meerscheune ähnelte dem Schrank der Narnia-Romane – man musste sie durchschreiten, um auf die dahinter liegenden magischen Inseln zu gelangen. Auf der Vorderseite hing ein altes geschnitztes Holzbrett, das Annas Familiennamen in roter Schrift auf weißem Grund zeigte: »MÅSØYBRYGGE«. Weitere Meerscheunen, teils zu Ferienhäusern umgebaut, verteilten sich über den Hafen. Früher, erzählte Anna, besaßen alle Fischer-Bauern eine solche Scheune, um von dieser in See zu stechen oder zu den Inseln aufzubrechen. Der Hafen war Dreh- und Angelpunkt einer geschäftigen Gemeinschaft gewesen. Das war Geschichte. Auf den Kais herrschte Stille, man hörte nur rostige Ketten gegen Bojen klirren. Aktive Fischerboote gab es nur auf alten Fotos. Man hätte meinen können, in einem Museum oder einem Dorf voller Alterswohnsitze zu stehen. Vor Kälte zitternd, sah ich mich um. Die höheren Lagen der Berge, jenseits des Ortes, waren noch schneebedeckt. Auf einer Kuppe stand ein Sendemast. Auf den Äckern war der Schnee geschmolzen, doch das Vieh fraß sicher noch Heu aus Futterspendern. Auf der Landzunge war das gelbliche Gras verfilzt und abgestorben. Grün waren nur die Fichtenwälder außerhalb des Ortes und die Wacholderdickichte auf den zerklüfteten Hügeln. Vereinzelte Birken und Ebereschen glänzten wie Fischskelette in der Sonne. Es war Ende April, und der Hafen hing zwischen zwei Jahreszeiten in der Schwebe – wenn die Sonne herauskam, schien sich der Frühling zaghaft zu regen, aber wenn sie hinter den Wolken verschwand, war der Wind so eiskalt, als wollte der Winter noch einmal anbrechen.
~
Ein weißes Motorboot tuckerte zwischen den Meerscheunen im glasigen Wasser auf uns zu. Am Ruder stand ein gebräunter Mann mit schütterem Haar und Holzfällerhemd. Er grüßte mit einem knappen Nicken. Sein Name lautete Henrik, und er würde uns zur Insel bringen. Er schien Anna zu grollen und diskutierte mit ihr vehement über die Menge ihres Gepäcks. Er sagte auf Englisch, sie sei zu alt für solche Späße. Anna entgegnete, ich sei kräftig und würde mithelfen. Sie scheuchte ihn auf sein Boot, mich schickte sie auf die Treppe unter dem Anleger. Ingrid reichte mir die Kisten. Bei den schwereren bedachte mich Henrik mit einem Blick, der wohl besagen sollte: Mein Boot ist mir lieb und teuer, also bitte Vorsicht, mein Freund, ja keine Schrammen. Von den Balken des Anlegers hing grüner, schleimiger Seetang. Anna zerrte große Kisten über die Holzplanken, begann aber bald zu keuchen. Ich erkundigte mich leise bei Ingrid, ob Anna wohlauf sei, was sie halbherzig bejahte.
Wir gingen an Bord, doch Anna war nicht mehr zu sehen. Minuten später kam sie in einem gelben Boot angerudert. Sie lenkte es vorsichtig hinter Henriks Boot und vertäute es dort. Im Ruderboot sitzend, wirkte sie beruhigend jung, aber von Nahem sah man, dass der verblassende rosa Lippenstift das Einzige war, was ihrem Gesicht ein wenig Farbe verlieh. Als ich ihr auf Henriks Boot half, merkte ich erschrocken, wie dünn ihr Arm war – ich schien einen Reiher zu halten, der sich unter dem Gefieder als klein und zerbrechlich erwies. Offenbar sah sie mir die Besorgnis an, denn sie verschloss mir durch einen strengen Blick den Mund.
~
Henrik schien das Unterfangen nicht gutzuheißen. Man hatte ihm zugetragen, Anna leide an Bluthochdruck. Vor einer Woche, berichtete er, habe er eine Frau zu einer nahen Insel gebracht, dort seien die Felsen noch eisbedeckt gewesen. Er schüttelte den Kopf. Anna starrte missmutig in die Ferne.
Ihre Laune wurde nicht besser, als wir auf der anderen Seite des Hafens stoppten, um einen weiteren Passagier an Bord zu nehmen, einen grauhaarigen Mann mit gepflegtem Bart, Sonnenbrille und blauem Wollpullover, so braun gebrannt, als wäre er kürzlich im Süden gewesen. Er wirkte topfit, sah aus wie ein Geschäftsmann nach einem Yacht-Urlaub. Ich wollte beim Einladen seines Gepäcks und einiger Brennstoffkanister helfen, doch Anna drückte mich lächelnd zurück auf den Sitz. Dieser Passagier gehörte nicht zu uns, egal, wer er war. Er versuchte, ein Gespräch mit mir anzuknüpfen, doch ich wollte Annas Vertrauen gewinnen und ahnte, dass es nicht hilfreich wäre, mit ihm zu reden. Also blieb ich einsilbig und verstummte schließlich ganz.
Das Beziehungsgeflecht zu durchschauen, war nicht gerade ein Kinderspiel. Noch am Morgen hatte ich nicht geahnt, dass wir auf Annas Insel zu dritt wären: Sie, Ingrid und ich. Schwer zu sagen, ob Ingrid sowieso mitgekommen wäre oder ob sie ihre Freundin meinetwegen begleitete. Sie bewunderte Anna, so viel war klar. Sie blieb höflich, aber ich spürte, dass sie meine Anwesenheit für keine gute Idee hielt.
~
Wir ließen Vega langsam hinter uns, passierten Fischerhütten und die Holzkerne halb fertiggestellter Sommerhäuser. Ich erkannte Landmarken wieder, auf die ich während meines ersten Besuchs aufmerksam gemacht worden war: das neue Museum mit dem dreiecksförmigen, modernistischen Dach, die neue Mole aus Stahl und Beton, an der Yachten anlegen sollten, dahinter die inzwischen stillgelegte Fabrik für Fischverarbeitung.
Ein neues Norwegen erstand aus den Knochen der alten Welt, die Anna am Abend zuvor geschildert hatte. Früher war der Hafen ein brummendes Servicezentrum für das Inseluniversum gewesen, aber beim Hinausfahren sah ich keinen einzigen Menschen – nur ein Auto, das in der Ferne auf einer Schotterpiste den Berg hinunterfuhr.
Mein Zuhause war in unermessliche Ferne gerückt. Der gewaltige Himmel, die Küstenlinie und der Ozean ließen das Boot nach kurzer Zeit winzig erscheinen. Wir fuhren auf die kalte, graue See hinaus, die offenen Arme des natürlichen Hafens blieben hinter uns zurück, vor uns gab es nur Wasser, Wolken und Licht. In einem Felsenteich verharrte ein Reiher mitten im Schnabelhieb, im Sonnenlicht wirkte er wie versteinert.
~
Nach kurzer Zeit veränderte sich das Meer, es wurde dunkler und stürmischer. Dichte Wolken erstickten das Licht, sie schienen Regen anzukündigen. Dann klarte es auf, und die weiterziehenden Wolken enthüllten hier und da einen eierschalenblauen Himmel. Die verchromten Handläufe des Bootes glitzerten silberig in der Sonne. Küstenseeschwalben sausten über den Wellen auf und ab, leuchtend weiße Flecke.
Die verkrampfte Stille löste sich allmählich. Anna spielte mit einem Ring an ihrer Hand, schob ihn über dem Fingerknöchel hin und her. Auf meine Frage, woran sie denke, antwortete sie, sie überlege, ob es zu Hause genug Katzenfutter gebe und ob ihr Sohn Isak beherzige, die Kakteen nicht in Wasser zu ertränken. Ingrid erkundigte sich nach ihrem Tablettenvorrat. Anna drehte sich schulterzuckend zur Ausrüstung um, die wir an Deck aufgetürmt hatten. Bündelweise Birkenscheite aus der Trockenkammer. Ein Propangaskanister für den Kochherd. Bananenkartons voller Tüten mit Lebensmitteln, Kondensmilch und Joghurt, Räucherlachs und etwas Obst. Kleidung in prallvollen Einkaufstaschen mit verschnürten Griffen. Ein halbes Dutzend weißer Kanister, in denen Wasser schwappte und gluckste. Eine Packung Toilettenpapier, vierundzwanzig Rollen. Eine blaue Kühlbox voller klirrender Flaschen. Wathosen in Plastikbeuteln aus dem Spar, gebündelte Rettungswesten. Ingrids Rucksack und Reisetasche. Zwei Fünfliterkanister mit Farbe. Ein Pappkarton voller Gläser mit Marmelade, Gurken und Chutneys, alle handbeschriftet. Ein Plastikfässchen mit Feuerzeugbenzin. In einer Ecke lehnte ein sorgfältig abgestelltes Gewehr, Kaliber .22LR, das in eine schwarze Mülltüte gewickelt war. Im Schlepptau folgte uns das gelbe, zur Hälfte mit kaputten Paletten beladene Ruderboot. Die Bretter würden der Reparatur der im arktischen Winter beschädigten Nistkästen dienen, erklärten die Frauen.
Den Holzhaufen betrachtend, ging mir auf, dass ich mich diesem Unternehmen im gleichen Maße verpflichtet hatte wie die beiden Frauen. Die Insel war eine gute Stunde entfernt und konnte bei schlechtem Wetter leicht abgeschnitten werden, deshalb brauchten wir genügend Vorräte. Ich wäre bis in den Juli mit diesen zwei Fremden zusammen. Mir wurde mulmig zumute.
Bis vor nicht allzu langer Zeit, hatte Anna erzählt, waren die Hege der Enten und das Ernten der Daunen ein Nebenerwerb von Frauen und Männern gewesen, die ganzjährig auf den Eilanden gelebt hatten. Gröbere Arbeiten wie das Trocknen des Seetangs wurden meist von Männern verrichtet, aber die Frauen – jede die Ehefrau eines Fischers – hatten alles andere erledigt. Es hatte eine dauerhafte Gemeinschaft gegeben, deren Angehörige sich notfalls gegenseitig unterstützt hatten. Nun war sie aufgelöst. Die Frauen glichen Zugvögeln – sie überwinterten anderswo und kehrten jedes Frühjahr möglichst zeitig zurück, um die Nester herzurichten, wenn auch nicht zu zeitig, denn niemand wollte von einem neuerlichen Kälteeinbruch überrascht werden. Die Wahl des passenden Zeitpunkts beruhte auf Erfahrung und war zugleich ein Vabanquespiel. Sollte es noch mal schneien, was nicht undenkbar war, dann könnten wir nicht mehr draußen arbeiten, sondern nur noch stricken und bibbern. Und sollte sich das Wetter massiv verschlechtern, dann säßen wir auf der Insel fest und hätten nur noch uns.
Um mich abzulenken, holte ich Stift und Papier aus dem Rucksack und fragte Ingrid nach den Namen der kleinen Inseln am Horizont. Ich versuchte, sie zu notieren. »Island-Insel«, »England-Insel«. Es entspann sich eine Diskussion über die Herkunft der Namen, doch am Ende blieb unklar, ob die Inseln als Orientierungspunkte für Seereisen zu den fernen Ländern gedient hatten, die sie im Namen trugen, oder ob Bewohner der Inseln als Strafe für ein Verbrechen dorthin verbannt worden waren.
~
Wolken jagten einander über den Himmel. Ingrid fragte Anna, ob es ihr gut gehe, und erhielt ein Nicken als Antwort. Ich musste oft an ihren spindeldürren Arm denken.
Anna hatte am Vorabend erzählt, ihre Großmutter, Dagmar, habe bis ins hohe Alter auf der Insel gelebt und sich um die Enten gekümmert. Fast klang es, als wollte sie Überzeugungsarbeit leisten. Sie erinnerte mich an meinen Großvater, der in einer sich wandelnden Welt stur an den althergebrachten landwirtschaftlichen Arbeitsweisen festgehalten hatte. Anfangs wirkte das heldenhaft, dann traurig und schließlich, als seine Kräfte erlahmten, beinahe bemitleidenswert. Er verstand nicht, das Alter zu akzeptieren, und konnte nicht loslassen. Ob es Anna ähnlich erging?
Ihr eigener Urgroßvater, so ihre Erzählung, hatte hochwertige, handgesäuberte Eiderdaunen bis ins ferne Trondheim verkauft. Er hatte alles per Post von der Hauptinsel versandt. Im Alter, so hieß es, hatte er sieben Kilo Eiderdaunen nach Vega gebracht. Ein kräftiger Mann hätte das Gewicht problemlos tragen können, aber die mit Daunen gefüllten Taschen waren klobige Windfänger. Er schleppte die schwere Last gegen den Wind quer über die Insel und war am Ende wie gerädert. Nachdem er im Postamt das Porto bezahlt hatte, bat er höflich um ein Glas Wasser und einen Hocker, dann fiel er tot um.
~
Henrik gab Gas. Das Meer wurde rauer. Die Möwen glitten im Wind auf und nieder wie weiße Plastiktüten. Vega blieb hinter uns zurück und wurde immer kleiner. Wir fuhren durch grauen Regen. Henrik unterhielt sich über die Schulter mit dem anderen, hinter ihm stehenden Passagier.
Anna blieb stumm. Sie stand gelassen da, den Blick auf die Inseln geheftet. Sie lauschte dem Gespräch der Männer mit halbem Ohr. Stimmte sie dem, was gesagt wurde, nicht zu, dann brachten Mimik oder Körpersprache ihre Missbilligung zum Ausdruck. Ich konnte Henrik ansehen, wie genervt er war. Trotzdem betrachtete ich sie wie gebannt.
Ein Sportangelboot fuhr zwischen zwei fernen Inseln hindurch. »Touristen«, sagte Anna still. Und fuhr in gebrochenem Englisch fort: »Sie fangen zu viele Fische. Die paar Dorsche, die es noch gibt, werden von solchen Leuten erbeutet. Früher gab es hier reiche Fischgründe, heute ist nichts mehr zu holen.« Henrik, der dies mitbekam, entgegnete, das sei »Schwachsinn«.
Die Riesenschiffe auf hoher See, sagte er, würden die Fischgründe plündern, und selbst einheimische Fischer hätten weit mehr Fische gefangen als seine Gäste mit ihren Ruten. Der andere Passagier befummelte nervös seine Uhr. Anna winkte ab, als hätte Henrik wenigstens teilweise recht oder als hätte sie keine Lust auf eine Diskussion. Alle verstummten wieder.
Anna sprach halblaut mit mir. Es schien sie zu ärgern, dass die Angler ein Anrecht auf die Fische zu haben glaubten, aber nicht wussten, wie viele sie entnehmen durften. Die neuen Technologien konnten helfen, durch das Labyrinth der Felsen zu navigieren, aber sie konnten auch eingesetzt werden, um Fische exakt zu orten. Es war viel zu einfach geworden. Ob Touristen oder Industriefischerei, alle beuteten das Meer aus.
~
Für die Insulaner glich das Fischen dem Atmen. Aus dem hiesigen Leben war es nicht wegzudenken. In Annas Geschichten vermischten sich das Fischen und das Sammeln der Eiderdaunen, das eine war ohne das andere nicht zu verstehen.
Im Gegensatz zu anderen Einheimischen, hatte sie erzählt, waren ihre Vorfahren nicht zu den weiter nördlich gelegenen Lofoten aufgebrochen, um sich dort den Besatzungen der großen Schiffe anzuschließen. Stattdessen hatten sie bis hin zu ihrem Vater in den heimischen Gewässern eine bescheidene Fischerei betrieben, um ihre Familien ernähren zu können, und den Überschuss ihrer Fänge in den Handelsposten auf Vega verkauft. Ich fragte mich, ob sie es schlicht nicht nötig gehabt hatten fortzugehen, immerhin waren sie durch die Eiderdaunen zu Wohlstand gelangt.
Die Bevölkerungsexplosion im Europa des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts hatte eine tiefgreifende Veränderung der Lebensweise zur Folge. Die neue, hungrige Welt wollte ernährt werden, und Fisch wurde zu einer extrem wertvollen Ware. Annas Ururgroßvater und dessen Söhne wussten das zu nutzen. Die weit draußen im Meer lebenden Insulaner waren im Vorteil gegenüber ihren Rivalen, sowohl jenen vom Festland als auch jenen von den größeren, küstennahen Inseln: Es waren die Zeiten von Wind und Segel, und Annas Vorfahren erreichten die Fischgründe Stunden früher als alle anderen und konnten sich obendrein rascher in Sicherheit bringen, wenn das Wetter umschlug.