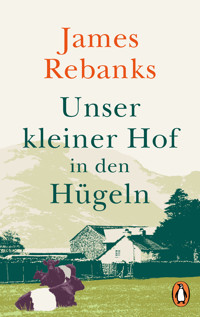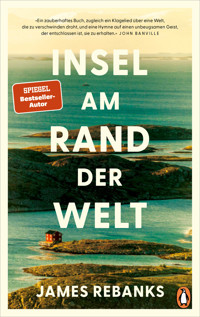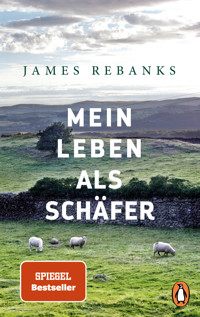
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Die Naturbuch-Sensation des Jahres. Unsentimental und doch kraftvoll . . . Ein Gegenmittel gegen unseren modernen Großstadtzynismus und ein zutiefst moralisches Buch.« The Times
Allein mit sich und der Natur, im Takt der Jahreszeiten und der Arbeiten, die sie mit sich bringen – das Leben der Schäfer verläuft heute noch wie vor Hunderten von Jahren. Im Sommer werden die Schafe in die Berge getrieben, im Herbst die Herden vergrößert, im Winter die Tiere vor der Kälte geschützt, ehe im Frühling die Lämmer zur Welt kommen und der Kreislauf von Neuem beginnt.
James Rebanks, der einer traditionellen englischen Schäferfamilie entstammt, bietet in seinem Buch einen einzigartigen Einblick in das ländliche Leben. Er erzählt von einer tiefen Verbundenheit zu seiner Heimat und von Menschen mit großer Bodenständigkeit, obwohl sich die Welt um sie herum vollständig verändert hat.
»Ein kluges Buch über Heimat und ein Leben in den Zyklen der Natur.« Berliner Zeitung
»Rebanks erzählt von der Hoffnung, die im Miteinander liegt, vom Halt, den Familie bietet – und vom Vertrauen auf eine natürliche Ordnung der Dinge. Er schreibt unsentimental, voller Gefühl und ohne Nostalgie.« ARD ttt
»Das ist verdammt großartig.« Helen MacDonald, Autorin von »H wie Habicht«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Der Autor:
James Rebanks ist der Herdwick-Schäfer, dem Zehntausende auf Twitter folgen, wenn er sein Schäferleben schildert (@herdyshepherd1). Seine Familie bewirtschaftet seit über sechshundert Jahren denselben Fleck Erde.
Das Buch:
Manche Menschen gestalten ihr Leben ganz nach ihren eigenen Wünschen. Nicht so James Rebanks. Er ist der älteste Sohn eines Schäfers, der selbst wiederum der älteste Sohn eines Schäfers ist. James Rebanks und seine Familie leben und arbeiten seit Generationen im nordenglischen Lake District, einer Gebirgs- und Seenlandschaft von außerordentlichen Schönheit, durch und durch geprägt von der Schafhaltung. Das Leben der Schäfer verläuft heute wie vor Jahrhunderten im Takt der Jahreszeiten und der Arbeiten, die sie mit sich bringen. Ein Wikinger würde die Abläufe immer noch verstehen: Die Schafe werden über den Sommer auf die Berge getrieben, dann wird im Tal Heu gemacht. Auf den herbstlichen Schafauktionen werden die Herden verjüngt. Dann müssen die Schafe heil über den Winter gebracht werden, was zermürbende Anstrengungen kostet. Der Frühling vergeht in einem schwindelerregenden Taumel, wenn die Lämmer geboren und die Schafe für die Rückkehr in die Berge vorbereitet werden.
In diesen Nachrichten aus einer uralten Landschaft erzählt ein moderner Schäfer von einer tief wurzelnden Bodenständigkeit, von einer Lebensweise, die wenig von sich reden macht und die Geschichte dennoch grundlegend beeinflusst hat. In atmosphärischer, klarer Prosa nimmt uns James Rebank mit durch das Schäferjahr; in einzigartigen Szenen schildert er das bäuerliche Leben und die existenzielle Verbundenheit mit dem Land, die die meisten von uns verloren haben. Er berichtet vom harten Arbeitsleben, von den Menschen in seiner Umgebung, von seiner Kindheit, von seinen Eltern und Großeltern, von einem Menschenschlag, der das traditionsreiche Leben weiterführt, auch wenn die Welt ringsum sich ändert. Viele Geschichten handeln von Menschen, die sich verzweifelt bemühen, den Verhältnissen, aus denen sie stammen, zu entfliehen. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der alles daransetzt, dort, wo er herkommt, bleiben zu können.
James Rebanks
Mein Leben als Schäfer
Deutsch von Maria Andreas
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
»The Shepherd’s Life. A Tale of the Lake District«
im Verlag Allen Lane (Penguin Random House UK), London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text
enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der
Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten.
Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss.
Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Verlagsgruppe Random House FSC®N001967
1. Auflage
Copyright © 2015 James Rebanks
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: buxdesign, München
Satz: Max Widmaier
ISBN 978-3-641-18323-3V001
www.cbertelsmann.de
Gewidmet dem Andenken meines Großvaters, W. H. Rebanks,
und meinem Vater, T. W. Rebanks, in tiefem Respekt
Zum oberen Ende dieser Täler hin trafen wir auf eine vorbildliche Republik von Schäfern und Landwirten. Jedem dieser Männer diente der Pflug nur dem Erhalt der eigenen Familie, gelegentlich half man auch dem Nachbarn aus. Mit zwei, drei Kühen deckte jede Familie ihren Bedarf an Milch und Käse. Das einzige Bauwerk, das sich über die Wohnstätten erhob, war das Gotteshaus als Haupt dieses wahren Commonwealth. Seine Mitglieder existierten inmitten eines mächtigen Reichs als Idealgesellschaft oder wohlgeordnete Gemeinschaft, deren Verfassung von den schützenden Bergen selbst gegeben und geregelt war. Hier gab es weder hochwohlgeborene Aristokraten noch Ritter oder Junker; doch viele dieser bescheidenen Söhne der Berge lebten in der Gewissheit, dass der Boden, den sie beschritten und bestellten, seit mehr als fünfhundert Jahren im Besitz von Männern ihres Namens war, im Blut mit ihnen verwandt …
William Wordsworth, A Guide Through the District of the Lakes inthe North of England, 1810
Inhalt
Dem Land verhaftet – traditionelle Bergschäferei auf den Fells
Sommer
Herbst
Winter
Frühling
Dank
Dem Land verhaftet –
traditionelle Bergschäferei auf den Fells
Die Hügel und Berge im Lake District, einer überwältigend schönen, von vielen Seen durchzogenen Gebirgslandschaft im Nordwesten Englands, werden von den Einheimischen Fells genannt. Ähnliche Landschaften heißen im Norwegischen Fjells, im Schwedischen Fjälls.
Werden Schafe erstmals in ihrem Leben zur Hochweide auf die Fells geführt, entwickeln die Tiere eine unauslöschliche Bindung an ihr Weidegebiet, das sie noch nach Jahren wiedererkennen. Für dieses Phänomen haben die Schäfer der Region ein eigenes Wort: Sie nennen solche Schafe hefted, »dem Land verhaftet«. Darin steckt die altnordische Wurzel hefð, »Tradition«.
~
Wir waren anders, von Grund auf anders, das wurde mir an einem verregneten Vormittag im Jahr 1987 bewusst. In der Gesamtschule unserer nächstgelegenen Kleinstadt, einem schäbigen Betonbau typisch Sechzigerjahre, hatten sich sämtliche Schüler in der Aula versammelt. Ich war ungefähr dreizehn, hockte inmitten all der anderen schulischen Leistungsverweigerer und ließ die Ansprache der kampfesmüden alten Lehrerin über mich ergehen. Es ging wieder einmal darum, dass wir uns doch höhere Berufsziele stecken sollten als nur Landarbeiter, Schreiner, Maurer, Elektriker oder Frisörin. Die Frau hatte uns diese Predigt schon unzählige Male gehalten, reine Zeitverschwendung, wie sie selbst wusste. Ebenso wie unsere Väter und Großväter, Mütter und Großmütter waren wir fest entschlossen, zu sein, was wir waren und immer schon gewesen sind. Viele von uns waren nicht auf den Kopf gefallen, dachten aber nicht im Traum daran, ihren Grips in der Schule vorzuführen. Das wäre uns nicht gut bekommen.
~
Zwischen dem Weltverständnis dieser Lehrerin und unserem eigenen klaffte ein Abgrund. Letztes Jahr hatten alle Schüler unseres Jahrgangs, denen eine Schulbildung nicht völlig egal war, aufs Gymnasium gewechselt. Übrig blieben nur die Loser, die nun die nächsten drei Jahre an einem Ort absitzen mussten, von dem sich alle nur wegwünschten. Das führte zu einer Situation ähnlich einem Guerillakrieg: Lehrer, die ihre Illusionen weitgehend verloren hatten, standen den angeödetsten, aggressivsten Jugendlichen gegenüber, die man sich nur vorstellen kann. Unsere ganze Klasse spielte gern ein »Spiel«, bei dem es darum ging, innerhalb einer Unterrichtsstunde schulische Ausstattung von größtmöglichem Wert zu schrotten und das Ganze als »Panne« zu verkaufen.
Bei solchen Aktionen war ich gut.
Der Boden war übersät mit kaputten Mikroskopen, Tierpräparaten, zersplitterten Stühlen und zerfetzten Büchern. Eine in Formaldehyd konservierte Froschleiche lag mit gespreizten Gliedern auf dem Boden wie ein Brustschwimmer. Die Gashähne brannten wie eine Bohrinsel, ein Fenster bekam einen Sprung. Die Lehrerin starrte uns nur noch an, in Tränen aufgelöst und völlig am Ende, während ein Techniker versuchte, die Ordnung wiederherzustellen. Eine Mathestunde gewann für mich erst an Reiz, als der Lehrer und ein Mitschüler mit Fäusten aufeinander losgingen. Der Junge rannte davon, die Treppe hinunter und über die schlammigen Sportplätze, der Lehrer immer hinterher, bis er den Jungen niederschlug, ehe er in die Stadt entwischen konnte. Wir klatschten, als hätten wir ein spannendes Rugby-Duell verfolgt. Von Zeit zu Zeit versuchte jemand – stets ein Stümper –, die Schule in Brand zu stecken. Ein Junge, den wir schikanierten, brachte sich ein paar Jahre später mit seinem Auto um. Es war, als steckten wir in einem Ken-Loach-Film fest: Niemand wäre überrascht gewesen, wenn ein magerer Junge mit einem Turmfalken aufgetaucht wäre.
Einmal hielt ich unserem verblüfften Direktor vor, die Schule sei in Wahrheit ein Gefängnis und ein »Übergriff auf meine Persönlichkeitsrechte«. Er sah mich befremdet an und fragte: »Aber was willst du denn zu Hause?«, als könne es darauf unmöglich eine Antwort geben. »Auf dem Hof arbeiten«, erwiderte ich genauso entgeistert – warum kapierte der Mann nicht, wie einfach die Sache war? Er zuckte resigniert mit den Schultern, meinte, ich solle mich nicht lächerlich machen, und ließ mich stehen. Wenn man etwas wirklich Gravierendes angestellt hatte, schickte er einen nach Hause. Deshalb überlegte ich, ob ich ihm nicht einen Ziegelstein durchs Fenster werfen sollte, traute mich dann aber doch nicht.
1987 hing ich also in dieser Schulversammlung meinen Tagträumen nach; ich starrte in den Regen hinaus und fragte mich, mit welchen Arbeiten die Männer auf unserem Hof gerade beschäftigt waren und welche ich davon wohl übernommen hätte. Irgendwie drang zu mir durch, dass von den Tälern des Lake District die Rede war, in denen mein Großvater und Vater ihre Höfe bewirtschafteten. Da schaltete ich auf Empfang. Aber schon nach ein paar Minuten Zuhören wurde mir klar, was diese Lehrkraft von uns hielt: Wir seien zu blöd und zu fantasielos, um »aus unserem Leben etwas zu machen«. Wir müssten über uns selbst hinauswachsen, wetterte sie. Wir seien zu beschränkt, um auch nur den Wunsch zu verspüren, diese Gegend zu verlassen, eine Gegend, in der es nur provinzielle Engstirnigkeit gebe und schmutzige Arbeit, die zu nichts führe. Hier hätten wir keine Zukunft, wir sollten endlich die Augen aufmachen und das einsehen. Aus ihrer Sicht war jeder, der so früh wie möglich von der Schule abgehen und mit Schafen arbeiten wollte, geistig mehr oder weniger minderbemittelt.
Dass wir, unsere Väter und unsere Mütter stolze, hart arbeitende und intelligente Menschen sein könnten, die Nützliches, vielleicht sogar Bewundernswertes leisteten, überstieg den geistigen Horizont dieser Frau. Erfolg definierte sich für sie über Bildung, Ehrgeiz, Unternehmungsgeist und eine glanzvolle Karriere, doch damit konnten wir nicht punkten. Ich glaube nicht, dass an dieser Schule jemals das Wort »Universität« fiel. Dort hätte auch keiner von uns hingewollt. Denn wer wegging, gehörte nicht mehr dazu. Er veränderte sich, und damit gab es für ihn kein Zurück mehr, was wir instinktiv spürten. Bildung war ein »Ausweg«, ein Weg in die Welt hinaus, aber dorthin wollten wir gar nicht, wir hatten unsere Wahl längst getroffen. Später begriff ich, dass man in modernen Industriegesellschaften geradezu besessen davon ist, »weiterzukommen« und »etwas aus seinem Leben zu machen«. Darin drückt sich eine Abwertung aus, die ich unerträglich finde: Wer bleibt, wo er ist, und körperlich arbeitet, gilt nicht viel.
Ich hörte der Lehrerin zu und ärgerte mich immer mehr, als sich herausstellte, dass sie unsere Gegend kannte und seltsamerweise auch noch zu lieben vorgab. Aber sie redete und dachte in Begriffen, die meiner Familie und mir völlig fremd waren. Sie liebte eine »wilde« Landschaft voller Berge, Seen, Muße und Abenteuer, bevölkert von einigen wenigen Menschen, denen ich nie begegnet war. Der Lake District war in ihrem Monolog die Spielwiese von umherstreifenden Bergsteigern, Lyrikern, Wanderern und Fantasten … Menschen, die im Gegensatz zu unseren Eltern oder uns »wirklich etwas geleistet hatten«. Ab und zu ließ sie in ehrfürchtigem Ton einen Namen fallen und wartete vergeblich auf ein Zeichen von Interesse. Einer der Namen war Alfred Wainwright, ein anderer Chris Bonnington, und immer wieder ließ sie sich des Langen und Breiten über einen gewissen William Wordsworth aus.
Ich hatte von keinem dieser Leute je gehört. Ich glaube, außer den Lehrern hatte niemand in der Aula von ihnen gehört.
~
In jener Schulversammlung begegnete mir zum ersten Mal diese im Kern romantische Sicht unserer Region. Es schockierte mich nicht wenig, dass auf die Landschaft, die ich und Menschen meinesgleichen so liebten und seit Jahrhunderten bewohnten, auch noch andere Leute Besitzanspruch erhoben, mit Argumenten, die ich kaum nachvollziehen konnte.
Später las ich Bücher, befasste mich mit jenem »anderen« Lake District und begann ihn besser zu verstehen. Ich erfuhr, dass die Außenwelt bis etwa 1750 kaum Notiz von unserer gebirgigen Ecke im Nordwesten Englands genommen hatte. Wenn doch, tat man sie als arm, unproduktiv, primitiv, rau, hässlich und rückständig ab. Ich konnte es kaum fassen, dass bis dahin niemand die Schönheit dieser Landschaft gesehen hatte, dass sie niemandem einen Besuch wert gewesen war – und verfolgte fasziniert, wie sich innerhalb weniger Jahrzehnte alles veränderte. Straßen wurden gebaut und später Eisenbahnen, die den Lake District leicht erreichbar machten. Und mit der einsetzenden Romantik, die das Pittoreske entdeckte, nahmen viele Menschen Berge, Seen und schroffe Landschaften wie die unsere anders wahr. Unsere Landschaft wurde plötzlich zum Magneten für Schriftsteller und Künstler, zumal die Alpen wegen der napoleonischen Kriege als Reiseziel ausfielen und die frühen Touristen gezwungen waren, stattdessen die heimischen Berglandschaften zu erkunden.
Die neue Begeisterung der Besucher richtete sich allerdings von Anfang an auf eine Fantasielandschaft, eine idealisierte, »geistige« Landschaft. Sie wurde zum Gegenpol anderer Entwicklungen, zum Beispiel der industriellen Revolution, die kaum hundert Meilen südlich ihren Ausgang nahm. Mit unserer Landschaft ließen sich Philosophien oder Ideologien illustrieren. Viele betrachteten den Lake District als Refugium, dessen herbe Landschaft und Natur Gefühle und Empfindungen wecken wie kein anderer Ort. Für viele Menschen existiert diese Landschaft, damit sie darin wandern oder klettern, sie betrachten, sie malen, über sie schreiben oder einfach nur von ihr träumen können. Viele möchten ihren Urlaub oder sogar ihr Leben hier verbringen.
Vor allem aber erfuhr ich, dass unsere Landschaft den Rest der Welt veränderte. Hier wurde zum ersten Mal der Gedanke formuliert, dass wir bei manchen Orten oder Dingen (ungeachtet aller Eigentumsrechte) ein unmittelbares Gefühl von Besitz empfinden, weil sie so schön, anregend oder einfach so besonders sind. Der romantische, im Lake District beheimatete Dichter William Wordsworth machte 1810 den Vorschlag, die Landschaft solle »eine Art nationaler Besitz werden, auf den ein jeder Anrecht habe und daran teilhaben solle, der Augen hat, um zu sehen, und ein Herz, um sich zu erfreuen«. Hier wurden Argumente formuliert, die heute weltweit den Natur- und Denkmalschutz prägen. Jede geschützte Landschaft auf der Welt, jedes Monument des National Trust, jeder Nationalpark, jedes UNESCO-Weltkulturerbe enthält ein wenig von diesen Worten in seiner DNA.
In den Jahren, nachdem ich die Schule verlassen hatte und erwachsen wurde, erlebte ich selbst, dass wir nicht die Einzigen sind, die diese Landschaft lieben. Sie ist für den Rest des Landes und zahllose andere Menschen auf der ganzen Welt zum malerischen Tummelplatz geworden – ohne Rücksicht auf Verluste. Um zu erkennen, was das heißt, brauche ich nur über den Pass nach Ullswater zu fahren, wo Autoschlangen über die Straßen kriechen und Menschenmassen sich am Seeufer drängen. Das hat sein Gutes und weniger Gutes. Heute strömen jedes Jahr 16 Millionen Besucher in ein Gebiet mit 43 000 Einwohnern. Sie geben jährlich über eine Milliarde Pfund aus. Mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze in der Region hängen vom Tourismus ab, und viele der Bauern sind darauf angewiesen, ihr Einkommen durch Bed & Breakfast oder andere Angebote aufzubessern. Aber in manchen Tälern sind über zwei Drittel der Häuser Zweitwohnsitze oder Feriendomizile, und viele Einheimische können sich das Wohnen in ihrer eigenen Gemeinde nicht mehr leisten. Sie sprechen missmutig davon, dass sie ins Abseits gedrängt wurden, und wir alle wissen, dass wir in dieser Landschaft in jeder Hinsicht nur noch eine winzige Minderheit darstellen. Es gibt Orte, die sich nicht mehr wie unsere eigenen anfühlen, als hätten die Gäste das Gästehaus übernommen.
Das Bild, das jene Lehrerin von unserer Landschaft hatte, wurde also erst in den letzten zweihundert Jahren von einer zunehmend verstädterten und industrialisierten Gesellschaft erschaffen. Der Lake District wurde für weite Kreise der Gesellschaft, denen die Verbindung zum Land abhandengekommen war, zur Traumlandschaft.
Wir, die Menschen, die dieses Land bewirtschaften, hatten nie solche Träume. Wir waren bereits hier und taten, was wir heute noch tun.
Ich hätte der Lehrerin gern gesagt, dass sie völlig schieflag. Dass sie diese Region und ihre Menschen überhaupt nicht kannte. Es dauerte Jahre, bis sich meine Gedanken klärten, aber ich glaube, ich hatte sie von Anfang an, in einer ungefähren, unausgereiften Form. Ich hatte auch schon eine grobe Vorstellung davon, dass es wichtig war, Bücher zu schreiben, wenn Bücher einem Ort Gestalt geben. Ich wusste, dass wir Bücher brauchten, die von uns handelten, die von uns selbst geschrieben waren. Aber in dieser Schulversammlung 1987 war ich dreizehn und sprachlos, und so machte ich nur mit der Hand ein Furzgeräusch. Alle lachten. Die Lehrerin brach ihre Predigt ab und verließ wütend das Podium.
~
Wenn Wordsworth und seine Freunde den Lake District »erfanden« oder »entdeckten«, dann bekam unsere Familie erst 1987 etwas davon zu spüren, als ich nach Hause ging und die Behauptungen der Lehrerin zu hinterfragen begann. Was sie uns da aufgetischt hatte, kam mir von Anfang an faul vor. Wie konnte es sein, dass die Geschichte unserer Landschaft nicht von uns handelte? Das erschien mir als Betrug, als klassischer Fall dessen, was die Historiker »Kulturimperialismus« nennen, wie ich später erfuhr.
Damals wusste ich noch nicht, dass Wordsworth in der Gemeinschaft der Schäfer und Kleinbauern des Lake District ein politisches und gesellschaftliches Ideal sah, dessen Bedeutung und Wert weit über die Region hinausreichten. Die Leute hier regierten sich selbst, frei von den aristokratischen Eliten, die anderswo das Leben der Menschen beherrschten – in Wordsworths Augen das Modell einer Gesellschaft, wie sie sein sollte. Wordsworth sah in uns einen wichtigen Gegenentwurf zum kommerziellen, urbanen und zunehmend industriellen England, das überall sonst in Erscheinung trat. Das war schon damals eine idealistische Sicht der Dinge, aber zumindest hatte der Dichter erkannt, dass der Lake District von Menschen mit einer eigenen Kultur und Geschichte bevölkert war. Er glaubte, dass mit der wachsenden Wertschätzung dieser Landschaft von den Besuchern auch Verantwortung gefordert sei. Sie müssten sich bemühen, die regionale Kultur wirklich zu verstehen. Andernfalls würde der Tourismus zur Keule, die vieles von dem, was das Besondere dieser Gegend ausmache, zerstören werde. Weiter erkannte Wordsworth, dass ein Schäfer eine andere Sicht dieser Landschaft besaß, eine Sicht von eigenständigem Wert, ein beachtlich moderner Gedanke. Davon zeugen diese verworfenen Zeilen der im Jahr 1800 verfassten Skizze von »Michael, ein Hirtengedicht«:
Kein Zweifel, hättest du direkt gefragt,
ob er die Berge liebe, so hätt er freilich
plump die Frage nochmals wiederholt,
dich angestarrt und wohl gesagt, sie seien
furchteinflößend anzuschau’n. Doch hättst du
weiter fortgeführt euer Gespräch,
gefragt nach seiner Arbeit und dem Treiben
von Erd und Himmel, gesehen hättest du
das Dunkle, Wunderliche seines Denkens,
das Staunen, Ehrfurchtsvolle – tief
wie Religion durchwirkt’ es ihm das Herz.
Aber davon war mir lange nichts bekannt, und ich warf Wordsworth vor, er habe uns hier nicht gesehen und aus dem Lake District einen Ort gemacht, wo andere Leute romantisch umherstreifen.
Ob es uns bewusst ist oder nicht, ob direkt oder indirekt – in unserer Einstellung zu dem, was uns umgibt, werden wir alle von kulturellen Quellen beeinflusst, von deren Sichtweisen und Standpunkten. Meine Sicht dieser Landschaft stammt nicht aus Büchern, sondern hat einen anderen Ursprung: Es ist ein älteres Bild, ererbt von den Menschen, die vor mir hier waren.
Was nun folgt, ist zum Teil die Schilderung unserer Arbeit im Verlauf eines Jahres, zum Teil ein autobiografischer Bericht über meine Kindheit und Jugend in den Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahren und über die Personen in meiner Umgebung, zum Beispiel über meinen Vater und meinen Großvater. Zum Teil erzähle ich aber auch eine neue Version der Geschichte des Lake District, nämlich aus der Perspektive der Menschen, die dort heute leben, und aus der ihrer Vorfahren.
Es ist die Geschichte einer Familie und ihrer Schäferei, doch darin spiegelt sich auch die umfassendere Geschichte der Menschen, die in der modernen Welt vergessen werden. Es geht hier um die Notwendigkeit, die Augen zu öffnen und diese Vergessenen zu sehen, die mitten unter uns leben, deren Leben oft stark von Traditionen geprägt und tief in der Vergangenheit verwurzelt ist. Wenn wir die Menschen in den Gebirgsausläufern Afghanistans verstehen wollen, sollten wir vielleicht zuerst versuchen, die Menschen in den Gebirgsausläufern unseres eigenen Landes zu verstehen.
Sommer
Ich habe einen großen Teil meines Lebens auf dem Land gelebt, hatte aber nie das Gefühl, dass ich dazugehörte … Es ist so merkwürdig … Ich habe nie eine solche Mentalität erlebt, wie sie hier zu spüren ist … Ich muss schon deshalb darüber reden, weil sie so eigenartig ist – diese Hartnäckigkeit der Kinder, mit der sie sich allem und jedem außerhalb des Dorfs widersetzen … Die Dorfkinder … sind überzeugt, dass sie etwas besitzen, was kein Zugezogener jemals erwerben kann, ein Leben, das auf eine geheimnisvolle Weise derart vollkommen ist, dass es reine Zeitverschwendung wäre, nach anderem zu suchen.
Daphne Ellington, Lehrerin
~
Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Die Sonne geht auf und unter, Tag für Tag, die Jahreszeiten kommen und gehen. Die Tage, Monate und Jahre lösen einander ab durch Sonne, Regen, Hagel, Wind, Schnee und Frost. Jeden Herbst fällt das Laub, um in jedem Frühling wieder hervorzusprießen. Die Erde dreht sich in den Weiten des Alls. Das Gras wächst mit der wärmenden Sonne und zieht sich wieder zurück. Was bleibt, sind die Schäfereien und die Herden, vor denen ein einzelnes Menschenleben an Bedeutung zurücktritt. Wir werden geboren, leben unser arbeitsreiches Leben und sterben, vergehen wie die Eichenblätter, die im Winter über unser Land wehen. Wir sind alle ein winziger Teil dessen, was überdauert und was wir als solide, echt und wahrhaftig empfinden. Unser Schäferleben wurzelt tief im Boden dieser Landschaft, tiefer als fünftausend Jahre.
~
Ich wurde Ende Juli 1974 in eine Welt hineingeboren, deren Mittelpunkt ein alter Mann und seine zwei Höfe waren. Der alte Mann war ein stolzer Bauer und hieß William Hugh Rebanks, »Hughie« für seine Freunde, »Granddad« für mich. Wenn ich meinem Großvater einen Gutenachtkuss gab, kratzte mich sein stoppeliges Gesicht. Er roch nach Schafen und Rindern und hatte nur noch einen einzigen gelben Zahn, aber mit dem nagte er den Knochen eines Lammkoteletts so sauber ab wie ein Schakal.
Er hatte drei Kinder. Zwei Töchter, die tüchtige Schafzüchter heirateten, und meinen Vater. Dad war der Jüngste und sollte die Landwirtschaft weiterführen. Ich war das jüngste Enkelkind, aber das einzige, das seinen Namen trug. Von meinen ersten Erinnerungen bis zum Tag seines Todes war mein Großvater für mich der Allergrößte. Schon als kleines Kind erkannte ich, dass er als König in seinem eigenen Reich herrschte, einem biblischen Patriarchen gleich. Er zog vor niemandem den Hut. Niemand sagte ihm, was er zu tun und zu lassen hatte. Er lebte bescheiden, war aber stolz, frei und unabhängig; schon durch sein Auftreten machte er deutlich, dass er hier seinen festen Platz hatte. Meine ersten Erinnerungen handeln von ihm und meinem Wunsch, eines Tages so zu sein wie er.
Wir leben und arbeiten auf unserem kleinen Berghof im äußersten Nordwesten Englands, im Lake District. Wir bewirtschaften ein Tal namens Matterdale zwischen den ersten beiden kuppigen Fells, die links aufragen, wenn man von Penrith auf der Hauptstraße nach Westen fährt. Wer auf dem Gipfel des Fell steht, der sich hinter unserem Haus erhebt, kann nach Norden über den silbern schimmernden Meeresarm des Solway bis nach Schottland schauen. Im Frühsommer stehle ich mir immer einen Moment, um auf diesen Fell zu steigen, dann sitze ich mit meinen Hütehunden da und nehme eine halbe Stunde lang die Welt in mich auf. Im Osten erkennt man das Rückgrat Englands, die Pennines, und unten breitet sich das Eden Valley mit seinem fruchtbaren Ackerboden aus. Ich lächle bei dem Gedanken, dass unsere Familiengeschichte sich mindestens sechshundert Jahre lang, wahrscheinlich noch länger, auf den Feldern und in den Dörfern am Fuß dieses Fell abgespielt hat, zwischen dem Lake District und den Pennines. Wir haben diese Landschaft geprägt und sind im Gegenzug von ihr geprägt worden. Hier haben meine Vorfahren über unzählige Generationen hinweg bis zu ihrem Tod gelebt und gearbeitet. Durch sie und Menschen ihresgleichen hat die Landschaft ihr Gesicht erhalten.
Es ist vor allem eine von Menschen besiedelte Landschaft. Jeder Hektar wurde in den letzten zehntausend Jahren durch menschliches Handeln geformt. Sogar die Berge waren durchsiebt von Bergwerksminen und pockennarbig von Steinbrüchen, und das scheinbar wilde Waldgebiet hinter uns wurde einst intensiv als Niederwald genutzt. Fast alle, mit denen ich verwandt bin und die mir nahestehen, leben in Sichtweite dieses Fell. Wenn wir von »unserer« Landschaft sprechen, meinen wir damit sowohl eine konkrete als auch eine gedankliche Realität, die wir uns nicht ausgesucht haben. Diese Landschaft ist unser Zuhause; wir vagabundieren selten weiter weg oder halten es anderswo nicht lange aus und kehren wieder zurück. Das mag manchem wie ein Mangel an Fantasie oder Unternehmungsgeist erscheinen, aber das lässt mich kalt. Ich liebe diese Gegend, für mich fängt alles hier an und endet hier, und überall sonst fühle ich mich im Nirgendwo.
Von diesem Fell blicke ich über das Land, das durch die Arbeit von großteils Vergessenen gestaltet wurde. Es ist eine einzigartige, von Menschenhand gemachte Landschaft, unterteilt in Wiesen, abgegrenzt durch Mauern, Hecken, Dämme, Straßen, Wildbäche, Entwässerungsgräben, Scheunen, Steinbrüche, Wälder und Wege. Ich kann unsere Weiden sehen und hundert Dinge, die ich erledigen müsste, anstatt hier oben auf dem Fell zu faulenzen. Ich sehe Schafe über eine Mauer in eine Heuwiese klettern und weiß, jetzt muss ich aufhören, Löcher in die Luft zu gucken und in den Tag hineinzuträumen wie ein verdammter Lyriker oder Ausflügler, jetzt muss ich an die Arbeit. Im Westen erheben sich die höchsten Fells des Lake District, deren Gipfel oft das halbe Jahr mit Schnee bedeckt sind; von dort oben sieht man die Irische See. Im Süden versperren die Fells die Sicht, aber irgendwo dahinter liegt der Rest von England. Der Lake District ist relativ klein, knapp über zweitausend Quadratkilometer. Wenn man von hoch oben auf unser Land herunterblickte, würde man erkennen, dass unsere Schäferei am östlichen Rand einer kleinen Gruppe von Bergtälern liegt. Sogar für Lake-District-Verhältnisse ist unser Tal klein, eine von Fells umgebene Senke mit umzäunten Weiden und Wiesen und ein paar verstreuten kleinen Höfen. Mit dem Auto habe ich es in fünf Minuten durchquert. Ich schaue anderthalb Kilometer hinüber zu meinen Nachbarn auf der anderen Talseite und höre, wie sie ihre Schafe auf den Berghängen zusammentreiben. Das Tal, in dem wir leben und wirtschaften, erinnert mich von hier oben an die hohlen Hände eines alten Mannes.
Diese Landschaft hat etwas an sich, das die Menschen lieben. Im Sommer erscheint sie außergewöhnlich grün und üppig. Es ist eine »bukolische« Landschaft von überschaubaren Ausmaßen, in der es ausgesprochen viel regnet und die Sommer warm sind, sodass das Gras hervorragend wächst. Schon vor langem haben Schriftsteller diese Landschaft als intim beschrieben, von menschlichem Maß. Weiß getünchte Höfe schmiegen sich an die Hänge direkt unterhalb des Gemeindelands der Fells, auf dem nach altem Recht alle Gemeindemitglieder ihre Tiere weiden dürfen. Andere Höfe sprenkeln den Talgrund, wo er kleine Rücken bildet, die sich über die Binsen und den nassen Boden ganz unten erheben; in einem davon wohnte mein Großvater. Wir sind eine von etwa dreihundert Bauernfamilien, die diese Landschaft erhalten und die alte Lebensweise weiterführen.
~
Mein Großvater wurde 1918 in eine sehr durchschnittliche Bauernfamilie hineingeboren, die wenig von sich reden machte. Sie lebte und wirtschaftete damals hauptsächlich im Herzen des Eden Valley. Den Archiven nach schlug sich die Familie von Generation zu Generation eher mühsam durch, schaffte es gelegentlich in die Reihen relativ etablierter Bauern und rutschte dann wieder in den Stand von Pächtern, Landarbeitern oder sogar ins Armenhaus und Schlimmeres zurück. Die schriftlichen Aufzeichnungen verlieren sich im sechzehnten Jahrhundert in einem unleserlichen Verzeichnis von Geburten, Todesfällen und Eheschließungen, in den Kirchenbüchern kleiner Dörfer, in deren Umkreis die Nachfahren immer noch leben und arbeiten. Mein Großvater gehörte einfach jener vergessenen schweigenden Mehrheit von Menschen an, die lebten, liebten, arbeiteten und starben, ohne viele schriftliche Spuren zu hinterlassen. In den Augen anderer war er damit im Grunde ein Niemand, und auch uns, seine Nachkommen, wird man als Niemande betrachten. Aber das ist ja der springende Punkt: Genau solche Niemande haben durch ihre Anstrengungen Landschaften wie diese erst geschaffen, und nur solche Niemande können sie weiter erhalten. Deshalb war ich so schockiert, als ich in der Schule eine ganz andere Version ihrer Geschichte serviert bekam, die Sicht privilegierter, reicher, längst toter Männer. Der Lake District ist aber die Landschaft bescheidener, hart arbeitender Menschen. Die wahre Geschichte dieser Landschaft sollte die Geschichte dieser Niemande sein.
~
Der Wecker vibriert auf dem Nachttisch. Ich verpasse ihm einen Schlag, unter dem er verstummt: halb fünf Uhr morgens. Ich habe ohnehin nicht sehr tief geschlafen. Das Schlafzimmer ist von der beginnenden Dämmerung schon halb erhellt. Ich sehe die Schulter meiner Frau und ihr angewinkeltes Bein über dem Leintuch. Unser zweijähriger Sohn liegt zwischen uns, er hat sich in der Nacht hereingeschlichen. Ich greife mir meine Kleider und verlasse lautlos den Raum. Bald wird die Sonne über den Berggrat steigen.
In der Küche trinke ich in großen Zügen aus dem Milchkarton. Ich bin erst halb wach und schlüpfe wie automatisch in die Klamotten. Mir bleibt noch eine halbe Stunde, bis wir uns am Tor zum Fell treffen. Wir werden heute die Herde vom Fell heruntertreiben, zur Schur. Meine Gedanken laufen auf Autopilot und gehen eine Checkliste durch.
Die richtigen Klamotten: abgehakt.
Frühstück: abgehakt.
Sandwiches: abgehakt.
Stiefel: abgehakt.
Als ich in die Scheune trete, springen meine Hütehunde Floss und Tan auf, schwänzeln um mich herum und winseln, bis ich sie von der Kette nehme. Sie wissen, dass sie mich auf den Fell begleiten werden. Ich füttere sie, damit sie später die nötige Energie haben. Ohne einen oder mehrere gute Hütehunde kann ein Schäfer auf den Fells einpacken. Die Schafe dort oben sind halb wild, können Schwäche riechen und würden ohne gute Hunde ausbüxen und ein Chaos anrichten. Hunde gelangen an viele Stellen, die für Menschen unzugänglich sind, in Steilwände, auf Geröllfelder, und können die Schafe von dort holen. Als ich hinausgehe, saust Tan zum Scheunentor und springt auf das Quad. Floss folgt ihm.
Hütehunde gefüttert und aufgeladen: abgehakt.
Quad: abgehakt.
Aufgetankt: abgehakt.
Die Schwalben schießen, von den Hunden aufgescheucht, explosionsartig aus dem Scheunentor. Die Jungen sind vor ein paar Tagen flügge geworden, und über meinem Kopf schwärmen ganze Familien auf die Wiesen hinaus, wo sie bis zum Abend dicht über dem Gras und den Disteln nach Futter jagen werden.
Lichtfinger in Rosa und Orange tasten sich über die Hänge. Sonnenaufgang.
Wir haben jetzt die heißesten Sommertage. Als ich das Sträßchen entlangfahre, spüre ich vom Asphalt Wärme aufsteigen. Sonne. Staub. Fliegen. Blauer Himmel. In der größten Tageshitze wäre es zu heiß, um die Schafe abwärts zu treiben; das haben wir uns in den letzten acht oder neun nasskalten Monaten kaum vorstellen können. Ab Mittag fangen die Schafe an zu hecheln und ziehen sich auf der Suche nach Schatten in Winkel und Spalten zurück, sodass wir viele übersehen würden. Auch für die Hütehunde wäre es zu heiß. Man kann einen Hund umbringen, wenn man ihn bei Hitze und feuchter Luft zu hart arbeiten lässt. Deshalb wollen wir früh anfangen und den Abtrieb hinter uns bringen, ehe die Sonne zu hoch steht.
Ich habe erst gestern Abend erfahren, dass wir uns heute treffen. Ich badete mich gerade, als das Telefon klingelte. Meine Frau brachte es herein; ich ließ mir nicht anmerken, dass ich in der Wanne lag. Der Anrufer war mein Nachbar Alan, ein älterer, hochgeachteter Schafzüchter, der eine Menge Schafe auf dem Fell hat und schon viel länger dabei ist als ich. Er ist der Boss, man könnte sagen, der gewiefte alte Hase, der die Zusammenarbeit aller Nutzer des Gemeindelands organisiert. Es ist nicht einfach, die Schäfer zu Gemeinschaftsaktionen zusammenzutrommeln, ich neide Alan den Job kein bisschen. Er machte nicht viele Worte:
»Morgen treiben wir die Schafe runter.«
»Okay.«
»Wir treffen uns um fünf Uhr früh am Tor zum Fell.«
»Alles klar.«
Dann legte er auf und rief den Nächsten an.
Ich wusste, dass das fällig war, denn in dieser Zeit müssen die Schafe geschoren werden, aber für den gemeinsamen Abtrieb muss das Wetter stimmen, und es dürfen keine anderen wichtigen Arbeiten anstehen, damit sich die Männer freimachen können. Alle warten auf den Tag X; man weiß nie, wann es so weit ist, bis der Anruf kommt oder Alan im Vorbeifahren von der Straße herüberschreit: »Morgen geht’s los.«
~
Der Schafabtrieb ist von alters her Gemeinschaftsarbeit; alle, die das Recht haben, Schafe auf dem Gemeindeland weiden zu lassen, bringen in vereinter Anstrengung und mithilfe der Hütehunde die Herden von den Bergen ins Tal. Auf unserem Fell mit den weiten, uneingezäunten Heideflächen und Gebirgswiesen weiden etwa zehn verschiedene Schafherden. Da es keine Bedrohung durch große Raubtiere mehr gibt, werden die Schafe sich selbst überlassen, müssen aber mehrmals im Jahr zum Lammen, Scheren und für andere, für das Wohl der Herde wichtige Arbeiten heruntergeholt werden. Unser Gemeindeland grenzt an die uneingezäunten Berglandflächen anderer Fells, die von einer anderen Gruppe von Schafbauern gemeinsam genutzt werden. Theoretisch könnten unsere Schafe also quer durch den ganzen Lake District ziehen. Das tun sie aber nicht, weil sie ihren Platz auf den Bergen kennen. Sie sind hefted, wie wir sagen; sie haben eine Ortsbindung, die sie schon als Lämmer von ihren Müttern beigebracht bekommen – eine Kette des Lernens, die ohne Unterbrechung Jahrtausende zurückreicht. Die Schafe können also nie woandershin verkauft werden, ohne dass diese alte Bindung zerstört wird. Es heißt, hier gebe es die größte Konzentration von Allmendeflächen in Westeuropa. Auf ihnen überdauert eine Art von Schafhaltung, die älter ist als die meisten anderen Formen der Tierhaltung auf der Welt.
Der Fell, von dem wir die Schafe heute heruntertreiben, gehört nicht uns, sondern dem National Trust, der großen gemeinnützigen Organisation für Kultur- und Naturschutz in England, Wales und Nordirland. Andere Fells haben andere Eigentümer, wir aber besitzen das alte, verbriefte Recht, auf dem unseren eine festgelegte Anzahl von Schafen zu weiden. Viele dieser gebirgigen Landflächen wurden von reichen Wohltätern aufgekauft und dem National Trust vermacht, zum Beispiel von Beatrix Potter, im Vertrauen darauf, dass der National Trust die Landschaft mit ihrer einzigartigen Lebensform schützt. Oft wurde in diesen Vermächtnissen eigens betont, dass die Fell-Herden weiterhin aus den traditionellen Herdwick-Schafen bestehen müssen.
Für ein Stück Land gibt es verschiedene Arten von Besitzrechten. Die Weiderechte auf unserem Fell sind in sogenannte »Stints« aufgeteilt, Anteile am Recht der Gemeindelandnutzung. Jeder Anteil, den man besitzt oder auch pachten kann, berechtigt dazu, eine bestimmte Anzahl von Schafen auf dem Land zu weiden – auf unserem Fell sind es sechs pro Anteil. Wir kaufen, verkaufen oder pachten Anteile, damit ältere Bauern sich zur Ruhe setzen und ihre Weiderechte und Herden an die nächste Generation weitergeben können. Manche Eigentümer eines Fell besitzen keine Anteile und haben daher auf ihrem eigenen Land kein Weiderecht, solange keine überzähligen Stints verfügbar sind. Die Weiderechte werden gemeinsam mit den Mitnutzern des Gemeindelands ausgeübt, die als »Commoners«, als »Gemeine« bezeichnet werden. »Gemeiner« ist hier nichts Abwertendes, sondern ein Titel, auf den man stolz sein darf. Ein Commoner besitzt ein Anrecht auf etwas Wertvolles, trägt zur Landschaftspflege auf den Fells bei und teilt unsere Lebensweise als Gleicher unter Gleichen. Wenn jemand Herdwick- oder Swaledale-Schafe züchtet, die eine Ortsbindung an das Gemeindeland auf den Fells haben, dann gehört er oft zu einem bestimmten Verband von »Commoners«. Das alles sind merkwürdige Relikte aus einer feudalen Vergangenheit, als wir dem jeweiligen Grundherrn für das Recht, das karge Bergland zu beweiden, Abgaben zahlen (und Waffendienst leisten) mussten. Aber solche Abgaben haben wir schon sehr lange nicht mehr bezahlt. Entweder verschwanden die Aristokraten aus der Region, oder sie machten sich nicht die Mühe, unsere Rechte wegen ausbleibender Zahlungen anzufechten, weil wir sehr störrisch und unangenehm werden können, wenn uns jemand in den Weg tritt. Das Eintreiben der Abgaben kostete mehr Aufwand, als es einbrachte, und so sind wir, die Bauern, als Sieger aus der Sache hervorgegangen. Wir sind ein winziger Teil einer uralten Wirtschafts- und Lebensweise, die sich in diesen Bergen halten konnte, weil hier schon immer wenig zu holen war, weil die Gegend relativ isoliert lag und durch die frühe Naturschutzbewegung vor Veränderungen bewahrt wurde.
~
Meine Mutterschafe und Lämmer sind nun seit fast acht Wochen oben in den Bergen. Es sind Herdwicks, eine alte Schafrasse, die auf den Fells des Lake District heimisch ist und dank jahrhundertelanger Zucht mit den Bedingungen dieser Landschaft, dieses Klimas und dieser Art der Haltung bestens zurechtkommt. Die Tiere müssen zwei Aufgaben erfüllen: erstens, die Winter und die harten Zeiten überleben und, zweitens, in den Frühlings- und Sommermonaten kräftige Lämmer werfen und sie in den Bergen großziehen, damit die Herde mit neuen weiblichen Lämmern verjüngt wird und die Schäfer überschüssige Lämmer verkaufen können.
ENDE DER LESEPROBE