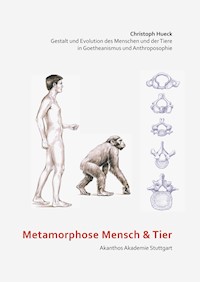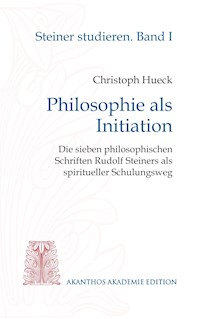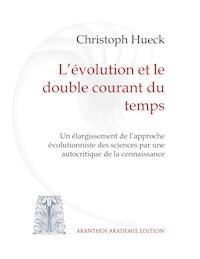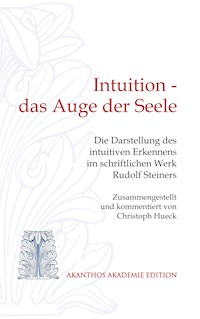
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der Auffassung Rudolf Steiners bedeutet Intuition nicht einen spontanen Einfall mit unklarem Ursprung, sondern eine Einsicht von höchster Klarheit und Sicherheit. Im intuitiven Erkennen wird die Kluft zwischen dem Erkennenden und dem Erkannten über-wunden. Durch ihre Tiefe ist die Intuition der mittelalterlichen unio mystica vergleichbar, der mystischen Vereinigung mit dem geistigen Weltgrund, durch ihre vollkommene Transparenz aber auch der exakten mathematischen Erkenntnis. Rudolf Steiner entwickelte sein Verständnis der Intuition zunächst in Bezug auf Goethes anschauende Urteilskraft und die intellektuelle Anschauung des deutschen Idealismus, vertiefte es aber zur unmittelbaren Anschauung geistiger Wesen. Intuition macht deutlich, was Steiner unter Geist und Geisteswissenschaft verstand. Hier wurden alle Darstellungen zur Intuition aus neunzehn Schriften und etlichen Aufsätzen Rudolf Steiners zusammengestellt und erläuternd kommentiert. Von den Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften über Die Philosophie der Freiheit und Die Geheimwissenschaft im Umriss bis zu Steiners letzten Schriften wird ein umfassender Überblick über dieses zentrale anthroposophische Thema gegeben, der einen Einblick in die Grundlage der Anthroposophie vermittelt. Die Zusammenstellung zeigt, wie Rudolf Steiner seine frühen philosophischen zu den späteren anthroposophischen Anschauungen weiterentwickelte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der zitierte Wortlaut Rudolf Steiners folgt der im Rudolf Steiner Verlag erschienenen Gesamtausgabe (GA). Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Dornach/Schweiz.
INHALT
Vorwort
Einleitung
Das intuitiv erlebte Denken
Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften
(1884-97) – die intuitive Erkenntnis des Organischen
Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung
(1886) – Intuition als wissenschaftliche Methode
Vier Aspekte des intuitiven Erkennens
Wahrheit und Wissenschaft
(1892) – Intuition als Überwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung
Die Philosophie der Freiheit
(1894) – Intuition als erlebte Geisttätigkeit
Goethes Weltanschauung
(1897) – die Wirksamkeit der Ideen in der Natur und das „Sehen mit Geistesaugen“
Die intuitive Geist-Erfahrung
Goethes geheime Offenbarung
(1899/1900) – das erste Aufblitzen der Esoterik der Intuition
Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens
(1901) – die Erweckung des intuitiven Sinnes und die Wiedergeburt der Dinge in der Seele
Das Christentum als mystische Tatsache
(1902) – der Weg zur Intuition (von der Einweihung)
Theosophie
(1904) – Intuitionen als Wahrnehmungen des „höheren Sinns“ und Offenbarungen geistig schaffender Urbilder
Exkurs zur meditativen Wahrnehmung geistiger Wesen
Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten
(1904/05) – „das Ich aufschließen für die Welt“
Zur zentralen Stellung von
Theosophie
und
Wie erlangt man Erkenntnisse…?
im Werk Rudolf Steiners
Die Stufen der höheren Erkenntnis
(1905-08) – die geisteswissenschaftliche Wesensintuition
Die Auffaltung des ursprünglichen Intuitionsbegriffs in vier Stufen des Erkennens
Aufsätze (1904-08) – Intuition, Ich-Erkenntnis und Wirklichkeit
Begriff, Erkenntnis und Stufen der „wahren Wirklichkeit“
Moralische Intuition – Freiheit, Liebe, Individualität
Geistwesen, Leibeswesen, Willensübungen
Die Geheimwissenschaft im Umriss
(1910) – Selbsterkenntnis, Welterkenntnis und der Weg zur Intuition
Intuition als irrtumsfreie Erkenntnis – Wahrheitskriterien der Anthroposophie
Der Bologna-Vortrag
(1911) – das Ich in den Weltgesetzen, der Leib als Spiegelungsapparat
Exkurs: Ein vierstufiger, meditativer Weg zur Intuition
Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen
(1912) und
Die Schwelle der geistigen Welt
(1913) – einige Charakteristika der erlebten Intuition
Die Begegnung mit dem eigenen „Doppelgänger“ durch den „Hüter der Schwelle“
Die Rätsel der Philosophie
(1914) – die Frage nach der Verwurzelung des Ich in der Wirklichkeit
Vom Menschenrätsel
(1916) – Produktivität im Denken, Empfänglichkeit im Willen
Von Seelenrätseln
(1917) – der Zusammenhang von Intuition, Wille, Schlaf und Stoffwechsel
Bewusstsein, Handeln, Erleben – Exkurs über die menschliche Gestalt
Aufsätze (1916-1918) – Intuition, Wille und vergeistigte Liebefähigkeit
Kosmologie, Religion und Philosophie
(1922) – Intuitionsübungen für den Willen
Anthroposophische Leitsätze
(1924) – das „Michael-Christus-Erlebnis“ und die „Bildnatur“ des Menschen
Grundlegendes zur Erweiterung der Heilkunst
(1925) – die Erkenntnis der menschlichen Wesensglieder durch Imagination, Inspiration und Intuition
Zusammenfassung und Ausblick
Anhang – „Ich bin“ als Meditationsinhalt
Literatur
Von der Tatsache,
dass die Ideen des Menschen
nicht nur ‚denkend‘ bleiben,
sondern im Denken ‚sehend‘ werden,
hängt unermesslich viel ab.
(Rudolf Steiner)
VORWORT
In diesem Buch wird der Begriff der Intuition, wie ihn der Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner (1861-1925), entwickelte, dargestellt. Es geht um eine Methode höherer, geistiger Erkenntnis. Denn in der Anthroposophie bedeutet Intuition nicht eine spontan auftretende Idee, eine gefühlte Ahnung, Eingebung oder Ähnliches, sondern eine geistige Einsicht „voll der lichtesten Klarheit und der unbezweifelbarsten Sicherheit“1. Man verbindet sich so intensiv und bewusst mit einem Inhalt, dass die Kluft zwischen dem Erkennenden und dem Erkannten vorübergehend verschwindet: „Ein Geisteswesen durch Intuition erkennen, heißt völlig eins mit ihm geworden sein, sich mit seinem Innern vereinigt haben.“2 Durch ihre Tiefe ist die Intuition der mittelalterlichen unio mystica vergleichbar, in der eine mystische Vereinigung der eigenen Seele mit dem Göttlichen erlebt wurde; durch ihre vollkommene Transparenz aber auch der exakten mathematischen Erkenntnis. Der Begriff der Intuition ist zentral für die Anthroposophie. Durch ihn wird klar, was Rudolf Steiner mit Geist und mit der wissenschaftlichen Erforschung des Geistigen meinte. In diesem Sinne soll die vorliegende Arbeit ein Beitrag zum Verständnis der Anthroposophie als einer Geisteswissenschaft sein.
Das gedruckte Werk Rudolf Steiners umfasst 45 Bände mit Schriften, Aufsätzen und Briefen sowie knapp 310 Bände mit über 6.000 mitstenographierten Vorträgen. Während Steiner die Anthroposophie in seinen Schriften systematisch entwickelte, ging er in seinen Vorträgen auf die Fragen und Bedürfnisse der Zuhörer ein. So findet man im Vortragswerk einzelne Themen verstreut zu verschiedenen Zeiten behandelt. Wir beschränken uns hier auf die Darstellung des intuitiven Erkennens in den Schriften Steiners. Die Berücksichtigung der Vorträge hätte diese Monographie wegen des sich daraus ergebenden schieren Umfangs verunmöglicht. Sie kann an anderer Stelle und in anderer Form geleistet werden.
Aus dem schriftlichen Werk wurden alle Stellen, die direkt oder indirekt mit dem Thema Intuition zusammenhängen, so gut wie möglich zusammengetragen, die meisten von ihnen werden hier auch zitiert. Die Reihenfolge der Darstellung entspricht in etwa der Reihenfolge des Erscheinens der Schriften. Die Zitate werden vor allem dadurch kommentiert, dass immer wieder auf die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Darstellungen hingewiesen wird. Wir lassen uns weitmöglichst auf Inhalt und Diktion ein in der Überzeugung, dass wir es bei Rudolf Steiners Texten nicht mit einer veralteten, sondern einer hochaktuellen Angelegenheit zu tun haben. Diese Form der Aufarbeitung, obwohl mühsamer zu lesen als eine abstrahierende Zusammenschau, wurde gewählt, um es dem Leser zu ermöglichen, die Entfaltung des Intuitionsbegriffs in Steiners Werk mitzuvollziehen und so nicht nur zu einem inhaltlichen Verständnis, sondern auch zu einem Erleben, zur Intuition der Intuition kommen zu können.
In seinem philosophischen Frühwerk (Schriften, die zwischen 1884 und 1900 erschienen) setzte Steiner die Intuition mit der anschauenden Urteilskraft Goethes und in gewissem Sinne auch mit der intellektuellen Anschauung des deutschen Idealismus gleich. In seinen geisteswissenschaftlichen Schriften (von 1901 bis 1925) bezeichnete er mit Intuition die höchste von drei Stufen der Geist-Erkenntnis. (Die beiden anderen Stufen, die Inspiration und die Imagination, können in der hier vorliegenden Arbeit nur am Rande behandelt werden.3) Wie der Intuitionsbegriff des Frühwerks mit der Intuition als höchster Form anthroposophischer Geisterkenntnis zusammenhängt, wird hier ausführlich entwickelt. Aus dem Begriff des intuitiven Erkennens werden dann auch die meditativen Übungen verständlich, die Steiner zum Erlangen intuitiver Erkenntnisse angab und die hier ebenfalls besprochen werden.
Rudolf Steiner hat den Begriff der Intuition nicht erfunden; er hat eine lange philosophiegeschichtliche und mystische Tradition. Es kann hier nicht die Aufgabe sein, diese Tradition nachzuzeichnen; eine Skizze wäre viel zu grob, eine ausführliche Darstellung würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Für eine Übersicht sei auf die Darstellung von Nel Noddings und Paul Shore verwiesen.4
Heute wird unter Intuition meist eine spontane Einsicht verstanden (und gesucht), als „kreativer Einfall“, „innere Stimme“, „treffendes Gefühl“ oder gar als „Bauchentscheidung“. Mit Intuition im steinerschen Sinne hat das nichts zu tun. Dennoch kann man wohl sagen, dass die Praxis des intuitiven Denkens, wie es in der Anthroposophie verstanden und geübt wird, auch zu einer erhöhten „Intuitionsfähigkeit“ im herkömmlichen Sinne führen kann. Denn Denken und Erkennen können nur in wacher Präsenz und innerer Aktivität, also in schöpferischer Geistesgegenwart intuitiv erlebt werden. Das Üben dieses konzentriert-tätigen und zugleich offen-anschauenden Denkens bildet gleichsam ein inneres Organ, das auch das bewusste Erfassen spontaner „Intuitionen“ erleichtern kann.
Von den anthroposophischen Autoren, die sich intensiv mit dem Intuitionsbegriff Steiners auseinandergesetzt haben, seien insbesondere Herbert Witzenmann und Renatus Ziegler genannt. Witzenmann5 arbeitete die Grundzüge des Intuitionsbegriffs in Bezug auf die philosophischen Schriften Steiners präzise heraus und stellte insbesondere die Doppelheit von geistiger Produktivität und selbstbestimmter Inhaltlichkeit als ‚rückbestimmte Bestimmung‘ des Denkens dar. Ziegler6 entwickelt den Intuitionsbegriff aus Steiners Philosophie der Freiheit systematisch in großer Klarheit und schlägt eine Brücke von der intuitiven Selbsterkenntnis bis zum Verständnis von Reinkarnation und Karma. Auch Dietrich Rapp7 hat die Doppelnatur des geistigen Erkennens deutlich herausgearbeitet. Zur Philosophie der Freiheit existiert darüber hinaus eine Fülle von Untersuchungen, die hier nicht alle genannt werden können.8 Für einen Ausblick auf den Zusammenhang mit der pädagogischen Intuition sei auf einen von Jost Schieren herausgegebenen Band verwiesen.9 Edward de Boer hat eine überschaubare und gut abgerundete Sammlung von Zitaten Steiners zur Intuition herausgegeben, die einen ausgezeichneten ersten Überblick über das Thema vermittelt.10
Das Studium von Rudolf Steiners Darstellungen erfordert ein hohes Maß an geistiger Eigenaktivität, denn „der Doktor“ – wie er liebevoll von seinen Schülern genannt wurde – definierte nicht, sondern umschrieb, auf Wesentliches eher hindeutend als es festlegend. Wie Steiner die sinnlichen Wahrnehmungen als unfertig ansah ohne die zu ihnen gehörigen Begriffe, und die Welt als unfertig ohne den Menschen, so kann man auch seine Bücher durchaus als unfertig ohne die eigenschöpferische Verständnistätigkeit des Lesers betrachten. Ergebnisse anthroposophischen Studiums sind daher (insbesondere, wenn sie bis zum Bereich innerer Erfahrung vorstoßen) in besonderem Maße durch die persönlichen Schwerpunktsetzungen, Einsichten und Hintergründe des Interpreten gefärbt. Das kann nicht anders sein, denn Anthroposophie ist keine Lehrbuchwissenschaft, sondern lebendige Geistbegegnung und -anschauung, die sich immer neu und individuell durch den Menschengeist ereignet. Es kommt daher vor, dass gerade anthroposophische Freunde ganz anderer Auffassung über bestimmte Darstellungen Rudolf Steiners sind als man selbst. Das macht aber die Sache und den anderen Menschen besonders interessant. Dennoch handelt es sich bei der Anthroposophie um eine Geisteswissenschaft; gewissenhafter Umgang mit ihr wird also vorausgesetzt. Gerade in seinen schriftlichen Darstellungen wählte Rudolf Steiner jedes Wort mit Bedacht – und so dürfen sie auch gelesen werden: mit Bedacht.
* * *
Die Gesichtspunkte für das Verständnis und die Zusammenschau des hier Dargestellten wurden durch den fruchtbaren Austausch mit vielen Persönlichkeiten bereichert und vertieft, von denen insbesondere meine Kolleginnen und Kollegen von der Akanthos-Akademie in Stuttgart: Corinna Gleide, Martina Maria Sam, Andreas Neider, Dorian Schmidt, Lorenzo Ravagli und Valentin Wember, sowie Anna-Katharina Dehmelt vom Institut für anthroposophische Meditation und auch Dirk Kruse, Hans-Christian Zehnter und Bernhard Schmalenbach genannt und für ihre freundschaftliche Unterstützung bedankt seien. Außerdem danke ich Shozan Shimoda für anregende Diskussionen zum Thema.
1Die Stufen der höheren Erkenntnis. GA 12. Dornach, 1979, S. 67. (Sofern nicht anders vermerkt, stammen alle angegebenen Titel von Rudolf Steiner. GA bezeichnet die Nummer in der Gesamtausgabe.)
2Die Geheimwissenschaft im Umriss. GA 13. Dornach 1989, S. 357.
3 Wer sich über diese drei Stufen einen ersten und zugleich sehr klaren Überblick verschaffen möchte, sei auf Rudolf Steiners kleine Schrift Die Stufen der höheren Erkenntnis (GA 12) verwiesen. Man findet dort auf wenigen Seiten die „Erkenntnislehre der Anthroposophie“ in ihren Grundzügen erläutert.
4 Nel Noddings, Paul J. Shore: Awakening the inner eye. Intuition in education. Troy, N.Y. 1998.
5 Herbert Witzenmann: Intuition und Beobachtung. Bd. 1: Das Erfassen des Geistes im Erleben des Denkens. Stuttgart 1977.
6 Renatus Ziegler: Intuition und Ich-Erfahrung. Erkenntnis und Freiheit zwischen Gegenwart und Ewigkeit. Stuttgart 2006.
7 Dietrich Rapp: Tatort Erkenntnisgrenze. Die Kritik Rudolf Steiners an Immanuel Kant. Heidelberg 2013.
8 Für eine aktuelle Übersicht vgl. das Literaturverzeichnis in Christian Clement (Hrsg.): Rudolf Steiner Schriften – kritische Ausgabe. Bd. II: Wahrheit und Wissenschaft, Die Philosophie der Freiheit. Stuttgart 2016. Es sei erwähnt, dass Rudolf Steiners Philosophie seit einigen Jahren auch von der Fachphilosophie bearbeitet wird (Hartmut Traub: Philosophie und Anthroposophie. Die philosophische Weltanschauung Rudolf Steiners. Grundlegung und Kritik. Stuttgart 2011).
9 Jost Schieren (Hrsg.): Rationalität und Intuition in philosophischer und pädagogischer Perspektive. Frankfurt a.M. 2008.
10 Edward de Boer (Hrsg.) Rudolf Steiner: Intuition, Brennpunkt des Denkens. Basel 2014.
EINLEITUNG
Wer Anthroposophie studiert, muss sich nach und nach ein Repertoire neuer Begriffe erarbeiten. Niemand hat es in der Schule gelernt, was „Ätherleib“, „Saturnzustand“ oder „Elementarwesen“ bedeuten. Auch viele alte Begriffe müssen erweitert, vertieft und umgeschmolzen werden. Und insbesondere macht es die Beschäftigung mit der Anthroposophie erforderlich, die Art und Weise, wie man denkt, allmählich zu verwandeln. Je länger man sich mit dieser von Rudolf Steiner inaugurierten und in schier unüberschaubaren Weiten und Tiefen entfalteten Wissenschaft des Geistes beschäftigt, umso mehr stößt man an die Grenzen des gewöhnlichen Denkens. Denn dieses richtet sich auf etwas anderes: Die Gedanken werden als Bezeichnungen für eine Wirklichkeit verwendet, die außerhalb von ihnen gesucht wird. Der (gewöhnliche) Gedanke des Elefanten ist ein Platzhalter für einen wirklichen Elefanten, der nicht gedacht, sondern nur wahrgenommen werden kann. In der Anthroposophie soll aber Wirklichkeit im Denken gefunden werden. Anthroposophische Gedanken, Begriffe und Ideen sollen nicht auf etwas anderes bezogen, sondern von innen her erlebt und erlebend „angeschaut“ werden. Rudolf Steiner wies seine Leser und Zuhörer immer wieder und wieder auf das Erleben des Denkens hin. Denn, so fasste er einmal zusammen, „in den erlebten Ideen ist die Geist-Welt gegeben“11.
Die Aneignung neuer Begriffe und die Veränderung der Wirklichkeitserfahrung im Denken können sich nur langsam und allmählich vollziehen, hängt doch das gewöhnliche Bewusstsein an nichts so sehr wie an sich selbst. Es möchte gleichsam instinktiv in der gegenständlichen Wirklichkeit verharren, denn sie ist es, an der es sich erhellt und erhält. Das gewöhnliche Denken nimmt daher auch die anthroposophischen Begriffe zunächst wie Bezeichnungen für etwas anderes, „geistig“ Wirkliches, das Rudolf Steiner (nach seiner Selbstaussage) wahrnehmen konnte, man selbst aber (noch) nicht. Zu dieser oft gemachten Voraussetzung schrieb Steiner: „Man stellt sich den Eintritt in die geistige Welt viel zu ähnlich einem sinnenfälligen Erlebnis vor, und so findet man, dass, was man beim Lesen von dieser Welt erlebt, viel zu gedankenmäßig ist.“ Doch stehe man „in dem wahren gedankenmäßigen Aufnehmen … in dieser Welt schon drinnen“ und habe sich „nur noch klar darüber zu werden, dass man schon unvermerkt erlebt hat, was man vermeinte, bloß als Gedankenmitteilung erhalten zu haben.“12 Der Mensch sei schon hellsichtig, zumindest im „wahren“ Denken – nur merke er es zunächst nicht.
Um den Blick auf das Wesentliche freizuhalten, charakterisierte Rudolf Steiner seine Begriffe, anstatt sie zu definieren. „Wir charakterisieren, wenn wir die Dinge unter möglichst viele Gesichtspunkte stellen“, sagte er einmal. „Dann sind diese Beziehungen so vielgliedrig, dass nicht eine Definition herauskommt, sondern eine Charakteristik.“13 Beim Studium der Anthroposophie ist man daher mit unterschiedlichsten Perspektiven auf bestimmte geistige Sachverhalte und mit entsprechenden Begriffsmetamorphosen konfrontiert, was die gedankliche Erschließung nicht gerade erleichtert. Andererseits eröffnet die systematische Erarbeitung anthroposophischer Begriffe ganz neue Einsichten und Forschungsfelder. Gerade im Mitvollzug ihrer Metamorphosen erweitern sich diese Begriffe von Bezeichnungen zu Blickweisen, von Anschauungsformen zu Erlebnissen. Wie Goethe durch immer neue Beobachtung des Pflanzenwachstums oder durch Reihenbildung innerhalb seiner mineralischen Sammlungen zu Begriffen kam, von denen er das Erlebnis hatte, sie „wie mit Augen zu sehen“, so ist die systematische Sammlung der Äußerungen Rudolf Steiners zu einem bestimmten Thema einer goetheschen Reihenbildung vergleichbar, durch die schließlich das Wesen der Sache in der eigenen Anschauung geistig aufleuchten kann.
Im Folgenden werden Rudolf Steiners schriftliche Darstellungen zur Intuition erläuternd und vergleichend zusammengestellt. Der Gang führt von den Ausführungen zu Goethes Naturwissenschaft über die philosophischen zu den geisteswissenschaftlichen und esoterischen Schriften, von der Erkenntnis des Lebendigen, des Denkens und des Ich zur Erkenntnis geistiger Wesen und schließlich zu Übungsanleitungen zur Erlangung intuitiven Erkennens.
Im Nachvollzug dieses Weges zeigt sich, dass sich der Begriff der Intuition bei Rudolf Steiner organisch, wie nach einer inneren Gesetzmäßigkeit entfaltet. Im ersten Keim, den Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften (1884), ist, so wird im Rückblick deutlich, die spätere Gestalt bereits potentiell enthalten, während in jeder weiteren Entwicklungsstufe die früheren Stadien integriert, sozusagen verinnerlicht weiterleben. So finden wir schon in den philosophischen Schriften vier Aspekte des intuitiven Erkennens, die sich später in die vier Stufen des Erkennens, die gegenständliche und die drei höheren der Imagination, Inspiration und Intuition auseinanderlegen. Von Stufe zu Stufe wird der Blick auf das Thema klarer und inhaltsvoller, der Blick zurück inniger, das Gesamtbild reicher. Die Wesensintuition, wie Steiner sie 1910 in Die Geheimwissenschaft im Umriss beschrieb, ist verständlicher, wenn man sich auch mit der Begriffsintuition aus Die Philosophie der Freiheit beschäftigt hat, und umgekehrt erhält die Begriffsintuition von der Geheimwissenschaft aus eine neue, vertiefende Beleuchtung. Vollzieht man die Entfaltung des Intuitionsbegriffs nach, so kann man dieses lebendige Ineinanderweben des Vergangenen und Zukünftigen, die aus einem gemeinsamen Zentrum entspringen und das Wesen der intuitiven Erkenntnis immer mehr zur Erscheinung bringen, erlebend nachvollziehen. Man schaut das Wesen der Intuition „wie mit Augen“, und man erkennt, dass es dasselbe Licht ist, dass von Anfang an bis in die letzten Zeilen Rudolf Steiners leuchtet.
Eine solche Herangehensweise kann, vertieft betrachtet, als ‚esoterisch‘ bezeichnet werden. Das bedeutet nichts Nebulöses, sondern ist im goetheschen Sinne des offenbaren Geheimnisses zu verstehen. Steiner schrieb:
„Wahrheiten, die einem ganzen Systeme von Ansichten angehören, können zumeist nur im Zusammenhange richtig verstanden und gewürdigt werden. Man nennt dann ihren tieferen Sinn, den sie für sich alleinstehend nicht haben können, den esoterischen. Der letztere wird nur dem geläufig sein, der den ganzen entsprechenden Kreis von Anschauungen kennt, dem das Einzelne angehört. Wahrheiten, die für sich, außer allem Zusammenhange sogleich verständlich sind, heißen exoterische. Die oberflächliche Art, die esoterische Wahrheiten aus dem Zusammenhange reißt und gleich exoterischen behandelt, kann zu den verhängnisvollsten Irrtümern führen.”14
Und Goethe selbst bemerkte einmal: „Den Zusammenhang müssen Sie selbst entdecken. Wer es nicht findet, dem hilft es auch nichts, wenn man es ihm sagt.“15
Alle Formulierungen in diesem Buch sind so zu lesen, dass Rudolf Steiners Auffassung referiert wird, auch, wenn dies der Lesbarkeit halber meist nicht explizit ausgesprochen ist. Inwiefern Steiners Sicht faktisch zutreffend ist, kann nur im Urteil des Lesers entschieden werden.
11Mein Lebensgang. GA 28. Dornach 1982, S. 435. Unter „Idee“ muss man sich bei Steiner allerdings nicht nur einen abstrakten Gedankeninhalt vorstellen, sondern die ganze Summe dessen, was im Verständnis einer Sache mitschwingt: die logische Gesetzmäßigkeit, das gefühlsmäßige Erleben von Stimmigkeit und Bedeutung sowie dynamisch-willenshafte Anteile.
12 GA 13, S. 49.
13 Vortrag vom 30.8.1919 in: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. GA 293. Dornach 1992, S. 140.
14 Rudolf Steiner (Hrsg.): J. W. Goethe: Naturwissenschaftliche Schriften. Band 4/I: Materialien zur Geschichte der Farbenlehre. Dornach 1982, Fußnote S. 127.
15 Wolfgang Herwig (Hrsg.): Goethes Gespräche (Biedermannsche Ausgabe). München 1987, Bd. 5, S. 84.
I. DAS INTUITIV ERLEBTE DENKEN
Im ersten Teil unserer Untersuchung zeichnen wir die Entwicklung des Intuitionsbegriffs in Rudolf Steiners frühen Schriften nach und beschäftigen uns dabei zunächst mit Fragen zur Erkenntnis des Organischen. Wie erfasst man die Lebenskraft, die in Organismen gestaltend wirksam ist (Kapitel über die Einleitungen und Grundlinien)? Wir setzen uns mit der Intuition als wissenschaftlicher Erkenntnismethode auseinander. Im Kapitel über Wahrheit und Wissenschaft beschäftigen wir uns u.a. mit der Grundstruktur des Erkenntnisvorgangs, in demjenigen über die Philosophie der Freiheit mit der Intuition als geistigem Wahrnehmungsorgan. Das Kapitel über Goethes Weltanschauung schließt diesen ersten Teil ab und behandelt die Konsequenzen des intuitiven Erkennens für eine lebendige und geistgemäße Naturanschauung. Rudolf Steiner ging also zunächst von erkenntnistheoretischen Fragestellungen aus, doch waren sie für ihn keine bloß philosophischen Probleme, denn auch vom philosophischen Denken gilt:
„Wer von der Kälte der Ideenwelt spricht, der kann Ideen nur denken, nicht erleben. Wer das wahrhafte Leben in der Ideenwelt lebt, der fühlt in sich das Wesen der Welt in einer Wärme wirken, die mit nichts zu vergleichen ist. Er fühlt das Feuer des Weltgeheimnisses in sich auflodern.“16, 17
16Goethes Weltanschauung. GA 6. Dornach 1990, S. 77.
17 Zitierweise: Bei der ersten Erwähnung wird der Band der Gesamtausgabe (GA) vollständig mit Titel, Nummer in der GA, Ort und Erscheinungsjahr zitiert. Für alle weiteren Zitate desselben Bandes im Text wird nur die Nummer der GA angegeben und nach einem \ die Seitenzahl in der schon erwähnten Ausgabe. Bei Zitaten, die mehrere Seiten überspannen, wird nur die Seite angegeben, auf welcher das Zitat beginnt. Im Anhang findet man alle verwendete Literatur aufgelistet.
EINLEITUNGEN ZU GOETHES NATURWISSENSCHAFTLICHEN SCHRIFTEN(1884-97) – DIE INTUITIVE ERKENNTNIS DES ORGANISCHEN
In diesem Kapitel erarbeiten wir uns den Begriff des intuitiven Erkennens anhand des Unterschieds in der Erkenntnis der belebten und der unbelebten Natur. Wir bestimmen vier grundlegende Aspekte des intuitiven Erkennens und verweisen auf den Zusammenhang mit der scientia intuitiva des Spinoza, der wie Rudolf Steiner die Intuition als ein unmittelbares Einswerden mit dem göttlichen Grund des Seins angesehen hatte.
Schon in seiner ersten Schrift18 sprach Rudolf Steiner vom intuitiven Erkennen, und zwar im Zusammenhang mit Goethes Anschauungen der organischen Natur. Wir müssen uns daher gleich zu Beginn unserer Untersuchung auf einige schwierige erkenntnistheoretische Überlegungen einlassen, wodurch wir uns aber eine gute Grundlage für die späteren Darstellungen verschaffen werden. Es wird sich nämlich zeigen, dass Rudolf Steiner die wichtigsten Aspekte seines Intuitionsbegriffs schon in den Einleitungen entwickelte.
Wie kann man Lebendiges verstehen? Die materialistische Biologie behauptet, man könne Organismen aus ihren physikalischen und chemischen Bestandteilen erklären. Die lebendige Ganzheit wird dabei stillschweigend vorausgesetzt. Ohne sie wären aber die Gene etc. überhaupt nicht vorhanden. Deshalb erklären nicht die Gene den Organismus, sondern der Organismus die Gene. Immer wieder sprechen Biologen daher auch von der organischen Ganzheit, von dem sich aus sich selbst heraus entwickelnden und gestaltenden Leben. Schon Aristoteles bezeichnete die unsichtbare Lebenskraft, die aus einem Samen die ganze Pflanze heraustreibt, als Entelechie, das Sein-Ziel-in-sich-Tragende, und Francisco Varela (um nur noch einen weiteren von vielen anderen Biologen zu nennen) prägte den Begriff der Autopoiesis, der Selbsterschaffung des Organischen. Doch lässt sich die „Lebenskraft“ nicht dingfest machen. Man kann sie nicht wie andere Stoffe im Organismus finden. Was liegt hier also zu Grunde? Wie kann man das Leben als solches erkennen?19
Um Lebendiges zu verstehen, ist nach Rudolf Steiner eine ganz andere Denkweise notwendig als diejenige der anorganischen Wissenschaften. Ein Kausaldenken im Sinne der Physik und Chemie reicht für die Erkenntnis des Organischen nicht aus. In der toten Natur verursachen sich die Vorgänge auf eine äußerliche Weise, eine Erscheinung bewirkt die andere: Eine Billardkugel stößt die zweite, Wärme dehnt einen Stein aus, die Erde zieht ihn an, etc. Sowohl die Ursachen als auch ihre Wirkungen sind sinnlich wahrnehmbar und wirken in wahrnehmbarer Weise aufeinander. Der Mensch ist bloß der Zuschauer dieses Geschehens. In der organischen Natur könne aber, so Steiner, von einer solchen äußerlichen Verursachung nicht gesprochen werden:
„Alle sinnlichen Qualitäten erscheinen hier … als Folge eines solchen, welches nicht mehr sinnlich wahrnehmbar ist. Sie erscheinen als Folge einer über den sinnlichen Vorgängen schwebenden höheren Einheit. Nicht die Gestalt der Wurzel bedingt jene des Stammes und wiederum die Gestalt von diesem jene des Blattes usw., sondern alle diese Formen sind bedingt durch ein über ihnen Stehendes, welches selbst nicht wieder sinnlichanschaulicher Form ist. … Es genügt die [sinnliche, Anm. CH] Anschauung nicht mehr, wir müssen die Einheit begrifflich erfassen, wenn wir die Erscheinungen erklären wollen.“ (1\73)
In den Organismen scheinen darüber hinaus die Gesetze der anorganischen Natur durchbrochen zu sein. Während z.B. bei einem Kristall die gestaltbildenden Kräfte aus den Eigenschaften der Stoffe erklärbar sind, gilt das nicht für die organischen Gestalten.
„Weil das Objekt nicht von Gesetzen der Sinnenwelt beherrscht erscheint, doch aber für die Sinne da ist, ihnen erscheint, so ist es, als wenn man hier vor einem unlösbaren Widerspruche in der Natur stünde, als wenn eine Kluft bestünde zwischen anorganischen Erscheinungen, welche aus sich selbst zu begreifen sind, und organischen Wesen, bei denen ein Eingriff in die Gesetze der Natur geschieht, bei denen allgemeingültige Gesetze auf einmal durchbrochen würden. Diese Kluft nahm man in der Tat bis auf Goethe allgemein in der Wissenschaft an; erst ihm gelang es, das lösende Wort des Rätsels zu sprechen. Erklärbar aus sich selbst sollte, so dachte man vor ihm, nur die unorganische Natur sein; bei der organischen höre das menschliche Erkenntnisvermögen auf.“ (1\74)
Immanuel Kant habe sogar versucht, „eine wissenschaftliche Begründung dafür zu finden, dass es dem menschlichen Geiste nie gelingen werde, die organischen Bildungen zu erklären. Wohl sah er die Möglichkeit eines Verstandes ein - eines intellectus archetypus, eines intuitiven Verstandes -, dem es gegeben wäre, den Zusammenhang von Begriff und Wirklichkeit bei den organischen Wesen … zu durchschauen; allein dem Menschen selbst sprach er die Möglichkeit eines solchen Verstandes ab. Der menschliche Verstand soll nämlich nach Kant die Eigenschaft haben, dass er sich die Einheit, den Begriff einer Sache nur als hervorgehend aus dem Zusammenwirken der Teile … denken kann, nicht aber so, dass jeder einzelne Teil als der Ausfluss einer bestimmten konkreten … Einheit, eines Begriffes in intuitiver Form erschiene.“ (1\75)
Indirekt, in Anlehnung an Kant, verwendet Steiner hier also zum ersten Mal den Begriff der Intuition, aber eben auch in Abgrenzung zu Kant.
„Auf der Möglichkeit, die Außenwelt durch die Sinne aufzufassen und ihre Wechselwirkung durch Begriffe auszudrücken, beruht die Erkenntnis der anorganischen Natur. Die Möglichkeit, auf diese Art Dinge zu erkennen, sah Kant für die einzige dem Menschen zukommende an. Dieses Denken nannte er diskursives; was wir erkennen wollen, ist äußere Anschauung; der Begriff, die zusammenfassende Einheit, bloßes Mittel. Wollten wir aber die organische Natur erkennen, so müssten wir das ideelle Moment, das Begriffliche nicht als ein solches fassen, das ein anderes ausdrückt, bedeutet, von diesem sich seinen Inhalt borgt, sondern wir müssten das Ideelle als solches erkennen; es müsste einen eigenen aus sich selbst, nicht aus der räumlich-zeitlichen Sinnenwelt stammenden Inhalt haben. Jene Einheit, welche dort unser Geist bloß abstrahiert, müsste sich auf sich selbst bauen, sie müsste sich aus sich heraus gestalten, sie müsste ihrem eigenen Wesen gemäß, nicht nach den Einflüssen anderer Objekte gebildet sein. Die Erfassung einer solchen aus sich selbst sich gestaltenden, sich aus eigener Kraft offenbarenden Entität sollte dem Menschen versagt sein.“ (1\82)
Damit ist bereits Wichtiges über das intuitive Erkennen gesagt. Ein intuitiver Begriff hat einen eigenen, rein ideellen und aus sich selbst, nicht aus der Sinnenwelt stammenden Inhalt. Er gestaltet sich aus sich selbst und drückt die Einheit, das Ganze einer Sache so aus, dass ihre einzelnen Teile als ein „Ausfluss“ dieser Einheit erscheinen (dass also der Zusammenhang der Teile mit dem Ganzen durch den intuitiven Begriff eingesehen werden kann).
Was ist nun zum Erfassen einer solchen, rein ideellen, sich aus sich selbst gestaltenden Entität nötig?
„Eine Urteilskraft, welche einem Gedanken auch einen anderen als bloß einen durch die äußeren Sinne aufgenommenen Stoff verleihen kann, eine solche, welche nicht bloß Sinnenfälliges erfassen kann, sondern auch rein Ideelles für sich, abgesondert von der sinnlichen Welt. Man kann nun einen Begriff, der nicht durch Abstraktion aus der Sinnenwelt genommen ist, sondern der einen aus ihm und nur aus ihm fließenden Gehalt hat, einen intuitiven Begriff und die Erkenntnis desselben eine intuitive nennen.“ [kursiv CH] (1\82)
Das intuitive Denken gibt sich seine Inhalte selbst. Für das intuitive Denken kann auch Nicht-Sinnliches, „rein Ideelles“ so wirklich (so stofflich) sein wie Sinnliches für das gewöhnliche Denken. Steiner weist auf eine schöpferische Tätigkeit („Urteilskraft“), durch die sich das intuitive Denken seinen ideellen „Stoff“ oder „Gehalt“ selbst verleiht.
Intuitiv ist demnach eine Erkenntnis, insofern sie einen rein geistigen (ideellen) Inhalt produktiv hervorbringt, wobei sich der Inhalt selbst gestaltet und bestimmt. Wir haben damit bereits zwei wichtige Aspekte der Intuition genannt, die uns im Weiteren immer wieder begegnen werden. 1.) Intuition, in Steiners Sinn verstanden, beruht auf geistiger Produktivität: Ich schaue geistig etwas an, das ich innerlich selbst hervorbringe. 2.) Was aber durch solche Urteilskraft hervorgebracht wird, ist nicht willkürlich und subjektiv, sondern bestimmt sich inhaltlich selbst.
Steiner entwickelt diese Idee anhand von Goethes Lehre von der Metamorphose der Pflanze. Goethe hatte die Entwicklung vom keimenden Samen über die beblätterte, blühende und fruchttragende Pflanze als Wechselspiel einer dreimaligen Ausdehnung und Zusammenziehung beschrieben: Vom Samen zum Stängel und den Blättern die erste Ausdehnung, dann eine erste Zusammenziehung in den kleiner werdenden Hoch- und oft winzigen Kelchblättern. Von der Knospe zu den entfalteten Blütenblättern eine zweite Ausdehnung, die zweite Zusammenziehung in den Staubgefäßen und dem Stempel der Blüte. Die dritte Ausdehnung vom Fruchtknoten zur voll ausgewachsenen Frucht, die dritte Zusammenziehung zum in der Frucht verborgenen Samen. Wie die erste Ausdehnung und Zusammenziehung nacheinander geschieht, so die zweite nebeneinander und die dritte ineinander; danach beginnt ein neuer Kreislauf. Ein gesetzmäßiger, in sich geschlossener, logisch durchschaubarer raum-zeitlicher Zusammenhang. Dazu Rudolf Steiner:
„Man hat sich nun ganz besonders gegen den Begriff abwechselnder Ausdehnung und Zusammenziehung bei Goethe gewendet. Alle Angriffe darauf aber gehen von einem Missverständnisse aus. Man glaubt, dass diese Begriffe nur dann Gültigkeit haben könnten, wenn sich eine physikalische Ursache für sie finden ließe… Dies zeigt nur, dass man die Sache auf die Spitze statt auf die Basis stellt. Es ist nichts vorauszusetzen, was die Ausdehnung oder Zusammenziehung bewirkt; im Gegenteile: alles andere ist Folge der ersteren, sie bewirken eine fortschreitende Metamorphose von Stufe zu Stufe. Man kann sich eben den Begriff nicht in seiner selbsteigenen, in seiner intuitiven Form vorstellen; man verlangt, dass er das Resultat eines äußeren Vorganges darstellen soll.“ (1\94)
Zum besseren Verständnis ist hier ein kleines Experiment hilfreich. Man kann sich das Wachstum einer Pflanze in ihrer dreimaligen Ausdehnung und Zusammenziehung bildhaft vorstellen. Man vollzieht dabei, indem man sich von einer Entwicklungsstufe zur nächsten fortbewegt, innerlich dasselbe, was auch die Pflanze macht. (Man achte bei dieser kleinen Übung darauf, wie man ebenso wie die Pflanze immer aus dem Ganzen heraus tätig ist.)
„Die Größe dieses Gedankens [der goetheschen Pflanzenmetamorphose] … geht einem nur dann auf, wenn man versucht, sich denselben im Geiste lebendig zu machen, wenn man es unternimmt ihn nachzudenken. Man wird dann gewahr, dass er die in die Idee übersetzte Natur der Pflanze selbst ist, die in unserem Geiste ebenso lebt wie im Objekte.“ (1\12)
Ahmt man die Wachstums- und Entwicklungsbewegungen einer Pflanze innerlich nach, so kann man erleben, wie sie sich entfaltet. Man erfährt die Wachstumskräfte durch die eigene, innerer Tätigkeit und die Gestaltung der Teile nach den Gesetzen des Ganzen. Man verharrt nicht in einem distanzierten Zuschauerbewusstsein, sondern vollzieht eine aktive phänomenologische Partizipation. Man bringt nichts Fremdes zu den äußerlich beobachtbaren Tatsachen hinzu, sondern ahmt eben diese selbst nach, und im phänomenologischen Nachvollzug erlebt man die Entwicklungskräfte und -gesetze des Ganzen unmittelbar. Was in dieser Art erfasst wird, wirkt als Entelechie real im Organismus: Das intuitiv Erlebte ist eine Wirk-lichkeit im eigentlichen Sinne des Wortes. Die in dieser Art lebendig erfasste Idee ist daher „nicht ein bloßer Verstandesbegriff, sie ist dasjenige, was in jedem Organismus das wahrhaft Organische ist, ohne welches derselbe nicht Organismus wäre. … Die Idee des Organismus ist als Entelechie im Organismus tätig, wirksam; sie ist in der von unserer Vernunft erfassten Form nur die Wesenheit der Entelechie selbst. Sie fasst die Erfahrung nicht zusammen; sie bewirkt das zu Erfahrende.“ (1\84)20
Damit ist ein dritter Aspekt des Intuitiven genannt: Das intuitiv Erfasste ist real in der Welt wirkende Wesenheit. Goethe nannte die im Lebendigen wirkende Idee den „Urorganismus“ oder „Typus“.
Rudolf Steiner deutet hier zum ersten Mal einen zentralen Gesichtspunkt der Anthroposophie an: Die Erscheinungen der Sinneswelt (hier: die Organismen) werden durch ein in ihnen wirkendes Geistiges bewirkt und gestaltet, und dieses Geistige kommt im erkennenden Bewusstsein des Menschen in seiner ihm ureigenen Art und Wesenheit zur Erscheinung.
Das intuitive Denken erfasst also in einer schöpferischproduktiven Weise Ideen, die nicht bloß aus der Sinneserfahrung abstrahiert sind, sondern sich vielmehr als nichtsinnliche Wesenheiten inhaltlich selbst bestimmen, ihre Teile vom Ganzen aus erklärlich machen, und die darüber hinaus als in der sinnlichen Erfahrungswelt wirksam erscheinen.
* * *
Mit wenigen Strichen skizziert Steiner dann eine philosophische Einordnung der Intuition. Er bezieht sich auf die scientia intuitiva des Spinoza und weist in diesem Zusammenhang auch auf den maßgeblichen Einfluss hin, den dieser Philosoph auf Goethes Denken über das Lebendige hatte.
„Spinoza unterscheidet drei Arten von Erkenntnis. Die erste Art ist jene, bei der wir uns bei gewissen gehörten oder gelesenen Worten der Dinge erinnern und uns von diesen Dingen gewisse Vorstellungen bilden, ähnlich denen, durch welche wir die Dinge bildlich vorstellen. Die zweite Art der Erkenntnis ist jene, bei welcher wir uns aus zureichenden Vorstellungen von den Eigenschaften der Dinge Gemeinbegriffe bilden. Die dritte Art der Erkenntnis ist nun aber diejenige, bei welcher wir von der zureichenden Vorstellung des wirklichen Wesens einiger Attribute Gottes zur zureichenden Erkenntnis des Wesens der Dinge fortschreiten. Diese Art der Erkenntnis nennt nun Spinoza scientia intuitiva, das anschauende Wissen. Diese letztere, die höchste Art der Erkenntnis, war es nun, die Goethe anstrebte.“ (1\78)
Die Gleichsetzung der scientia intuitiva (des intuitiven Wissens) mit geistiger Anschauung wird uns im Weiteren immer wieder begegnen. In seinen Aufsätzen Die Stufen der höheren Erkenntnis (1905-1908)21 beschrieb Rudolf Steiner ebenfalls drei Stufen des geistigen Erkennens (Imagination, Inspiration und Intuition), die verwandt zu denen des Spinoza sind. Wir kommen später darauf zurück.
* * *
In der Einleitung zum 2. Band von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften (1887) finden wir eine weitere Vertiefung des Ideenverständnisses. Rudolf Steiner liefert nun eine Skizze von Goethes Erkenntnistheorie, eine allgemeine Bestimmung des Verhältnisses von Erfahrung und Denken, von äußerer Erscheinung und innerem, ideellen Wesen. Die Intuition wird zwar nicht explizit erwähnt, aber mit charakteristischen Formulierungen umschrieben, und wir kommen durch die folgenden Gedankengänge zu einem tieferen Verständnis des intuitiven Erkennens, ja der Grundlagen der Anthroposophie. Warum, so fragt Steiner, sind wir von der im Denken erkannten Wirklichkeit befriedigt, von der äußeren dagegen nicht?
„Die anschauliche Wirklichkeit tritt uns als Fertiges gegenüber. Es ist eben da; wir haben nichts dazu beigetragen, dass es so ist. Wir fühlen uns daher einem fremden Wesen gegenüber, das wir nicht produziert haben, ja bei dessen Produktion wir nicht einmal gegenwärtig waren. Wir stehen vor einem Gewordenen. Erfassen aber können wir nur das, von dem wir wissen, … wie es zustande gekommen ist … Bei unserem Denken ist das anders. Ein Gedankengebilde tritt mir nicht gegenüber, ohne dass ich selbst an seinem Zustandekommen mitwirke; es kommt nur so in das Feld meines Wahrnehmens, dass ich es selbst aus dem dunklen Abgrund der Wahrnehmungslosigkeit herauf hebe. Der Gedanke tritt in mir nicht als fertiges Gebilde auf, wie die Sinneswahrnehmung, sondern ich bin mir bewusst, dass, wenn ich ihn in einer abgeschlossenen Form festhalte, ich ihn selbst auf diese Form gebracht habe. Was mir vorliegt erscheint mir nicht als erstes, sondern als letztes, als der Abschluss eines Prozesses, der mit mir so verwachsen ist, dass ich immer innerhalb seiner gestanden habe. Das aber ist es, was ich bei einem Dinge, das in den Horizont meines Wahrnehmens tritt, verlangen muss, um es zu begreifen. Es darf mir nichts dunkel bleiben; es darf nichts als Abgeschlossenes erscheinen; ich muss es selbst verfolgen bis zu jener Stufe, wo es ein Fertiges geworden ist. Deshalb drängt uns die unmittelbare Form der Wirklichkeit, die wir gewöhnlich Erfahrung nennen, zu einer wissenschaftlichen Bearbeitung. Wenn wir unser Denken in Fluss bringen, dann gehen wir auf die uns zuerst verborgen gebliebenen Bedingungen des Gegebenen zurück; wir arbeiten uns vom Produkt zur Produktion empor, wir gelangen dazu, dass uns die Sinneswahrnehmung auf dieselbe Weise durchsichtig wird wie der Gedanke. Unser Erkenntnisbedürfnis wird so befriedigt.“ (1\160)
Beim Denken steht man innerhalb des Entstehungsprozesses. Allerdings bleibt dieses Stehen im Entstehen des Denkens gewöhnlich unbemerkt, denn da achtet man auf das Denkergebnis. (In der Philosophie der Freiheit wird Steiner später in prägnanter Formulierung schreiben: „Das ist die eigentümliche Natur des Denkens, dass der Denkende das Denken vergisst, während er es ausübt.“ [4\42]. Insofern ist das Bemerken dieses Verhältnisses, das man zum Denken hat, schon ein erster Schritt auf dem Weg zu der geistigen „Erweckung“, die Steiner in seinen Schriften nach der Jahrhundertwende darstellte, und die wir im zweiten und dritten Teil besprechen werden.22)
Der zweite wesentliche Aspekt ist der Hinweis, dass auch die Tatsachen der Sinneswelt „auf dieselbe Weise durchsichtig“ werden können wie der Gedanke. Dazu müsse man sein „Denken in Fluss bringen“ und sich „vom Produkt zur Produktion“ emporarbeiten, man müsse auf die „verborgen gebliebenen Bedingungen des Gegebenen“ zurückgehen. Goethe, der das Werden der Pflanzen aktiv nachvollzog, hatte geschrieben, „dass wir uns durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig machten“ (1\81).
„Anschauen“ bedeutet hier also nicht die Betrachtung eines fertig Gegebenen, sondern das Leben in und Erleben einer die Natur nachahmenden Tätigkeit. Man lässt die Pflanze innerlich noch einmal zu dem werden, was sie äußerlich geworden ist. Man vollzieht mit ihr dasselbe, was man auch mit einem Gedanken tun kann, nur, dass man mit dem Werden des Gedankens von Anfang an verbunden ist, die Pflanze einem aber zunächst fremd von außen entgegentrat.
Indem man die äußere Welt in der eigenen Tätigkeit neu erstehen lässt, wird die Kluft zwischen Denken und Erfahrung überwunden. Das Denken produziert dann nicht mehr einen Inhalt, der mit der Natur nichts zu tun hat, sondern nimmt die Welterscheinungen als seinen Inhalt auf; die Natur erscheint nicht mehr dunkel und fremd, sondern wird vertraut und durchsichtig, indem man ihre Werdekräfte mit eigener Aktivität durchdringt.
Indem man bewusst im Entstehungsprozess des Denkens stehen kann, erweckt man sich geistig selbst; indem man zu den verborgenen Ursprüngen und Bedingungen der Welterscheinungen zurückgeht, erkennt man die Welt als aus dem Geist geworden. Denselben Geist, der in einem lebt, findet man auch in der Welt. Schon hier ist die Anthroposophie in nuce zu erkennen.
„Ein Prozess der Welt erscheint nur dann als von uns ganz durchdrungen, wenn er unsere eigene Tätigkeit [geworden] ist.
… Das Denken ist aber der einzige Prozess, bei dem wir uns ganz innerhalb stellen können, in dem wir aufgehen können. Daher muss der wissenschaftlichen Betrachtung die erfahrene Wirklichkeit auf dieselbe Weise als aus der Gedankenentwicklung hervorgehend erscheinen, wie ein reiner Gedanke selbst.
… Wenn wir von dem Wesen eines Dinges oder der Welt überhaupt sprechen, so können wir also gar nichts anderes meinen, als das Begreifen der Wirklichkeit als Gedanke, als Idee. In der Idee erkennen wir dasjenige, woraus wir alles andere herleiten müssen: das Prinzip der Dinge. Was die Philosophen das Absolute, das ewige Sein, den Weltengrund, was die Religionen Gott nennen, das nennen wir, auf Grund unserer erkenntnistheoretischen Erörterungen: die Idee.“ (1\162)
Der Unterschied der „Idee“ von dem „absoluten Weltengrund“ oder „Gott“ liegt darin, dass der Mensch mit ihr im Erkennen eins ist, weil sie seine eigene Tätigkeit ist. Doch obwohl er sie erzeugt, gibt sie sich ihren Inhalt selbst; aber gerade weil er sie erzeugt, offenbart sie sich ihm vollständig. Man ist, so Steiner, in einem Zentrum, das sich wie die Sonne aus sich selbst erhellt.
„Sie fordert kein Hinausgehen über sich selbst. Sie ist die auf sich gebaute, in sich selbst festbegründete Wesenheit. Das liegt nicht etwa darinnen, dass wir sie in unserem Bewusstsein unmittelbar gegenwärtig haben. Das liegt an ihr selbst. Wenn sie ihr Wesen nicht selbst ausspräche, dann würde sie uns eben auch so erscheinen wie die übrige Wirklichkeit: aufklärungsbedürftig. Das scheint denn doch dem zu widersprechen, was wir oben sagten: die Idee erschiene deshalb in einer uns befriedigenden Form, weil wir bei ihrem Zustandekommen tätig mitwirken. Das rührt aber nicht von der Organisation unseres Bewusstseins her. Wäre die Idee nicht eine auf sich selbst gebaute Wesenheit, so könnten wir ein solches Bewusstsein gar nicht haben. Wenn etwas das Zentrum, aus dem es entspringt, nicht in sich, sondern außer sich hat, so kann ich, wenn es mir gegenübertritt, mich mit ihm nicht befriedigt erklären, ich muss über dasselbe hinausgehen, eben zu jenem Zentrum. Nur wenn ich auf etwas stoße, das nicht über sich hinausweist, dann erlange ich das Bewusstsein: jetzt stehst du innerhalb des Zentrums; hier kannst du stehen bleiben. Mein Bewusstsein, dass ich innerhalb eines Dinges stehe, ist nur die Folge von der objektiven Beschaffenheit dieses Dinges, dass es sein Prinzip mit sich bringe.“(1\163)
„… hier kannst du stehen bleiben“ – man kann sich an die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor erinnert fühlen, als Petrus sprach: Hier ist es gut.
Das Zitat zeigt auch wieder die oben genannten Aspekte der Intuition: Sie wird von uns hervorgebracht; sie bestimmt ihren Inhalt selbst; sie ist das Prinzip, das in der Welt wirkt („aus dem alles hervorgeht“). Und – das ist ein vierter Aspekt, auf den wir weiter unten noch genauer eingehen werden – sie vereinigt uns in unserem tiefsten Inneren mit dem weltschöpferischen Prinzip:
„Wir gelangen, indem wir uns der Idee bemächtigen, in den Kern der Welt. Was wir hier erfassen, ist dasjenige, aus dem alles hervorgeht. Wir werden mit diesem Prinzipe eine Einheit; deshalb erscheint uns die Idee, die das Objektivste ist, zugleich als das Subjektivste.“ (1\163)
„Indem sich das Denken der Idee bemächtigt, verschmilzt es mit dem Urgrunde des Weltendaseins; das, was außen wirkt, tritt in den Geist des Menschen ein: er wird mit der objektiven Wirklichkeit auf ihrer höchsten Potenz eins. Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. Das Denken hat den Ideen gegenüber dieselbe Bedeutung wie das Auge dem Lichte, das Ohr dem Ton gegenüber. Es ist Organ der Auffassung.“ (1\125)
Steiner spricht hier schon keimhaft „im Gewande des Idealismus“23 aus, was er nach der Jahrhundertwende auf mystische, dann christliche, dann theosophische und schließlich auf anthroposophische Weise darstellte.
18Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften. GA 1. Dornach 1987. (Die Einleitungen bestehen aus vier Teilen, die 1884, 1887, 1890 und 1897 erschienen.)
19 Für eine ausführliche Diskussion siehe Christoph Hueck: Evolution im Doppelstrom der Zeit. Die Erweiterung der naturwissenschaftlichen Entwicklungslehre durch die Selbstanschauung des Erkennens. Dornach 2012.
20 In diesem Sinne fügt Steiner noch einen erhellenden Vergleich zwischen Mechanismus und Organismus an: „Dies ist eben der Gegensatz des Organismus zur Maschine. Bei der letzteren ist alles Wechselwirkung der Teile. Es existiert nichts Wirkliches in der Maschine selbst außer dieser Wechselwirkung. Das einheitliche Prinzip, welches das Zusammenwirken jener Teile beherrscht, fehlt im Objekte selbst und liegt außerhalb desselben in dem Kopfe des Konstrukteurs als Plan. Nur die äußerste Kurzsichtigkeit kann leugnen, dass gerade darinnen die Differenz zwischen Organismus und Mechanismus besteht, dass dasjenige Prinzip, welches das Wechselverhältnis der Teile bewirkt, beim letzteren nur außerhalb (abstrakt) vorhanden ist, während es bei ersterem in dem Dinge selbst wirkliches Dasein gewinnt. So erscheinen dann auch die sinnlich wahrnehmbaren Verhältnisse des Organismus nicht als bloße Folge aus-einander, sondern als beherrscht von jenem inneren Prinzipe, als Folge eines solchen, das nicht mehr sinnlich wahrnehmbar ist. In dieser Hinsicht ist es ebensowenig sinnlich wahrnehmbar, wie jener Plan im Kopfe des Konstrukteurs, der ja auch nur für den Geist da ist; ja es ist im wesentlichen jener Plan, nur dass er jetzt eingezogen ist in das Innere des Wesens und nicht mehr durch Vermittlung eines Dritten - jenes Konstrukteurs - seine Wirkungen vollzieht, sondern dieses direkt selbst tut.“ [kursiv CH] (1\73)
21Die Stufen der höheren Erkenntnis. GA 12. Dornach 1979.
22 Tatsächlich ist es so, dass das bewusste Stehen im Entstehen des Denkens der übersinnlichen Erkenntnisstufe der Imagination zugrunde liegt.
23 „Ich verfasste innerhalb dieses Sammelwerkes Einführungen in Goethes Botanik, Zoologie, Geologie und Farbenlehre. Wer diese Einführungen liest, wird darin schon die theosophischen Ideen in dem Gewande eines philosophischen Idealismus finden können.“Dokument von Barr. In: Briefwechsel und Dokumente. GA 262. Dornach 1967, S. 9.
GRUNDLINIEN EINER ERKENNTNISTHEORIE DER GOETHESCHEN WELTANSCHAUUNG(1886) – INTUITION ALS WISSENSCHAFTLICHE METHODE
In diesem Kapitel blicken wir noch einmal auf die intuitive Erkenntnis des organischen Typus und beschreiben den Zusammenhang zwischen Intuition und anschauender Urteilskraft, bei der Form und Inhalt des Erkannten zusammenfallen. Wir beschäftigen uns mit der Intuition als einer wissenschaftlichen Methode, die unmittelbar in die Wahrheit einer Sache einzudringen vermag und bestimmen den Menschen als den Träger des intuitiv zu erkennenden Weltinhaltes.
Vor der Herausgabe des 2. und 3. Bandes der Einleitungen erschienen 1886 die Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung24, in denen Rudolf Steiner das Verhältnis von Denken und Erfahrung systematisch ausarbeitete. Gegen Ende des Buches finden sich Ausführungen über Goethes Erkenntnis des Lebendigen sowie eine Besprechung der Intuition als wissenschaftliche Methode.
Zur Erkenntnis des Organischen heißt es wie schon in den Einleitungen, dass das Erfassen des Typus „eine intensivere Tätigkeit unseres Geistes“ voraussetze, als das Nachdenken über anorganische Phänomene:
„Bei dem Nachdenken über die Dinge der unorganischen Natur gibt uns die Wahrnehmung der Sinne den Inhalt an die Hand. Es ist unsere sinnliche Organisation, die uns hier schon das liefert, was wir im Organischen nur durch den Geist empfangen. … Wir haben da im Denken zu dem Stoffe nur die Form zu finden. Im Typus aber sind Inhalt und Form enge aneinander gebunden. Deshalb bestimmt der Typus ja nicht rein formell wie das Gesetz den Inhalt, sondern er durchdringt ihn lebendig, von innen heraus, als seinen eigenen. An unseren Geist tritt die Aufgabe heran, zugleich mit dem Formellen produktiv an der Erzeugung des Inhaltlichen teilzunehmen.“ (2\109)
Eine merkwürdig aristotelische Formulierung (vgl. Aristoteles’ Unterscheidung von Materie und Form, S. → ff.). In der anorganischen Natur wirkt das Gesetz rein formell, die Wahrnehmung kommt von außen, der Begriff von innen, beide stehen sich getrennt gegenüber. Beim Organischen muss aber auch der Inhalt „durch den Geist empfangen“ werden. Was man von Lebewesen durch die Sinne wahrnehmen kann, ist eben gar nicht das eigentlich Organische! Es ist nur die gegenwärtige, geronnene Gestalt, ein Ausschnitt aus einem fortwährend lebendigen Entwicklungs- und Verwandlungsgeschehen. Die Entwicklung eines Organismus, den lebendigen Zusammenhang seiner Organe kann man nicht sehen, sondern nur denken und im aktiven Denken anschauend erleben. Indem man ihn nach den Gesetzmäßigkeiten des Typus denkt, durchdringt der Typus die – geistige – Anschauung (den geistigen Inhalt) „lebendig, von innen heraus, als seinen eigenen“.25
Auch hier benennt Rudolf Steiner die entsprechende Fähigkeit nach dem philosophischen Sprachgebrauch:
„Man hat von jeher eine Denkungsart, welcher der Inhalt mit dem Formellen in unmittelbarem Zusammenhange erscheint, eine intuitive genannt.“ (2\109)
Was im Erkennen des Anorganischen die Sinne liefern, muss beim Organischen der Geist produzieren:
„Unser Geist muss … in dem Erfassen des Typus viel intensiver wirken als beim Erfassen eines Naturgesetzes. Er muss mit der Form den Inhalt erzeugen. Auf dieser höheren Stufe muss also der Geist selbst anschauend sein. Unsere Urteilskraft muss denkend anschauen und anschauend denken. Wir haben es hier, wie Goethe zum erstenmal auseinandergesetzt, mit einer anschauenden Urteilskraft zu tun.“ (2\110)
Steiner wird später auf diesen Aspekt der geisteswissenschaftlichen Erkenntnismethodik immer wieder zurückkommen, dass nämlich die geistige Anschauung auf Produktivität beruht, ja Produktivität ist, ein aktives Erzeugen oder besser: Hervorbringen von Inhalten, die nur innerhalb der schöpferischen Geistes-tätigkeit des Menschen erscheinen, und die doch inhaltlich durch sich selbst bestimmt sind. Steiner lässt keinen Zweifel, dass er mit der anschauenden Urteilskraft die Intuition meint:
„Vertritt der Typus in der organischen Natur das Naturgesetz (Urphänomen) der unorganischen, so vertritt die Intuition (anschauende Urteilskraft) die beweisende (reflektierende) Urteilskraft.“ (2\110)26
Die reflektierende Urteilskraft denkt über etwas nach, man bleibt Zuschauer, das Bewusstsein von der Sache getrennt. Die anschauende Urteilskraft bringt ihre Erkenntnisse aktiv hervor; von Anfang an ist sie deshalb mit dem durch sie erkannten Wesen eins.
* * *
Im Folgenden rechtfertigt Rudolf Steiner dann die Intuition als wissenschaftliche Methode. Die Darstellung ist ebenso grundlegend für das Verständnis der Anthroposophie wie die Einsicht in den Produktivitätscharakter der geistigen Anschauung. Steiner geht dabei zunächst von Wissen und Glauben aus:
„Was auf intuitivem Wege erreicht wird, halten viele zwar für sehr wichtig, wenn es sich um eine wissenschaftliche Entdeckung handelt. Da, sagt man, führt ein Einfall oft weiter als methodisch geschultes Denken. Denn man nennt es ja häufig Intuition, wenn jemand durch Zufall ein Richtiges getroffen, von dessen Wahrheit sich der Forscher erst auf Umwegen überzeugt. Stets wird aber geleugnet, dass die Intuition selbst ein Prinzip der Wissenschaft sein könne. Was der Intuition beigefallen, müsse nachträglich erst erwiesen werden - so denkt man - wenn es wissenschaftlichen Wert haben soll. … Zu der geringschätzenden Art, mit der man die Intuition behandelt, trägt nicht wenig bei, dass man ihren Errungenschaften nicht jenen Grad von Glaubwürdigkeit beilegen zu können meint wie den der beweisenden Wissenschaften. Man nennt oft allein, was man bewiesen hat, Wissen, alles übrige Glaube.“ (2\111)
Dann erweitert er diese Polarität um die Intuition als ihrer Steigerung oder Synthese:
„Wer in der uns vorliegenden Welt … nichts weiter sieht als einen Abglanz, ein Bild von einem Jenseitigen, einem Unbekannten, Wirkenden, das hinter dieser Hülle nicht nur für den ersten Blick, sondern aller wissenschaftlichen Forschung zum Trotz verborgen bleibt, der kann allerdings nur in der beweisenden Methode einen Ersatz für die mangelnde Einsicht in das Wesen der Dinge erblicken. Da er nicht bis zu der Ansicht durchdringt, dass eine Gedankenverbindung unmittelbar durch den im Gedanken gegebenen wesenhaften Inhalt, also durch die Sache selbst zustande kommt, so glaubt er sie nur dadurch stützen zu können, dass sie mit einigen Grundüberzeugungen (Axiomen) im Einklange steht, die so einfach sind, dass sie eines Beweises weder fähig sind, noch eines solchen bedürfen.
Unsere Weltansicht … hat uns zu der Ansicht geführt, dass der Kern der Welt in unser Denken einfließt, dass wir nicht nur über das Wesen der Welt denken, sondern dass das Denken ein Zusammengehen mit dem Wesen der Wirklichkeit ist. Uns wird mit der Intuition nicht eine Wahrheit von außen aufgedrängt, weil es für unseren Standpunkt ein Außen und Innen in jener Weise, wie es die von uns eben gekennzeichnete, der unserigen entgegengesetzte wissenschaftliche Richtung annimmt, nicht gibt. Für uns ist die Intuition ein unmittelbares Innesein, ein Eindringen in die Wahrheit, die uns alles gibt, was überhaupt in Ansehung ihrer in Betracht kommt. Sie geht ganz in dem auf, was uns in unserem intuitiven Urteile gegeben ist. Das Charakteristische, auf das es beim Glauben ankommt, dass uns nur die fertige Wahrheit gegeben ist und nicht die Gründe, und dass uns der durchdringende Einblick in die in Betracht kommende Sache abgeht, fehlt hier gänzlich. Die auf dem Wege der Intuition gewonnene Einsicht ist gerade so wissenschaftlich wie die bewiesene.“ (2\112)
Als Beispiel blicken wir noch einmal auf die Idee des dreimaligen Wechsels von Ausdehnung und Zusammenziehung im Wachstum der (einjährigen Blüten-)Pflanze: zuerst nach-, dann neben- und dann ineinander (s.o.). Diese Idee beschreibt nichts anderes, als was sinnlich an der Pflanze zu beobachten ist, und doch beschreibt sie es so, dass der Vorgang der Metamorphose in seiner Gesetzmäßigkeit innerlich einsichtig wird. Man braucht keine weitere Begründung, weil die wirkliche Anschauung der Pflanze ihre Idee selbst begründet.27
Für eine Auffassung, für die das Wesen der Wirklichkeit verborgen ist, kann sich das Erkennen nur auf die beweisende Methode stützen. Das wird von der Naturwissenschaft vertreten, die in ihren Gedanken über die Natur nur Modelle der eigentlichen, hinter den Erscheinungen verborgen geglaubten Wirklichkeit sieht. Das Subjekt fühlt sich von der Welt getrennt und kann daher nie sicher sein, dass seine Erkenntnisse etwas mit der wahren Wirklichkeit zu tun haben. Sicherheit kann nur ein Beweis liefern, durch den die Kraft der Überzeugung aus dem äußerlich Angeschauten fließen muss.28