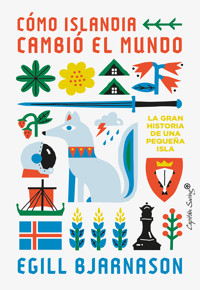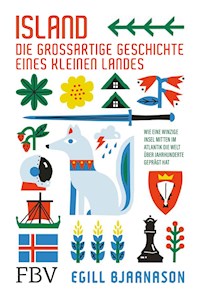
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nicht erst seit sich die rebellischen Fußballer dieser kleinen Nation überraschend für die Fußball-WM 2018 qualifizierten oder seit dem Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 sorgt Island für Aufsehen. Die Geschichte Islands begann vor 1.200 Jahren, als ein frustrierter Wikingerkapitän mitten im Nordatlantik auf Grund lief und dabei ein neues Land entdeckte. Plötzlich war die Insel nicht mehr nur ein Zwischenstopp für die Küstenseeschwalbe, sondern wurde zu einer Nation, deren Politiker und Musiker, Seeleute und Soldaten, Vulkane und Blumen den Globus für immer veränderten. Das Buch nimmt die Leser mit auf eine Reise durch die Geschichte und zeigt ihnen, wie Island bei so unterschiedlichen Ereignissen wie der Französischen Revolution, der Mondlandung und der Gründung Israels eine zentrale Rolle spielte. Immer wieder stand eine bescheidene Nation an vorderster Front historischer Ereignisse und prägte die Welt, wie wir sie kennen. Die bisher unerzählte großartige Geschichte eines kleinen Landes, so fantastisch erzählt, als hätte man Bill Bryson zum Schreiben auf der Insel ausgesetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ISLAND
DIE GROSSARTIGE GESCHICHTE EINES KLEINEN LANDES
WIE EINE WINZIGE INSEL MITTEN IM ATLANTIK DIE WELT ÜBER JAHRHUNDERTE GEPRÄGT HAT
EGILL BJARNASON
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2023
© 2023 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0 Fax: 089 652096
Copyright der Originalausgabe © 2021 by Egill Bjarnason. All rights reserved. Die englische Originalausgabe erschien bei Penguin Books, an imprint of Penguin Random House LLC unter dem Titel How Iceland Changed the World. The Big History of a Small Island.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Britta Fietzke
Redaktion: Christiane Otto
Korrektorat: Susanne Schneider
Umschlaggestaltung: Catharina Aydemir, in Anlehnung an das Cover der Originalausgabe
Abbildungen Innenteil: © 2021 The Heads of State
Satz: Zerosoft, Timişoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-620-7
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-169-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-170-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Einleitung
1 Die Entdeckung des Westens
2 Das mittelalterliche Erbe
3 Island verursacht eine Klimaschwankung
4 Nationalismus
5 Der Zweite Weltkrieg
6 Die Entstehung Israels
7 Die Mondlandung
8 Der Kalte Krieg
9 Die Gleichberechtigung der Geschlechter
Nachwort
Danksagung
Über den Autor
Für Fyrir Val & Frey
Einleitung
Der Ort Selfoss ist eine seltene Rarität. Fast alle der 63 Orte und Städte auf Island wurden aufgrund nautischer Zweckmäßigkeit nah am Meer und sichtbar für herannahende Schiffe gegründet, aber Selfoss liegt im Landesinneren, abseits der steinigen Küste. Ich wuchs dort, eingeschlossen von Land, auf.
Der Ort liegt am Ostufer der Ölfusá, dem landesweit größten Fluss, der einem Gletscher 170 Kilometer entfernt im Landesinneren entspringt. Während der ersten 900 Jahre nach der Gründung von Selfoss sah die Gegend nur wenige Reisende, weil die Flussüberquerung zu Pferd oder per Ruderboot eine lebensgefährliche Unternehmung darstellte, zudem war es, wenn wir mal ehrlich sind, das Ganze auch nicht wert. Die isländischen und dänischen Oberen setzten aber ein symbolisches Zeichen mit der Entscheidung für den gemeinsamen Bau einer Hängebrücke. Diese verband den Westen mit dem Süden Islands, als sie 1891, also noch 13 Jahre vor dem ersten Auto, fertiggestellt wurde. Selfoss wurde nun zu einem Halt für Langzeitreisende – der Ort, an dem man seine Kleidung trocknen und sich von anderen Reisenden aus der entgegenkommenden Richtung über die Wetterlage aufklären lassen konnte. Heute halten die Menschen wegen der Hotdogs an.
Die Brücke bringt nach wie vor viel Verkehr in den Ort und dient als zentrale Wegmarke, um die sich alles andere dreht, ähnlich einem Hafen bei einer Hafenstadt. Wo andere Orte eine Fischfabrik haben, haben wir einen Molkereibetrieb. Und statt die Schiffe zu beobachten, die in und aus dem Hafen fahren, können wir unsere Autos beobachten, die immer und immer wieder vorbeifahren – der wichtigste Kreisverkehr ist unfassbar groß. »Großstadtgroß« – immerhin ist Selfoss mit seinen ungefähr 8000 Einwohnern einer von Islands größten Orten. Man darf sich also nicht von der Größe einschüchtern lassen, wenn man durch den Ort läuft, und auch nicht von der Tatsache, dass man dabei allein unterwegs ist – durch Selfoss laufen nur Kinder oder ab und an betrunkene Autofahrer, denen der Führerschein entzogen wurde.
Entlang der Hauptstraße von Selfoss finden sich unter anderem fünf Friseure, drei Bankfilialen, eine Buchhandlung, die meinen Eltern gehört, ein Geschäft für Garn, ein Geschäft für Weihnachtsdekorationen und ein Supermarkt namens Krónan. Vor dem Eingang von Letzterem begann auch meine Karriere als Journalist, mit einem Notizbuch und der günstigsten Kamera bewaffnet, die ich mir von Sunnlenska, einer Lokalzeitung, hatte ausleihen können. Täglich versuchte ich dort, die vorbeilaufenden Passanten für »Die Frage des Tages« abzufangen, eine Kolumne, in der unschuldige Fußgänger aufgefordert wurden, ihre Meinung zu einem aktuellen Thema zu äußern, über das sie letztlich fast gar nichts wussten, und – nach der gesicherten intellektuellen Peinlichkeit – für ein Foto stillzuhalten, das neben der Antwort abgedruckt werden sollte.
Im Laufe der Zeit arbeitete ich mich hoch in die Nachrichtenredaktion. Eine frühe Headline von mir besagte: »Masken waren nicht zum Schwimmen! Beutel voller Sexspielzeug in Schwimmbad gefunden«. Ein anderes Mal verfasste ich einen Kriminalbericht über einen Tomatenzüchter, der Marihuana in einem verlassenen Schlachthof anbaute. Er gab darin zu, dass das Leben als heimlicher Drogenkönig in einer kleinen Gemeinschaft ganz schön stressig sei. Er habe daher das meiste Gras selbst konsumiert.
Sunnlenska blieb dank seines sehr einfallsreichen Besitzers meine frühen Zwanziger über im Geschäft. Eine seiner fabelhaften Ideen für das Überleben war die Nutzung eines Tauschsystems: Er bezahlte Leute lieber mit Waren als mit Geld, also mit dem, was die örtlichen Unternehmer für Werbung eintauschten. Der Weihnachtsbonus bestand zum Beispiel aus Feuerwerkskörpern und einem Stapel Bücher, die der Zeitung zur Besprechung zugeschickt worden waren. An einem der Zahltage kam er auf einem Mongoose-Rad angefahren, einem Tourenrad mit 27 Gängen, breiten Reifen und einem Gepäckträger. »Das gehört jetzt dir«, verkündete er voller Enthusiasmus, der wohl primär auf seinem offensichtlichen Werbedeal zurückzuführen war. Null Komma null in Scheinen als Bezahlung diesen Monat.
Um meinen Lohn auch wirklich zu genießen, musste ich damit eine Runde drehen. Und einer der besten Aspekte Selfoss’, wie ein Reiseführer schnell zu erwähnen weiß, ist die Tatsache, wie leicht man den Ort verlassen kann. Die Route 1, die berühmte Ringstraße, führt mitten durch die Stadt.
Mit einem Zelt und einer beeindruckenden Menge an Couscous beladen, radelte ich an der Molkerei vorbei und um den Kreisverkehr herum in Richtung Osten.
Hringvegur bzw. Þjóðvegur 1 ist eine 1322 Kilometer lange Ringstraße, an die die meisten Ortschaften und Dörfer des Landes angeschlossen sind. Wenn man ohne Pause durchfährt, kann man es in 15 Stunden schaffen – auf dem Rad dauert es allerdings ein wenig länger. Die Landschaft Islands ist bekannt für ihre Unebenheit und an der Küste weht eine steife Brise. Zudem kann einfach keine Statistik und kein Wettermuster erklären, warum einem der Wind immer ins Gesicht bläst, während man auf dem Rad sitzt. Wirklich immer. Immer.
Mein eingetauschtes Rad hielt sich wacker, aber dank unstetem Gegenwind und den langen Bergaufstrecken war ich nach der ersten Hälfte völlig erschöpft und entschied mich für eine Pause in der Ortschaft Húsavík.
Húsavík befindet sich an der Nordküste und überblickt die Skjálfandi-Bucht. Die Buchtöffnung richtet sich gen hohen Norden, in Richtung der Islandsee, der Grönlandsee, dem arktischen Ozean und, noch weiter, dem Nordpol.
Ich spazierte mit schmerzendem Knie durch den Hafen und begann ein Gespräch mit einem Kapitän eines der hölzernen Schoner, dessen Crew noch eine Person gebrauchen konnte. Schnell erfuhr ich, dass »eine Person brauchen« bedeutete, dass die Crew momentan nur aus einer Person bestand: ihm, Käpt’n Hordur Sigurbjarnarson, einem fast schon einer Karikatur eines alten Skippers ähnelnden Mann, das klassische Bild, aber ohne Holzpfeife (er war strikter Nichtraucher). Reibeisenstimme, graues Haar, grimmiges Gesicht, fester Handschlag. Herzliches Lächeln.
Ich erzählte ihm von meiner Theorie, dass die Windrichtung fast schon auf magische Weise immer gegen einen arbeite. Er konnte das anscheinend nicht nachvollziehen.
»Also, wird dir schlecht auf See?«, stellte er seine erste Frage bei dem plötzlichen Jobinterview.
Woher sollte ich das wissen? Das wäre, als würde man mich fragen, ob ich zur Weltraumkrankheit neigte (der Variante der Reiseübelkeit bei Astronauten). Die Hochsee befand sich völlig jenseits meines Erfahrungshorizonts, mein Körper war diesbezüglich also noch nie getestet worden. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Seemannsknoten eine absolut essenzielle Überlebensfähigkeit war.
Er kratzte sich am Kopf und legte den Kopf schräg, als würde er Wasser aus seinem Ohr laufen lassen. »Komm am Nachmittag noch mal vorbei, und wir schauen, was passiert.«
Es sollte sich herausstellen, dass ich nicht zu den 35 Prozent der Bevölkerung gehörte, die anfällig für die Seekrankheit waren. Ich schloss das Fahrrad ab und rief die Zeitung an, um mitzuteilen, dass ich in diesem Sommer nicht wiederkommen würde. Der Besitzer war kurz davor, einen großen Werbevertrag mit einem Whirlpool-Händler zu landen. Nach Wochen auf kalter See sollte ich mir manchmal die Frage stellen, ob meine Entscheidung die richtige gewesen war: Ein Whirlpool klang nun wie eine höchst verlockende Idee.
Ich durchlief einen Crashkurs an Knoten und Flaggleinen, arbeitete bei eiskalten Bedingungen zwölf Stunden am Stück und trug die knallgelbe Weste, die mir der Käpt’n gegeben hatte. »Das ist die erste Farbe, die das Auge wahrnimmt, falls du mal über Bord gehen solltest«, versicherte er mir.
Der Käpt’n war durch und durch Seefahrer. Seine fünf liebsten Beläge auf einer Pizza kamen alle aus dem Meer – letztlich also ein Fischbuffet auf Brot – und er konnte, selbst wenn er an Land in einer Eisenwarenhandlung stand, immer den Norden anzeigen. Mein fehlender Orientierungssinn wiederum war ihm ein Rätsel. Er segelte seit 25 Jahren mit der Hildur aus Húsavík heraus und nahm Passagiere für Walbeobachtungen oder Vergnügungsfahrten mit.
Nach diesem ersten glücklichen Sommer wurde die Schiffskabine zu meinem jährlichen Sommerzuhause. Danach ging es für mich jedes Jahr Anfang Mai nach Húsavík, und wir fuhren unter 250 Quadratmetern gespannter Segel mit Passagieren, die scharf auf Wale und Papageientaucher waren, an Bord aus dem Hafen. Jeden Tag erzählten wir die gleichen Geschichten und machten die gleichen Witze, vom Frühling bis in den Herbst – bis sich dann die Wale aus der Bucht heraus und von Island her in alle Ecken der Welt verteilten.
Es war mein erstes Mal auf See, aber es war auch das erste Mal, dass mir Islands merkwürdige Position bewusst wurde, sowohl als marginalisierte Kuriosität als auch als globaler Knotenpunkt. Wohlmeinende Touristen stellten Fragen, die von erstaunlich bis leicht beleidigend rangierten, zum Beispiel ob denn das Land genügend ausgebildete Menschen hätte, um eine funktionierende Regierung am Laufen zu halten. Alle Besucher schienen eine vorgefasste Meinung über Island zu haben. Island, der fremde Planet. Island, die gefrorene Einöde. Island, der teure Tummelplatz. Island, die Wikingerfeste. Der Käpt’n und ich versuchten dann manchmal, während wir die See nach Walen absuchten, diese Mythen zu entwirren oder herauszufinden, welche davon sich am wahrsten anfühlten.
»Wale lassen die Einbildungskraft der Menschen auf Hochtouren laufen«, sagte der Käpt’n eines Tages zu mir. »Es reicht schon ein flüchtiger Blick auf sie, und schon haben die Leute das Gefühl, sie hätten das ganze Tier gesehen, von Maul bis Fluke.« Mit Island verhält es sich ähnlich.
Dieses Buch erzählt die Geschichte Islands, indem es den westlichen Geschichtskanon etwas genauer unter die Lupe nimmt. Es mag vielleicht auf den ersten Blick etwas gewagt erscheinen, Island als Hauptakteur auf der Weltbühne zu präsentieren, immerhin hatte Island nie eine eigene Militärstreitmacht und hat nie ein anderes Land beschossen. Es hat nie gegen einen Führer eines anderen Lands intrigiert oder einen Stellvertreterkrieg geführt oder den Anspruch erhoben, irgendeine Hegemonialmacht innezuhaben. Wie aber erklärt man die ganzen Fingerabdrücke, die es überall auf der westlichen Geschichte hinterlassen hat? Ohne die Isländer hätte niemand die nordische Mythologie festgehalten oder die mittelalterliche Geschichte der nordischen Könige. Ohne Island hätte die Welt zwischen England und Ägypten keine riesige Seuche durchlebt, was ein fragiles politisches Klima erschuf, aus dem wiederum die Französische Revolution hervorgehen sollte. Der antiimperialistische Kampf hätte mit einem Helden weniger auskommen müssen. Neil Armstrong hätte niemals die Mondlandung auf der Erde üben können. Ein Schachspiel, das den Kalten Krieg prägen sollte, hätte keinen Austragungsort gehabt. Die Welt hätte noch weitere Jahre auf eine erste Frau als Staatsoberhaupt warten müssen. Und der Nordatlantik wäre vielleicht unter die Kontrolle der Nazis statt der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs gekommen, inklusive all den daraus möglicherweise resultierenden Nachwehen.
Ich zeige hier eine neue Perspektive auf Islands Geschichte auf, eine, die sich um das Leben einiger bekannter und unbekannter Isländer webt, um so die Geschichte zu erzählen, die sowohl auf der neuesten Forschung als auch auf vernachlässigten Erzählungen basiert. Zusammen ergeben die Kapitel eine bemerkenswerte Chronik Islands: eine 1200 Jahre lange Siedlungsgeschichte, die begann, als ein frustrierter Wikingerkapitän und sein unfähiger Navigator in der Mitte des Nordatlantiks überraschend auf Grund liefen. Plötzlich war die Insel nicht mehr nur ein Zwischenhalt für die Küstenseeschwalbe, sondern wurde zu einer Nation von Diplomaten und Musikern, Seglern und Soldaten, die sich im Angesicht einer enormen Verantwortung wiederfanden und leise die Welt für immer veränderten.
Käpt’n Hordur sollte zu einem lebenslangen Freund werden, der mir auf unseren Segeltörns nach Grönland, Norwegen, Schweden und Dänemark die wichtigsten Recherchen für dieses Buch ermöglichte.
Auf unserer ersten Reise ins Ausland, drei Jahre nach unserem Kennenlernen, stand eine kleine Gruppe von etwas mehr als 20 Menschen zum Abschied winkend auf dem Hafenkai. Es war ein sonniger Sommertag. Die Ehefrau des Ersten Offiziers warf ihm vom Dock aus Küsse zu. Von der Magie des Moments angezogen, schlossen sich ein paar Touristen von einem nahe gelegenen Hotdog-Stand der Gruppe an und winkten mit. Die Spring war gelöst, das Schiff glitt von dannen und der fünfjährige Enkel des Käpt’n rief immer lauter und vehementer, je weiter wir uns entfernten, sodass ich schon fast fürchtete, er könnte einen Herzinfarkt erleiden. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!
Das Leben zu See war einfach, wenn auch unfassbar unvorhersehbar. Die einzige Konstante war die Sorge – über die Wind- und Wetterbedingungen. Rückenwind schob das Schiff mal acht nautische Meilen nach vorn, während schlechte Winde und Strömungen auch mal unser Vorankommen auf vier oder fünf Knoten verlangsamten. Die Zeit spulte sich auf komische Art ab, denn sie wurde weniger mithilfe von Stunden gemessen als vielmehr mithilfe des langsamen, geplanten Kurses über das Meer. Dieses Meer erstreckte sich in schier unendlicher Weite in alle Richtungen, und das Tag für Tag. Wasser. Wasser. Wasser. Land!
Wir hatten unser Ziel erreicht: die Küste Grönlands. Dort segelten wir mit unseren Passagieren um den Kangertittivaq, den längsten Fjord der Welt und eines der größten natürlichen Areale der Welt, dem Massentourismus noch erspart bleibt. Große Eisberge liegen an den Ausläufern der massiven grönländischen Eiskappe. Gegen Sommerende verdünnt das geschmolzene Eis das Salzverhältnis im Meer so sehr, dass man es zum Kochen von beispielsweise Pasta oder Kartoffeln nutzen kann. Als Schiffskoch konnte ich das Meereswasser sogar zum Abwaschen oder Brotbacken nutzen, den Brotteig zu einem »Meereswasserlaib« verknetend. Käpt’n Hordur aß das Brot mit großem Eifer, obwohl es lächerlich salzig schmeckte, aber er war einfach ein großer Fan von Sparsamkeit.
Das war auch der Grund dafür, dass unser Käpt’n große Probleme beim Betrachten unserer Passagiere hatte: Er wurde unruhig, wenn er die Leute beim Nichtstun auf dem Deck sah. Sobald sie nicht manische Fotografen oder zwanghafte Stricker oder mit einer anderen kontinuierlichen und produktiven Aktivität beschäftigt waren, erfand er gern Aufgaben für sie. Am Ende all unserer achttägigen Törns hatten meist alle eine nautische Verantwortung übertragen bekommen, wie dem Käpt’n bei der abendlichen Eisbergwache oder dem morgendlichen Ankerlichten zu helfen.
Die von uns besegelten Fjorde und erwanderten Berge hatten meist zwei Namen: einen aus der Zeit, in der die Gegend von den Europäern kartiert worden war, und einen, den die örtlichen Inuit nutzten. Die Namen Letzterer waren eher beschreibender Natur – der Fjord mit dem Roten Berg, der Grat mit den Zwillingsbergen –, sodass die Ortsansässigen die Menschen auf Durchreise mit Beschreibungen anleiten konnten. Unsere europäischen Seekarten waren jedoch eher ein Denkmal für die verstaubten, lang verstorbenen Entdecker und Seefahrer, die die Gegend nach sich selbst, ihren Müttern und allen, die sie (zumindest namentlich) respektierten, benannt hatten: Carlsberg-Fjord, Liverpool-Land, Charcot-Bucht. Eins der englischen Walschiffe, das vor einem Jahrhundert die Küste im Zickzack abfuhr, schöpfte die Liste der Namen so weit aus, dass sogar der Name des Deckschrubbers benutzt wurde.
Dieser Trick ist so alt wie Grönland selbst.1 Erik der Rote, der von Island ins Exil verbannt worden war, führte andere von Island weg, um auf Grönland die erste europäische Kolonie zu gründen, die er dann Eriksfjord nannte. Eine der Personen, die ihm in dieses Abenteuer in ein fremdes neues Land folgten, war eine beeindruckende Frau und bemerkenswerte Entdeckerin: Gudridur Thorbjarnardottir.
Gudridur hörte in Eriksfjord, nach der Ansiedlung in Südwestgrönland, das Gerücht einer mit vielen Bäumen reich bewachsenen Landmasse auf der anderen Seite des Meeres, einem Land noch weiter westlich, als es jede Karte zeigte. Nach zwei gescheiterten Anläufen vollendete Gurdidur endlich diese Reise gen Westen, auch wenn jeder Anlauf sie jeweils einen Ehemann gekostet hatte. Sie landete 500 Jahre vor Kolumbus in Nordamerika und gebar dort den ersten europäisch-amerikanischen Einwohner.
Die Isländer fanden das unkolonisierte Amerika ziemlich enttäuschend und verließen es daher wieder – um diesen riesigen Kontinent dann die nächsten 800 Jahre wieder mehr oder weniger zu vergessen. Die Geschichtsbücher wiederum vergaßen Gudridur und ihre Tapferkeit. Sie jedoch sollte wieder zurück nach Europa segeln, bis nach Rom reisen und dann wieder zurück auf ihr Gut auf Island ziehen, wo sie dann auch sterben sollte. Die amerikanische Siedlung verschwand wieder, verrottete mit der Zeit und versank unter dem Gras.
Als Käpt’n Hordur und ich zwei Monate später wieder in den Hafen segelten, stand dort die gleiche Gruppe an Menschen, immer noch winkend, als hätten sie den Platz nie verlassen.
Auf dem Meer ist jeder Tag eine endlose Aneinanderreihung von Wendungen und Risiken, daher sind zwei Monate eine sehr lange Zeit. Aber als ich wieder in den Alltag zurückkehrte, den ich so abrupt verlassen hatte, fühlten sich meine Erinnerungen an die Eisberge, die so hoch wie Wolkenkratzer sind, und an die umherschweifenden Eisbären weniger wie jüngste Ereignisse, sondern vielmehr wie die lebhaften Halluzinationen eines Exzentrikers an. Heutzutage ist es einfach für uns, unsere Route mithilfe von Karten, Satelliten und Fotografien nachzuvollziehen, aber es ist umso schwerer, sich vorzustellen, wie das für Gudridur gewesen sein muss, als sie nach Jahren der Abwesenheit wieder nach Island zurückkehrte und versuchte, den anderen von diesem Kontinent zu erzählen, der so weit jenseits des Meeres lag und den niemand sonst gesehen hatte.
Wir werden also hier versuchen, die Geschichte Gudridurs aufzudecken und zurückzuerobern – wie auch andere Schlüsselnarrative der isländischen Geschichte, die mit der Zeit vernachlässigt wurden und verloren gingen. Zudem muss ich hier mit einigen der heiß geliebten Mythen des heroischen Entdeckers, des exzentrischen Schachgenies oder des edelmütigen Nordlichts aufräumen, damit die Rolle Islands verständlich wird. Das lässt uns aber mit einer weitaus reicheren und komplexeren historischen Darstellung zurück, die – wenig überraschend – mit einem Schiff beginnt.
1
Die Entdeckung des Westens
Island seit der Ansiedlung bis 1100 n. Chr.
Die Isländer sind das intelligenteste Volk der Erde, weil sie Amerika entdeckten und niemandem davon erzählten.
Oscar Wilde
Irgendwo in den Weiten des Nordmeeres, zwischen Island und Norwegen, verstrickte sich Thorsteinn Olafsson in das größte Mysterium des Mittelalters, indem ihm ein simpler Fehler unterlief: Er ließ sein Schiff ein paar Grad zu weit Richtung Westen segeln. Seine Passagiere wären lieber in ihrem trauten Heimathafen Island angelandet, aber stattdessen mussten sie mit einem Eisberg vorliebnehmen. Sie kamen ihm nah. Näher. Noch näher: bum! Das Holzschiff gab ein Geräusch von sich, das an einen brechenden und splitternden Baumstamm erinnerte. Es war kein fairer Kampf zwischen dem Schiff und dem Eisberg – gefrorenes Gletscherwasser ist einfach älter und weitaus stärker. Die Fahrtrichtung des Schiffes, havariert und heillos verloren, war nun dieselbe wie die des Eisbergs: Wo auch immer die Strömung ihn hintrieb und der Wind ihn hinblies, wurde auch das Schiff im Schlepptau hingetrieben. Ausgeliefert.
Aber dank Glück im Unglück trieben die Winde und Strömungen das Schiff mitsamt der Insassen auf Land, wenn auch nicht auf das erhoffte. »Zu Beginn des Winters«, eine vage und ziemlich allumfassende Bezeichnung in der Arktis, »erreichte das Schiff den Osten Grönlands«, besagt ein kurzer, etwa fünf Jahre später verfasster Bericht.
Das Schiff war an der größten Insel der Welt angelandet. Aus administrativer Sicht hatte Thorsteinn seine Passagiere sogar eigentlich auf Island abgeliefert, denn dies hier war Islands Kolonie Südgrönlands.
Obwohl sie sich gerade monatelang zusammen auf dem nördlichen Nordatlantik herumgewälzt hatten, schienen die Passagiere an Bord immer noch ihre gegenseitige Gesellschaft zu genießen. Immerhin hüpfte im Laufe der nächsten vier Jahre niemand von ihnen auf ein Schiff in Richtung Island (auch wenn nach wie vor ungeklärt bleibt, ob es überhaupt Schiffe gab, auf die man hätte springen können zu der Zeit). Thorsteinn, der wahrscheinlich ein besserer Mensch als Navigator war, verknallte sich in eine der Frauen an Bord: Sigrid Björnsdóttir. Er hielt also bei ihrem Onkel um ihre Hand an, und sie heirateten in der massiven Steinkirche, auf die die Grönländer besonders stolz waren.
Als Sigrid Björnsdóttir an jenem ruhigen Septembermorgen die Steinkirche durchquerte, wirkte die Zukunft, die auf sie wartete, so beständig wie der Jahreszeitenwechsel. Licht fiel durch die riesigen Bogenfenster der majestätischen Feldsteinkirche auf die Menge der »vielen Nobelmänner, sowohl fremd als auch einheimisch«, wie es die Oberen festhielten. Die zwei glücklichen Schiffbrüchigen wurden nach »einem Ja und einem Handschlag« als Mann und Frau vorgestellt.
Die Hochzeitsurkunde, von Grönlands Pfarrer Pall Hallvardsson unterzeichnet, wurde später dem Bischoff Islands überreicht und jahrhundertelang in Skálholt eingelagert, bis sie dort von Historikern wieder ausgegraben wurde, die bei dem Datum jedoch glatt zweimal hingucken mussten: 16. September 1408. Das war das späteste Datum, das je für die unter Erik dem Roten gegründete grönländische Siedlung dokumentiert werden konnte. Nur kurze Zeit später, nach ungefähr 400 Jahren der nordischen Besiedlung, sollte diese lebhafte Gemeinschaft verschwinden. Wie vom Erdboden verschluckt. Und bis heute weiß niemand, warum.
Die Isländer der Wikingerzeit hatten Grönland auf der Suche nach mehr Land entdeckt und danach dessen Massen an Walrössern und Narwalen in eine globale Unternehmung verwandelt. Die isländischen Grönländer waren dann aber, aufgrund der Gier nach Holz und Weizen, noch weiter westlich gereist und hatten so 500 Jahre vor Kolumbus die Segelrouten zwischen Europa und Nordamerika entdeckt. Grönland war nicht nur die Herberge für eine einzelne winzige Besiedlung, sondern der aufstrebende Ableger eines Handelsimperiums gewesen, eine wichtige Verbindung zwischen den natürlichen Ressourcen Nordamerikas und der mächtigen Wikingerzivilisation Norwegens. Neuere archäologische Funde deuten auf eine weitaus größere Anwesenheit hin, als wir ursprünglich auf der Basis der schriftlichen Aufzeichnungen angenommen hatten.
Wie also konnte eine Gemeinschaft von einigen Tausend Menschen nach mehreren Jahrhunderten einfach so spurlos verschwinden? Wie konnte sich eine ganze Inselnation in eine Geisterstadt verwandeln? Und wie war es wohl in diesem frühen Amerika gewesen?
Um dieses Mysterium aufzudröseln, folgen wir nun drei der bekanntesten Entdecker Islands – Erik, Leif und Gudridur – durch die absurden, brutalen und glücklichen Geschehnisse, die ihre Leben prägten. Viele von uns kennen die vereinfachten Versionen ihrer Geschichten, aber wie es ja so oft ist, ist die Wahrheit viel komplizierter. Unsere Helden und Heldinnen ermordeten Menschen, verirrten sich sehr oft, konvertierten zum Christentum, verirrten sich erneut, ermordeten noch ein paar mehr Menschen, retteten Schiffbrüchige, logen, nahmen Schmiergeld an, ermordeten noch ein paar mehr Menschen und starben schließlich auf einem Gehöft. Zudem ist die vernachlässigte Heldin Gudridur Thorbjarnardottir – auch wenn die Geschichte bis dato mehr von den Vermächtnissen Eriks des Roten und Leif Erikssons erzählt haben mag – die eigentliche Entdeckerin, die ein gemütliches Leben hinter sich ließ und sich mit den nordamerikanischen Einheimischen verbündete, während die Männer mit Steinewerfen beschäftigt waren. Besonders spannend ist die Tatsache, dass all diese Entdecker miteinander verwandt waren, entweder angeheiratet oder sogar blutsverwandt. Ihr Stammbaum ist also der Startpunkt für unser Grönland-Mysterium.
Die Geschichte endet mit einem Verschwinden. Aber sie beginnt mit einem Exil.
Wie so viele andere romantisierte auch ich lange die stürmischen Ozeanüberquerungen. Über dem Deck zusammenbrechende Wellen. Durch die Kombüse fliegende Scheren. Matrosen bei dem Versuch, ihr Schiff vor der unermesslichen Kraft des Ozeans zu retten. Refft das Großsegel! Fiert die Schot! Zehn Grad Steuerbord! Aber während meiner eigenen Meeresüberfahrten vor ein paar Jahren kamen mir die Stürme dann doch etwas weniger romantisch vor.
Das Chaos zwingt einen dazu, die Stimme anzuheben und zu schreien, auch bei Gesprächen von Angesicht zu Angesicht. Die Finger werden taub beim Greifen der Schulter der Schiffskameraden. Jetzt geh endlich verdammt noch mal ’ne Runde schlafen! Unten in der Kajüte musste ich dann aber feststellen, dass ich mich nicht ausziehen konnte, ohne mich der Länge nach hinzulegen. Im Laufe der Nacht wachte ich auf, weil mir kaltes Meereswasser vom Deck ins Gesicht tropfte und langsam in mein Ohr lief. Schlafen war keine Option mehr. Ich hievte mich also hoch, dabei die Reling, die Leiter, irgendwas festhaltend. Auf dem Deck oben trat ich fast auf den Schiffskoch, der ein wenig »frische Luft schnappen« wollte, aber nicht mehr aufrecht stehen konnte. Beim Verlassen des Hafens im Norden Islands hatten wir vor lauter Übermut noch Witze darüber gerissen, wie lustig es wäre, eine Kochshow in einer Kombüse bei wildem Wellengang zu filmen. Mit der leicht grünen Farbe im Gesicht wirkte er aber nun nicht mehr so, als wäre er zu einer solchen Show in der Lage. »Das Schlimmste an der Seekrankheit«, verriet er mir auf Händen und Knien, »ist die Tatsache, dass man weiß, dass man davon nicht sterben wird.« Essen fiel an diesem Tag aus.
Diese völlig unromantische Begebenheit ereignete sich während der Überfahrt von Island nach Stavanger in Norwegen. Zufälligerweise segelten wir also die gleiche Strecke ab wie Erik der Rote, nur andersherum, also auf den Spuren seiner Route vor einem Jahrtausend, um dabei unseren Holzschoner, die Opal, in das Trockendock der besten Bootsbauer Skandinaviens zu bringen. Erik der Rote ist der berühmte Begründer der ersten isländischen Besiedlung Grönlands, aber seine Geschichte nimmt keinen besonders noblen Anfang.
Als Erik nicht viel mehr als ein Hosenmatz war, wurde er mit seinem Vater Thorvald zur Flucht aus Norwegen gezwungen, der wegen »ein paar Morden« ins Exil geschickt wurde. Sie flohen Richtung Westen nach Island, bestiegen eine Knarr, ein Schiff mit breiten Balken, das für den Transport einer kleinen Mannschaft und einer großen Ladung bestimmt war, und reisten etwa eine Woche durch diese stürmische See. Knarren waren wichtig für die Wikingerreisen im offenen Nordatlantik. Dennoch lag weiterhin vieles in den Händen Njörds, dem Gott des Meeres. Der Kapitän konnte also zwar mithilfe des Ruders an der Steuerbordseite lenken, aber letztlich lag es bei den Winden, welches Ziel man erreichte. Nur ein starker Windstoß reichte aus, damit das Boot den Mast, also das wichtigste Holzteil, verlor. Wehte kein Wind, konnte die Mannschaft tagelang die angestrebte Küste in Sichtweite anstarren, ohne sich ihr auch nur ein bisschen zu nähern. Guter Wind konnte aber bedeuten, dass die Knarr sich mit einer Höchstgeschwindigkeit von acht Knoten fortbewegte (nur so zum Vergleich: Ein Seehund bewegt sich bei schnellster Geschwindigkeit schwimmend mit etwa zehn Knoten voran).
Erik und Thorvald bewegten sich also in Richtung Westen über das norwegische Meer. Bei schroffem Wind wurde Erik kalt, bei Regen nass. Wenn das Schiff die Wellen brach und Wasser über das Deck verteilte, konnte er kaum schlafen. Eine Knarr hat nur wenig Platz unterhalb des Decks und es gab keinerlei Deckungsmöglichkeiten vor dem Wetter. Wenn wir davon ausgehen, dass die Reise regulär verlief, dann kam er nach sieben bis zehn Tagen auf Island an. Die Knarr schaffte es bei langen Reisen durchschnittlich auf 6,5 Knoten – neugierige Archäologen haben dank moderner Knarr-Nachbauten ihre Effizienz feststellen können –, aber natürlich war die Geschwindigkeit allein nicht der ausschlaggebende Faktor für den Erfolg seiner Reise.
Der Schoner, auf dem ich Jahrhunderte später segeln sollte, war nicht schneller als die Knarren, immerhin bläst der Wind nach wie vor in dieselbe Richtung. Bei gutem Wetter und Wind segelte mein Schiff mit etwa acht Knoten, bei Wellengang und Strömungen waren es nur noch vier oder fünf pro Stunde: je nachdem die gleiche Geschwindigkeit wie beim Joggen oder Rennen. Natürlich hatten wir den großen Vorteil von Kabinen unter Deck, wasserfesten Jacken und einem würgenden Koch, aber unser größter Vorteil war schlicht unsere Fähigkeit zur Navigation, ohne uns nach norwegischen Vögeln, Walen, den Gestirnen oder dem Sonnenstand ausrichten zu müssen, denn wir, diese vom Glück gesegneten neuzeitlichen Seemänner, hatten einen Kompass.
Wenn man behauptet, dass Island, Grönland und das Festland Nordamerikas ursprünglich von Männern entdeckt wurden, die vom Kurs abgekommen waren, dann geht man fälschlicherweise davon aus, dass ein Kurs überhaupt gesetzt werden konnte. Diese Männer hatten das Segeln noch Jahrhunderte bevor die Navigation mehr war als eine wohlbegründete Vermutung, erfunden. So wie das isländische Wörterbuch 156 Einträge für »Wind« hat, hatten die frühen Seemänner ein eigenes Wort dafür, wenn man sich auf See verfuhr: hafvilla. Die alten Texte verraten uns nicht, wie sich die ersten isländischen Siedler ohne einen Kompass orientierten. Nutzten sie einen Quadranten und eine Sonnenuhr? Wenn ja, dann wäre dies ein eher schwieriges Unterfangen gewesen an dem Ende der Welt, das vor allem durch lange dunkle Winter und wolkige Himmel geprägt ist. Sterne? Im Sommer, wenn die meisten Überfahrten nach Island stattfanden, werden diese von der Mitternachtssonne versteckt.
Dieser eingeschränkte, wenn auch beeindruckende Grad an Navigationsfähigkeit war immens wichtig für den Verlauf der Geschichte. Wenn Erik der Rote und sein Vater Island nicht gefunden hätten – wenn sie nur ein paar Grad zu weit südlich gesegelt wären und die Insel vollständig verpasst hätten –, dann wären Jahrhunderte der Besiedlung von Grönland und Nordamerika eventuell völlig anders verlaufen. Dieses Gleichgewicht zwischen präziser Navigation und dem hoffnungslosen Verirren auf dem Meer war der entscheidende Faktor für den größten Teil des Verlaufs nordischer Geschichte. Keine zwei Segler hatten das gleiche Maß an Erfolg. Wie wir feststellen werden, segelte Erik genau auf sein Ziel zu, Leif folgte jemandem, der sich verirrt hatte, und Gudridur erlitt mitten im Meer Schiffbruch: alles maritime Glücksfälle, alle entscheidend für das darauf Folgende.
Wie der Autor Magnus Magnusson feststellt, ist Island das einzige Land Europas, das sich an seine Anfänge als Nation erinnert, da die Gründung in den »Werken der frühen Historiker verankert« ist. Die abgelegene nordatlantische Insel existierte bereits seit Jahrmillionen, wenn auch einzig als Festtagsvogelkolonie für sein einziges einheimisches Säugetier, den Polarfuchs, als der Mensch auf einmal einen Weg dorthin fand. Island, das halb so groß ist wie das Vereinigte Königreich und genauso groß wie der Bundesstaat Ohio, war das letzte große Territorium der nördlichen Hemisphäre, das besiedelt wurde. Als dann Neuseeland ein paar Hundert Jahre später von den Maori besiedelt wurde, war die gesamte Weltkugel von Menschen besetzt – abgesehen von ein paar kleinen Inseln (wie Kap Verde) und den Orten, deren extreme Wetterbedingungen dies nicht zuließen (Spitzbergen).
Zuerst wurde das Land von drei Entdeckern besucht, die nacheinander auf der Bildfläche erschienen und jeweils aus reiner Neugier und einem Verlangen heraus gekommen waren, die Angebereien über den Fund einer riesigen, leeren Insel der jeweils anderen zu überprüfen. Flóki Vilgerðarson, der dritte Entdecker in der Runde, soll Island seinen Namen gegeben haben, als er auf einer Bergspitze stand und den weiten mit Meereseis gefüllten Breiðafjörður überblickte. Andere frühe Namensvorschläge waren unter anderem Schneeland, Gardarsholm und Thule.
Aber diese Entdecker schlugen hier auf, schauten sich um und zogen wieder von dannen. Der tatsächliche erste Tag der isländischen Geschichte – der Anfang der Besiedlung – war ein Sommernachmittag 874 n. Chr., als der norwegische Bauer Ingólfur Arnarson mit seiner Familie und Sklaven im Schlepptau vom Kap Ingólfshöfði ins heutige Reykjavík im Südwesten wanderte. Islands erste Geschichtsschreibung, Landnámabók (das »Buch der Landnahme«, Anm. d. Ü.), erzählt die Geschichte Ingólfurs und listet die Namen und Wohnstätten der Tausenden von Siedler nach ihm auf. Dies war eine Art Wikinger-VIP-Liste, niedergeschrieben von Ari dem Gelehrten, dem ersten Nerd des Landes, und sollte die ehrenwerte Ahnentafel Islands hervorheben – um zu beweisen, dass hier eben nicht nur Sklaven und Mörder hausten. Island, wie Ari in 102 Kapiteln erklärt, war das Land der tapferen Norweger.
Jedoch erwähnt Ari im Vorwort so ganz nebenbei, dass vor der norwegischen Besiedlung »da diese Männer« gewesen seien, sogenannte Papar, also irische Mönche – eine Information, die für neuzeitliche Forscher die Sprengkraft einer geworfenen Handgranate hat. Ari wiederholt diese Geschichte im späteren Íslendingabók (dem »Buch der Isländer«), in dem er behauptet, die Mönche hätten Island verlassen, weil sie nicht länger an der Seite der nordischen Heiden leben wollten, und hätten »irische Bücher und Glocken und Stäbe« zurückgelassen.
Historiker und Archäologen versuchen seit Langem, diese These Aris zu verifizieren, aber bis heute steht der Beweis noch aus. Manche Namen besonders alter Stätten, wie beispielsweise Papar Island (oder auch »Papey Island«, Anm. d. Red.) im Osten, implizieren nur, dass es mal frühe Siedler gegeben haben mag, die ursprünglich daran geglaubt haben mögen, dass rätselhafte Mönche vor ihnen diese Orte besiedelt hatten. Und im frühen 20. Jahrhundert wurden drei silberne Münzen aus der römischen Zeit an drei verschiedenen Orten im südöstlichen Zipfel Islands gefunden, eine ziemlich praktische Gegend für irische Schiffe zum Anlanden. Außerdem finden sich in englischen Texten, die von einem irischen Mönch 50 Jahre vor der Besiedlung Islands geschrieben wurden, Referenzen auf eine religiöse Gemeinschaft auf einer nordischen Insel namens Thule, die immerwährendes Licht im Sommer zu haben schien.
Aber Kritiker der Vor-Wikinger-Besiedlungstheorie gehen davon aus, dass das Wort »Papar« mehr als eine Bedeutung hatte und in diesem Fall auf unebene Landschaften verwies. Sie verwarfen die Münzpfunde, weil diese nur bewiesen, dass alte Münzen reisen würden – das sieht man schon, wenn man zu Hause die Sofaritze untersucht. Die Beschreibung Thules könnte zudem, so argumentierten die Kritiker, genauso gut die Faröerinseln, die Shetlandinseln, Saaremaa (eine estnische Insel), Grönland oder Smøla in Norwegen meinen, wo die Einheimischen behaupteten, dass sie das geheimnisvolle nordisches Land bewohnten. Aber ein Aspekt der Mönchsthese ist definitiv kein Mythos: Isländer haben signifikante Anteile irischer Abstammung. Wissenschaftler des in Reykjavík ansässigen Unternehmens deCODE, das sich auf genetische Abstammung spezialisiert, haben 2018 die Genome von 25 uralten Isländern sequenzieren können, die im Nationalmuseum Islands eingelagert liegen, und diese mit den Genomen von Inselkelten und der skandinavischen Bevölkerung vergleichen können. Diese Ergebnisse zeigen, dass die frühen Siedler zu 57 Prozent nordischer, aber sonst keltischer und »gemischter« Abstammung waren. Diese Vermischung soll wohl, davon geht man zumindest aus, in Britannien und Irland stattgefunden haben, wobei Frauen damals noch eher inselkeltischer Abstammung waren als Männer. Das könnte darauf hinweisen, dass manche Wikinger auf dem Weg nach Island einen Zwischenstopp in Irland eingelegt haben, wo sie eventuell Frauen für die Reise gen Westen entführten. Eine britische Boulevardzeitung ließ gar in ihrer Überschrift die folgende Deutung der Ergebnisse verkünden: »Wikinger-Sextouristen lebten glücklich mit Briten bis ans Ende ihrer Tage«.
Es ist jedoch unmöglich, nur aufgrund der Genomsequenzierung herauszufinden, ob ein Teil der frühen isländischen Bevölkerung aus Iren bestand, die einfach nur nicht schneller laufen konnten als die Wikinger. Es ist genauso gut möglich, dass die irischen Frauen vom Charme der herumwandernden Skandinavier, die die Segelkunst auf den nordischen Gewässern beherrschten, betört wurden. Immerhin legten sie großen Wert auf körperliche Hygiene, was die Ausgrabungen von Grabstätten andeuten, in denen sich viele Pinzetten, Rasierer, Kämme und Ohrreiniger aus Tierknochen und Geweihen finden ließen. Sie sprachen Altnordisch, brachten ihre eigenen Kulturriten mit und, was im heidnischen Irland vielleicht noch wichtiger war, glaubten nicht an Jesus Christus.
Skandinavien – also Dänemark, Norwegen und Schweden – war die letzte heidnische Bastion Europas. Letztlich ist ein Mangel an Religiosität eine der wichtigsten Merkmale der Definition der Wikinger, ein Wort, dessen genaue Bedeutung bis heute ungeklärt ist, auch wenn es einige Vermutungen gibt. Wie man das Wort deutet, hängt weitgehend von der Sicht auf ihre hauptsächliche Motivation ab. Wenn man sie primär als Banditen ansieht, dann klingt die Definition »eines Piraten, der nah an der Küste bleibt« logisch, da vik das altnordische Wort für »Bucht« und »Bach« ist. Aber die Wikinger etablierten auch ein ausgefeiltes Tauschnetzwerk, das sich über Westeuropa und den baltischen Raum erstreckte. Die Evolution vom Jäger zum Händler könnte an vielen Faktoren liegen, beispielsweise die Probleme der Ressourcenknappheit, die mit Schurkereien einhergehen: Es gibt nur eine begrenzte Menge Ländereien, die man einnehmen, und Menschen, die man entführen kann.
Außer natürlich, man stößt auf neue Territorien.
Island wurde also ungefähr 100 Jahre nach dem Beginn der Wikingerzeit ein Mittelpunkt des Wikingergetümmels. Als nun Erik der Rote etwa 960 n. Chr. mit seinem Vater auf Island ankam, waren die besten landwirtschaftlichen Gebiete auf Island schon eingenommen. Sie waren für die Filetgrundstücke rund 50 Jahre zu spät dran.
Unter Wikingern gab es laut der damaligen Sagas eine absonderliche Methode, um Land als Eigentum zu bestimmen: Die frühen Siedler steckten dafür das Land in Brand, wenn die Sonne im Osten stand. Dann liefen sie so lange weiter, bis die Sonne im Westen stand, und steckten das Land erneut in Brand. Auf diese Weise konnte niemand mehr Land für sich beanspruchen, als er an einem Tag erlaufen konnte – eine effektive Art, um den Landbesitz auszugleichen, weil so nicht eine Person alles für sich reklamieren konnte. Allerdings bedeutete dies auch, dass der als Letzter ankommende Siedler schlicht Pech hatte, wenn bereits alles verteilt worden war. Als Erik und sein Vater, beide durchnässt bis auf die Knochen und exiliert, die Knarr verließen und die seltsame neue Insel betraten, mussten sie feststellen, dass sie ihr Dasein in der Nähe von Hornstrandir fristen mussten, dem letzten zu besiedelnden Ort Islands. Ihr Gehöft stand an einer Ozeanklippe, und Meeresalgen waren so ziemlich die einzige Fauna weit und breit. Das ganze Jahr über bestand die Gefahr für Schnee und dichten Nebel, zudem waren Attacken von Eisbären kein Mythos. Unser Held Erik der Rote steckte in der isländischen Einöde fest und langweilte sich zu Tode, aber damit konnte und wollte er sich nicht abfinden. Sobald sein Vater gestorben war, suchte er nach einem Weg aus dieser Misere.
Die Details dieser Geschichte stammen aus zwei Büchern: der Erikssaga und der Grænlendinga saga (der Grönland-Saga). Diese Geschichten wurden, basierend auf mündlichen Erzählungen, von zwei Autoren niedergeschrieben, die jeweils nichts von der Existenz des anderen wussten, aber beide verfassten sie ihre Texte etwa 250 Jahre nach den tatsächlichen Geschehnissen. Die Vínland-Sagas, wie die zwei Geschichten gemeinsam genannt werden, sind Teil des berühmten isländischen Genres »Isländersagas«, also Siedlungsgeschichten, die im Verlauf von ungefähr 200 Jahren, etwa von 1200 bis 1350, niedergeschrieben wurden. Zusammen sind die Íslendingasögur 38 einzelne Familiengeschichten, die auch nach wie vor einen wichtigen Bestandteil der isländischen Identität darstellen. Wenn man sie alle lesen will, so berichtet es zumindest ein Mann, der dies geschafft hat, braucht es vier Wochen harter Arbeit – das Narrativ geht oft in staubtrockenen Stammbäumen und Serienmorden unter, aus denen der Leser selten wirklich schlau wird. Die meisten Isländer kennen jedoch nur die eher stilistisch ansprechenderen und unterhaltsameren Sagas wie die Saga von Njáll, die Laxdæla saga (die Saga der Bewohner des Laxárdalr, des Lachsflusstals, Anm. d. Ü.) und Egils saga.
Professorin Sigurdur Nordal sagte mal, dass die Sagas (ein Wort, dass im Englischen übrigens aus dem Isländischen kommt, aber im Deutschen nicht mit »den Sagen« verwechselt werden sollte, Anm. d. Ü.) einst mit der Wissenschaft begannen, aber mit der Fiktion endeten. Die Vínland-Sagas wurden recht kurz nach den tatsächlichen Entdeckerreisen niedergeschrieben – »nur« etwa drei Generationen später – und es existieren zwei grundverschiedene Versionen. Es gibt wohl Grund zur Annahme, dass die Vínland-Sagas, zusammengenommen mehr Wahrheit enthalten als andere Sagas, sich also irgendwo zwischen einer Saga mit einem narrativen Bogen und einer »getreuen« Dokumentation der Siedlergeschichte durch Ari den Gelehrten bewegt. Wir können uns also relativ sicher sein, dass die Geschichte von Erik dem Roten auf wahrheitsgetreuen Tatsachen aufbaut. Selbst Ari erwähnt übrigens in seiner langen Geschichte der Namensliste die Reisen nach Grönland durch Erik dem Roten, und manche Experten sind der Meinung, dass er der Autor hinter der Erikssaga ist. Ein letzter interessanter Aspekt setzt die Vínland-Sagas, von allen anderen ab: Die Figuren sind tatsächliche Wikinger – blutrünstige Seebären auf Reisen. Die »Wikinger« in den meisten anderen Sagas sind eigentlich nicht mehr als Bauern, die mit anderen Bauern kämpfen.
Erik der Rote wird den Lesern nicht, wie es sonst bei anderen für die Sagas titelgebenden Helden der Fall ist, anhand eines seitenlangen Stammbaums und einer bildhaften Beschreibung seiner Person vorgestellt, und das ist ungewöhnlich. Der Autor der Saga von Njáll, zum Beispiel, erwähnt immer wieder die Tatsache, dass Njáll keinen Bart hat, fast schon, um so erklären zu können, warum ein Mann namens Gunnar seine Kämpfe ausfocht. Gunnar wiederum, so hält es der Autor fest, konnte sein Schwert derartig schnell schwingen, dass »es wirkte, als befänden sich drei Schwerter zeitgleich in der Luft«. Der ungewöhnlich aussehende Egil der Egils saga wird so detailliert beschrieben, dass die Ärzte heutzutage vermuten, dass er Morbus Paget gehabt haben könnte. Wir wissen sogar, dass er als Kind – oh, wie charmant – seine Nase mit seiner Zunge berühren konnte.
Erik der Rote jedoch ist wie ein weißes Blatt, denn die Saga erwähnt nicht einmal seine Haarfarbe, von der sein Spitzname herstammen dürfte. Die Leser müssen ihn nur aufgrund seiner Handlungen bewerten. War er tapfer? Raffiniert? Grausam? Dumm? War er ein kühner Entdecker oder einfach ein vom Glück beschiedener Exilierter? Was wir aber wissen, ist, dass er sein erbärmliches Stück Land am Ende der Welt hinter sich ließ und es schaffte, Thjodhild, die Tochter eines reichen Bauern im Westen Islands, zu heiraten. Groß gewachsen, dunkelhaarig und schmeichlerisch? Kurz nach seinem Umzug auf die Farm, die den Hvamms-Fjord überblickt, wurden zwei seiner Sklaven von seinen Nachbarn getötet, weil diese wohl laut Aussagen des Letzteren mithilfe von Hexerei einen Erdrutsch ausgelöst hätten. Postwendend lief Erik zu seinen Nachbarn und erstach sie alle.
Der Idiot! Erik der Dumme! Es gab im Island des 10. Jahrhunderts keine Auge-um-Auge-Gerechtigkeit für Sklaven. Er war nun der unausgeglichenen Vergeltung beschuldigt und musste (schon wieder) auf eine nahe gelegene Insel fliehen. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir also daraus schließen, dass Erik entweder eine kurze Zündschnur hatte und politisch unausgereift war oder dass er den bizarren Glauben hatte, dass alle Menschen gleich seien. Seine nächste Handlung deutet auf Ersteres.