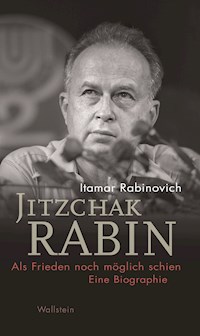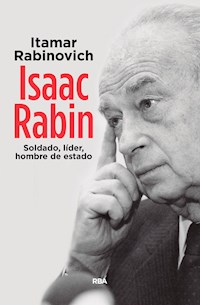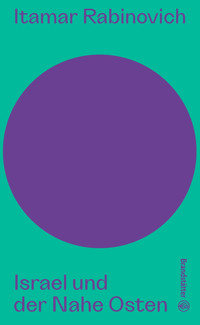
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Auf dem Punkt
- Sprache: Deutsch
Aus der Reihe AUF DEM PUNKT Inmitten der besorgniserregenden Spannungen im Nahen Osten liefert Itamar Rabinovich eine einzigartige Insider-Analyse des Nahostkonflikts, der vergangenen und möglicher künftiger Friedensprozesse. Er analysiert die arabisch-israelischen Beziehungen über den Palästina-Konflikt hinaus im größeren Kontext der regionalen und internationalen Politik, von der Rolle des Irans, Syriens und der Türkei bis zu jener der USA und Chinas. Wer die historischen Wurzeln und komplexen Dynamiken des Nahostkonflikts – von der Gründung Israels über die Abraham-Abkommen und den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 bis zu den aktuellen Geschehnissen – und die Risiken eines möglichen Kriegs verstehen will, kommt an dieser unverzichtbaren Orientierungshilfe nicht vorbei.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Itamar Rabinovich
Israel und der Nahe Osten
Übersetzt von Britta Fietzke
Aus der Reihe »Auf dem Punkt«
Herausgegeben von Hannes Androsch
Vorwort
1Der Hintergrund
2Das Auf und Ab des Nahostfriedensprozesses
3Das Netz der Beziehungen
4Frieden und Normalisierung
Schlusswort
Weiterführende Literatur
Endnoten
Der Autor
Impressum
Vorwort
Ich freue mich sehr, dass ich den deutschen Lesern und Leserinnen hiermit eine gekürzte und aktualisierte Fassung meines 2022 erschienenen Buches Middle Eastern Maze: Israel, the Arabs, and the Region präsentieren kann. Das damalige Manuskript bestand aus einem narrativen Teil und zwei analytischen Kapiteln, in denen die vielschichtigen Beziehungen Israels zu seinen arabischen und anderen Nachbarn im Nahen Osten sowie das Konzept von »Frieden und Normalisierung«, das ein wesentlicher Aspekt des arabisch-israelischen Friedensprozesses ist, vorgestellt wurden.
In dem Buch argumentiere ich, unter anderem, dass der iranisch-israelische Konflikt in den 2000er-Jahren wichtiger wurde als der arabischisraelische Konflikt. Leider bewahrheiteten sich diese Beobachtungen aus dem Jahr 2022 mit dem Kriegsausbruch im Oktober 2023. Dieser war am 7. Oktober mit einer mörderischen Attacke der Hamas aus Gaza ausgelöst worden. Die Hisbollah, der iranische Stellvertreter im Libanon, beteiligte sich nicht vollständig am Krieg, sondern begann einen fast ein Jahr andauernden Zermürbungskrieg, bevor jener schließlich zu einem ausgewachsenen Krieg wurde. In kurzer Zeit wurde die iranische Strategie, sich hinter zahlreichen Stellvertretern zu verstecken, aufgedeckt, und im April 2024 begann ein offener Schlagabtausch zwischen dem Iran und Israel, der im Oktober 2024 mit einem zweiten iranischen Raketenangriff auf Israel fortgesetzt wurde.
Es wirkte zu diesem Zeitpunkt so, als stünden Israel und der Iran kurz vor einem ausgewachsenen Krieg, doch seither haben zwei wichtige Entwicklungen stattgefunden: Zum einen wurde am 26. November ein Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon unterzeichnet, zum anderen wurde das Assad-Regime in Syrien durch ein plötzliches Wiederaufleben der syrischen Rebellion gestürzt, die das Assad-Regime mit Unterstützung Russlands und des Irans 2016 niedergeschlagen hatte. Der Waffenstillstand im Libanon kam zustande, als Israel und der Iran gemeinsam beschlossen, dass ein Ende des Zermürbungskrieg, den die Hisbollah am 8. Oktober 2023, einen Tag nach dem Angriff der Hamas auf das südliche Israel, begonnen hatte, in ihrem beiderseitigen Interesse sei. Der Waffenstillstand basiert im Wesentlichen auf der Rückkehr zur Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats aus dem Jahr 2006, die die Hisbollah von der israelischen Grenze fernhält und eine Rückkehr der israelischen Bevölkerung ermöglichen soll, die das Grenzgebiet zuvor verlassen hatte. Die Schläge, die der Iran und die Hisbollah einstecken mussten, waren einer der Gründe für den Angriff der in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens versammelten syrischen Rebellen gegen das Assad-Regime, der auch in kurzer Zeit zu dessen Sturz führen sollte. Der Verlauf der Ereignisse in Syrien könnte in der kommenden Zeit zu massiven Veränderungen in der Geopolitik der Region führen. Hoffentlich trägt dieser Band zu einem besseren Verständnis der aktuellen und der zukünftigen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten bei.
Im Oktober 2024 schien es, als stünden Israel und der Iran am Rande eines ausgewachsenen Krieges, doch seither haben zwei wichtige Entwicklungen stattgefunden.
1
Der Hintergrund1
Der arabisch-israelische Konflikt hält nun schon seit über siebzig Jahren an. Ein früherer Konflikt zwischen der kleinen jüdischen und der deutlich größeren arabischen Gemeinschaft in Palästina hatte sich zuerst im späteren Osmanischen Reich Bahn gebrochen. Nach dem Ersten Weltkrieg, der Veröffentlichung der Balfour-Deklaration 1917 (in der die britische Regierung den »Bau einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina« befürwortete) und der Einrichtung eines britischen Mandats für Palästina auf beiden Seiten des Jordans im Jahr 1920 wurden die Auseinandersetzungen immer heftiger und bedeutsamer. Araber und Juden kämpften über dreißig Jahre lang um Rechte und Kontrolle, wobei der Konflikt 1947 mit dem UN-Teilungsplan für Palästina einen vorläufigen Höhepunkt erreichte.
Im Zuge des jahrzehntelangen schwelenden Konflikts wurde den in Palästina einheimischen Arabern von einem Großteil der arabischen Welt Unterstützung und Hilfe zuteil, aber der Konflikt verschärfte sich nach der Gründung des Staates Israel 1948, den sofort fünf arabische Armeen angriffen. Der Sieg Israels, die Konsolidierung und Erweiterung des ursprünglichen Gebiets, die Niederlage der arabischen Armee, das Scheitern eines palästinisch-arabischen Staates, wie es die UN-Resolution vorgesehen hatte, sowie die daraus resultierende Problematik der palästinensischen Flüchtlinge waren grundlegende Fakten im Prozess, der den arabisch-jüdischen Konflikt im Völkerbundsmandat für Palästina zum arabisch-israelischen Konflikt machte, wie wir ihn auch heute noch erleben.
Der historische Verlauf des Konflikts lässt sich zweiteilen: vor und nach dem Jom-Kippur-Krieg 1973. Die alten Wunden eiterten fünfundzwanzig Jahre lang nach der Gründung Israels vor sich hin, da die Bemühungen, sie zu heilen oder wenigstens anzugehen, aus diversen Gründen, auf die ich noch eingehen werde, fehlschlugen. Nach dem Sieg Israels im Oktober 1973 aber wurden diplomatische Initiativen eingesetzt, die sich zu einem israelisch-ägyptischen Friedensprozess entwickelten, der wiederum im März 1979 im ersten Friedensvertrag Israels mit einem arabischen Staat mündete. Dieser Prozess kam danach jedoch zum Stillstand, der bis über die 1980er-Jahre hinaus anhalten sollte. Dann wurde eine neue Phase der Friedensverhandlungen bei der Madrider Konferenz im Oktober 1991 initiiert. Diese Verhandlungen mündeten in einem zweiten Friedensvertrag im Jahr 1994, da mit Jordanien, in einem palästinensisch-israelischen Durchbruch und in einer ziemlichen arabisch-israelischen Normalisierung. Selbst auf dem Höhepunkt des Madrider Prozesses von 1993–1995 konnte diese Phase jedoch keine umfängliche Beilegung des arabisch-israelischen Konflikts oder ein Ende des politischen Disputs sowie des Blutvergießens zwischen Israel und einem Teil der arabischen Welt herbeiführen. Neue Entwicklungen im Jahr 1996 bremsten die Verhandlungen aus und ließen sie 1998 fast gänzlich scheitern.
Der Madrider Prozess stellt den ersten nachhaltigen internationalen Versuch zur Lösung des arabisch-israelischen Konflikts dar. Es ist bedeutsam, dass kein ähnlicher Anlauf — statt der kurzlebigen Anstrengungen, verschiedenen Vermittlungsbemühungen und teilweise erreichten Einigungen — vorher unternommen worden war und dass man selbst in einem fast vierzig Jahre währenden uneinheitlichen Friedensprozess keine vollumfängliche Einigung erreichen konnte. Der arabisch-israelische Konflikt ist tatsächlich eines der komplexesten und schwierigsten Probleme der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und bis jetzt. Der erste Schritt hin zu einem Verständnis seiner Komplexität ist die Erkenntnis, dass es nicht einen einzelnen arabisch-israelischen Konflikt gibt, sondern eine Anhäufung einzelner, miteinander verbundener Konflikte:
—Der Kernkonflikt zwischen Israel und Palästina. Ein klassischer Konflikt zwischen zwei nationalen Bewegungen, die jeweils den geschichtlichen Anspruch sowie das Besitztum desselben Stück Landes für sich reklamieren. Dieser ursprüngliche Strang des arabisch-israelischen Konflikts wurde ungefähr fünfzehn Jahre lang (1949–64) von der Vernichtung der palästinensischen Bevölkerung, die sich aufgrund des Israelischen Unabhängigkeitskriegs verstreut hatte, und der Vorrangstellung der damaligen pan-arabischen Ideologien sowie von den arabischen Staatsinteressen überschattet. Das erneute Aufflammen des palästinensischen Nationalismus Mitte der 1960er-Jahre und — ironischerweise — die Etablierung israelischer Kontrolle über ganz Palästina westlich des Jordans 1967 verliehen den Palästinensern wieder eine wichtige Rolle in der arabischen Welt. Ihre neue Signifikanz wurde von der Offensive der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) gegen Israel verstärkt, die vor dem Hintergrund der Niederlage der etablierten arabischen Armeen durchgeführt worden war.
—Ein umfassenderer Konflikt zwischen Israel und dem arabischen Nationalismus, also ein nationaler, politischer, kultureller und immer religiöserer Konflikt, in den beide Seiten mit jeweils einem starken historischen und kulturellen Erbe im Gepäck gingen. Das nationale Wiederaufleben des jüdischen Volkes in seiner historischen Heimat unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, nach Jahrtausenden des Exils und der Verfolgung, entfaltete sich während eines Frontalzusammenstoßes mit einer arabischen Nationalbewegung, die nach einem Jahrhundert des In-sich-Gehens und der Demütigung durch westliche Mächte auch nach Wiederbelebung, Erneuerung und Macht strebte. Leider fassen die meisten Araber den Zionismus und Israel entweder als Teil der westlichen Welt auf oder, was noch schlimmer ist, als westlichen Brückenkopf in ihrer Mitte.
—Eine Reihe bilateraler Konflikte zwischen Israel und arabischen Nachbarstaaten, entstanden aus geopolitischen Rivalitäten und anderen Faktoren. Daher wurde Ägypten 1948 vom palästinensischen Problem mit in den Krieg gegen Israel hineingezogen; jedoch wurde die ägyptische Entscheidung, sich der arabischen Kriegskoalition anzuschließen, und der daraus resultierende Konflikt mit Israel auch von den Ambitionen der arabischen und regionalen Anführer, von Ägyptens Wettbewerbsgedanke mit Israel als anderer mächtiger und ambitionierter Staat in der Region sowie von dem Wunsch nach einer Landbrücke zur östlichen arabischen Welt durch die Wüste Negev beeinflusst. Ähnlich hat auch Syriens bittere Beziehung mit Israel sowohl eine ehrliche Verbindung zum arabischen Nationalismus als auch zum palästinensischen Anliegen und seine akute Rivalität mit Israel um die Vorherrschaft in der Levante zum Ausdruck gebracht.
—Der größere internationale Konflikt. Die Palästinafrage ist schon länger eine wichtige und herausstechende internationale Angelegenheit. Vom Heiligen Land (das sogenannte Filastin bei den Arabern und Muslimen) ausgelöstes Interesse und Leidenschaft, die Vorherrschaft der früher sogenannten Jüdischen Frage, den Rivalitäten der Kolonial- und späteren Supermächten im Nahen und Mittleren Osten sowie das generelle Gewicht der arabischen Welt sind nur einige der Gesichtspunkte und Mächte, die zur geopolitischen Bedeutsamkeit in internationalen Angelegenheiten des sich entwickelnden arabisch-israelischen Konflikts beigetragen haben. Der Konflikt durfte weder ursprünglich noch später einfach nur ein regionaler Zank sein, denn sowohl die Araber als auch die Israelis erbaten sich von Anfang an internationale Unterstützung für ihre jeweiligen Anliegen, während sich ausländische Regierungen und andere Akteure — sei es um der ehrlichen Verpflichtung gegenüber einer der Parteien, der Suche nach Eigenvorteilen oder des Friedens und der Stabilität willen — immer schon eingemischt haben.
Der Kalte Krieg vergrößerte und verstärkte diese internationalen Faktoren. Der Mittlere Osten, aufgrund seiner intrinsischen Signifikanz, seiner geografischen Nähe zur Sowjetunion und seiner Offenheit gegenüber Veränderungen, wurde zu einem wichtigen Schauplatz des sowjetischamerikanischen Wettstreits. Die Sowjetunion wandelte sich in den frühen 1950er-Jahren von ihrer anfänglichen Unterstützung Israels zu einer weitreichenden Unterstützung der arabischen Staaten, und sie schlachtete den arabisch-israelischen Konflikt für sich aus, um die westliche Stellung im Mittleren Osten zu schwächen sowie im Gegenzug die eigene zu stärken. Nach ungefähr zehn Jahren der Fluktuationen entschieden sich die Vereinigten Staaten für eine Strategie der offenen Kooperation mit Israel und anderen Alliierten des Mittleren Ostens gegen die örtlichen radikalen und prosowjetischen Regime. Daher standen sich die beiden Supermächte in den Nahostkriegen 1967 und 1973 sowie in anderen nahöstlichen Krisen stellvertretend gegenüber. Israels Macht wuchs dank der amerikanischen Hilfe und Unterstützung dramatisch an, aber der militärische Beistand der Sowjetunion für seine Alliierten und Klienten, die Aussicht auf eine sowjetische Militärintervention sowie die syrischen Armeen waren ausschlaggebend dafür, dass Israel die politischen Früchte seiner militärischen Macht und seiner Erfolge nicht ernten konnte.
Wohingegen es in den 1950er- und 1960er-Jahren die Sowjetunion war, die meist einen Vorteil aus dem arabisch-israelischen Konflikt schlug, konnte Israel 1967 das Gleichgewicht mit seinem Sieg des Sechstagekriegs verändern. Innerhalb weniger Jahre hatte die arabische Welt verstanden, dass Washington den Schlüssel zur Wiedererlangung der Territorien hielt, die Israel in diesem Krieg für sich hatte erobern können. Die amerikanische Unterstützung des Prinzips, Land gegen Frieden zu tauschen, sowie die gelegentliche Bereitschaft für und Fähigkeit zu entsprechenden Handlungen waren die Grundlage, auf der die USA ihre Nahostfriedensverhandlungen und die damit einhergehenden mehrfachen beeindruckenden Erfolge orchestrieren konnte. So steht der ägyptisch-israelische Friedensprozess, der nach dem Jom-Kippur-Krieg 1973 angestoßen wurde und der erste große Durchbruch im arabisch-israelischen Konflikt war, in einem engen Zusammenhang mit einem der größten Erfolge Washingtons im Kalten Krieg: Ägyptens Wandel von einem Verbündeten der Sowjetunion zu einem Staat im amerikanischen Dunstkreis. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sowie dem Ende des Kalten Kriegs war die internationale und regionale Landschaft des Mittleren Ostens völlig verwandelt. Washingtons Interessen am Mittleren Osten wurden nicht mehr zu einem Großteil von der Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion geprägt, sondern regionale Akteure wie der Irak, Iran und die Türkei begannen nun eine größere Rolle zu spielen. Zudem fing ein sich nun wieder behauptendes Russland vor einigen Jahren erneut damit an, in den Mittleren Osten vorzudringen.
Die Sowjetunion schlachtete damals den arabisch-israelischen Konflikt für sich aus, um die westliche Stellung im Mittleren Osten zu schwächen sowie im Gegenzug die eigene zu stärken.
1948–1967
Der Israelische Unabhängigkeitskrieg 1948 endete mit einer Reihe von Waffenstillstandsabkommen. Die Bemühungen um Friedensverhandlungen mit Ägypten und Jordanien sowie die internationalen Anstrengungen um eine Lösung des Konflikts scheiterten. Er schwelte vor sich hin und führte 1956 zu einem zweiten Krieg, dieses Mal gegen Ägypten. Israel eroberte im Zuge dessen die Sinai-Halbinsel und den Gazastreifen, wurde aber aufgrund des US-amerikanischen und sowjetischen Drucks zum Rückzug gezwungen. Auf den Krieg folgten elf Jahre verhältnismäßiger Stabilität, jedoch führte eine Reihe von Entwicklungen 1963 zu der Krise im Mai 1967. Diese Entwicklungen beinhalteten auch die Wiederkehr eines palästinensischen Nationalismus, die Etablierung einer einheitlichen arabischen Führung, die arabischen Bemühungen, die Quellen des Jordans umzuleiten, sowie die frühen Terrorattacken palästinensischer Organisationen. Aus Angst, Israel würde Syrien angreifen, remilitarisierte Ägypten im Mai 1967 die Sinai-Halbinsel und verkündete am 23. Mai eine Blockade der Meerenge von Tiran. Daraufhin zog Israel am 5. Juni 1967 in den Krieg, im Zuge dessen eroberte es mit einem verblüffenden Sieg die Sinai-Halbinsel, das Westjordanland und die Golanhöhen. Der Sieg Israels überzeugte die Araber davon, dass sie das Land nicht mit der eigenen Militärmacht würden besiegen können. Israel hatte nun dank der Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens die Kontrolle über das gesamte Mandatsgebiet Palästina und die große palästinensische Bevölkerung inne.
1967–1973
Israel hatte mithilfe der Eroberung ägyptischer, syrischer und jordanischer Landgebiete den Schlüssel für eine potenzielle politische Lösung in der Hand und besaß nun ein Faustpfand, das es nach dem Unabhängigkeitskrieg 1948 nicht gehabt hatte. Es stellte sich jedoch als schwierig heraus, diese Vorteile auch zu nutzen. Der auf dem Gipfeltreffen der Arabischen Liga erzielte Konsens sah vor, dass kein Frieden mit Israel als Gegenleistung für die im Juni eroberten Gebiete geschlossen werden sollte. In Israel wiederum gewannen im Laufe der Zeit jene politischen Kräfte an Einfluss, die dafür plädierten, dass Israel die eroberten Gebiete aus sicherheitspolitischen und ideologischen Gründen behalten sollte. Zur Überwindung der festgefahrenen Situation zog Ägyptens Staatspräsident Anwar as-Sadat gemeinsam mit Syrien im Oktober 1973 in den Krieg. Sadat, der 1970 an die Macht gekommen war, wollte so einen diplomatischen Prozess anstoßen. Infolge eines nachrichtendienstlichen Fehlers traf dieser Israel unvorbereitet und das Land erlitt in den ersten Kriegstagen einen schweren Rückschlag.
1973–1977
Israel konnte zu einem späteren Zeitpunkt den Verlauf des Jom-Kippur-Kriegs wieder umkehren, denn zum Kriegsende hin hatte es sich auf dem ägyptischen Festland und in der Nähe von Damaskus positionieren können. Der US-amerikanische Außenminister Henry Kissinger verhandelte Waffenstillstandsabkommen mit Ägypten und Syrien, zudem begann er den diplomatischen Prozess, der zu einem israelisch-ägyptischen Rückzugsabkommen sowie 1975 zu einem Interimsabkommen im Sinai führen sollte. Auch ein Waffenstillstandsabkommen mit Syrien konnte nach langen, schwierigen Verhandlungen getroffen werden. Jimmy Carters Sieg über Gerald Ford in der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl 1976 setzte Kissingers Diplomatie im Mittleren Osten ein jähes Ende und bereitete den Boden für eine andere, von Carter und seinem Team verfolgte Politik.
1977–1982
Jimmy Carter startete seine Diplomatie für den Nahen Osten Anfang 1977. Sein Team und er waren fest entschlossen, zusammen mit der Sowjetunion eine umfassende Lösung des arabisch-israelischen Konflikts zu erreichen. Seine Vision umfasste ein Friedensabkommen mit vollständigem Rückzug Israels aus allen 1967 besetzten Territorien und die Gründung eines palästinensischen Staats. Währenddessen fand der erste Wechsel der politischen Macht in Israel von einer Arbeiterpartei hin zum rechtsstehenden Likud (angeführt von Menachem Begin) statt. Sowohl Begin als auch Anwar as-Sadat beunruhigte Carters Vision und sie waren zu mutigen Schritten bereit. Sadat machte sich in einer dramatischen Wende nach Jerusalem auf, um die israelische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Ägypten nicht länger der Gegner sei. Begin signalisierte, sie würden sich vom Sinai zurückziehen, um einen Frieden mit Ägypten zu erreichen, aber der Weg von einem dramatischen Besuch in Jerusalem zu einer tatsächlichen Einigung gestaltete sich dann doch als schwierig. Carter berief die Parteien zu einer Camp-David-Konferenz zusammen, die zu einem ägyptisch-israelischen Friedensabkommen führte. Die palästinensische Frage wurde mithilfe eines Autonomieplans adressiert, der von Begin und seinem Team ausgearbeitet worden war. Hiermit war das erste Nahostfriedensabkommen erreicht.
1982–1991
Die Gespräche über die Implementierung des Autonomieplans konnten jedoch keine Ergebnisse erzielen. Die Palästinafrage suchte weiterhin die Regierung Begins heim, und er autorisierte 1982 eine Invasion des Libanons, im Versuch, die Militärmacht der PLO (der Palästinensischen Befreiungsorganisation) zu zerschlagen. Tatsächlich wurde daraufhin die PLO aus dem Libanon vertrieben, doch langfristig stärkte der Krieg die Schiiten, die bis dato ein eher unterprivilegierter Teil der libanesischen Bevölkerung gewesen waren. Dieser Prozess stand in einem äußerst engen Zusammenhang mit der Iranischen Revolution 1979, die das Regime der Ajatollahs an die Macht brachte. Dessen Exportpolitik der islamisch-schiitischen Revolution wurde zuerst im Libanon umgesetzt, wo sie die Hisbollah (die »Partei Gottes«) ursprünglich als eine Mischung aus terroristischer Organisation, Miliz und politischer Bewegung gründeten. Im Laufe der folgenden Jahre übernahm die Hisbollah den libanesischen Staat, entschied sich aber dafür, dessen Hülle offiziell zu erhalten und die eigene Macht staatsunabhängig auszuüben. Während Ronald Reagans Präsidentschaft waren die Vereinigten Staaten aus diplomatischer Sicht nicht im Mittleren Osten aktiv, aber der Ausbruch der Krise im Golf nach der irakischen Invasion Kuwaits 1990 sowie dem daraus folgenden Golfkrieg brachte die Bush-Regierung dazu, den ersten Versuch einer Lösung des arabisch-israelischen Konflikts zu unternehmen. Bushs Außenminister James Baker spielte eine führende Rolle in der Einberufung der Madrid-Konferenz im Oktober 1991. Zwei Entwicklungen — der Kollaps der Sowjetunion und der US-amerikanische Sieg im Golfkrieg — statteten Washington mit präzedenzlosem Einfluss und Prestige aus. Die Regierung rund um Bush und Baker fühlte sich damit einflussreich genug, um eine Lösung für den arabisch-israelischen Konflikt zu finden. Die Tatsache, dass Saddam Hussein, Iraks Staatspräsident, Israel mit ballistischen Raketen während des Golfkriegs beschossen hatte, überzeugte die Bush-Regierung davon, dass der arabisch-israelische Konflikt dringend gelöst werden musste.
2
Das Auf und Ab des Nahostfriedensprozesses2
Madrid und Oslo: Hoffnungsvolle Jahre
Im Nachgang der Madrider Konferenz begannen drei arabische und israelische Teams die Verhandlungen, die im Gebäude des Außenministeriums in Washington stattfanden: israelisch-syrisch, israelisch-libanesisch und eine gemeinsame jordanisch-palästinensische Delegation mit ihrem israelischen Gegenüber. Der Anfang war nicht allzu vielversprechend. Syrien, die Palästinenser und die israelische Regierung unter Premier Jitzchak Schamir standen dem gesamten Prozess reserviert gegenüber. Es brauchte die israelischen Wahlen im Jahr 1992 und die Formierung der Rabin-Regierung, um neues Leben in die Washingtoner Gespräche zu hauchen. Dennoch brachte auch dieses »neue Leben« keinen Durchbruch. Ein solcher konnte nur aufseiten der Syrer oder Palästinenser erwartet werden. Der Libanon wurde von Syrien dominiert, während Jordanien als konservative Monarchie nicht den ersten Schritt unternehmen konnte. Syriens Position war problematisch, denn das Land debattierte, dass es zwar prinzipiell dem Frieden gegenüber positiv gestimmt sei, jenen aber nicht näher definieren wollte, bevor es ein restloses Zugeständnis von Israel hatte, dass es die Golanhöhen vollständig verlassen würde. Israel vertrat jedoch die Position, dass Verhandlungen nicht an der Untergrenze beginnen würden und dass das Ausmaß des Rückzugs nicht gleich zu Anfang festgelegt werden würde. Die Palästinenser wurden von einer Gruppe örtlicher Anführer vertreten, die wiederum ihre Anweisungen von den Oberen der PLO in Tunis erhielt. Und daher brachten die sogenannten WashingtonTalks zwar ein wenig Fortschritt, aber entwickelten sich im späteren 1992 und in der ersten Hälfte 1993 ohne einen Durchbruch.
Parallel dazu etablierten sich bilaterale Nahost-Verhandlung in Oslo, die, im Gegensatz zu diversen anderen bilateralen Gesprächen, Früchte trugen. Die palästinensische Delegation in Oslo war von der PLO legitimiert worden, während die israelische Delegation vom stellvertretenden Außenminister Jossi Beilin angestoßen, dann vom Außenminister Schimon Peres übernommen und letztlich (widerwillig) vom Premier Jitzchak Rabin unterstützt wurde. Beide Seiten befanden sich Anfang August nah an einer Einigung.
Dies wurde zu einem Wendepunkt. Rabin, der nicht gänzlich glücklich mit der in Oslo Form annehmenden Einigung war, unternahm einen allerletzten Versuch für einen Durchbruch mit Syrien, indem er Anfang August beim US-amerikanischen Außenminister Warren Christopher