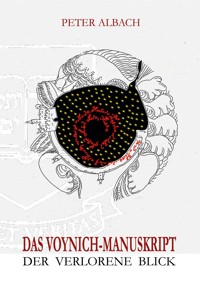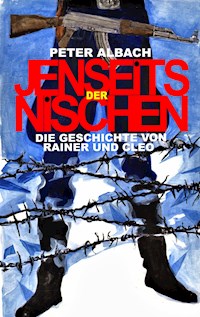
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Autor ist 17, als er 1974 seinen Bruder in einem Arbeitslager der DDR besuchen darf. Der Schüler ist schockiert von dem, was er dort, in der Braunkohle bei Leipzig sieht. Die Bilder verschwinden nie mehr aus seinem Kopf. Er hat sich mehr als 30 Jahre später auf die Suche nach Zeitzeugen gemacht und zwei gefunden. Gemeinsam mit Rainer Buchwald und Clemens Lindenau begibt er sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Entstanden ist ein Buch, das zwei Leben im Sozialismus zwischen Jugendwerkhof und Arbeitslager schildert, mit sehr persönlichen Einblicken in einen Alltag in der DDR, der weitestgehend im Verborgenen blieb, obwohl Tausende von der unmenschlichen Härte des Sozialismus betroffen waren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Während im Sozialismus die Verteilung der materiellen Güter nach Umfang und Qualität der geleisteten Arbeit erfolgt, wird es beim Übergang zum Kommunismus möglich werden, ein Verteilungsprinzip zu verwirklichen, das es in der bisherigen Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat.
Was die Menschen zu einem kulturvollen, schöpferischen, gesunden und glücklichen Leben benötigen, werden sie von der Gesellschaft unentgeltlich erhalten.
Sie werden gern arbeiten, werden an einer nützlichen, in höchstem Maße produktiven Arbeit interessiert sein, sie werden ihre Fähigkeiten uneingeschränkt in den Dienst der kommunistischen Gesellschaft stellen.
Weltall, Erde Mensch, Verlag Neues Leben, Berlin 1954, Seite 497
Gegen das Vergessen
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Mehr als 30 Jahre später
Zeitreise
Der Start ins Leben
Die gestohlene Jugend
Rüdersdorf
Ein Tag in der Anstalt
Vom kurzen Glück in Freiheit
Oben und unten
Besserungsunwillig
Als die Mauer fiel
Arbeitslager-Notizen von Clemens Lindenau
Lagerjungs
Flucht
Braune Hölle
Verhör
Nur noch weg
Was aus uns geworden ist
Epilog
Das geschriebene Unrecht der DDR
Prolog
Ein abgehärmter, kahlgeschorener Mensch, in filziges Dunkelblau gekleidet, sitzt mir gegenüber, blass und verletzt, mitten auf der Stirn eine frische Narbe, es ist mein Bruder. Nur mühsam gelingt ein Gespräch.
Ich erinnere mich nur ungern an jenen regengrauen Tag im Frühjahr 1974, als wir, meine Mutter und ich, mit barschen, harten Worten von Männern in schwarzblauen Uniformen empfangen wurden, die Kalaschnikow vor der Brust. Meine Mutter hatte die Erlaubnis bekommen, meinen Bruder in der Haftanstalt, in der Braunkohle bei Leipzig gelegen, zu besuchen, und ich war mitangemeldet.
Was ich sah, war Stacheldraht, zweifach war das Lager umzäunt und in der Mitte zwischen dem Stacheldraht, als ob das nicht schon genügt hätte, wohin wollte man denn in einem komplett eingezäunten Land entfliehen, Bretterzäune für dazwischen frei laufende Hunde, so scharf, wie ich später erfahren sollte, dass sich niemand an diese herantraute und das Fleisch zum Fraß über den Bretterzaun den Hunden zugeworfen wurde.
Ich hatte gerade Kafka gelesen und Bruno Apitz in Erinnerung.
Nach Kontrolle der Ausweise und der Besuchserlaubnis wurden wir in einen Raum geführt, wo weitere Besucher bereits Platz genommen hatten. Die dort waren, vermieden jeglichen Blickkontakt, schwiegen und waren still.
Bis auf eine Frau, die den Kopf in den Händen vergraben hatte und auf den Boden blickte. Immer wieder wiederholte sie dieselben Worte: „Die Hunde, diese schrecklichen Hunde, haben Sie auch die Hunde gesehen? Das sind Bestien. Mein Sohn hat doch nichts getan, diese Hunde, diese schrecklichen Hunde.“
Wir wurden dann von Bewaffneten abgeholt und über das Gelände geführt.
Auf dem Weg zum Besucherraum sah ich eine Gefangenenkolonne im Karree heranmarschieren, in filziges Dunkelblau gekleidet mit gelben Flicken zur Kennzeichnung versehen, bewacht wieder von Männern mit Kalaschnikow im Anschlag und Hunden an der Leine.
Ich rief: „Das sieht ja aus wie ein KZ.“
„Noch ein Wort und du bleibst hier“, brüllte mich einer der Bewaffnete an.
Ich verstummte augenblicklich, sagte kein Wort mehr. Ich war 17 und hatte gelernt, in der besten und menschlichsten aller vorstellbaren Welten, im Sozialismus der DDR zu leben, die strahlende Krone des Humanismus, ein Hort der Menschlichkeit.
Was ich dort in der Braunkohle sah, konnte es deshalb nicht geben. Es widersprach jeder Theorie, allem, was mir gelehrt worden war, und spottete allen humanistischen Beteuerungen.
Mehr als 30 Jahre später
An einem Donnerstagnachmittag in Berlin. Ich bin direkt gewählter Bundestagsabgeordneter, wollte zunächst Malerei und Grafik studieren, wurde aber Jurist.
Dass ich mit meinem familiären Hintergrund in der DDR Jura studieren durfte, nie ernsthaft für die SED oder Stasi angeworben wurde, gehört zu den Mysterien des real existierenden Sozialismus.
Noch nicht einmal eine Akte gibt es über mich. Und ich hätte darauf gewettet, dass eine Stasiakte existiert. Alle Überprüfungen, ob als Stadtverordneter, Bürgermeister oder Abgeordneter, blieben jedoch ergebnislos.
Im Plenum wurde soeben heftig über den Mindestlohn gestritten. Jetzt sitze ich am Schreibtisch, trinke Kaffee und sehe den Ordner „Arbeitslager“ durch. Um an nähere Informationen zu kommen, hatte ich etliche Bürgermeister angeschrieben.
„Hat schon jemand auf meinen Brief geantwortet?“, frage ich meine Mitarbeiter.
„Ja, die meisten.“
„Klasse.“
Ich nenne hier nicht jeden Bürgermeister beim Namen. Jedoch danke ich allen, die selber nachgeforscht haben oder Nachforschungen veranlassten.
Da waren nicht nur Bürgermeister, sondern auch Stadtkämmerer und Stadtarchivare. Sie haben mir sehr weitergeholfen. Aus den Antworten kann ich sehen, wie dürftig die Aktenlage zu diesem Thema ist. Die Bürgermeister haben ihre Stadtarchivare beauftragt, in den Unterlagen zu recherchieren. Vielerorts wurden keine Hinweise auf entsprechende Arbeitslager gefunden.
An einigen Orten erinnern sich die Menschen noch an die Busse, die die Häftlinge zur Schicht fuhren und nach Feierabend wieder abholten.
Ich habe viele Einladungen erhalten, bei den zuständigen Ministerien nachzufragen und Akteneinsicht zu beantragen. Das würde allerdings voraussetzen, dass ich in den nächsten Monaten meine Arbeit als Bundestagsabgeordneter niederlege, um in die Archive zu gehen und Akten zu wälzen. Das kann ich nicht machen.
Es würde auch viel zu lange dauern und dem, was ich will, nicht gerecht werden. Einige haben mir geschrieben, es sei ihnen bislang nicht möglich gewesen, das Thema Arbeitserziehung gründlich zu bearbeiten. Ob ich das nicht machen könnte?
Optimal wäre, es ließen sich Historiker finden.
Ich möchte, dass dieses schreckliche Segment der deutschen Geschichte nicht vergessen bleibt, es dahin zurückholen, wo es hingehört, in das öffentliche Bewusstsein. Gerade auch, weil ich mir bewusst bin, dass die große Mehrheit der DDR-Bürger von Arbeitslagern nichts wusste und wissen konnte.
Ich will jetzt nicht langweilen, indem ich alle Antworten aufzähle. Nur ein paar will ich extra erwähnen. Gespannt bin ich, wie die Antwort aus Regis-Breitingen ausgefallen ist. In den Archiven hat der Bürgermeister nichts gefunden, aber er berichtet von seinen eigenen Erinnerungen an das Arbeitslager. Das ist gleich viel interessanter. Die Arbeitserziehungskommandos waren in zwei Barackenkomplexe geteilt. Die Häftlinge arbeiteten vor allem im Tagebau. Ein paar Gruppen rückten morgens zur Arbeit in die Stadt aus, um Gruben zu schaufeln und Gräben auszuheben. In der Strafanstalt Regis-Breitingen gab es Sportanlagen. Bürgermeister Thomas Kratzsch erinnert sich an eine Judo-Jugendgruppe, die in der Sporthalle trainierte.
Ich hatte gehofft, dass ich einen Zeitzeugen aus Regis-Breitingen finde, der mir seine Geschichte erzählt. Der Bürgermeister kann mir nicht weiterhelfen. Er habe einige angesprochen, doch leider müsse er mir mitteilen, dass kein Interesse besteht. Dann ist es ebenso.
Ich blättere im Ordner weiter. Eine Absage aus der Stadt Lübbenau im Spreewald. Eine Absage aus Oberhof.
Mein Vorhaben sei mit Interesse aufgenommen worden. Recherchen und Nachfragen bei „Ur-Einwohnern“, Heimatforschern und Hobby-Chronisten hätten allerdings ergeben, dass niemand etwas über ein Arbeitslager wisse. Es sei lediglich bekannt, dass am Bau der Großschanze Strafgefangene eingesetzt wurden.
Endlich wieder eine positive Nachricht. Sie kommt aus Rossleben. Auf dem Gelände des Kaliwerkes Roßleben, Schacht II in Wendelstein, hat es in den fünfziger Jahren ein Haftarbeitslager gegeben, das bis Mitte der sechziger Jahre bestand. Es war dem Strafvollzug der Bezirksbehörde der Deutschen Polizei in Halle zugeordnet. Auf dem umzäunten und bewachten Gelände wohnten und arbeiteten nur männliche Strafgefangene, die aus politischen Gründen und wegen krimineller Vergehen Strafen verbüßen mussten. Circa 250 Häftlinge im Lager Roßleben arbeiteten in der Grube. Während sie sich plagten, stand immer ein Wachmann dabei mit einem bissigen Hund.
Arbeiter aus dem Strafvollzug erhielt auch der VEB Eisenhüttenkombinat. Das Arbeitslager wurde Mitte der sechziger Jahre aufgelöst. Die Häftlinge arbeiteten im Gleisbau, wurden für Verlade- und Betonarbeiten eingesetzt, formten Steine und reinigten Rohre.
Heute heißt die Firma ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH. Wir fragen in der Presseabteilung des Unternehmens nach. Der Unternehmenssprecher hat Akten gefunden. Aus der Anzahl der Unterkünfte und der Arbeitsplätze könne man auf die Zahl der Häftlinge schließen. In einem Protokoll aus dem Jahr 1953 taucht eine Zahl von 1500 Gefangenen auf. Das lassen Pläne zum Ausbau des Lagers vermuten. Ein anderes Papier korrigiert die Zahl wieder auf 600. Der Grund ist nicht bekannt.
Aus der Gemeinde Sollstedt im Landkreis Nordhausen in Thüringen wird mir mitgeteilt, dass im Nachbarort Obergebra zwar bis Mitte der sechziger Jahre ein Strafgefangenenlager existierte. Die Häftlinge arbeiteten unter Tage in der Sollstedter Kaligrube. Jedoch habe es sich um „normale Kriminelle“ gehandelt. Allerdings sei in Hohenleuben im jetzigen Landkreis Greiz neben der Jugendhaftanstalt ein Arbeitserziehungslager für Frauen unterhalten worden. Die Frauen schufteten für 10 bis 15 Mark im Monat für den VEB Keramische Werke Hermsdorf.
Landauf, landab schleppten die Gefangenen Ziegel und Zementsäcke, bauten Spulen für Kofferradios, nähten Bettwäsche und Tischdecken, putzten Maschinen und bauten Gleise. Sie arbeiteten unter unzumutbaren Bedingungen. Die Arbeiten waren nicht nur schwer. Sie gefährdeten oft auch ihre Gesundheit. In Bitterfeld zum Beispiel starb ein Gefangener an einer Quecksilbervergiftung. Er hatte im Chemiekombinat gearbeitet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelt im März 1983 „Todeskommando“ in Bitterfeld und berichtet von politischen Häftlingen, die giftige Dämpfe einatmeten und wegen schwerer Vergiftungen nach sieben Monaten Arbeitseinsatz aus der Produktion herausgenommen werden mussten.
Arbeitsschutz gab es hier nicht. Von der Ausbeutung der Arbeiter in den Gefängnissen versprach sich das Ministerium des Innern erzieherischen Einfluss. „Erziehung durch Arbeit“ war der Dreh- und Angelpunkt des Strafvollzugs in der DDR. Die DDR-Oberen gingen davon aus, dass sich die Gefangenen durch „gesellschaftlich nützliche Arbeit“ nach ihrer Entlassung problemlos in die Gesellschaft einordnen und die sozialistischen Gesetze einhalten würden. Sie sollten zu einem verantwortungsbewussten Leben erzogen werden. Politische Gefangene hatten es schwer, da sie meistens als „besserungsunwillig“ eingestuft wurden. Sie waren „Klassenfeinde“. Es sollte ihnen im Arbeitslager dreckig gehen, damit sie wieder auf Linie gebracht werden. Erziehungsmaßnahmen waren jedoch nicht der einzige Grund für einen katastrophalen Arbeitseinsatz: Der Staat hatte ein großes wirtschaftliches Interesse an den Strafgefangenen in den Lagern und verdiente Milliarden mit den Arbeitssklaven.
Für heute habe ich erst einmal genug Infos gesammelt. Ich hoffe, dass ich noch Zeitzeugen finde, die mir aus ihrem Alltag im Arbeitslager erzählen können.
Geschichten von Betroffenen, die es selbst erlebt haben, sind einfach echter. Wir starten einen Aufruf über die Medien.
Glück gehabt: Eines Tages klingelt im Büro das Telefon. Reinhard Kienitz, der Ortschronist von Rüdersdorf bei Berlin, ist am anderen Ende der Leitung. Er ist in dem Ort aufgewachsen und kann sich an das Jugendarbeitslager an der Thälmann-Straße erinnern. Ein ehemaliger Häftling, Rudolf Moritz Bannier, er ist inzwischen gestorben, habe ein Buch darüber geschrieben: „Nackt“. Im September 2000 hatte dieser den Flachbau in Rüdersdorf besucht, in dem er 1967 als 17-Jähriger eingesperrt gewesen war. Vor Kurzem habe er zwei Männer getroffen, die an einer Aufarbeitung dieses Kapitels der Rüdersdorfer Geschichte sehr interessiert und bereit seien zu sprechen. Er gibt mir die Namen und Telefonnummern.
Eine Woche später sitze ich im Büro und warte auf Rainer Buchwald und Clemens Lindenau, über deren Leidensweg hier berichtet werden soll, über die gestohlene Jugend von Cleo und Rainer – Arbeitssklaven für den Sozialismus.
Die Geschichte beginnt in der Gegenwart mit einem Besuch in einem ehemaligen Arbeitslager.
Zeitreise
An einem Dienstagmorgen im Juni fahren wir zurück in die Vergangenheit. Wir wollen nach Mecklenburg-Vorpommern. In Ueckermünde war Rainer Buchwald in den siebziger Jahren ein paar Monate eingesperrt zur Arbeitserziehung.
172 Kilometer liegen zwischen Berlin-Mitte und Ueckermünde, eine Stadt tief im Nordosten nahe der polnischen Grenze. Die Etappe führt durch die Provinz. Bäume säumen die Straßen. Dörfer, Wiesen und Windräder ziehen an uns vorbei, irgendwann nur noch vereinzelte Häuser. In der Ferne lugt ein Kirchturm zwischen Strommasten hervor. An einer Straßenecke gibt es einen Buchladen. Verlassen liegen die Orte da. Es sind kaum Menschen unterwegs.
Während der Autofahrt reden wir über dies und das.
Nach zwei Dritteln der Strecke zweigt die A 11 ab nach Warnitz.
„Da hinten gibt es ein Lokal, da haben wir schon öfter eine Karre Mist gegessen“, erzählt Rainer.
„Was ist das?“, lache ich.
„Na, ein Naturschnitzel mit Spiegelei“, klären mich Rainer und Cleo auf.
„Da halten wir auf dem Rückweg an“, sage ich.
Nach gut zwei Stunden Fahrt biegen wir kurz, bevor es ins Zentrum von Ueckermünde geht, rechts und nach wenigen Metern links ab in die Ziegeleistraße. Wir parken und steigen aus. Der Berndshof liegt in der Sonne. Es ist ein schöner Ort, um eine Strafe zu verbüßen. So scheint es. Das Meer schimmert graublau. Im Innenhof blühen rote und pinke Rosen. Ein rotes Stoppschild im Hof zeigt nach rechts zur Anmeldung. Nur der heruntergekommene Wachturm und die Gitter vor den Fenstern erinnern mich an Regis-Breitingen. Ich habe sofort wieder dieses bedrückende Bild vor Augen, wie ich als 17-Jähriger meinen Bruder im Arbeitslager besuchte. Über das Gelände verteilen sich ein paar zartgelb gestrichene Häuser, in denen die Gefangenen wohnen. Weiter hinten befinden sich Werkstatt und Gewächshäuser.
Ein kleiner Mann im beigen Anzug und eine groß gewachsene Frau im Hosenanzug kommen uns entgegen. Jörg Spielberg leitet die Anstalt, Angela Stöwesand ist seine Stellvertreterin.
Der Empfang ist herzlich: „Schön, dass Sie da sind.“
Vom Hof sind es nur wenige Schritte zum Haus der Justizangestellten. Im Büro des Gefängnis-Chefs steht nur das Nötigste. Ein Schreibtisch, ein Schrank, Regale und ein Tisch mit ein paar Stühlen. Die beiden schenken Kaffee ein.
Wir plaudern ein wenig. Rainer erzählt von seinem Aufenthalt von Januar bis Oktober 1974.
„Ich musste noch einmal hierherfahren, um meine Vergangenheit besser zu bewältigen“, erklärt er.
„Und wir sind mitgefahren, damit er es besser ertragen kann“, sagt Clemens.
Reise in die Vergangenheit: wir drei im Juni 2008 in Ueckermünde
Das Arbeitslager hat eine lange Geschichte: Es stammt aus der NS-Zeit und wurde in der DDR als solches weiter genutzt. Das Gefängnis entwickelte sich vom Haftarbeitslager in den fünfziger Jahren über ein Arbeitserziehungskommando in den sechziger Jahren bis hin zu einer Strafvollzugseinrichtung in den siebziger Jahren.
Rainer erzählt von einer Aktion im Herbst 1974. Aus Zeichen der Solidarität mit allen Opfern des SED-Regimes legten damals 60 Gefangene des Strafvollzugskommandos Berndshof zeitgleich ihre Arbeit nieder. Sie wurden in die Absonderungszelle gesteckt und stellten Ausreiseanträge, die der Anstaltsleiter und der Verbindungsoffizier der Staatssicherheit bearbeiten mussten. Danach beteiligten sich immer mehr Häftlinge an den Gedenkminuten zum 17. Juni und 13. August.
Die Arbeitsbedingungen waren erbärmlich. Ein Beispiel aus dem Winter 1979: Zehn Häftlinge des Kommandos Ueckermünde I wärmten sich an der einzigen Heizung, die funktionierte. Ihr Aufseher beschuldigte sie der Arbeitsverweigerung und rief den Leiter des Kommandos zu Hilfe.
„So, wer will hier nicht arbeiten?“, brüllte er, ging auf einen Gefangenen los und stürzte ihn auf eine Palette. Danach zog er den Mann wieder heraus und trieb ihn aus der Halle. Draußen wurde er verprügelt.
Der Leiter des Kommandos belehrte die Häftlinge, fragte nach ihren Delikten und beschimpfte sie als „Verbrecher und Lumpen, die nur fressen und nicht arbeiten wollen“. Wem kalt sei, der könne ja ein paar Runden auf dem Hof drehen oder Liegestütze im Schnee machen.
„Da wird euch schon wieder warm.“